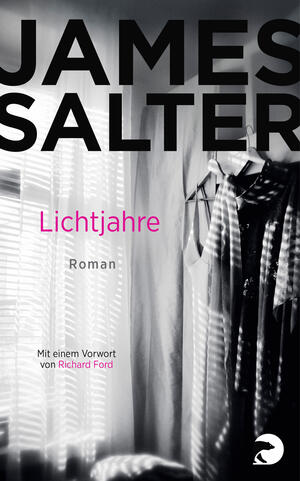
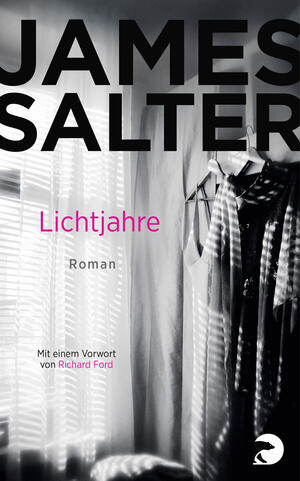
Lichtjahre — Inhalt
Auf den ersten Blick ist es paradiesisch: Das privilegierte Leben von Viri und Nedra kreist um Dinnerpartys und Freunde, um einen sonnendurchfluteten Garten, um endlose Ferien am Atlantik mit den Kindern. Doch langsam entblättert sich das Trügerische dieser Idylle: Viri beginnt eine Affäre mit einer jungen Mitarbeiterin, Nedra trifft sich mit einem langjährigen Freund der Familie. In poetischen Bildern führt James Salter uns vor Augen, dass nichts unerbittlicher ist als die Zeit und nichts vergänglicher als das Glück.
Leseprobe zu „Lichtjahre“
1
Wir schießen über den schwarzen Fluß, das flache Wasser ist glatt wie Stein. Kein Schiff, kein Ruderboot ist zu sehen, nicht ein einziges Weiß. Das Wasser ist zerfurcht, aufgebrochen vom Wind. Diese große Meeresbucht ist weit, endlos. Der Fluß ist brackig, blau vor Kälte. Er zieht verschwommen unter uns dahin. Die Seevögel hängen über ihm, sie kreisen, verschwinden. Wir schnellen über den weiten Fluß, ein Traum aus der Vergangenheit. Die Tiefen bleiben hinter uns, der Grund bleicht die Oberfläche, wir jagen an den Untiefen vorbei, an wintergelagerten [...]
1
Wir schießen über den schwarzen Fluß, das flache Wasser ist glatt wie Stein. Kein Schiff, kein Ruderboot ist zu sehen, nicht ein einziges Weiß. Das Wasser ist zerfurcht, aufgebrochen vom Wind. Diese große Meeresbucht ist weit, endlos. Der Fluß ist brackig, blau vor Kälte. Er zieht verschwommen unter uns dahin. Die Seevögel hängen über ihm, sie kreisen, verschwinden. Wir schnellen über den weiten Fluß, ein Traum aus der Vergangenheit. Die Tiefen bleiben hinter uns, der Grund bleicht die Oberfläche, wir jagen an den Untiefen vorbei, an wintergelagerten Booten, verlassenen Stegen. Und auf Flügeln wie die Möwen steigen wir in die Höhe, drehen uns um, blicken zurück.
Der Tag ist weiß wie Papier. Die Fenster sind eisig. Die Steinbrüche liegen verlassen, die Silbermine verschüttet. Der Hudson ist von ungeheurer Weite hier, weit und ruhig. Ein dunkles Land, ein Land der Störe und Karpfen. Im Herbst war er silbern von Shadfischen. Oben zogen die Gänse in langen, sich wandelnden Keilen dahin. Die Flut strömt vom Meer herein.
Die Indianer suchten, so sagt man, einen Fluß, der „in beide Richtungen fließt“. Hier fanden sie ihn. Der Salzkeil dringt bis zu fünfzig Meilen ins Land; manchmal erreicht er Poughkeepsie. Früher gab es hier riesige Austernbänke, Robben im Hafen, in den Wäldern unerschöpfliches Wild. Dieser große Gletscherbruch mit seinen einladenden Buchten, Uferstände von wildem Sellerie und Reis, dieser majestätische Fluß. Die Vögel ziehen, aufgereiht wie Perlen, auf waagerechter Flugbahn vorüber. Sie scheinen langsam heranzukommen, dann werden sie schneller, schießen wie Pfeile über einem dahin. Der Himmel hat keine Farbe. Ein Gefühl von Regen hängt in der Luft.
All das hier gehörte einmal den Niederländern. Dann, wie so vieles andere, den Engländern. Der Fluß ist ein Spiegel. Er hält nur Stille, eine glitzernde Kälte. Die Bäume sind kahl. Die Aale schlafen. Die Fahrrinne ist tief genug für Hochseeschiffe; wenn sie wollten, könnten sie die Städte im Landesinnern in Erstaunen versetzen. In den Marschen gibt es Schildkröten und Krebse, Reiher, Bonapartemöwen. Von den oberen Städten fließen Abwässer in den Fluß. Der Fluß ist dreckig, aber er reinigt sich selbst. Die Fische sind betäubt; sie treiben mit den Gezeiten.
Am Ufer stehen Steinbauten, die nicht mehr in Mode sind, und zugige, schmucklose Holzhäuser. Es gibt noch Anwesen von früher, Überreste des großen Grundbesitzes vergangener Tage. Nah am Wasser steht ein großer viktorianischer Bau, die Ziegel weiß gestrichen, mit hoch darüber ragenden Bäumen und einem von einer alten Mauer umgebenen Garten, darin ein zerfallenes Gewächshaus mit schmiedeeisernen Verzierungen rings um das Dach. Ein Haus am Fluß, für die Nachmittagssonne zu tief gelegen. Statt dessen durchflutete es die Morgensonne, das von Osten her kommende Licht. Mittags erstrahlte es in voller Pracht. Es gibt Stellen, an denen die Farbe dunkel geworden ist, kahle Stellen. Die Kieswege lösen sich auf; Vögel nisten in den Schuppen.
Wir schlenderten im Garten, aßen die kleinen bitteren Äpfel. Die Bäume waren trocken und knorrig. In der Küche brannte das Licht.
Ein Auto kommt die Einfahrt herauf, zurück aus der Stadt. Der Fahrer geht ins Haus, nur für einen Moment, bis er gehört hat, was passiert ist: das Pony ist ausgebrochen.
Er ist wütend. „Wo ist sie? Wer hat die Tür offengelassen?“
„Mein Gott, Viri. Ich weiß nicht.“
In einem Raum mit vielen Pflanzen, einer Art Wintergarten, leben eine Eidechse, eine braune Schlange, eine schlafende Schildkröte. Die Eingangsstufe ist hoch, die Schildkröte kann nicht heraus. Sie schläft mit eingezogenen Beinen auf dem Kies. Ihre Nägel sind elfenbeinfarben, sie rollen sich nach innen, sie sind lang. Die Schlange schläft, die Eidechse schläft.
Viri hat den Mantelkragen hochgeschlagen und stapft den Hügel hinauf. „Ursula!“ ruft er. Er pfeift.
Das Tageslicht ist erloschen. Das Gras ist trocken; es knarzt unter den Sohlen. Den ganzen Tag hat die Sonne nicht geschienen. Den Namen des Ponys rufend, dringt er bis in die hintersten Ecken vor, bis zur Straße, zu den anliegenden Feldern. Überall Stille. Es beginnt zu regnen. Er sieht den einäugigen Hund, der einem Nachbarn gehört, eine Art Husky mit grauer Schnauze. Das Auge ist vollkommen geschlossen, versiegelt, mit Fell bedeckt, als wäre es nie dagewesen, so lange hat er es schon verloren.
„Ursula!“ ruft er.
„Sie ist hier“, sagt seine Frau, als er zurückkommt.
Das Pony steht an der Küchentür, ruhig, dunkel, und frißt einen Apfel. Er berührt seine Lippen. Es beißt ihn beiläufig sanft ins Handgelenk. Seine Augen sind schwarz, glänzend, mit den langen, verrückten Wimpern einer betrunkenen Frau. Das Fell ist dicht, der Atem sehr süß.
„Ursula“, sagt er. Ihre Ohren stellen sich kurz auf, vergessen dann. „Wo warst du? Wer hat deinen Stall aufgemacht?“
Sie interessiert sich nicht für ihn.
„Hast du gelernt, wie man das macht?“ Er berührt eines ihrer Ohren, es ist warm, fest wie ein Schuh. Er führt sie zum Stall, dessen Tür weit offensteht. Draußen vor der Küche tritt er sich den Schmutz von den Schuhen.
Überall brennt Licht: ein riesiges, erleuchtetes Haus. Tote Fliegen, groß wie Bohnen, liegen hinter den Samtvorhängen, an manchen Ecken wölbt sich die Tapete, das Fensterglas verzerrt. Sie leben in einer Art Vogelhaus, einer Bienenwabe. Das Dach ist aus dickem Schiefer, die Zimmer sind wie Läden. Dieses Haus läßt keinen Ton nach außen dringen; im Dunkeln ist es wie ein Schiff. Drinnen kann man, wenn man genau hinhört, alles wahrnehmen: Wasser, leise Stimmen, das langsame, gleichmäßige Nachgeben des Holzes.
Im Hauptbadezimmer mit seinen Flecken, Schwämmen, teefarbenen Seifen, Büchern und wassergewellten Ausgaben der Vogue weicht er in Ruhe vor sich hin. Das Wasser reicht ihm über die Knie; es dringt bis in die Knochen. Auf dem mit Teppich ausgelegten Boden steht ein Korb voll glatter Steine, ein leeres Glas von tiefstem Blau.
„Papa“, rufen sie durch die Tür.
„Ja.“ Er liest die Times.
„Wo war Ursula?“
„Ursula?“
„Wo war sie?“
„Ich weiß nicht“, sagt er. „Sie ist spazieren gewesen.“
Sie warten auf mehr. Er ist ein Geschichtenerzähler, ein Mann der Wunder. Sie horchen auf Geräusche, erwarten, daß die Tür gleich aufgeht.
„Aber wo war sie?“
„Ihre Beine waren naß“, verkündet er.
„Ihre Beine?“
„Ich glaube, sie war schwimmen.“
„Also, Papa, wirklich.“
„Sie hat versucht, an die Zwiebeln auf dem Grund zu kommen.“
„Da gibt’s keine Zwiebeln.“
„Oh doch.“
„Ehrlich?“
„Genau da wachsen sie.“
Sie erklären es einander vor der Tür. Es ist wahr, beschließen sie. Sie warten auf ihn, zwei kleine Mädchen, auf dem Boden kauernd wie Bettler.
„Papa, komm raus“, sagen sie. „Wir wollen mit dir reden.“
Er legt die Zeitung beiseite und sinkt ein letztes Mal in die Umarmung des Badewassers.
„Papa?“
„Ja.“
„Kommst du raus?“
Das Pony fasziniert sie. Sie haben Angst vor ihm. Sie sind immer kurz davor loszurennen, wenn es einen unerwarteten Laut von sich gibt. Geduldig, still steht es in seinem Stall; ein grasendes Tier, es frißt stundenlang. Seine Nüstern umgibt ein Kranz feiner Haare, seine Zähne sind braun.
„Die Zähne hören nie auf zu wachsen“, hat der Mann, der sie ihnen verkauft hat, gesagt. Er war ein Trinker, seine Kleider waren zerrissen. „Sie wachsen immer nach und schleifen sich immer wieder ab.“
„Was würde passieren, wenn sie nichts fressen würde?“
„Wenn sie nichts fressen würde?“
„Was würde mit den Zähnen passieren?“
„Seht zu, daß sie frißt“, sagte er.
Sie beobachten sie oft; sie horchen auf das Mahlen ihrer Kiefer. Dieses mythische Tier, man riecht seinen Duft im Dunkeln, ist größer als sie, stärker, klüger. Sie sehnen sich danach, sich ihm zu nähern, seine Liebe zu gewinnen.
2
Es war im Herbst 1958. Ihre Kinder waren sieben und fünf. Das Licht ergoß sich auf den schieferfarbenen Fluß. Ein weiches Licht, Gottes Muße. In der Ferne schimmerte die neue Brücke wie eine Feststellung, wie eine Zeile in einem Brief, die einen aufhorchen läßt.
Nedra war in der Küche bei der Arbeit, ihre Ringe hatte sie beiseite gelegt. Sie war hochgewachsen, beschäftigt; ihr Nacken war bloß. Wenn sie innehielt, um mit gesenktem Kopf ein Rezept zu lesen, war sie überwältigend in ihrer Konzentration, ihrer Hingebung. Sie hatte ihre Armbanduhr an, ihre besten Schuhe. Unter der Schürze war sie für den Abend gekleidet. Es kamen Leute zum Essen.
Sie hatte die Stiele der Blumen, die auf der hölzernen Anrichte ausgebreitet waren, gekürzt und angefangen, sie zu arrangieren. Vor ihr lagen Schere, hauchdünne Käseschachteln, französische Messer. Auf ihren Schultern lag Parfum. Ich werde ihr Leben von innen nach außen beschreiben, von seinem Kern aus, auch das Haus, Zimmer, in denen sich Leben gesammelt hatte, Zimmer im morgendlichen Sonnenschein, die Böden bedeckt mit Orientteppichen, die ihrer Schwiegermutter gehört hatten, aprikosenfarben, rot und braun, Teppiche, die, obwohl sie abgenutzt waren, das Sonnenlicht zu trinken und seine Wärme in sich aufzunehmen schienen; Bücher, duftende Blütenblätter, Kissen in den Farben von Matisse, Dinge wie funkelnde Wahrheiten, von denen viele, hätten sie alten Völkern gehört, für das kommende Leben in die Grabstätten gelegt worden wären: durchsichtige Würfel aus Kristall, Hirschhornteile, Bernsteinperlen, Schachteln, Skulpturen, hölzerne Kugeln, Illustrierte, in denen sich Fotografien von Frauen befanden, mit denen sie sich verglich.
Wer putzt dieses große Haus, wer schrubbt die Böden? Diese Frau – sie tut alles, sie tut nichts. Sie trägt ihren sandfarbenen Pullover, schlank wie eine Gerte, die langen Haare zusammengebunden, das Feuer prasselt im Kamin. Ihr wahres Interesse gilt dem Kern des Lebens: Mahlzeiten, Bettücher, Kleidung. Alles andere hat keine Bedeutung; es wird irgendwie erledigt. Sie hat einen breiten Mund, den Mund einer Schauspielerin, aufregend, strahlend. Dunkle Flecken in ihren Achselhöhlen, Minzduft in ihrem Atem. Sie ist von Natur aus extravagant. Sie macht spontane Einkäufe, geht zu Bendel’s, als würde sie Freunde besuchen, rafft fünf oder sechs Kleider zusammen und betritt eine Kabine, ohne sich die Mühe zu machen, den Vorhang ganz zuzuziehen; während sie sich auszieht, erhascht man einen flüchtigen Blick, schlanke Arme, schlanker Leib, ein kleiner Slip. Ja, sie schrubbt Böden, sammelt schmutzige Wäsche auf. Sie ist achtundzwanzig. Ihre Träume hängen noch an ihr, schmücken sie; sie ist selbstsicher, ruhig, man denkt bei ihr an langhälsige Tiere, an Wiederkäuer, vergessene Heilige. Sie ist vorsichtig, es ist schwer, sich ihr zu nähern. Ihr Leben liegt im verborgenen. Man bekommt sie nur durch den Rauch und die Unterhaltung von vielen Abendessen zu sehen: Essen auf dem Lande, Dinner im Russian Tea Room, dem Café Chauveron zusammen mit Viris Kunden, im St. Regis, im Minotaur.
Es kamen Gäste mit dem Auto aus der Stadt, Peter Daro und seine Frau.
„Um wieviel Uhr kommen sie?“
„Gegen sieben“, sagte Viri.
„Hast du den Wein aufgemacht?“
„Noch nicht.“
Der Wasserhahn lief, ihre Hände waren naß.
„Hier, nimm das Tablett“, sagte sie. „Die Kinder wollen vorm Kamin essen. Erzähl ihnen eine Geschichte.“
Sie stand einen Moment lang da und begutachtete ihre Vorbereitungen. Sie schaute kurz auf die Uhr.
Die Daros trafen in der Dunkelheit ein. Man hörte die Autotüren schwach zuschlagen. Ein paar Augenblicke später standen sie mit strahlenden Gesichtern an der Eingangstür.
„Hier ist ein kleines Geschenk“, sagte Peter.
„Viri, Peter hat Wein mitgebracht.“
„Gebt mir eure Mäntel.“
Der Abend war kalt. In den Räumen spürte man den Herbst.
„Das ist eine schöne Fahrt hierher“, sagte Peter, während er sich die Kleidung glattstrich. „Ich liebe diese Strecke. Sobald man die Brücke überquert hat, ist man mitten im Wald, alles stockfinster, und die Stadt ist verschwunden.“
„Es ist fast urtümlich“, sagte Catherine.
„Und man ist zu dem schönen Haus der Berlands unterwegs.“ Er lächelte. Was für eine Selbstsicherheit, welche Siegesgewißheit liegt in den Zügen eines Mannes um die Dreißig.
„Ihr seht wunderbar aus, ihr beide“, sagte Viri.
„Catherine ist ganz vernarrt in dieses Haus.“
„Genau wie ich“, lächelte Nedra.
Novemberabend, immer gleich, klar. Geräucherte Bachforelle, Hammelfleisch, ein Endiviensalat, auf der Anrichte ein entkorkter Margaux. Das Essen wurde unter einem Druck von Chagall aufgetragen, der Meerjungfrau über der Bucht von Nizza. Die Signatur war wahrscheinlich unecht, aber wie Peter schon früher gesagt hatte, was machte das für einen Unterschied, sie war ebensogut wie Chagalls eigene, vielleicht sogar noch besser, mit genau dem richtigen Schuß Lässigkeit. Und der Druck, dieser in reiner Nacht treibende Engel, war schließlich nur einer von Tausenden, von denen sich die meisten nicht einmal durch irgendeine Signatur auszeichneten, echt oder unecht.
„Mögt ihr Forelle?“ fragte Nedra, die Platte in der Hand haltend.
„Ich weiß nicht, was ich lieber mag, sie zu fangen oder sie zu essen.“
„Du kannst sie also wirklich fangen?“
„Es gab Zeiten, da hab ich mich das auch gefragt“, sagte er. Er nahm sich eine großzügige Portion. „Wißt ihr, ich hab schon überall geangelt. Forellenangler sind eine Sorte für sich, einsam, wunderlich. Nedra, das schmeckt köstlich.“
Er hatte schütteres Haar und ein glattes, volles Gesicht, das Gesicht eines Erben, eines Mannes, der für den Trust einer Bank arbeitet. Aber in Wirklichkeit war er den ganzen Tag auf den Beinen, ständig Gauloises rauchend, die er aus verkrumpelten Päckchen angelte. Er hatte eine Galerie.
„So hab ich Catherine erobert“, sagte er. „Ich habe sie mit zum Angeln genommen. Eigentlich hab ich sie zum Lesen mitgenommen; sie saß mit einem Buch am Ufer, während ich Forellen fing. Hab ich euch die Geschichte erzählt, wie ich in England angeln war? Ich fuhr zu einem kleinen Fluß, es war einmalig. Das war nicht der Test, das ist der berühmte Fluß, den jahrelang ein Mann namens Lunn verwaltete. Sagenhafter alter Mann, typisch englisch. Es gibt ein wunderbares Foto von ihm mit Pinzette, wie er gerade Insekten sortiert. Der Mann ist eine Legende.
Ich war in der Nähe von einem Gasthaus, einem der ältesten in England. Es heißt ›The Old Bell‹. Ich kam an diese wirklich schöne Stelle, und da waren zwei Männer, die saßen am Ufer und waren nicht gerade glücklich darüber, daß da noch jemand auftauchte, aber da sie Engländer waren, taten sie natürlich so, als hätten sie mich nicht einmal gesehen.“
„Peter, entschuldige bitte“, sagte Nedra. „Nimm dir noch etwas.“
Er bediente sich.
„Nun gut. Ich sagte: ›Wie geht’s?‹ – ›Schöner Tag‹, sagte der eine. ›Ich meine, wie läuft das Angeln?‹ Langes Schweigen. Schließlich sagte einer: ›Sind ’n paar Forellen hier.‹ Noch mehr Schweigen. ›Einer da drüben beim Felsen‹, sagte er. ›Wirklich?‹ – ›Ich hab ihn vor ’ner Stunde gesehen‹, sagte er. Wieder langes Schweigen. ›Großes Ding.‹“
„Hast du den gefangen?“ fragte sie.
„Oh, nein. Die Forelle war ein alter Bekannter von ihnen. Du weißt ja, wie das ist; du warst doch schon in England.“
„Ich war noch nirgendwo.“
„Ach, komm schon.“
„Dafür habe ich aber schon alles gemacht“, sagte sie. „Das ist wichtiger.“ Ein breites Lächeln erschien über ihrem Weinglas. „Oh, Viri“, sagte sie. „Der Wein ist wunderbar.“
„Der ist gut, nicht wahr? Wißt ihr, es gibt ein paar kleine Geschäfte, wo man – erstaunlicherweise – wirklich guten Wein bekommt, und gar nicht mal teuer.“
„Woher hast du den hier?“ fragte Peter.
„Du weißt doch, wo die 56ste Straße ist …“
„Bei der Carnegie Hall.“
„Genau.“
„Da an der Ecke.“
„Die haben ein paar sehr gute Weine.“
„Ja, ich weiß. Wie heißt doch gleich der Verkäufer? Da gibt’s einen bestimmten Verkäufer …“
„Ja, mit Glatze.“
„Der versteht nicht nur was von Weinen; er kennt auch ihre Poesie.“
„Er ist fabelhaft. Jack heißt er.“
„Genau“, sagte Peter. „Netter Mann.“
„Viri, erzähl von der Unterhaltung in dem Laden“, sagte Nedra.
„Das war woanders.“
„Ich weiß.“
„Das war in der Buchhandlung.“
„Komm schon, Viri“, sagte sie.
„Ich hab nur zufällig was mit angehört“, erklärte er. „Ich war auf der Suche nach einem Buch, und da waren diese beiden Männer. Der eine sagte zum andern“, er machte perfekt ein Lispeln nach, „›Sartre hatte recht, wissen Sie.‹“
„›Ach ja?‹“ Er machte den anderen nach. „›Womit denn?‹
›Genet ist ein Heiliger‹, sagte er. ›Der Mann ist ein Heiliger.‹“
Nedra lachte. Sie hatte ein volles, nacktes Lachen. „Du kannst das so gut“, sagte sie zu ihm.
„Nein“, wehrte er vage ab.
„Du machst das perfekt“, sagte sie.
Dinner auf dem Land, der Tisch gedrängt voll von Gläsern, Blumen, allen erdenklichen Speisen, Dinner, die in Tabakrauch enden, einem Gefühl von Leichtigkeit. Behagliche Dinner. Die Unterhaltung kommt nie ins Stocken. Diese beiden sind etwas Besonderes, sie leben füreinander, sie verbringen ihre Zeit lieber mit ihren Kindern, sie haben nur ein paar Freunde.
„Wißt ihr, nach einigen Dingen bin ich richtig süchtig“, begann Peter.
„Wie zum Beispiel?“ sagte Nedra.
„Nehmen wir die Biographien von Malern“, sagte er. „Wunderbar, die zu lesen.“ Er dachte einen Moment lang nach. „Frauen, die trinken.“
„Im Ernst?“
„Irische Frauen. Die mag ich besonders.“
„Trinken die?“
„Trinken? Alle Iren trinken. Ich war mit Catherine schon auf Einladungen, wo große Damen der irischen Gesellschaft vornüber in ihre Teller gekippt sind, total betrunken.“
„Peter, das glaube ich nicht.“
„Die Bediensteten achten gar nicht auf sie“, sagte er. „Es wird da ›die Schwäche‹ genannt. Die Gräfin von – wie war doch gleich ihr Name, Liebling? Mit der wir solche Probleme hatten – um zehn Uhr morgens betrunken. Eine ziemlich dunkle Dame, verdächtig dunkel. Ein paar von denen sehen so aus.“
„Was meinst du mit dunkel, den Teint?“
„Schwarz.“
„Wie kommt das denn?“ fragte Nedra.
„Tja, wie ein Freund von mir sagen würde – weil der Graf einen so großen Schwanz hatte.“
„Du weißt ja wirklich eine Menge über Irland.“
„Ich würde gern dort leben“, sagte Peter.
Eine kleine Pause. „Was gefällt dir von allem am besten?“ sagte sie.
„Am besten von allem? Machst du Witze? Es gibt nichts auf der Welt, was ich lieber täte als einen Tag lang angeln gehen.“
„Ich steh nicht gern so früh auf“, sagte Nedra.
„Man braucht nicht früh aufzustehen.“
„Ich dachte.“
„Nein, wirklich nicht.“
Die Weinflaschen waren ausgetrunken. Die Farbe ihrer Leere war wie die Farbe in Kirchenschiffen.
„Man muß Stiefel tragen und all so’n Zeug“, sagte sie.
„Nur wenn man Forellen fängt.“
„Die laufen voll Wasser, und dann ertrinken die Leute.“
„Manchmal“, sagte er. „Du weißt nicht, was dir entgeht.“
Sie griff sich an den Hinterkopf, so als hörte sie nicht länger zu, löste ihr Haar und schüttelte es nach hinten.
„Ich habe ein phantastisches Shampoo“, erklärte sie. „Es kommt aus Schweden. Ich kaufe es bei Bonwit Teller’s. Es ist wirklich einmalig.“
Sie spürte den Wein, das weiche Licht. Ihre Arbeit war getan. Den Kaffee und Grand Marnier überließ sie Viri.
Sie saßen auf den Sofas am Kamin. Nedra ging zum Plattenspieler. „Ich muß euch was vorspielen“, sagte sie. „Ich sag euch, wenn’s kommt.“
Eine Platte mit griechischen Liedern begann. „Es ist das nächste“, erklärte sie. Sie warteten. Die leidenschaftliche, klagende Musik schlug ihnen entgegen. „Also. Das Lied handelt von einem Mädchen, dessen Vater sie mit einem ihrer netten Verehrer verheiraten will …“
Sie bewegte die Hüften. Sie lächelte. Sie streifte sich die Schuhe ab und saß mit angezogenen Beinen da.
„… sie aber will nicht. Sie will den Stadttrinker heiraten, weil er sie jede Nacht leidenschaftlich lieben wird.“
Peter beobachtete sie. Es gab Momente, in denen sie alles zu offenbaren schien. In ihrem Kinn war ein Grübchen, klargestochen, kreisrund. Ein Zeichen von Intelligenz, von Nacktheit, das sie wie ein Juwel trug. Er versuchte, sich Szenen vorzustellen, die sich in diesem Haus abspielten, aber er wurde durch ihr Lachen daran gehindert. Ihr Lachen hob auf, was sie gesagt hatte, es war ein Kleidungsstück, das sie zurücklassen konnte wie abgestreifte Strümpfe, wie einen Bademantel am Strand.
Sie saßen zurückgelehnt in den weichen Kissen und redeten bis Mitternacht. Nedra trank reichlich, hielt immer wieder ihr Glas zum Nachschenken hin. Sie war mit Peter in ein separates Gespräch vertieft, als stünden sie beide sich am nächsten, als könne sie ihn vollkommen verstehen. Jedes Zimmer, jeder Winkel hier gehörte ihr, die Löffel, die Stoffe, der Boden unter den Füßen. Es war ihr Reich, ihr Serail, in dem sie barfuß gehen konnte, in dem sie mit nackten Armen schlafen durfte, mit ausgebreitetem Haar. Als sie gute Nacht sagte, schien ihr Gesicht bereits gewaschen, als wäre sie schon allein. Der Wein hatte sie müde gemacht.
„Wenn du das nächste Mal heiratest“, sagte Catherine, als sie mit ihrem Mann nach Hause fuhr, „solltest du jemanden wie sie heiraten.“
„Was soll das heißen?“
„Keine Angst. Ich mein nur, daß es offensichtlich ist, wie sehr dir so was gefallen würde …“
„Catherine, sei nicht albern.“
„… und ich finde, du solltest es ausprobieren.“
„Sie ist einfach eine sehr großzügige Frau. Das ist alles.“
„Großzügig?“
„Ich meine das im Sinne von überströmend, üppig.“
„Sie ist die egoistischste Frau auf der Welt.“
3
Er war Jude, ein sehr eleganter Mann, ein sehr romantisch aussehender, ein Hauch von Müdigkeit lag in seinen Zügen, intelligente Züge, um die ihn jedermann beneidete, sein Haar war spröde, er war merkwürdig nachlässig gekleidet – das heißt nicht übermäßig gepflegt: ein fehlender Knopf, ein schmutziger Manschettenrand. Er hatte einen leicht säuerlichen Atem wie der eines Onkels, dem es nicht mehr so gut geht. Er war klein. Er hatte weiche Hände und keine, wirklich fast überhaupt keine Ahnung von Geld. Die Notwendigkeit, Geld zu haben, ja, die kannte er zur Genüge, aber ob er welches hatte, war purer Zufall, wie Regen, es kam, oder es kam nicht. Er war bar jedes wirklichen Instinkts.
Seine Freunde waren Arnaud, Peter, Larry Vern. Jeder Freund ist auf andere Art und Weise ein Freund. Arnaud war sein engster, Peter sein ältester.
Er stand wartend vor dem Ladentisch, sein Blick glitt über farbige Stoffballen.
„Haben wir für Sie schon einmal Hemden angefertigt, Sir?“ fragte eine Stimme, eine sichere Stimme von großer Weisheit.
„Sind Sie Mr. …?“
„Conrad.“
„Mr. Daro hat mir Ihren Namen gegeben“, sagte Viri.
„Wie geht es Mr. Daro?“
„Er hat Sie mir sehr empfohlen.“
Der Ladenbesitzer nickte. Er lächelte Viri zu, das Lächeln eines Kollegen.
Drei Uhr nachmittags. Die Tische in den Restaurants haben sich geleert, der Tag beginnt zu verblassen. Ein paar Frauen schlendern zwischen den weiter entfernten Auslagen des Geschäfts, sonst ist alles ruhig. Conrad hatte einen leichten Akzent, den man anfangs schwer einordnen konnte. Er wirkte weniger fremd als auf gewisse Weise sehr speziell, ein Zeichen vollendeter Manieren. Es war ein Wiener Akzent. Es lag eine tiefe Weisheit darin, die Weisheit eines Mannes, der Diskretion bewahren konnte, der vernünftig, ja sogar bescheiden und für sich allein speiste, der die Zeitung Seite für Seite las. Seine Fingernägel waren gepflegt, sein Kinn gut rasiert.
„Mr. Daro ist ein sehr angenehmer Mann“, sagte er, als er Viris Mantel entgegennahm und ihn behutsam neben dem Spiegel aufhängte. „Er hat ein ungewöhnliches Merkmal. Sein Hals ist siebzehneinhalb.“
„Ist das viel?“
„Von den Schultern aufwärts könnte er ohne weiteres ein Preisboxer sein.“
„Seine Nase ist zu fein.“
„Schulteraufwärts und kinnabwärts“, sagte Conrad. Er nahm Viris Maße mit der Sorgfalt einer Frau, die Länge der Arme, Brust, Taille, den Umfang der Handgelenke. Jede Ziffer notierte er auf einer großen, vorgedruckten Karte, einer Karte, die, wie er sagte, immer aufgehoben würde. „Ich habe noch Kunden von vor dem Krieg“, sagte er. „Sie kommen noch immer zu mir. Dienstags und donnerstags; das sind die einzigen Tage, an denen ich hier bin.“
Er legte seine Musterbücher auf den Ladentisch und öffnete sie, wie man eine Serviette auseinanderfaltet. „Sehen Sie sich diese mal durch“, sagte er. „Das ist nicht alles, aber es sind die besten.“
Die Seiten enthielten kleine Quadrate aus Stoff, Zitronengelb, Magenta, Cocoa, Grau. Es gab Stoffe mit Streifen, Batiken, ägyptische Baumwolle, die so dünn war, daß man durch sie hindurch hätte lesen können.
„Der hier wäre gut. Nein, vielleicht doch nicht ganz das Richtige“, entschied Conrad.
„Wie wär es mit dem hier?“ sagte Viri. Er hielt ein Stückchen Stoff in der Hand. „Wäre das zu aufdringlich, ein ganzes Hemd, meine ich?“
„Auf jeden Fall besser als ein halbes Hemd“, sagte Conrad. „Aber lassen Sie mich mal sehen …“ Er dachte nach. „Der wäre fabelhaft.“
„Oder dieser hier“, sagte Viri.
„Ich sehe schon – zwar kenne ich Sie erst ein paar Minuten, aber man merkt gleich, daß Sie ein Mann von eigenem Geschmack und genauen Vorstellungen sind. Ja, wirklich, keine Frage.“
Sie waren wie alte Freunde; ein tiefes Verständnis war zwischen ihnen aufgekommen. Die Falten in Conrads Gesicht waren die eines Witwers, eines Mannes, der sich sein Wissen verdient hatte. Sein Auftreten war respektvoll, aber selbstbewußt.
„Probieren Sie diese Kragen“, sagte er. „Ich werde Ihnen ein paar wundervolle Hemden machen.“
Viri stand vor dem Spiegel und begutachtete sich in verschiedenen Kragen, langen, spitzen, Kragen mit abgerundeten Enden.
„Der hier ist nicht schlecht.“
„Etwas zu schmal für Sie“, meinte Conrad. „Wenn ich mir erlauben darf.“
„Selbstverständlich. Allerdings, da wäre eine Sache“, sagte Viri, während er den Kragen wechselte. „Die Ärmel. Ich habe gesehen, daß Sie dreiunddreißig aufgeschrieben haben.“
Conrad konsultierte die Karte. „Dreiunddreißig“, bestätigte er. „Ganz genau. Das Meßband irrt nicht.“
„Ich hab es lieber, wenn sie nicht so lang sind.“
„Das ist nicht lang. Vierunddreißig wäre lang.“
„Und zweiunddreißig?“
„Nein, wirklich. Das wäre komisch“, sagte Conrad. „Was bringt Sie dazu, bei den Ärmeln zum Grotesken zu neigen?“
„Ich hab’s gern, wenn ich meine Knöchel sehe“, sagte Viri.
„Mr. Berland …“
„Glauben Sie mir. Dreiunddreißig ist zu lang.“
Conrad drehte seinen Bleistift um, radierte.
„Ich begehe ein Verbrechen“, sagte er und zog einen halben Zoll ab.
„Ich versichere Ihnen, sie werden nicht zu kurz sein. Ich mag keine langen Ärmel.“
„Mr. Berland, ein Hemd … aber ich glaube, ich muß Ihnen das nicht erst sagen.“
„Natürlich nicht.“
„Ein schlechtes Hemd ist wie die Geschichte von einem hübschen Mädchen, das nicht verheiratet ist und eines Tages schwanger wird. Es ist nicht das Ende der Welt, aber eine ernste Sache.“
„Wie steht es mit der Brusttasche? Ich mag es, wenn sie recht tief sind.“
Conrad sah gequält aus. „Eine Tasche“, sagte er. „Wofür um alles in der Welt brauchen Sie eine Tasche? Die ruiniert das ganze Hemd.“
„Nicht völlig, oder?“
„Wenn ein Hemd schon etwas zu kurze Ärmel hat und obendrauf noch eine Tasche …“
„Die Tasche soll ja nicht auf den Ärmeln sitzen. Ich habe sie mir eigentlich eher dazwischen vorgestellt.“
„Was soll ich sagen? Wozu brauchen Sie eine Tasche?“
„Für meinen Bleistift. Ich muß immer einen Bleistift bei mir haben“, sagte Viri.
„Aber doch nicht dort. Also das“, sagte er und deutete auf einen Kragen, den Viri angelegt hatte, „das ist wirklich ein schöner Kragen, finden Sie nicht auch?“
„Ist er hinten nicht zu hoch?“ Er drehte den Kopf zur Seite, um besser sehen zu können.
„Nein, ich denke nicht. Aber wenn Sie wollen, können wir ihn ein wenig herunternehmen – sagen wir, einen viertel Zoll.“
„Ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen.“
„Nein, nein“, versicherte ihm Conrad. „Keineswegs. Ich mache nur einen kleinen Vermerk …“ Er schrieb, während er sprach. „Die Details sind alles. Ich habe schon Kunden gehabt … einmal hatte ich einen Mann, der stammte aus einer ziemlich bekannten Familie der Stadt, politisch sehr einflußreich. Er hatte zwei Leidenschaften. Hunde und Uhren. Er besaß große Mengen von beiden. Jeden Tag schrieb er die genaue Uhrzeit auf, zu der er ins Bett ging und wieder aufstand. Seine linke Manschette wurde einen halben Zoll weiter gearbeitet als die rechte, wegen seiner Armbanduhren, versteht sich. Die meisten davon Vacheron Constantins. Ein viertel Zoll hätte allerdings auch genügt. Seine Frau, die sonst in jeder Hinsicht eine Heilige war, nannte ihn Doggy. In sein Monogramm war das Profil eines Schnauzers eingearbeitet.
Ich hatte auch schon Kunden – ohne Namen nennen zu wollen, aber sagen wir, vom Schlage eines Lepke Buchalter. Sie wissen, wen ich meine?“
„Ja.“
„Gangster. Na ja, Sie wissen ja, daß Gangstermode oft zum allgemeinen Chic geworden ist, aber diese Männer waren zweifelsohne phantastische Kunden.“
„Haben sie viel Geld ausgegeben?“
„Ach, Geld … abgesehen vom Geld.“ Conrad machte eine ausladende Bewegung. „Geld war kein Problem. Sie waren einfach glücklich, daß sich jemand ihnen widmete, daß jemand versuchte, sie gut anzuziehen. Verzeihen Sie, aber was machen Sie beruflich?“
„Ich?“
„Ja.“
„Ich bin Architekt.“ Nach Verbrecherkönigen klang das ein wenig dürftig.
„Ein Architekt“, sagte Conrad. Er machte eine kleine Pause, so als wollte er dem Gedanken erlauben, sich erst einmal zu setzen. „Sind irgendwelche Bauten in dieser Gegend von Ihnen?“
„Nein, nicht in dieser Gegend.“
„Sind Sie ein guter Architekt? Zeigen Sie mir einmal eins Ihrer Gebäude?“
„Das, Mr. Conrad, kommt ganz darauf an, wie die Hemden ausfallen.“
Conrad gab einen kleinen Laut der Zustimmung und des Verständnisses von sich. „Was das angeht“, sagte er, „kann ich Sie beruhigen. Ich bin jetzt dreißig, nein, einunddreißig Jahre im Geschäft. Ich habe ein paar sehr gute und ein paar schlechte Hemden gemacht, aber alles in allem hab ich’s geschafft, mein Handwerk vollständig zu erlernen. Ich kann zu mir sagen: Conrad, du hast zwar – unglücklicherweise – keine richtige Schulbildung genossen, deine Finanzen sind ein wenig mager, aber eine Sache ist unbestritten: du verstehst etwas von Hemden. Von einer Manschette zur andern, wenn ich so sagen darf. Also, wann bin ich hier?“
„Dienstags und donnerstags.“
„Ich wollte Sie nur mal prüfen“, sagte Conrad.
Sie wählten einen Stoff aus, der wie Federn gemustert war, Federn aus dunklem Grün, Schwarz, Permanganat, einen anderen in der Farbe von Hirschleder und einen dritten in Königsblau.
„Sie finden nicht, daß das Blau zu blau ist?“
„Ein Blau kann nicht zu blau sein“, sagte Conrad. „Wie viele sollen wir Ihnen machen?“
„Na, eins von jeder Sorte“, sagte Viri.
„Drei Hemden?“
„Jetzt habe ich Sie enttäuscht.“
„Ich werde nur enttäuscht sein, wenn sie nicht zu Ihren Lieblingshemden gehören“, sagte Conrad. Er klang ein wenig resigniert.
„Ich werde Ihnen viele neue Kunden schicken.“
„Da bin ich mir sicher.“
„Einen werde ich Ihnen gleich nennen. Ich weiß nicht, wann genau er hereinschauen wird, aber sehr bald.“
„Dienstags oder donnerstags“, mahnte Conrad.
„Natürlich. Sein Name ist Arnaud Roth.“
„Roth“, sagte Conrad.
„Arnaud.“
„Sagen Sie ihm, daß ich mich freue und ihn erwarte.“
„Sie erinnern sich doch an seinen Namen?“
„Ich bitte Sie“, protestierte Conrad. Er war wie ein Patient, der zu lange Besuch gehabt hatte; er schien irgendwie erschöpft.
„Sie werden ihn sehr unterhaltsam finden“, sagte Viri.
„Sicher.“
„Wann werden die Hemden fertig sein?“ sagte er, während er seinen Mantel anzog.
„In vier bis sechs Wochen, Sir.“
„So lange?“
„Wenn Sie die Hemden sehen, werden Sie überrascht sein, wie schnell sie gemacht wurden.“
Viri lächelte. „Es war mir eine große Freude, Mr. Conrad“, sagte er.
„Die Freude war ganz meinerseits.“
Die Straße war dicht gedrängt mit Menschen, die Sonne schien noch hell; die ersten Pendler, gut gekleidet, eilten zu frühen Zügen. Er genoß den Straßentumult, als er in der treibenden Menge ging. Er wußte in diesem Moment, wonach all diese Menschen strebten. Er verstand die Stadt, die überfüllten Straßen, Herbsttage, die wie Messer in den obersten Fenstern blitzten, Geschäftsleute, die aus den Drehtüren des Sherry-Netherland strömten, den windgefegten Park.
In einer Telefonzelle wählte er eine vertraute Nummer.
„Ja, hallo“, sagte eine Stimme gelangweilt.
„Arnaud …“
„Hallo, Viri.“
„Hör mal, was haben wir heute? Dienstag. Ich will, daß du dich am Donnerstag mit jemandem triffst. Du wirst mir bis ans Ende deines Lebens dankbar sein.“
„Wo bist du? In einem Puff?“
„Wie geht doch gleich die Geschichte von den zwölf absolut reinen Männern, die für die Welt von essentieller Bedeutung sind?“
„Sag mir schon die Pointe.“
„Nein, das hier ist eine Art Scholem-Alejchem-Geschichte. Diese zwölf Männer – du mußt die Geschichte doch kennen – sind über die ganze Welt verstreut. Niemand weiß, wer sie sind, aber wenn einer von ihnen stirbt, wird er sofort durch einen andern ersetzt. Ohne sie würde die Zivilisation zusammenbrechen, wir würden im Chaos versinken, im Verbrechen, in völliger Desillusion.“
„Das ist wahrscheinlich schon passiert, es sind nur noch vier oder fünf übrig.“
„Ich hab einen getroffen.“
„Darum geht’s also.“
„Sein Name ist Conrad.“
„Conrad? Machst du Witze? Das ist ein Betrüger.“
„Nein, ich meine einen anderen Conrad. Du mußt ihn kennenlernen.“
„Du weißt, was das letzte Mal dabei rausgekommen ist, als du das gesagt hast?“
„Laß mich nachdenken.“
„Ich habe fünfhundert Dollar in einen Film investiert.“
„Ah ja, ich erinnere mich.“
„Conrad, sagst du? Was soll der Kerl mir denn Gutes tun?“
Viri beobachtete den Straßenverkehr, dessen Geräusche gedämpft zu ihm drangen und der das Metall unter seinen Füßen vibrieren ließ, sein Blick wurde von den glänzenden Autos in die Ferne gezogen.
„Er wird dir ein paar Hemden machen.“
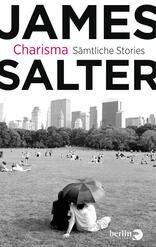
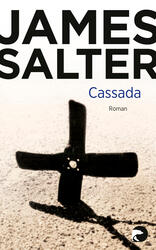








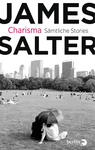
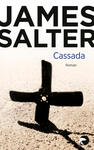

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.