

Märzgefallene (Die Gereon-Rath-Romane 5) Märzgefallene (Die Gereon-Rath-Romane 5) - eBook-Ausgabe
Der fünfte Rath-Roman
— Vom Autor der Romanvorlage zu Babylon BerlinMärzgefallene (Die Gereon-Rath-Romane 5) — Inhalt
Rath ermittelt in einer mysteriösen Mordserie
Rosenmontag 1933. Gereon Rath feiert Karneval in Köln, und der Morgen danach beginnt mit einem heftigen Kater, der falschen Frau im Bett und einem Anruf aus Berlin: Der Reichstag steht in Flammen! Sofortige Urlaubssperre!
Zurück in Berlin, wird Rath in die Kommunistenhatz der Politischen Polizei eingespannt und soll eine mysteriöse Mordserie aufklären, der etliche Weltkriegsveteranen zum Opfer fallen. Nebenher muss er einen Geschäftsfreund des Gangsterbosses Johann Marlow aus den Klauen der SA befreien und sich um die Vorbereitungen der Hochzeit mit seiner Dauerverlobten Charly kümmern.
„Kutschers historische Krimis erzählen mehr als so manche Geschichtsstunde.“ Berliner Morgenpost
Leseprobe zu „Märzgefallene (Die Gereon-Rath-Romane 5)“
1
Der Mann saß an einem stählernen Pfeiler im Schatten der Hochbahntrasse, das Kinn auf die Brust gesunken, als sei er nur kurz eingenickt. Man hätte denken können, er schlafe seinen Rausch aus, so kauerte er da, in einem alten, geflickten Soldatenmantel, in Wickelgamaschen und löchrigen Handschuhen, eine dicke Wollmütze tief in die Stirn gezogen.
Wilhelm Böhm musste seinen Bowler festhalten, den ihm der scharfe, frostige Wind vom Kopf fegen wollte. Sie befanden sich direkt unter dem Hochbahnhof Nollendorfplatz, keinen Steinwurf entfernt vom [...]
1
Der Mann saß an einem stählernen Pfeiler im Schatten der Hochbahntrasse, das Kinn auf die Brust gesunken, als sei er nur kurz eingenickt. Man hätte denken können, er schlafe seinen Rausch aus, so kauerte er da, in einem alten, geflickten Soldatenmantel, in Wickelgamaschen und löchrigen Handschuhen, eine dicke Wollmütze tief in die Stirn gezogen.
Wilhelm Böhm musste seinen Bowler festhalten, den ihm der scharfe, frostige Wind vom Kopf fegen wollte. Sie befanden sich direkt unter dem Hochbahnhof Nollendorfplatz, keinen Steinwurf entfernt vom Treppenaufgang, und dennoch war der Tote niemandem aufgefallen, offenbar seit Tagen nicht, jedenfalls niemandem, der es für nötig erachtet hätte, angesichts eines leblosen Körpers, der bei Minustemperaturen auf der Straße lag, die Polizei zu rufen. Böhm hielt die Luft an, als er in die Hocke ging; der tote Mann, den er in Augenschein nehmen wollte, sah einfach aus wie jemand, der stank, ein Stadtstreicher eben, einer der vielen Obdachlosen, die Berlins Straßen bevölkerten und von denen es Jahr für Jahr mehr zu geben schien. Und tatsächlich musste sich der Oberkommissar seinen Schal vor die Nase halten, um weiteratmen zu können, denn trotz der Kälte verströmte der Tote den Gestank eines Menschen, der seit Jahren auf der Straße lebte: alter Schweiß, Urin, Alkohol.
Taubenkot bedeckte den reglosen Körper in einer dünnen, fleckigen Schicht, von den Schuhen bis hinauf zur Wollmütze. Oben aus dem Stahlgebälk gurrte es, unzählige Tauben hockten in den Streben, eine regelrechte Kolonie, die fortlaufend ihre Spuren hinterließ: Auch das Pflaster ringsum war über und über verschmutzt. Verständlich, dass die Passanten, jedenfalls die, die sich auskannten, diese Ecke mieden und die Hochbahn lieber an anderer Stelle unterquerten.
Ein Schupo, der am Nollendorfplatz seine täglichen Runden drehte, hatte schließlich – nach wie viel Tagen? – die Blutlache unter dem leblosen Mann entdeckt und die Zentrale Mordinspektion alarmiert. Die Genugtuung darüber, dass es ihm gelungen war, den Toten loszuwerden, ohne das eigene Revier damit behelligen zu müssen, war Wachtmeister Breitzke immer noch anzusehen. Kein Polizist riss sich darum, den Tod eines ungewaschenen Obdachlosen zu bearbeiten, auch nicht die Kollegen vom 174. Revier.
Den Schal vor Mund und Nase, betrachtete Böhm den Toten. Aus dem linken Nasenloch war das Blut in einem dünnen Rinnsal bis aufs Pflaster gelaufen, wo es eine Lache bildete, die bereits geronnen war. Oder gefroren, so genau war das bei den Temperaturen nicht zu sagen. Dort, wo es seinen Weg über den Mantel genommen hatte, war das Blut zu einem großen Teil im schweren Stoff versickert.
Mit spitzen Fingern durchsuchte Böhm die Taschen des Toten und fand einen alten, völlig zerfledderten Militärpass, der an einer Ecke sogar angesengt war, als habe sein Inhaber ihn bereits einmal verbrennen wollen und ein Feuerzeug an die Ecke gehalten, dann aber doch davor zurückgeschreckt. Der Oberkommissar faltete das speckige, abgegriffene Dokument auseinander. Der Reservist Heinrich Wosniak, so verrieten es die Einträge auf der fleckigen Pappe, geboren am 20sten März 1894 zu Hagen / Westfalen, war im August 1915 an der Ostfront zum 1. Garde-Reserve-Infanterie-Regiment gestoßen, das kurz darauf nach Flandern verlegt wurde. Die Hölle des Grabenkrieges hatte er überlebt, und war dennoch in seinem Soldatenmantel gestorben. Ein Großteil der Berliner Bettler trug Soldatenkleidung; Kleidung, die die Männer, oftmals schrecklich verkrüppelte Gestalten, seit dem Krieg nicht abgelegt hatten. Sie hatten ihre Gesundheit geopfert für das Vaterland, und nun kümmerte sich kein Mensch mehr um sie. Selbst den Leuten, die sie anbettelten, war ihr Anblick eher lästig, als dass sie Mitleid empfanden. Und schon gar keine Dankbarkeit. Dafür, dass diese Männer ihre Knochen hingehalten hatten für den Patriotismus der Daheimgebliebenen.
„Soll ich mit der Spurensicherung anfangen, Oberkommissar?“
Böhm blickte auf. Da stand Kriminalsekretär Gräf, einer der beiden Männer, die er mit rausgenommen hatte zum Nollendorfplatz, und pustete Atemwölkchen in die kalte Februarluft. Nicht mal eine Stenotypistin hatten sie ihm gegönnt, nur den Kriminalsekretär und einen Kommissaranwärter. Der Oberkommissar stemmte seinen schweren Körper in die Höhe und richtete sich auf. Dem unmittelbaren Dunstkreis des Toten entkommen, konnte er endlich wieder frei atmen.
„Fangen Se an, Gräf. Kronbergs Leute sind noch im Wedding, mit denen können wir heute nicht rechnen.“ Böhm zeigte auf den Spurensicherungskoffer in der Hand des Kriminalsekretärs. „Das heißt, wir werden uns mit Bordmitteln bescheiden müssen. Schau’n Sie sich erst mal um, ob Sie überhaupt etwas finden. Zigarettenkippen, Fußspuren, was weiß ich. Die Ecke hier ist glücklicherweise nicht so stark frequentiert, jede Spur auf dem Pflaster könnte also ein Hinweis sein.“
Gräf stellte den Koffer ab und ließ die Verschlüsse aufschnappen. „Und was ist mit Fingerabdrücken?“, fragte er.
„Darum kümmere ich mich selber. Am Stahlträger könnten welche sein. Wenn überhaupt. Wer geht in diesen Tagen schon ohne Handschuhe vor die Tür?“ Böhm schaute sich um. „Wo bleibt eigentlich Steinke?“
„Hat wohl Probleme, die Kamera aus dem Kofferraum zu kriegen.“
Reinhold Gräf machte sich mit einem Packen Markierungsschilder und einer Handvoll Beweissicherungsbehälter an die Arbeit, und Böhm wandte sich dem Schupo zu.
„Heinrich Wosniak, sagt Ihnen der Name was?“
„Von den Jestalten, die hier rumlungern, kenn ick doch keene Namen.“
„Haben Sie den Toten denn schon mal gesehen?“
„Wie?“
„Ich meine, das ist doch Ihr Revier. Hat der vielleicht hier schon mal irgendwo rumgesessen? Irgendwo gebettelt? Auf ’ner Parkbank geschlafen? So was eben.“
Wachtmeister Breitzke zuckte die Achseln. „Da müsst ick erst mal sein Jesichte sehen.“
Böhm nickte. Der Kopf des Toten war so tief auf die Brust gesunken, die verfilzten Haare hingen so weit in die Stirn, dass man das Gesicht kaum erkennen konnte.
„Wir können den Mann erst bewegen, wenn die Spurensicherung abgeschlossen ist. Solange muss ich Sie bitten zu bleiben.“
„Warten Se mal!“ Breitzke hörte sich mit einem Mal deutlich weniger gelangweilt an und zeigte auf die vernarbte Haut, die unterhalb der Mütze der Leiche zu sehen war. „Vielleicht könnte det Kartoffel sein. Der steht schon mal am Nolle rum, drüben bei der U-Bahn, und schnorrt die Leute an.“
„Ich denke, von den Gestalten hier kennen Sie keine Namen?“
„Is ja ooch ’n Spitzname.“
„Kartoffel“, sagte Böhm. „Das heißt, den richtigen Namen kennen Sie nicht?“
„Ne, saach ick doch.“
„Sobald wir Fotos gemacht haben, schau’n Sie sich das Gesicht mal in Ruhe an. Vielleicht isser das ja wirklich.“
Wachtmeister Breitzke wirkte nicht begeistert, aber er nickte.
Böhm hörte ein leises Fluchen. Kommissaranwärter Steinke näherte sich mit dem Fotoapparat, die unhandliche Kamera unter den Arm geklemmt, das schwere Stativ geschultert. Ob der studierte Jurist, direkt vom Hörsaal in die Burg gekommen, jemals eine Hilfe sein würde, das bezweifelte Böhm. Auch nach einem Jahr bei der Kriminalpolizei agierte der Kommissaranwärter wie ein blutiger Anfänger; das Einzige, mit dem er sich bestens auskannte, waren Dienstgrade und Besoldungsstufen. Dennoch hatte Steinke gute Chancen, die Prüfungen zu bestehen, und dann wäre er als Kommissar der Vorgesetzte von Männern wie Gräf, dem leider der Ehrgeiz fehlte, die Kommissarsprüfung abzulegen, der aber der weitaus bessere Kriminalist war. Böhms einzige Hoffnung war, dass Steinke vielleicht doch durch die Prüfung rasselte, es gab schon mehr als genug unfähige Kriminalkommissare am Alex.
„Da sind Se ja endlich, Steinke.“
„Komme mir vor wie ein Packesel“, sagte der Kommissaranwärter und ließ das Stativ zu Boden fallen. Er ging zu dem Toten hinüber und verpasste dem leblosen Bündel einen kurzen Fußtritt, als handele es sich um einen überfahrenen Hund.
„Was machen Sie denn da, Mann?“
„Wollte nur feststellen, ob der Penner wirklich tot ist und nicht nur besoffen.“
„Wäre er nicht tot, wären wir wohl nicht hier“, sagte Böhm. „Lernen Sie heutzutage nicht mehr, dass Sie an einem Tatort selbstverständlich nichts anzurühren haben, bis die Spurensicherung abgeschlossen ist?“
„Schon, aber …“
„Und ganz abgesehen davon: Erweisen Sie einem Toten gefälligst mehr Respekt!“
„Mit Verlaub, Herr Oberkommissar, aber das ist ein Stadtstreicher, ein … Pennbruder. Frage mich, warum wir für so einen überhaupt rausfahren müssen.“
„Was soll denn das heißen? Dass so einer es nicht verdient, dass wir die Umstände seines Todes untersuchen?“
„Ich meine ja nur.“
„Meinen Sie nicht, bauen Sie lieber die Kamera auf und erledigen Sie Ihre Arbeit. Wir wollen hier endlich weiterkommen.“
Für einen Augenblick sah es so aus, als wolle Steinke noch etwas sagen, er öffnete den Mund, aber dann fuhr oben ein Zug in den Hochbahnhof ein, und das Donnern des Stahls machte jedes weitere Wort unhörbar. Der Kommissaranwärter winkte ab und begann, das Stativ auseinanderzufalten.
Böhm holte Rußpulver, Pinsel und Klebefolien aus dem Spurensicherungskoffer und machte sich daran, den Stahlträger vorsichtig einzustäuben. In der Nähe des Toten fand er keine Abdrücke, doch in rund eineinhalb Metern Höhe wurden zwei gut erhaltene und ein halber verwischter sichtbar. Er hatte gerade begonnen, die Spuren auf Folie zu bannen, da drückte Steinke das erste Mal auf den Auslöser. Die Nieten in den Stahlträgern reflektierten den Blitz, der tote Mann sah im unnatürlich grellen Licht für einen Moment zum ersten Mal wirklich bleich und tot und nicht nur betrunken aus.
Böhm nahm die Abdrücke mit zum Mordauto hinüber und beschriftete sie. Während er auf der bequemen Rückbank saß, warf er einen Blick durchs Autofenster zu Gräf hinüber, der gerade eine Zigarettenkippe mittels Pinzette vom Boden nahm und die Stelle gewissenhaft markierte, dann einen zu Steinke, der den Fotoapparat so lustlos bediente, als sehe er immer noch nicht ein, weshalb sie überhaupt hier rausgefahren waren.
„Und aus so einem soll mal ein Kriminalkommissar werden“, brummte der Oberkommissar, tütete den ersten Abdruck ein und schüttelte den Kopf.
„Heutzutage müssen Sie nur in der richtigen Partei sein, dann wird das schon mit der Karriere.“
Böhm erschrak und drehte sich um. Neben dem Mordauto stand Doktor Magnus Schwartz, wie immer wie aus dem Ei gepellt, in der rechten Hand die schwarzlederne Arzttasche.
„Sie sollten nicht so reden, Doktor.“ Böhm zuckte mit derKinnspitze zu Steinke hinüber, der in einiger Entfernung mit dem Fotoapparat hantierte. „Man weiß nie, was die jungen Leute heute so aufschnappen. Und bei welchen Stellen es dann landet.“
„Dann sollten Sie aber auch vorsichtiger sein, lieber Böhm. Ich für meinen Fall lasse mir jedenfalls nicht den Mund verbieten. Der braune Spuk geht auch wieder vorüber. In einer Woche wird gewählt.“
„Ihr Wort in Gottes Gehörgang“, sagte Böhm.
Leute wie Steinke, der an der Universität schon Mitglied der NS-Studentenschaft gewesen war, hatten in diesen Tagen Oberwasser. Und nicht nur Doktor Schwartz hoffte, dass sich das mit den Reichstagswahlen bald wieder ändern würde. Noch war Deutschland schließlich eine Demokratie, da mochten die Nazis noch so viel von einer nationalen Erhebung faseln.
Schwartz stellte seine Tasche ab und schaute sich um. „Sie sind ja nicht gerade mit großem Aufgebot hier“, sagte er.
„Ich bin froh, dass man mir wenigstens das Mordauto gegönnt hat und ich nicht das Fahrrad nehmen musste. Wenn ich schon keine Spurensicherer bekomme. Der ED hat derzeit alle Hände voll zu tun.“
„Tja, was will man machen“, meinte Schwartz. „Viel los in diesen Tagen. Mal wieder Wahlkampf, und das sind die mit Abstand ungesündesten Zeiten in Deutschland. Schlimmer als jede Grippewelle.“ Er zeigte zur Leiche hinüber. „Der hier scheint aber kein Opfer der Politik geworden zu sein, oder?“
„Ne, und auch keins der Grippewelle.“
„Das haben Sie schon herausgefunden? Was brauchen Sie mich da überhaupt noch?“
„Am besten schauen Sie ihn sich einmal an. Einfach nur erfroren ist er nämlich auch nicht.“
Böhm ging mit dem Gerichtsmediziner zur Leiche hinüber, von der Steinke gerade Nahaufnahmen machte.
„Ich denke, das reicht, Steinke. Lassen Sie den Doktor jetzt mal seine Arbeit erledigen.“
Der Kommissaranwärter gehorchte bereitwillig. Wachtmeister Breitzke, der geduldig ausgeharrt hatte, sah seine Chance gekommen. „Entschuldigen Sie, Herr Oberkommissar“, sagte er, „aber bevor der Doktor … Ich meine: Sie sagten doch, ich sollte mir den Toten mal näher anschauen, wenn er fotografiert ist …“
„Ja?“
„Weil …“ Breitzke schaute auf seine Taschenuhr. „Ich müsste hier wirklich mal langsam weiter meine Runden drehen.“
Böhm guckte streng. „Gut“, sagte er, „dann schauen Sie mal.“ Vorsichtig fasste er den auf die Brust gesunkenen Kopf des Toten bei den Haaren und zog ihn nach oben.
Es machte den Eindruck, als würde Heinrich Wosniak sie anschauen aus seinen toten Augen, beinahe vorwurfsvoll. Seine rechte Gesichtshälfte war vernarbt und erinnerte auf unappetitliche Weise tatsächlich an eine verschrumpelte Kartoffel. Das rechte Ohr war als solches kaum noch zu erkennen, das rechte Auge ohne Braue. Der Mann sah aus, als habe man seine Gesichtshaut zur Hälfte aus irgendwelchen Resten zusammengeleimt. Gleichwohl waren die bitteren Gesichtszüge gut zu erkennen, die der Mann mit in den Tod genommen hatte.
„Jau. Det is Kartoffel.“ Breitzke sagte das ungerührt. „Hab ick ja jleich jesacht. Kann ick jetze jehen?“
„Der Spitzname passt“, sagte Böhm. „Was hat den armen Kerl denn so entstellt?“
„Ein französischer Flammenwerfer, wat weeß ick? Jedenfalls hat er schon so ausjesehen, als ick ihn det erste Mal vom Nolle verscheucht habe.“
„Sie haben ihn verscheucht?“
„Ist den Leuten manchmal zu sehr auf die Pelle gerückt. Da muss man doch eingreifen.“
Böhm nickte. „Dann drehen Se man weiter Ihre Runden, Wachtmeister. Auf dass Berlin sicher bleibt.“
Breitzke salutierte und wollte sich schon abwenden mit wichtigem Gesicht, da schickte Böhm ihm noch einen Satz hinterher: „Und Ihren schriftlichen Bericht lassen Sie mir bitte heute noch zum Alex schicken.“
Breitzke salutierte ein zweites Mal und entfernte sich dann eiligen Schrittes.
Doktor Schwartz beugte sich zu dem Toten hinunter.
„Schlimme Verbrennungen. Zweiten bis dritten Grades.“
„Also tatsächlich Andenken aus dem Krieg?“
„Nein, so alt sind die Narben nicht. Wenn Sie mich fragen, hat er sich die vor zwei, höchstens drei Jahren zugezogen.“
Der Gerichtsmediziner holte eine Lupe aus seiner Arzttasche und eine kleine Stablampe, mit der er dem Toten in die Nase leuchtete.
Böhm schaute ihm eine Weile zu und wurde immer ungeduldiger, je länger der Doktor schwieg. Er trat von einem Bein aufs andere, verkniff sich aber die Frage, die ihm auf der Zunge lag.
Schwartz hatte die Lampe mittlerweile zwischen die Zähne genommen, um die Hände freizuhaben, und brummte etwas Unverständliches. Schließlich erhob er sich und packte sein Werkzeug wieder weg.
„Sicher bin ich mir nicht“, sagte er, „würde mich jedoch nicht wundern, wenn jemand dem armen Kerl hier eine Stricknadel durch die Nase ins Gehirn gerammt hätte.“
„Eine Stricknadel?“
„Nicht zwingend eine Stricknadel. Aber etwas in der Art, ein langer, spitzer Gegenstand. Einfache Methode, aber effektiv.“
„Vielleicht ein Unfall? Wollte er sich mit einem ungeeigneten Werkzeug die Nase säubern?“
„Ich will dem Toten ja nicht zu nahe treten. Aber erstens sieht er nicht so aus wie jemand, der sich überhaupt jemals um Reinlichkeit gekümmert hat, und zweitens müsste er das Corpus Delicti dann ja noch in der Hand halten. Wenigstens aber müsste es irgendwo hier herumliegen, wenn niemand Drittes beteiligt war.“
„Und wie sieht’s mit dem Todeszeitpunkt aus?“
Schwartz schaute auf die von Raureif und Taubendreck wie mit einer Art fleckigem Zuckerguss überzogene Leiche. „Bei solchen Außentemperaturen schwer zu sagen. Er kann da schon Tage gelegen haben, ohne dass die Verwesungsprozesse in Gang gekommen sind. Eine tiefgekühlte Leiche verwest nun mal nicht.“
„Also wie immer: Genaues erst nach der Obduktion.“
„Ich will Ihnen keine falschen Hoffnungen machen, Oberkommissar.“ Schwartz schaute skeptisch drein. „Dass die Leichenöffnung in dieser Frage noch genauere Erkenntnisse liefert, ist leider eher unwahrscheinlich.“ Er zuckte die Achseln. „Ich könnte mir vom Wetterdienst die Temperaturen der letzten Tage kommen lassen und versuchen, diesen Faktor zu berücksichtigen. Aber eine wirklich genaue Schätzung des Todeszeitpunktes wird auch damit kaum möglich sein. Der Mann kann seit einem Tag hier liegen oder seit einer Woche.“
„Hm.“ Böhm guckte enttäuscht.
„Am besten suchen Sie nach Zeugen. Befragen Sie die Passanten, dann bekommen Sie vielleicht heraus, wie lange der arme Teufel hier schon tot oder wenigstens leblos gelegen hat. Verdammt …“
Der Doktor fluchte. Eine der Tauben, die oben in den Stahlstreben gurrten, hatte einen hellen Fleck auf seinem dunklen Wintermantel hinterlassen. Schwartz zog ein blütenweißes Taschentuch hervor und versuchte, die Sauerei wieder wegzutupfen. Was ihm eher schlecht gelang, der Fleck war nun ein weiß verschmierter Streifen auf seiner linken Schulter.
„Wenn Tauben reden könnten, mein lieber Böhm“, meinte Schwartz, „dann wären Sie schon einen Schritt weiter. Aber leider können die nur gurren und scheißen.“
Böhm sagte nichts, er war zu sehr damit beschäftigt, ein Grinsen zu unterdrücken.
„Ich würde vorschlagen, wir lassen die Leiche gleich abtransportieren“, sagte der Gerichtsmediziner, „ist mir zu gefährlich hier. Ich arbeite lieber in der Hannoverschen Straße weiter, da haben Tauben keinen Zutritt.“
Böhm nickte und schaute auf die Leiche, betrachtete die dünne Schicht Taubenkot, die den Toten bedeckte. Und fragte sich, ob die Tauben ihnen nicht doch helfen könnten.
2
Wie kütt die Mösch, die Mösch, die Mösch bei uns in de Küch?
Der Gesang von Willi Ostermann kratzte aus den Lautsprechern und übertönte das Stimmengewirr der Leute, die sich im Lichthof des Kaufhauses Tietz zu den Rolltreppen drängten. Ein findiger Verkäufer hatte einen elektrischen Plattenspieler an die Sprechanlage angeschlossen, und so konnte man dem Mundartschlager auch in den Hallen des größten Kölner Kaufhauses nicht entgehen.
Wie Rath den alten Ostermann so gegen den Kaufhauslärm ansingen hörte, war ihm, als sei er nie weg gewesen. Die eigentümliche Elektrizität, mit der sich die Kölner Luft in den Tagen vor Aschermittwoch auflud, holte ihn gleich wieder heim. Wie lange war das jetzt her, dass er das zum letzten Mal gespürt hatte? Wie viele Jahre lebte er nun schon in einer Stadt, der all dies fremd war? Erst jetzt, als er es wieder spürte, merkte er, dass ihm das Karnevalsfieber tatsächlich gefehlt hatte. Sogar die Lieder vom unvermeidlichen Ostermann.
Die Schaufensterpuppen im Tietz-Lichthof waren als Zigeuner, Mexikaner, Musketiere oder Clowns ausstaffiert, sie trugen gestreifte Hosen und glitzernde Jacken, Pappnasen und bunte Hütchen, an denen Luftschlangen und Konfetti hingen. Mit stoischem Blick schauten die kostümierten Puppen auf die Menschen, die sich an ihnen vorbeidrängten, sich an Regalen mit Perücken, Masken und Schminke vorbeischoben, vorbei an Kleiderständern mit schrägen Hüten, knappen Röcken und fabrikgefertigten Kostümen. Es herrschte so etwas wie Torschlusspanik, in zwei Tagen war Rosenmontag.
„Es muss nichts Tolles sein“, sagte Rath, „nichts Originelles.“
„Originelles findest du bei Tietz sowieso nicht.“ Der blonde Mann neben ihm schaute skeptisch. „Alles, was du hier siehst, wird in den nächsten Tagen tausendfach getragen.“
Die Augen unter der Krempe des eleganten Filzhutes zogen Lachfalten. Pauls Gesicht lachte fast immer, selbst wenn sein Mund es nicht tat. Manchmal glaubte Rath, sein Freund schaue grundsätzlich mit einer spöttischen Distanz auf die Welt und ihren alltäglichen Irrsinn. Er kannte Paul Wittkamp seit Kindertagen, seit die Familie Rath, ein paar Jahre vor dem Krieg, hinaus nach Klettenberg gezogen war, und es gab keinen, den er besser kannte. Auch wenn sie sich in den letzten Jahren kaum hatten sehen können, genügte immer noch ein Blick, und jeder wusste, woran er beim anderen war.
Rath blieb vor einem Regal stehen, in dem ein größeres Sortiment an Papp- und Gumminasen fein säuberlich aufgereiht auf Käufer wartete. Ostermann war mittlerweile von den Monacos abgelöst worden. Es war einmal ein treuer Husar schmetterte aus den Lautsprechern.
„Hauptsache, niemand erkennt mich“, sagte Rath und wühlte sich durch die falschen Nasen.
„Was hast du denn vor?“ Paul wedelte mit dem Zeigefinger. „Du solltest dich benehmen, bald bist du ein verheirateter Mann.“
„Mit der Betonung auf bald“, sagte Rath und griff zu der größten Gumminase, die er finden konnte. „Jetzt wird erst mal Fastelovend gefeiert. Wie in alten Zeiten.“
Warum er wirklich im Karnevalstrubel unerkannt bleiben wollte, sagte er nicht. Dass er immer noch Angst hatte, in Köln von einem der Reporter LeClerks entdeckt zu werden. Und dass es dann wieder losgehen könnte. Die Schlagzeilen damals, nach dem tödlichen Zwischenfall an der Neusser Straße, hatten ihm mehr zugesetzt, als er das auch Paul gegenüber jemals zugegeben hätte. Erst in Berlin hatte er wieder Ruhe gefunden.
Gedankenverloren betrachtete Rath die Gumminase, einen unglaublichen Zinken, an dem eine dicke schwarze Brille und ein falscher Schnauz befestigt waren. Kurz entschlossen hielt er sich das Ganze vors Gesicht.
„Und? Wie sehe ich aus?“
Der Schnurrbart kitzelte ein wenig beim Sprechen.
„Setz dir einen schwarzen Hut auf“, sagte Paul, „dazu ein schwarzer Bratenrock, und du siehst aus, als wärest du direkt dem Stürmer entsprungen.“
Rath schaute in den nächstbesten Spiegel. Er sah wirklich aus wie eine antisemitische Karikatur – wie eine der Isidor-Zeichnungen, mit denen die Nazi-Postille Der Angriff seinerzeit Berlins Vize-Polizeipräsidenten Bernhard Weiß regelmäßig verunglimpft hatte.
„Meinst du, ich kriege so Ärger mit der SA?“
Paul zuckte die Achseln. „Wohl eher mit einem Juden, der sich auf den Arm genommen fühlt.“
„Aber solche Nasen gibt es doch zu Tausenden“, sagte Rath und wies auf das Regal. „Wer weiß, wer die alles tragen wird. Und wenn ich dazu keinen schwarzen Hut, sondern irgendwas rot-weiß Geringeltes anziehe oder so, dann sehe ich eher aus wie ne doof Nuss und nicht wie ein Itzig.“
„Mach, was du willst, Gereon. Jedenfalls kann ich sicher sein, dass du mit so einer Maske nicht Gefahr läufst, der Damenwelt den Kopf zu verdrehen. Dann muss ich wenigstens nicht auf dich aufpassen.“
„Hattest du das etwa vor?“
„Soll dein Trauzeuge zulassen, dass du kurz vor dem Gang zum Traualtar den Pfad der Tugend verlässt?“
„Sehe ich so aus, als wollte ich das?“
Paul lachte laut los. „Nein, ganz bestimmt nicht. Nicht mit dieser Nase.“ Er schlug Rath auf die Schulter. „Lass dir das Nasenfahrrad da in drei Teufels Namen einpacken. Und dann gehen wir zu mir und wühlen uns durch die Karnevalskisten. Oder willst du noch zu Cords?“
„Ne.“ Rath schüttelte den Kopf. „Ich habe für heute genug von Kaufhäusern.“
Den ganzen Morgen waren sie schon durch die Geschäfte gezogen, um Trauringe zu besorgen. Bei einem Juwelier in der Hohe Straße waren sie schließlich fündig geworden und hatten zwei schlichte, aber elegante Ringe in Auftrag gegeben. Paul solltesie abholen und erst zur Hochzeit mit nach Berlin bringen, so bestand auch keine Gefahr, dass Charly sie vor der Zeit entdeckte.
Rath hatte sich nicht lumpen lassen, vielleicht auch, um sein schlechtes Gewissen zu besänftigen. Weil seine Reise nach Köln, obwohl er sich das nicht eingestehen mochte, auch eine Art Flucht war. Eine Flucht aus Berlin, eine Flucht aus dem Alltag, eine Flucht weg von Charly. Der nach Wochen und Monaten des Hin und Her endlich festgezurrte Hochzeitstermin bereitete ihm, je näher er rückte, desto mehr Bauchschmerzen. So hatte er Pauls Einladung, noch einmal zusammen Karneval zu feiern, dankend angenommen. Zumal Gennat ihn ohnehin seit Monaten drängte, endlich all die Überstunden abzubauen, die sich angesammelt hatten.
Am Ausgang zur Schildergasse glaubte Rath, im Gedränge vor den großen Glastüren ein Gesicht gesehen zu haben, das ihm bekannt vorkam. Es dauerte einen Moment, ehe der Groschen fiel: Gut zehn Jahre war das her, seine Anfänge bei der Kölner Polizei, noch unter Aufsicht der britischen Besatzer. Ein Taschendieb, eine seiner ersten Festnahmen. Schürmann, Eduard Schürmann, genannt Zweifinger-Ede. Drei Jahre hatte der Mann damals bekommen, soweit Rath sich erinnern konnte, Jahre, dieihn offenbar nicht wieder in die Gesellschaft eingegliedert hatten: Ede rückte im Gedränge draußen vor dem Ausgang einem beleibten Herrn mit steifem Hut näher auf die Pelle, als das schicklich war.
„Entschuldige mich einen Augenblick. Wir sehen uns draußen.“ Rath drückte Paul seinen Einkauf in die Hand und stürzte hinaus auf die Straße. Edes braunen Hut konnte er für eine Weile nicht sehen, den Dicken aber behielt er im Blick. Der Trottel schien immer noch nichts bemerkt zu haben. Rath rempelte ihn an, notgedrungen, als er an ihm vorbeistürzte, um Ede zu fassen zu bekommen. Er legte dem Taschendieb die Hand auf die Schulter.
„Bist du nicht langsam zu alt für dieses Geschäft?“
Eduard Schürmann blieb wie angewurzelt stehen und drehte sich um. Aus dem Augenwinkel konnte Rath erkennen, dass er etwas Schwarzes mit der linken Hand hinter dem Rücken versteckte.
„Was soll das? Kennen wir uns?“
„Ist schon ein paar Jahre her, aber du hast dich kaum verändert. Wenigstens, was deine Gewohnheiten angeht.“ Rath lächelte freundlich. „Machst dich immer noch am liebsten über die Dicken her, was? Weil die so unbeweglich sind?“
Obwohl Ede sich erkennbar Mühe gab, verständnislos zu gucken, konnte Rath sehen, wie das Gesicht unter dem braunen Hut eine Idee blasser wurde.
„Herr Kommessar“, sagte Schürmann und zeigte ein misslungenes Lächeln, „han Se jar nit erkannt. Man erzählt, Se hätte Ihren Beruf an den Naarel jehängt.“
„Du den deinen offensichtlich nicht.“ Rath musterte den Mann von oben bis unten. „Arbeitest du ohne Raben? Oder war ich zu schnell für euch?“
„Wovun reden Se?“
„Von der Brieftasche, die du eben gezogen hast.“ Rath machte eine lockende Bewegung mit dem Zeigefinger. „Besser, du gibst sie mir. Wenn du nicht willst, dass wir dem großen Gebäude neben dem Kaufhaus Cords einen Besuch abstatten.“
Rath zeigte auf den Turm des Polizeipräsidiums, der düster und drohend am anderen Ende der Schildergasse in den grauen Himmel ragte wie ein mittelalterlicher Bergfried.
„Nit nöödich, Herr Kommessar, die Zeiten sin vorbei. Ich bin Uhrmacher.“
„Vor zehn Jahren hab ich dich wegen Taschendiebstahls in mehreren Fällen einbuchten lassen, und du willst mir erzählen, dass du jetzt in deinem Lehrberuf arbeitest?“
„Herr Kommessar, ich wor im Kahn, jo, un ich jehörte do och hin. Äver im Klingelpütz han ich mir jeschwore, ner bessere Minsch ze wääde. Ich han jetzt ner kleine Laden. Hier.“ Schürmann reichte Rath eine Visitenkarte. „Nur weil alle Welt Ede für mich säät, müssen Se nit denken, dat ich für immer und ewig ner Janove bin. Ich bin ehrlich jeworde, fraare Se mingFrau.“
Rath schaute auf die Karte. Für einen Moment verblüfft. Mit so etwas hatte er nicht gerechnet.
E. Schürmann, Uhrmachermeister
Unter Krahnenbäumen / Ecke Eigelstein
„Ede Schürmann“, sagte Rath, „nicht gerade ein vertrauenerweckender Name. Und auch keine vertrauenerweckende Adresse.“
„Nenne Se mich Eduard, dat klingt schon mehr nach Uhrmacher. Und wat die Adress anjeht: Och im Bahnhofsviertel bruche die Lück Uhre.“
Paul war inzwischen herangekommen.
„Was ist denn los?“, wollte er wissen. „Brauchst du Hilfe?“
Rath zeigte auf den Dicken, dessen Melone sich im Menschengewühl der Schildergasse zwischen den am Bordsteinrand parkenden Autos schon ein ganzes Stück entfernt hatte. „Tu mir einen Gefallen und halte diesen Mann dahinten auf. Den Dicken mit dem steifen Hut.“
„Hat er was verbrochen?“
Rath schüttelte den Kopf. „Im Gegenteil, er ist das Opfer.“
Paul blickte kurz von Rath zu Ede und wieder zurück, als erwarte er eine weitere Erklärung. Als keine erfolgte, zuckte er die Achseln und machte sich auf den Weg.
„Mein Freund wird den Dicken aufhalten, den du bestohlen hast“, sagte Rath zu Ede. „Und ich werde ihm seine Brieftasche zurückgeben.“
„Ich weiß nit, wovun Se reden.“
„Es ist ein Vorschlag zur Güte. Gib mir die Brieftasche, und alles ist vergessen. Oder wir zwei spazieren doch noch zur Krebsgasse und ich lasse dich einer Leibesvisitation unterziehen.“
„Ich weiß wirklich nit, welche Brief…“ Schürmann stutzte und schaute nach unten. „Meinen Se vielleicht die?“
Auf dem Pflaster, näher an Raths Füßen als an Edes, lag eine schwarze Brieftasche. Ede machte Anstalten sich zu bücken, doch Rath kam ihm zuvor und hob sie auf. Das Leder war noch warm und weich, als habe sie jemand eine Weile in der Hand gehalten. Rath öffnete sie, fand ein bisschen Klimpergeld, einen Zehn- und einen Zwanzigmarkschein, ein paar Rabattmarken und im Nebenfach eine Ausweiskarte, wie sie die Briten seinerzeit in ihrer Besatzungszone eingeführt hatten. 1923 hatte der Dicke einige Pfunde weniger mit sich herumgetragen, dennoch war es eindeutig sein Gesicht, das Rath entgegenblickte. Wilhelm Klefisch stand unter dem Passfoto.
„Dat muss einer verlore han, kein Wunder hier in demm Jewöhl …“
Ein strenger Blick reichte, um Edes Ausflüchte abzuwürgen. Rath packte alles wieder ein und schloss die Brieftasche.
„Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht: Ich lass mich nicht für dumm verkaufen. Dass du heute pünktlich zum Abendessen bei deiner Frau sitzen kannst, hast du nur meiner Gutmütigkeit zu verdanken, ist das klar?“
„Sonnenklar, Herr Kommessar.“ Ede verbeugte sich devot.
„Wir werden ein Auge auf dich haben, Herr Schürmann. Also pass auf, dass sich deine Hand so bald nicht wieder in fremde Taschen verirrt. Das nächste Mal kommst du nicht so glimpflich davon.“
Ede schwieg.
„Haben wir uns verstanden?“
„Natürlich, Herr Kommessar.“
„Und nun verschwinde.“
Eduard Schürmann verbeugte sich noch einmal und tat dann wie geheißen. Rath suchte Paul und fand ihn neben dem Dicken, der wild gestikulierte.
„Wilhelm Klefisch?“, fragte er, als er die beiden erreicht hatte, und der Dicke nickte.
„Sie haben etwas verloren, Herr Klefisch“, sagte Rath und wedelte mit der Brieftasche.
Der Dicke betastete seinen Mantel, guckte verdutzt und nahm die Brieftasche, die Rath ihm reichte, mit dankbarem Blick entgegen.
„Danke, der Herr. Wo haben Sie die denn gefunden?“
„Gleich da vorne, am Eingang bei Tietz. Die Leute sind einfach drüber weggetrampelt.“
Klefisch klappte das schwarze Leder auf und zählte die Scheine und Münzen. Einmal, zweimal. Und dann noch ein drittes Mal.
„Da fehlen fünfzig Mark“, sagte er schließlich und schaute vorwurfsvoll.
„Sind Sie sicher?“
Der Dicke nickte. „Todsicher. Ich möchte ja keine voreilige Verdächtigung aussprechen, aber …“
Der Dicke schaute hilfesuchend zu Paul, dessen Rolle er wohl immer noch nicht ganz einordnen konnte. Rath jedenfalls schien er für einen Dieb zu halten. Entweder für einen strunzdämlichen oder für einen mit einem besonders raffinierten Trick.
„Ich weiß nicht, was Sie denken, aber …“ Rath zückte seinen Polizeiausweis. „Wenn da wirklich Geld fehlen sollte: Glauben Sie mir, ich habe es nicht gestohlen.“
Klefisch begutachtete den Ausweis, immer noch misstrauisch. „Aber irgendeiner muss es ja genommen haben.“
Ja, dachte Rath, und ich weiß auch wer! Nur ist der über alle Berge!
„Wir können zum Präsidium gehen und den Verlust anzeigen“, sagte er, „aber als Polizeibeamter kann ich Ihnen da wenig Hoffnung machen. In dem Gewühl da vorne kann jeder das Geld an sich genommen und die Brieftasche wieder hingelegt haben. Seien Sie froh, dass Sie Ihre Papiere noch haben.“
„Gut, mein Herr. Lassen wir das Ganze auf sich beruhen. Aber ich muss darauf bestehen, mir Ihren Namen zu notieren!“
Das hat man nun von seiner Gutmütigkeit, dachte Rath und faltete Edes Visitenkarte, die er immer noch in der Hand hielt, kleiner und kleiner.












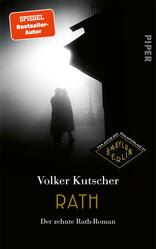











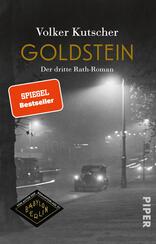


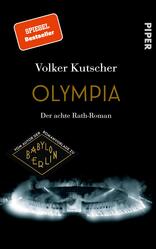

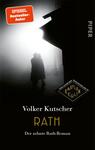

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.