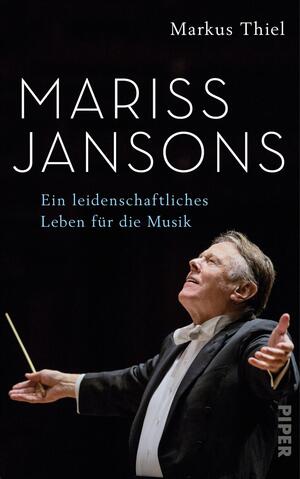
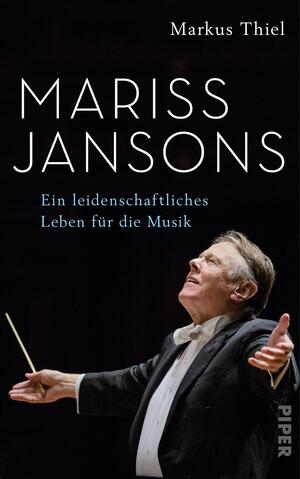
Mariss Jansons Mariss Jansons - eBook-Ausgabe
Ein leidenschaftliches Leben für die Musik
„Ein berührender Blick auf Mariss Jansons“ - Schwäbische Zeitung
Mariss Jansons — Inhalt
Er war ein Stardirigent. Dennoch kein abgehobener Maestro, sondern ein Kollege auf Augenhöhe. Ein Workaholic, kompromisslos in seiner Liebe zur Musik, mit enorm hohen Ansprüchen an sich selbst, immer mit größter Genauigkeit und Emotionalität bei der Sache. Mariss Jansons verzehrte sich buchstäblich für seine Arbeit. All das machte ihn zum von allen respektierten und geliebten Künstler. Markus Thiel hat bis zu Jansons Tod am 1.12.2019 viele Gespräche mit ihm geführt und legt mit dieser Biografie ein aktuelles und lebendiges Porträt des überragenden Dirigenten vor. Dabei bringt er uns Jansons nicht nur als Musiker, Kulturpolitiker und Interpret nahe, sondern vor allem auch als Mensch.
- Die einzige umfassende und autorisierte Biografie über den großen Dirigenten
- Markus Thiel hat den Stardirigenten jahrelang intensiv begleitet und auch mit vielen wichtigen Wegbegleitern gesprochen
- „Mariss Jansons war einer der großen Dirigenten unserer Zeit, ein wirklicher Star.“ – FAZ
- „Für mich war Jansons einer der inspirierendsten Musiker meiner Karriere.“ - Lang Lang
Leseprobe zu „Mariss Jansons“
Vorwort
Es hätte anders kommen sollen. Ein längeres Telefongespräch war noch verabredet. Wir wollten vor allem über Mussorgskys Oper Boris Godunow sprechen, die er im Sommer 2020 bei den Salzburger Festspielen zu dirigieren plante. Endlich, denn Oper war ihm kostbarer als vieles andere. Und vielleicht hätte Mariss Jansons auch ein paar Details oder Richtigstellungen zu diesem Buch angebracht, obgleich er sich nie als ständig eingreifende, über jedes Zitat wachende Instanz begriff. Doch wenige Tage vor dem Gespräch, in der Nacht zum 1. Dezember 2019, ist [...]
Vorwort
Es hätte anders kommen sollen. Ein längeres Telefongespräch war noch verabredet. Wir wollten vor allem über Mussorgskys Oper Boris Godunow sprechen, die er im Sommer 2020 bei den Salzburger Festspielen zu dirigieren plante. Endlich, denn Oper war ihm kostbarer als vieles andere. Und vielleicht hätte Mariss Jansons auch ein paar Details oder Richtigstellungen zu diesem Buch angebracht, obgleich er sich nie als ständig eingreifende, über jedes Zitat wachende Instanz begriff. Doch wenige Tage vor dem Gespräch, in der Nacht zum 1. Dezember 2019, ist er in seiner Heimatstadt St. Petersburg verstorben. Gerade weil er noch Pläne hatte, übrigens auch zu seinem allmählichen Rückzug vom Pult, kam der Tod so überraschend. Es war der Tag, an dem die Musikwelt in Schockstarre verfiel.
Dabei stand er dem Projekt anfangs so skeptisch gegenüber. Dmitri Schostakowitsch habe ein Buch verdient, sagte er ganz am Anfang unserer Gespräche. Auch Peter Tschaikowsky, Sergej Prokofjew, Richard Strauss – überhaupt all jene, deren Noten er regelmäßig auf die Pulte seiner Musiker legen ließ. Aber Dirigenten oder ganz generell Künstler jeglicher Art? Der Interpret, der Nachschaffende, der bloße Realisateur eines von einem genialen Geist geschaffenen Werks, ein solcher Mensch brauche keine Biografie: Was an Relevantem, so dachte und sprach Jansons, hätte ein solches Buch über ihn schon mitzuteilen?
Man könnte dies als Koketterie abtun, als geschmeicheltes Abwinken. Vielleicht auch als Skepsis, die aus der Angst geboren war, zu viel preiszugeben. Doch Mariss Jansons war es Ernst damit. Es hatte auch lange gedauert, bis er mit dieser Biografie und einer Zusammenarbeit einverstanden war. „Ich bin nicht davon überzeugt“, sagte er gern. Ein Satz, den alle kennen, die mit ihm zu tun hatten. Musiker ohnehin, Mitarbeiter der verschiedenen Orchestermanagements, Agenten, Intendanten, auch Regisseure. Es ist kein Nein, kein Ja, kein Vielleicht, kein „Ich weiß nicht“. Der Zweifel sprach aus diesem Satz. Jener stumme, lästige, peinigende, aber eben dennoch wichtige, lohnende, fruchtbare Begleiter, den Jansons seit Beginn seiner Karriere stets an seiner Seite wusste und den er nicht abschüttelte – weil er es nicht konnte und es auch nicht wollte.
Und weil ein solches Buch im Grunde gar nicht zu diesem Künstler passte. Mariss Jansons war, wie diese Biografie zeigen möchte, die große paradoxe Erscheinung unter den Dirigentenstars. Einerseits war da diese so geradlinige Laufbahn. Sie begann mit großen, prägenden Dirigentenfiguren, führte weiter zu einem eher nachrangigen Orchester, das dank Jansons erstrangig wurde, setzte sich fort in einer Art Übersee-Experiment, um schließlich mit den Chefpositionen bei zwei Weltklasse-Ensembles ihre Erfüllung zu finden. Am Ende hatte dieser Dirigent, von dem Simon Rattle (übrigens auch ohne Koketterie) einst sagte, er sei „der Beste von uns allen“, Legendenstatus erreicht.
Andererseits geschah dies alles, ohne dass Jansons auf der PR-Klaviatur der Äußerlichkeiten gespielt, ohne dass er die angeblichen Erfordernisse des Klassikmarktes bedient hatte. Jansons’ Karriere vollzog sich ohne jenes Begleitgetöse, das bei anderen auch Unzulängliches gnädig übertönt. Und wenn er gelegentlich solchen Maßnahmen zustimmte und sie einsetzte, dann war dafür eine oft für alle Beteiligten enervierende Umstimmungsprozedur erforderlich („Ich bin nicht überzeugt“).
Neben einer Schilderung seines Lebenswegs und der genauen Beleuchtung der biografischen Stationen sollen hier also auch übergreifende Aspekte thematisiert werden. Die Darstellung und Deutung orientiert sich dabei an Jansons’ Orchesterstationen. Manchmal kann es zu themenbedingten Überschneidungen, Parallelisierungen und zeitlichen Sprüngen kommen. Wenn diese Biografie nicht immer der Chronologie folgt, dann deshalb, weil sich dadurch Konstanten und Querverweise akzentuieren lassen.
Zu den hier leitenden Fragen zählt zum Beispiel jene nach dem Selbstverständnis des Dirigenten Jansons in seiner Rolle als Orchesterchef, aber auch als Interpret, der bei aller Klangarbeit und klar konzeptionierten Orchestererziehung offen blieb für die Haltungen der Kollegen und andere Richtungen der Aufführungspraxis.
Zur Sprache kommt darüber hinaus das Selbstverständnis eines Künstlers, der von Vorbereitung und Analyse geradezu besessen war – und dessen Arbeitshaltung auf die Orchester ausstrahlte: Obgleich Jansons in der Zeit der großen, unantastbaren, monarchisch gebietenden Maestri sozialisiert worden war, war er nie auf deren autoritäre Herrscherwerkzeuge angewiesen, um sich durchzusetzen. Was er mit seiner – auch gesundheitsgefährdenden – Arbeit vorlebte, war Argument genug. Darin zeigt sich ein weiteres Paradox seiner Laufbahn: Sie wurzelte in der Ära der Pultgebieter und erfüllte sich in einer Zeit, in der der Dirigent zum Primus inter Pares wurde, zum – gleichwohl herausgehobenen – Partner selbstbewusster Musiker. Ein Wandel, dem sich Jansons anpasste, der ihn auch veränderte.
Jansons verzehrte sich buchstäblich für seine Arbeit. Auch das machte ihn zum von allen respektierten, verehrten, geliebten Künstler. Es gibt Menschen, die ihm skeptisch gegenüberstanden, nicht zuletzt auch Musiker. Aber Jansons stieß nie auf offene, unausräumbare Ablehnung. Er war, wie dieses Buch zeigen will, ein Sonderfall im weltweiten Musikleben, weil er geradezu unangreifbar erschien – und zuweilen auch ungreifbar. Jansons hatte ausgeprägte Charakterzüge, aber keine Allüren. Und all dies kam nicht nur in seiner Rolle als Interpret zur Geltung, sondern auch als engagierter, unbeirrter, hartnäckiger Kulturpolitiker. Ob in Pittsburgh, wo er um den Erhalt des Orchesters kämpfte. Oder in München, wo er das neue Konzerthaus durchsetzen konnte – ein Vorhaben, von dem Mariss Jansons (im Gegensatz zu vielen Beteiligten und Mitstreitern) von Anfang an und rückhaltlos überzeugt gewesen war. Vielleicht wurde es auch deshalb zu seinem wichtigsten, zu seinem Lebensprojekt – auch wenn er nie ans Dirigentenpult des Konzertsaals treten durfte.
Eine zweite Geburt
Vier Takte sind es nur, kurz nachdem das berühmte Motiv erstmals in den Saal gemeißelt wird. Weil es nicht so recht klappt, wie er es sich vorstellt, singt der junge Mann im dunklen Rollkragenpullover mit den leicht zu Berge gekämmten Haaren die Passage einfach vor: „Ta, ta, ta, taaa – ti, ti, ti, tiii – ta, ta, ta, taaa.“ Im Piano wandert das Motiv durch die Violinen, wird später von der Viola übernommen, bevor es zum Tutti-Ausbruch kommt. Als ob die Musiker das nicht kennen würden. Unter vielen Dirigenten haben sie die Takte gespielt, mutmaßlich auch unter ihrem aktuellen Chef Lorin Maazel. Sie haben sie in unzähligen Aufnahmen gehört und womöglich auch während der Ausbildung exerziert. Und jetzt steht da dieser 28-Jährige mit dem ernsten Gesicht, der es bei diesem Schlager tatsächlich auf Grundsätzliches abgesehen hat.
„Das ist das Wichtigste“, sagt er mit Nachdruck. „Wenn diese drei Takte zusammen sind, dann ist alles in Ordnung. Bitte alles ganz gleich, nicht schneller. Hören Sie aufeinander.“ Mariss Jansons erklärt dem Radio-Symphonieorchester Berlin, dem heutigen Deutschen Symphonieorchester Berlin, den Anfang von Beethovens fünfter Symphonie. Mehr noch: Er fordert Präzision, von teils altgedienten Musikern. „Bitte sehr, noch einmal.“ Ein Blick übers Orchester hinweg, schräg nach oben, dann mit entschlossener Miene nochmals ein kurzer, fast ansatzloser Auftakt. „Ta, ta, ta, taaa.“
Nachhilfe für ein etabliertes Ensemble, auch wenn es vielleicht nicht ganz mithalten kann mit den Philharmonikern derselben Stadt? Jansons darf das, es wird sogar von ihm erwartet. Im September 1971 nimmt er am Herbert-von-Karajan-Dirigentenwettbewerb teil. Schon länger ruht das Auge des Klassikgottes auf ihm, jetzt soll Jansons in Berlin die beträchtlichen Erwartungen erfüllen. Fünf Runden sind angesetzt, teilweise mit extrem schwierigem Repertoire. Für die ersten Durchgänge wurden die späteren Berliner Symphoniker engagiert. In der Jury sitzen Prominente wie der Brite Walter Legge, mächtiger Produzent des Labels EMI und Gründer des Philharmonia Orchestra London, oder der Österreicher Hans Swarowsky, einer der wichtigsten Dirigierlehrer seiner Zeit. Swarowsky notiert im Prüfungsprotokoll über Jansons und seine Interpretationen von Mozart, Beethoven und Strawinsky: „Jupiter gut, fließend unterteilt, teilweise in Triolen. Eroica sehr gut. Sacre sehr gut. Bartók besonders gut.“ Sein Gesamturteil: „ursprünglicher Musiker“.
Für eine der ersten Runden hat Jansons einen Ausschnitt aus Ravels Daphnis und Chloé vorgeschlagen, womit er aber auf Bedenken stößt: Ein solch heikles Stück sei dafür weniger geeignet, man empfehle daher Beethovens Fünfte. Als eine Art Kompromiss darf Jansons den Ravel im Schlusskonzert des Wettbewerbs dirigieren. Filmaufnahmen vom Herbst 1971 zeigen Jansons nicht nur beim Proben, sondern auch im Konzert. Den kniffligen Übergang vom dritten zum vierten Satz im Beethoven-Opus bewältigt er mit großer Klarheit und höchster Konzentration. Immer wieder kontrollierende Blicke ins Orchester, kein bloßes Taktieren, eine fühlbare Wachheit auf beiden Seiten, ein ständiges Regulieren.
Im Schlusskonzert dann Daphnis und Chloé. „Ich war sehr nervös“, erinnerte sich Mariss Jansons später. „Karajan saß im Saal, und ich war mit dem musikalischen Ergebnis meines Dirigats nicht zufrieden. Das, was ich aus dem Werk herausholen wollte, konnte ich nicht zeigen.“
Es hat nicht ganz gereicht. Den ersten Platz erringt der polnisch-israelische Dirigent Gabriel Chmura, den zweiten Preis teilen sich Mariss Jansons und der Pole Antoni Wit, Rang drei belegt der Bulgare Emil Tschakarow. Doch das eigentliche, von vielen Wettbewerbsbesuchern und von den Medien wahrgenommene Ereignis ist Jansons. Er gibt zahlreiche Interviews und erhält wohlwollende Kritiken. Er habe den reifsten Eindruck gemacht, heißt es vielfach. „Der Russe Mariss Jansons konnte auch im Konzert mit Beethovens fünfter Symphonie und Daphnis und Chloé brillant bestehen“, hebt ein Fernsehbeitrag hervor. „Ein junger Kenner der Partituren und des Dirigierhandwerks.“
Das Berliner Publikum reagiert auf seine Weise, ein Zuhörer spricht in die Kamera: „Der Russe war kolossal.“ Bei der Preisverleihung schreitet Herbert von Karajan nochmals aufs Podium, drückt die Schultern seines Eleven mit gönnerhafter Miene. Man ahnt, wer sein eigentlicher Favorit war. Auch für den Hoffnungsträger bedeutet die Geste mehr als eine Silbermedaille, sie kommt einer zweiten Geburt gleich: »Ich war nicht mehr der Sohn von Arvīds Jansons«, sagte er später. „Ich war nun Mariss Jansons.“
Die erste Geburt ereignet sich 28 Jahre zuvor im lettischen Winter des Jahres 1943. Allerdings nicht wohlbehütet und mit entsprechender medizinischer Versorgung, sondern unter Todesgefahr. Iraīda Jansone, Angehörige einer jüdischen Familie, hält sich in Riga versteckt, die Stadt ist von den Deutschen besetzt. Ihr Bruder und ihr Vater wurden bereits von der SS ermordet. Auch sie fürchtet, verhaftet und deportiert zu werden.
Am 14. Januar 1943 bringt sie ihren Mariss zur Welt – in einem Land, das kaum mehr existiert. Seit 1941 steht Lettland unter deutscher Besatzung. Doch war das Land bereits vor dem Einmarsch der Wehrmacht vollkommen traumatisiert von einem Jahr sowjetischer Besatzung. Zigtausende Letten wurden nach Sibirien gebracht, es herrschte ein Terrorregime. Die Deutschen werden von vielen als Befreier begrüßt. Manche sehen sie als das kleinere Übel, andere als Verheißung. Die Invasoren aus dem Westen können auch auf Kollaborateure vertrauen.
Ob importiert oder im Land schon längst unterschwellig präsent: Ein verheerender Antisemitismus bricht sich Bahn, der für die jüdische Bevölkerung einem Todesurteil gleichkommt. Bis zum Spätherbst 1941 ist die jüdische Gemeinde nahezu ausgelöscht, bei den Massakern im Wald von Rumbula etwa werden fast 30 000 Juden ermordet. Kurz zuvor entsteht in Riga, der sogenannten „Moskauer Vorstadt“, ein Getto, in dem Tausende Juden zusammengepfercht werden. Da auch Deportierte aus dem Westen hier hausen müssen, verschlimmern sich die Wohnverhältnisse drastisch.
Das Zusammenleben wird unerträglich. Viele werden daraufhin aus der Stadt in die lettischen Wälder transportiert und getötet. Im Juni 1943, wenige Monate nach Mariss Jansons’ Geburt, verfügt der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, dass auch in Lettland Konzentrationslager entstehen sollen. Das Getto von Riga wird schrittweise aufgelöst. Nur ein kleiner Teil der lettischen Juden kann dem Grauen entkommen, versteckt, geduldet, unterstützt von wohlwollenden Landsleuten. Iraīda Jansone und ihr einziges Kind Mariss gehören dazu.
Die damals Verfolgte ist mit dem Dirigenten Arvīds Jansons verheiratet. Eine Musikerbeziehung: er der geachtete Mann am Dirigentenpult und frühere Geiger im Opernorchester und sie die Mezzosopranistin. Als der Krieg endlich vorüber, jedoch noch längst nicht psychisch bewältigt ist, sind beide am Opernhaus ihrer Heimatstadt Riga engagiert. Einen Babysitter kann und will sich das Paar nicht leisten, allerhöchstens eine Putzfrau, um die Wohnung in Ordnung zu halten. Und so wird der kleine Mariss fast täglich in den Musentempel mitgenommen – was ihm nicht allzu viel auszumachen scheint. Er erforscht die geheimnisvollen dunklen Gänge hinter der Bühne und Garderoben und ist ständig von singenden, tanzenden, spielenden Menschen umgeben.
Das Grauen der deutschen Besatzung mag überwunden sein, doch nun führt die Familie ein Leben unter dem Sowjetsystem – und wird bedroht. Mariss erfährt dies bereits im Alter von vier Jahren. Ein KGB-Offizier taucht plötzlich auf, um seine Tante mitzunehmen. „Warum?“, fragt der Junge. Da antwortet der Uniformierte: „Wir gehen ein bisschen spazieren, dann kommt sie zurück.“ Die Tante wird nach Sibirien deportiert.
Umso mehr bietet die Oper einen Schutzraum, auch eine Flucht aus der Realität. Mariss nimmt die dort aufgeführten Werke in sich auf, anfangs unbewusst, später mit immer größerer Faszination. Wird für Tschaikowskys Schwanensee oder Don Quichotte auf eine Musik von Ludwig Minkus geprobt, tanzt Mariss das Beobachtete später der Putzfrau in der elterlichen Küche vor. Nicht immer zur Begeisterung des Einfraupublikums, Pfannen und Töpfe fallen zu Boden, Teller gehen zu Bruch. Sehr bald schon darf Mariss auch die Aufführungen verfolgen, wobei ihm die Trennung von Fiktion und Realität nicht immer leichtfällt. An einem Abend sitzt der Fünfjährige wieder einmal in der Loge rechts über dem Orchestergraben. Wie so oft steht seine Mutter auf der Bühne, diesmal als Carmen. Wie im Stück vorgesehen, stürzt sich im letzten Akt der Tenor auf sie, es ist Don José in seinem finalen Eifersuchtsanfall mit tödlichen Folgen. „Bitte nicht meine Mutter berühren!“, gellt es plötzlich aus der Loge. Arvīds Jansons bringt seinen Sohn weg.
Zwischen Mutter und Sohn entwickelt sich – auch weil der Vater durch den Beruf stark gefordert ist – eine besonders innige Beziehung. Die Unterdrückung und Auslöschung der jüdischen Bevölkerung ist kaum ein Thema in der Familie. Noch immer, auch später, grassiert in der Sowjetunion ein schleichender Antisemitismus, manchmal tritt er offen zutage. Empathie, humanitäre Prinzipien, auch religiöse Grundsätze, all das lehrt Iraīda Jansone den kleinen Mariss und lebt es ihm vor. Auch strenge Manieren, wie sie im Lettland der damaligen Zeit und in dieser Gesellschaftsschicht üblich waren.
In der Schule setzt sich diese Erziehung für das Kind fort. „Wir hatten dort sehr eiserne Regeln, was den mitmenschlichen Umgang betraf“, erinnerte sich Jansons. „Wenn der Lehrer einen etwas fragte, musste man aufstehen. Außerdem mussten wir Jungen uns immer verbeugen und die Mädchen knicksen. Und für eine Note, egal wie schlecht, mussten wir uns bedanken.“ Zeitlebens stand Jansons unter dem Einfluss dieser Prägung. Mit einer antiautoritären Erziehung („Das macht uns doch eher zu Wilden“) konnte er wenig anfangen: „Ich mag altmodisch sein, aber es geht doch um das Miteinander. Um gesellschaftliche Beziehungen und darum, wie man sich in die Gemeinschaft einbringen kann und sollte.“ Eine autoritäre Stimmung herrscht im Hause Jansons dennoch nicht. Nie bekommt der Sohn von der Mutter ein simples „Du musst!“ zu hören. „Sie hat mir alles erklärt, sodass ich alles verstehen konnte. Und sie hat mir alles mit Liebe vermittelt.“
Vom Vater ist das Kind zutiefst fasziniert, ebenso wie von dessen Beruf, mit dem man ein großes Ensemble steuern kann. Im Opernhaus beobachtet Mariss zwar mit Freude das Bühnengeschehen. Doch wandert sein Blick in diesen Jahren immer häufiger zum Pult. Auch dies macht sich zu Hause bemerkbar. Mariss zieht sich dort gern ein Hemd und eine saubere Hose an, stellt sich vor den Tisch, legt ein Buch darauf und verteilt Holzstücke vor sich – seine „Musiker“ und seine „Partitur“. Schon mit drei Jahren beginnt dieses Nachahmen und Nachspielen. Es gibt Fotos, die diese Szenen zeigen: Mariss mit zerzauster Frisur und Taktstock in der rechten Hand. Später, als er schreiben kann und mehr über Komponisten, ihre Werke und ihre Geschichte weiß, verfasst er sogar Programmhefte für imaginäre Abonnenten. „In meiner Fantasie hat sich schon damals festgesetzt, dass ich Dirigent bin“, sagte er viel später. „Ich war in dieser Welt und habe mit diesen Ideen gelebt.“
Die Eltern reagieren anfangs amüsiert, begreifen aber bald, dass diese Begeisterung nicht bloß eine vorübergehende Phase ist: Ihr Sohn meint es ernst. Nie haben sie ihr Kind zu diesem frühen Zeitpunkt zur Musik gezwungen. Mariss wächst natürlich und wie selbstverständlich in diese Welt hinein. Diese Entwicklung kann gerade deshalb nicht mehr rückgängig gemacht werden, weil sie durch Wahrnehmung, eigenes Wollen und Spielerisches angestoßen wird. „Es war“, so sagte Jansons im Rückblick, „als ob es da einen Sonnenstrahl gab, der mir zeigte: Schau, geh diesen Weg.“
Mit sechs Jahren bekommt Mariss vom Vater eine Geige. Arvīds Jansons ist der Meinung, dies sei das richtige Instrument für den Sohn, und unterrichtet ihn selbst. Der Kleine macht schnell Fortschritte, aus dem ersten Kratzen werden bald akzeptable, ansprechende Klänge. Doch das ständige Üben, das Arbeiten am Ton ermüdet sogar den Hochbegabten. Mariss verliert die Lust, auch weil er noch eine andere Leidenschaft hegt. Dieser geht er nicht im Musikzimmer der elterlichen Wohnung, sondern im Hinterhof nach.
Fast täglich treffen sich Mariss und seine Freunde zum Fußball. Ein paarmal gehen Fensterscheiben zu Bruch, einige Anwohner sind empört. Die jungen Spieler lassen sich davon nur vorübergehend stören. Ab und zu ist ein Mädchen dabei, das in einem der angrenzenden Häuser wohnt. Ihr Vater ist der bekannte Trainer der Mannschaft „Daugava“, die Jungs erkundigen sich, ob sie bei ihm vorfühlen könne. Ein paar Tricks, einige Kniffe, das könnten sie gut gebrauchen. Der Trainer lässt sich überzeugen und staunt über das Talent des achtjährigen Mariss.
Der hat inzwischen die Geige so gut wie aufgegeben. Fußballspieler, so denkt er sich, das wäre doch als Karriereziel auch nicht übel. Eines Tages spricht der Trainer beim Ehepaar Jansons vor. Ihr Sohn, schwärmt er, könne ein sehr guter Spieler werden. Ob man ihn nicht auf eine Sportschule schicken wolle? Die Eltern sind entsetzt, eine Äußerung des Vaters besiegelt alles: „Vergiss es.“ Und zum Trainer gewandt: „Er wird Musiker.“
Ein Schock für Mariss Jansons. Doch kann er nicht sehr lange angehalten haben. Im Nachhinein nahm er den Eltern die Entscheidung nicht krumm. „Niemand hat mich je zur Musik gezwungen.“ Die „besondere Atmosphäre“, die ständig präsenten großen Komponisten und ihre Werke setzen ihn nicht unter Druck, all dies wird zur Selbstverständlichkeit. Und so reift bald die Einsicht: Sollte auch er sich später in der Welt der Musik bewegen wollen, dann nur auf Basis einer profunden Ausbildung.
Erste entsprechende Kenntnisse hat sich Mariss Jansons ohnehin schon angeeignet. Eines der ersten Werke, das er regelmäßig hört, beginnt mit jenem „Ta, ta, ta, taaa“, das er später dem Radio-Symphonieorchester Berlin vorsingen wird. Beethovens fünfte Symphonie fasziniert ihn bereits als Kind. Immer wieder müssen die Eltern für ihren Sohn die Platte auflegen. Bis Mariss Jansons eines Tages, das improvisierte Dirigieren am Küchentisch ist längst vorbei, selbst in die Partitur von Beethovens Opus 67 blickt. Er lernt, mitzulesen, Instrumente zu erkennen, Entwicklungen zu verfolgen. Dem faszinierten Jungen wird immer klarer, was hinter den Klängen aus dem Lautsprecher steckt. Mehr noch: Diese Symphonie wird nicht nur zum heiß geliebten Werk, sondern auch zur Medizin: „Immer wenn ich krank war und zu Hause bleiben musste, bat ich meine Mutter, sie solle mir die Partitur der Fünften bringen. Dann legte sie die Platte auf – und ich war in meiner Welt.“
„Wer Mariss Jansons begegnen will, ist mit diesem sensibel geschriebenen und faktenreichen Buch bestens bedient.“
„Beim Lesen fällt auf: Eigentlich ist es unmöglich über Musik zu schreiben, aber (Markus Thiel) schafft das mit großer Eleganz, mit großer Delikatesse.“
„Ein berührender Blick auf Mariss Jansons“
„(Markus Thiel) legt mit dieser Biografie ein aktuelles und lebendiges Porträt des überragenden Dirigenten vor. Dabei bringt er uns Jansons nicht nur als Musiker, Kulturpolitiker und Interpret nahe, sondern vor allem auch als Mensch.“
„Für Klassikfans besonders bereichernd ist zudem Thiels Kompetenz als Musikkritiker. Immer wieder schafft er es, in Worte zu fassen, was Jansons’ Interpretationen auszeichnet und so oft über andere hebt.“
„Insgesamt ist Markus Thiel mit ›Mariss Jansons – Ein leidenschaftliches Leben für die Musik‹ eine Biografie gelungen, die die Dirigentenpersönlichkeit aus vielen farbigen Mosaiksteinchen zusammensetzt. Durch den direkten und unkomplizierten Sprachstil ist ein würdiges Andenken entstanden.“
„Sehr informativ und überzeugend“

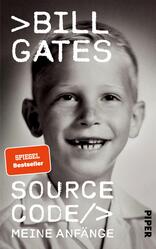
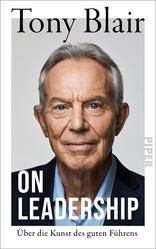

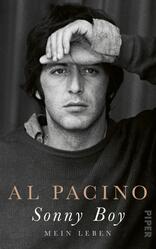



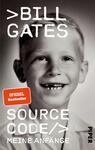


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.