
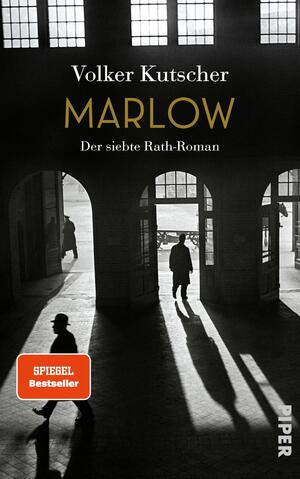
Marlow (Die Gereon-Rath-Romane 7) Marlow (Die Gereon-Rath-Romane 7) - eBook-Ausgabe
Der siebte Rath-Roman
— Historischer Krimi für „Babylon Berlin“-FansMarlow (Die Gereon-Rath-Romane 7) — Inhalt
„Volker Kutschers Romane sind großes Kino“ taz
Berlin, Spätsommer 1935. In der Familie Rath geht jeder seiner Wege. Pflegesohn Fritz marschiert mit der HJ zum Nürnberger Reichsparteitag, Charly schlägt sich als Anwaltsgehilfin und Privatdetektivin durch, während sich Gereon Rath, mittlerweile zum Oberkommissar befördert, mit den Todesfällen befassen muss, die sonst niemand haben will. Ein tödlicher Verkehrsunfall weckt seinen Jagdinstinkt, obwohl seine Vorgesetzten ihm den Fall entziehen und ihn in eine andere Abteilung versetzen.
Es geht um Hermann Göring, der erpresst werden soll, um geheime Akten, Morphium und schmutzige Politik, um Charlys Lebenstrauma, den Tod ihres Vaters. Und um den Mann, mit dem Rath nie wieder etwas zu tun haben wollte: den Unterweltkönig Johann Marlow.
Leseprobe zu „Marlow (Die Gereon-Rath-Romane 7)“
Eine andere Geschichte
Marlow, Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
Sonntag, 28. Juli 1918
Das Gut liegt nicht allzu weit außerhalb der Stadt. Außerhalb von Marlow, einem kleinen, verschlafenen Nest im Mecklenburgischen, das sich nur deshalb Stadt nennen darf, weil es vor Hunderten von Jahren, aus Gründen, an die sich niemand mehr erinnert, irgendwann einmal die Stadtrechte erhalten hat. Das Meer ist nicht weit, doch die meisten Marlower haben es nie gesehen, die wenigsten sind überhaupt je aus ihrem Städtchen hinausgekommen. Bis der Krieg die jungen Männer [...]
Eine andere Geschichte
Marlow, Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
Sonntag, 28. Juli 1918
Das Gut liegt nicht allzu weit außerhalb der Stadt. Außerhalb von Marlow, einem kleinen, verschlafenen Nest im Mecklenburgischen, das sich nur deshalb Stadt nennen darf, weil es vor Hunderten von Jahren, aus Gründen, an die sich niemand mehr erinnert, irgendwann einmal die Stadtrechte erhalten hat. Das Meer ist nicht weit, doch die meisten Marlower haben es nie gesehen, die wenigsten sind überhaupt je aus ihrem Städtchen hinausgekommen. Bis der Krieg die jungen Männer in alle Himmelsrichtungen getrieben hat. Doch auch von den Soldaten, die Marlow dem Weltkrieg geopfert hat, haben nur die wenigsten das Meer sehen dürfen, der Großteil ist in Eisenbahnwaggons zur Front gekarrt worden, direkt in den Schlamm der Schützengräben, in dem die allermeisten dann auch verreckt sind.
So gesehen hast du Glück gehabt: Obwohl in Marlow geboren, bist du herausgekommen, hast einen großen Teil deiner Jugend am anderen Ende der Welt verbracht, die Zeit danach in der Schweiz, im Internat, und an der Universität. Dann kam der Krieg, auch für dich, doch du hast ihn überlebt, bislang, obwohl an der Ostfront, wohin es dich verschlagen hat, genauso gestorben wird wie an der Westfront.
Und nun hat ausgerechnet der Krieg dich wieder zurückgebracht; deine Sanitätskompanie ist von der Front ins Reservelazarett Pasewalk verlegt worden. Nicht Mecklenburg, sondern Pommern, aber nah genug, dass die Gerüchte dich erreichen konnten. Von der chinesischen Hure in Marlow und ihrem Bastard. Und dass Gott sie in seiner Gerechtigkeit gestraft habe mit einer schlimmen Krankheit.
Schon als du die Geschichte das erste Mal hörtest, hat sie dich elektrisiert, und als du dann nachgefragt hast, jedoch nichts Genaueres in Erfahrung bringen konntest, wusstest du, dass du hinfahren musst. Nach Marlow. Nach Altendorf.
Es ist bereits dunkel, als du das Gut erreichst. Du parkst vor dem Haupthaus und steigst aus dem Automobil. Während du wartest, dass jemand auf dein Klopfen reagiert, lässt du deinen Blick über den Hof wandern, der dir in den ersten Jahren deines Lebens so etwas wie Heimat gewesen ist und den du eigentlich niemals wiedersehen wolltest. So wenig wie du das Land hinter der Küste wiedersehen wolltest. Das Schicksal hält sich nicht immer an solche Pläne. Und der Krieg noch weniger.
Du hörst Schritte, und dann steht der alte Engelke in der Tür, eine Laterne in der Hand, und blinzelt den späten Besucher an. Engelke, der einzige, der Gut Altendorf immer treu geblieben ist, auch in den Jahren, als der Gutsherr in Tsingtau weilte, im Schutzgebiet Kiautschou.
Die Miene des Alten ist unergründlich, nur ein leichtes Zucken der Augenbrauen verrät dir, dass er dich erkannt haben muss, doch ob diese Regung Erschrecken ausdrückt, ob sie Überraschung zeigt oder etwas völlig anderes, vermagst du nicht zu sagen.
Für einen Moment glaubst du, Engelke werde die Tür sofort wieder zuschlagen. Dann aber macht der Alte den Mund auf.
„Der junge Herr! Welche Überraschung! Ich wusste gar nicht, dass Sie …“
„Ist sie hier?“
„Wie meinen?“
„Sie ist hier, nicht wahr? Er hat sie aus Tsingtau mitgebracht! Ich weiß es.“
„Sie sollten mit Ihrem Herrn Vater reden, junger Herr, ich werde …“
Du drängst dich an dem Alten, der vergeblich versucht, dich aufzuhalten, vorbei in die Halle.
„Sag mir, wo sie ist, Engelke! Bring mich zu ihr!“
„Nicht hier, Herr, nicht hier.“
Engelke zerrt dich am Ärmel wieder aus der Halle, ihr verlasst das Haus. Vor der Tür deutet der Diener mit seiner Laterne quer über den Hof, als wäre es ihm peinlich.
Nicht zu glauben. Vater hat sie mit nach Deutschland genommen, doch er lässt sie nicht im Herrenhaus wohnen. Nicht einmal jetzt, wo sie krank ist. Du nimmst dem Alten die Laterne ab und stiefelst zu den Gesindehäusern hinüber, die sich im Mondschatten des Herrenhauses ducken wie schüchterne Kinder. Bevor du das erste Haus erreichst, zerschneidet ein unmenschlich hoher Schrei die Nacht. Du erstarrst für einen Moment, dann läufst du umso schneller, läufst über den Hof, hinüber zu dem kleinen Häuschen, aus dem der Schrei gekommen ist, und stürzt hinein ohne anzuklopfen.
Sie liegt in der Schlafkammer, im Schein einer Petroleumlampe. Ihr Sohn, von dem du schon gehört, den du aber nie gesehen hast, sitzt neben dem Bett und hält ihre Hand, schaut auf, als du den Raum betrittst. Ihr Gesicht glänzt vor Schweiß und ist vom Schmerz gezeichnet. Kaum zu glauben, dass sie gerade einmal Mitte dreißig ist, so zerfurcht wirken ihre Züge, so tief haben sich die Falten in ihre Haut gegraben. Und doch schimmert ihre Schönheit durch all dieses Leid hindurch.
„Du bist es“, sagt sie, und es hört sich an, als traue sie ihren Sinnen nicht.
Ihr Deutsch ist makellos, ohne jeden Akzent, das hat dich früher schon erstaunt. Gleichwohl hat sie es nie geschafft, dir auch nur ein einigermaßen passables Mandarin beizubringen, obwohl genau das ihre Aufgabe war.
Du hast geglaubt, sie nie wiederzusehen, aber vergessen hast du sie nie.
„Chen-Lu“, sagst du und nimmst ihre Hand. „Was ist mit dir? Du bist krank.“
„Entschuldige. Aber manchmal tut es so weh!“
Und ihr schmerzzerfurchtes, schweißglänzendes Gesicht bringt tatsächlich ein Lächeln zustande. Sie schaut den Jungen an. „Geh schlafen, Kuen-Yao“, sagt sie. „Der Mann hier ist ein guter Freund.“
Der Junge schaut dich an, mit einer Mischung aus Misstrauen und Zuneigung. Über seine unergründlich dunklen Augen huscht ein kleiner Schimmer der Hoffnung. Dann steht er auf und verlässt den Raum.
„Dein Sohn?“
Sie nickt.
„Ein hübscher Junge.“
„Nicht wahr?“ Sie lächelt. „Ach, Magnus! Ich mache mir Sorgen um ihn. Wer soll sich um ihn kümmern, wenn ich nicht mehr da bin? Er ist erst elf.“
„Red doch nicht so.“
„Doktor Erichsen sagt, man kann es nicht heilen. Es ist in der Leber. Es wuchert überall.“
Du lässt dir dein Erschrecken nicht anmerken. „Warum ist der Doktor nicht hier?“, fragst du. „Welche Medizin gibt er dir?“
Ihr Blick weist zum Nachttisch. Dort liegt ein Röhrchen Aspirin neben einem Wasserglas.
„Das ist ein Witz! Du brauchst stärkere Schmerzmittel.“
„Ach, es hilft doch eh nichts mehr.“ Wieder lächelt sie. „Wie schön, dass du hier bist. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen.“
Du nimmst ihre Hand. „Ich bin Arzt“, sagst du. „Das heißt: Noch nicht ganz. Sanitätsfeldwebel, das Studium muss ruhen, wenn das Vaterland ruft. Aber ich weiß, was dir hilft. Ich … Warte!“
Du gehst hinaus zum Auto. In deiner Arzttasche, die du immer mit dir führst, muss noch eine Ampulle sein. Das wichtigste Medikament, das ihr im Krieg habt. Als du in die Stube zurückkehrst, merkst du, dass sie wieder Schmerzen leidet und den Schrei nur mit Mühe unterdrücken kann. Du beeilst dich, die Spritze aufzuziehen. Ihre Haut ist so dünn und durchscheinend, dass du nicht einmal nach der Vene tasten musst. Du kannst förmlich zusehen, wie das Morphin sich in ihrem Körper ausbreitet und den Schmerz vertreibt. Die verkrampften Muskeln lösen sich, die Anspannung weicht aus ihrem Gesicht.
„Es wird alles gut“, sagst du, obwohl du weißt, dass es nicht stimmt.
Sie nickt. Obwohl sie weiß, dass du lügst.
Ihre Gesichtszüge werden immer entspannter, ihr Lächeln so gelöst, dass man meinen könnte, sie sei auf dem Weg der Genesung. Aber das ist sie nicht. Sie spürt lediglich keine Schmerzen mehr.
Mehr kannst du nicht für sie tun. Kann niemand für sie tun. Und Doktor Erichsen, dieser Quacksalber, hat ihr selbst das verweigert. Vielleicht auch nur, weil es ihm niemand bezahlen will. Aspirin! Wie lächerlich! Dieser Dreckskerl hätte Chen-Lu einfach elendig und qualvoll verrecken lassen.
Du streichelst ihr die Stirn und bleibst am Bett sitzen, bis sie in den Schlaf fällt. Bevor du das Haus verlässt, schaust du noch nach dem Jungen. Auch der schläft tief und fest. Wieviel Schlaf die Krankheit den beiden wohl schon geraubt hat?
Du bringst die Arzttasche zurück ins Auto und gehst zum Herrenhaus. Diesmal klopfst du nicht, du öffnest die schwere Tür und gehst hinein, die Laterne leuchtet dir den Weg. Du findest deinen Vater im Salon, die Füße hochgelegt, derweil Engelke ihm gerade Wein nachschenkt.
„Magnus“, sagt er und richtet sich auf, „kommst du doch noch zu mir! Und ich dachte schon, die kleine Hure ist dir wichtiger als der eigene Vater.“
Du fragst dich, ob der Alte immer schon so zynisch und verbittert war oder ob ihn erst der Tod seiner Frau, nur wenige Monate nach eurem Eintreffen in China, zu dem misanthropischen Ekel gemacht hat, das jetzt vor dir sitzt. Das letzte Mal gesehen hast du ihn vor zehn Jahren ungefähr. Im Schutzgebiet, im Hafen von Tsingtau. Friedrich Larsen winkte nicht einmal, als sein Ältester an Bord des Dampfers ging, der ihn zurück nach Europa und ins Internat bringen sollte, weit weg von jeglicher Versuchung, weit weg von der jungen Frau, in die sich der Sechzehnjährige bis über beide Ohren verliebt hatte.
Vielleicht ist Vater tatsächlich beleidigt, dass sein Ältester ihn seither niemals besucht hat. Nicht einmal, als der kaiserliche Forstinspektor Friedrich Larsen wenige Monate nach Kriegsausbruch von japanischen Truppen aus dem Schutzgebiet vertrieben wurde und nach Mecklenburg zurückkehren musste. Das alles hast du erst viele Monate später aus einem knapp gehaltenen Feldpostbrief erfahren. Auch, dass deine Brüder inzwischen eingezogen waren. Nach wenigen Monaten gefallen sind. Aber dass sie Chen-Lu mit nach Deutschland genommen haben, das hat dir der Alte verschwiegen.
Und jetzt sitzt er da und trinkt, gibt unflätige Bemerkungen von sich, trinkt und lacht, während nebenan ein Mensch dem Tod entgegensieht.
„Warum bringt ihr sie nicht ins Herrenhaus? Warum ist Doktor Erichsen nicht hier? Sie hat Schmerzen!“
„Ins Herrenhaus? Mein Gott, Magnus, sie ist keine Larsen, sie ist eine Bedienstete. Natürlich bleibt sie im Gesindehaus. Ihr Geschrei ist auch so schon laut genug.“
„Sie liegt im Sterben, verdammt!“
„So ist das eben. Wenn der Herr beschlossen hat, eines seiner Schäfchen zu sich zu holen, was kann der Mensch da …“
„Halt deinen Mund, ich kann dein bigottes Gerede nicht ertragen! Redest du so auch über deine Söhne, die im Krieg geblieben sind?“
Friedrich Larsen erhebt sich aus seinem Sessel und greift zu einem Krückstock. Das Gehen fällt ihm schwer.
„Bigott?“, sagt er, als er vor seinem Ältesten steht. „Wer hat sich denn all die Jahre um sie gekümmert? Hat den Scherbenhaufen zusammengekittet, den der liebe Herr Sohn hinterlassen hat?“
„Du hast mich weggeschickt! Ans andere Ende der Welt!“
Der Alte tritt ganz nah an dich heran, so nah, dass du den Alkohol riechen kannst.
„Wenn dir immer noch so viel an der kleinen Hure liegt“, zischt Friedrich Larsen, „dann kümmere dich doch selbst um sie. Und ihren kleinen Bastard. Aber dieses Haus betrittst du nie wieder! Verstanden?“ Und damit weist er zur Tür. „Geh! Verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen.“
Du drehst um und würdigst deinen Vater keines weiteren Blickes.
Du weißt, du wirst dein Elternhaus nie wieder betreten. Du weißt, du wirst wiederkommen.
Erster Teil
Samstag, 24. August, bis Samstag, 31. August 1935
1
Als Gerhard Brunner aus dem Bahnhof trat und in den wolkenbetupften Spätsommerhimmel blickte, fühlte er sich, als sei er gerade erst in der Stadt angekommen. Und ein bisschen so war es ja auch: Der Mann, der da auf dem Askanischen Platz stand, wie aus dem Ei gepellt in seinem sommerhellen Dreiteiler, sah völlig anders aus als der, der den Bahnhof gut zehn Minuten zuvor betreten hatte. Brunner genoss dieses Gefühl. Ein anderer zu sein. Vielleicht hatten sie ihn auch deshalb für diese Aufgabe ausgewählt. Weil er es liebte, in die Haut eines anderen zu schlüpfen, weil er es so glaubhaft erscheinen ließ, ein anderer zu sein. Dass er einen Schlag bei Frauen hatte, spielte natürlich auch eine Rolle. Aber das Entscheidende war die absolute Vertrauenswürdigkeit, die er ausstrahlte.
Auch Irene vertraute ihm, und das war das Wichtigste, wichtiger noch als ihre Liebe, die allein nichts ausgerichtet hätte. Liebe machte blind, aber sie löste niemandem die Zunge, das vermochte allein das Vertrauen. Brunner hatte viel Zeit und Geduld investiert, um Irenes Vertrauen zu gewinnen, und jetzt zahlte sich das endlich aus. Führte aber auch zu ungeahnten Schwierigkeiten. Bei ihrem letzten Treffen hatte sie tatsächlich das Thema Heirat angesprochen, vorsichtig zwar, aber unmissverständlich. So war das wohl in der heutigen Zeit, in der Frauen sich nicht schämten, auch selbst die Initiative zu ergreifen. Er war nicht darauf eingegangen, aber er hatte die Sache am nächsten Tag gleich mit seinem Vorgesetzten besprochen, und der hatte sich bereiterklärt, die nötige Summe für einen Verlobungsring bereitzustellen. Eine Investition, die sich auszahlen dürfte. Die Frage war nur, wie lange Brunner die Hochzeit würde hinauszögern können. Denn dazu war er, bei aller Liebe, nun doch nicht bereit.
Er kramte ein paar Münzen aus seinem Portemonnaie. Von einer der Blumenfrauen, die im Schatten der Vorhalle ihre Ware feilboten, erstand er einen hübschen Strauß roter Rosen, dann machte er sich, die Blumen in der Hand, die Aktentasche unterm Arm, auf den Weg zum Taxistand.
Der Lindwurm der wartenden Kraftdroschken glänzte in der Sonne. Brunner steuerte den ersten Wagen in der Reihe an, doch dessen Fahrer winkte ab, der zweite ebenso, der dritte wickelte gerade eine Stulle aus dem Butterbrotpapier und bedachte den an die Scheibe klopfenden Fahrgast mit einem Achselzucken. Berliner Taxifahrer waren eigen, diese Erfahrung hatte Brunner schon oft genug machen dürfen: Wenn sie eine Pause einlegen wollten, dann machten sie die und ließen sich dafür im Zweifel sogar eine Fuhre durch die Lappen gehen.
Weiter hinten in der Reihe stand ein Chauffeur neben seiner Kraftdroschke und winkte. Na also, dachte Brunner. Der Mann wirkte trotz seiner einladenden Geste zwar nicht gerade freundlich, doch war Freundlichkeit auch eine Gabe, die man von einem Berliner Taxifahrer nicht unbedingt erwarten durfte. Hilfsbereit war der Mann gleichwohl, er lüftete seine Chauffeursmütze und öffnete dem Fahrgast beflissen die Tür. Brunner warf die Aktentasche in den Fußraum und ließ sich in die Lederpolster fallen. Den Blumenstrauß legte er neben sich auf die Rückbank.
„Wilmersdorf“, sagte er, als der Taxifahrer hinter dem Steuer saß. „Rüdesheimer Platz.“
Der Fahrer nickte, startete den Motor und legte den Gang ein. Brunner lehnte sich zurück, nestelte eine Ernte 23 aus der Schachtel und steckte sie an.
Gemächlich zockelte das Taxi die Möckernstraße hinunter, in einem Schneckentempo, das Brunner nervös machte. Er hatte es wirklich nicht eilig, nicht sonderlich jedenfalls, doch ein solches Geschleiche konnte er einfach nicht ertragen. Normalerweise hetzten Berliner Taxifahrer durch die Straßen ihrer Stadt, als seien sie auf der Flucht, doch dieser hier fuhr, als wäre er auf dem Weg zu seinem Zahnarzt und wolle am liebsten niemals ankommen.
Brunner klopfte gegen die Trennscheibe. „Drücken Sie ruhig mal ein bisschen auf die Tube“, sagte er, im freundlichsten Tonfall, zu dem er trotz seiner Gereiztheit imstande war. „Soll Ihr Schaden nicht sein.“
Der Fahrer reagierte nicht. Weder sagte er etwas, noch fuhr er schneller. Mit sturem Blick unterquerte er die Hochbahn am Landwehrkanal. Die Fahrbahn der Möckernbrücke vor ihnen war völlig frei und bot keinerlei Anlass, sie mit höchstens zwanzig Stundenkilometern zu überqueren. Sie wurden so langsam, dass sie sogar von einem Radfahrer überholt wurden, dann von einer anderen Kraftdroschke, und Brunner wünschte sich, er säße im überholenden Taxi und nicht in diesem. Warum nur war er ausgerechnet an diesen Lahmarsch geraten? Irene konnte ruhig eine Weile warten, so etwas schadete nicht, er wusste, dass sie ihn umso inniger empfangen würde, wenn er sich ein wenig verspätete. Wichtiger war es, die Post noch rechtzeitig vor der nächsten Leerung am Rüdesheimer Platz einzuwerfen. Er nutzte den Briefkasten dort, so oft es ging; die Kästen in der Nähe des Büros und rund um den Anhalter Bahnhof waren nicht sicher. Das Forschungsamt hörte nicht nur Telefone ab.
„Haben Sie Petersilie in den Ohren, Mann?“, herrschte er den Fahrer an. „Nun fahren Sie schon schneller! Wofür bezahle ich Sie eigentlich?“
Der Fahrer drehte sich kurz um und schaute ihn an, wachsbleich im Gesicht, Schweißperlen auf der Stirn, dabei war es gar nicht mehr warm, die Sonne war hinter den Wolken verschwunden.
„Oder geht es Ihnen nicht gut?“, fragte Brunner.
„Wie?“
Die Stimme des Fahrers klang heiser und, ganz im Gegensatz zu seiner Fahrweise, seltsam gehetzt, fast hektisch.
„Sie sehen krank aus. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, fahren Sie doch rechts ran und ruhen sich aus. Ich finde schon eine andere Taxe.“
„Nein, nein!“
Der Fahrer schüttelte den Kopf, derart energisch, als könne er sich alles vorstellen, nur eines nicht: rechts ranzufahren und seinen Fahrgast wieder aussteigen zu lassen.
Und endlich, endlich gab er nun Gas. Das Taxi beschleunigte spürbar, Brunner wurde in den Sitz gedrückt. Sie wurden schneller und schneller. Der Taxifahrer schaltete hoch und trat das Gaspedal durch. In halsbrecherischem Tempo rasten sie die Möckernstraße hinunter, dass die Bäume am Straßenrand nur so an ihnen vorbeiflogen. Instinktiv hielt Brunner seinen Hut fest, obwohl das Verdeck geschlossen war. An was für einen Fahrer war er hier verdammt noch mal geraten? Schnecke oder Windhund, und dazwischen gab es nichts?
Die Ampel an der Yorckstraße kam in Sicht. Sie sprang gerade auf Rot um, doch der Fahrer machte keinerlei Anstalten, sein Tempo zu verringern.
„Bremsen Sie, Mann! Wir haben Rot!“
Brunner klang panischer, als er wollte, er war dabei, die Beherrschung zu verlieren. Er trat mit seinem Fuß auf eine Bremse, die gar nicht da war, als könne er den Wagen so zum Stehen bringen, doch der überfuhr die rote Ampel und bog auf die Yorckstraße. Autos hupten, es grenzte an ein Wunder, dass sie mit keinem anderen Fahrzeug kollidierten.
Brunners Erleichterung darüber währte nur kurz, denn sein Fahrer gab wieder Gas und raste auf die Yorckbrücken zu. Die Panik kehrte in dem Moment zurück, als Brunner merkte, dass sie die Rechtskurve niemals schaffen würden, die sie nehmen mussten, um dem Verlauf der Straße zu folgen. Der Fahrer machte nicht einmal Anstalten, die Kurve zu fahren, stattdessen steuerte er das Taxi quer über den Fahrdamm durch den Gegenverkehr, löste ein weiteres Hupkonzert aus und nötigte einen Passanten auf dem Gehweg zum Hechtsprung.
„Bremsen Sie doch, Mann! Sind Sie wahnsinnig?“
Brunners Stimme überschlug sich, doch der Fahrer antwortete nicht. Und er bremste nicht. Saß mit weit aufgerissenen Augen und verzerrtem Gesichtsausdruck hinter dem Lenkrad, das er festhielt wie im Krampf und keinen Millimeter bewegte. Bevor Brunner sich erklären konnte, was zum Teufel da gerade passierte, spürte er den Schlag, den der Bordstein ihrem Taxi versetzte, und dann sah er auch schon die Mauer auf sich zukommen, eine jener gelb-roten preußischen Klinkermauern, die er so hasste und von denen es in dieser Stadt so viele gab. Er öffnete die Tür, als gebe es noch irgendein Entkommen, obwohl er ahnte, dass es bereits zu spät war. Den Türgriff in der Hand wandte er den Blick von der heranrasenden Mauer im letzten Moment ab, als könne er das unerbittliche Schicksal durch Wegschauen doch noch besiegen. Das Letzte, was er in seinem Leben sehen sollte, war der Blumenstrauß auf dem Rücksitz, der ihm einen eigentümlichen Trost spendete.
2
Es war einfach nur ekelhaft.
Charly wollte eigentlich gar nicht hinsehen, aber der rote Schaukasten befand sich nun einmal direkt gegenüber der Volksbadeanstalt, und in der Spiegelung des Glases konnte sie unauffällig beobachten, was auf der anderen Straßenseite geschah.
Hinter dem Glas jedoch hing die aktuelle Ausgabe des Stürmer aus, und die dicken Buchstaben der Schlagzeilen und der antisemitischen Parolen sprangen sie an wie kleine Vampire, die ihre giftigen Zähne in ihre Gedanken schlagen wollten.
Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel!
Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!
Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung des deutschen Volkes!
Es war wie bei einem schrecklichen Verkehrsunfall: Sie schaute hin, obwohl sie eigentlich nicht hinsehen wollte.
Las die Schlagzeile. Jud Rennert – Der Rassenschänder in Mannheim – Wie er die Notlage einer deutschen Frau ausnützen wollte – Vom Schäferstündchen ins Konzentrationslager
Und dann die Karikatur auf der Titelseite, die einen mit allen antisemitischen Klischees ausgestatteten unrasierten und offensichtlich wollüstigen Juden an der Hotelrezeption zeigte, in Begleitung einer deutlich jüngeren blonden Frau, und darunter den Text: Keine Angst, Kindchen, lass mer nur machen, a Hotel is schließlich ka Rasseforschungsinstitut, es genügt hinzuschreiben „verheiratet“ und es Paradies steht uns offen.
Neben Charly standen Menschen, die diesen antisemitischen, pornographischen und denunziatorischen Schund wirklich lasen und offensichtlich ernst nahmen. Mit zustimmendem Nicken Artikel für Artikel lasen. Und das im roten Wedding.
Da endlich kam die Frau, auf die sie gewartet hatte. Pünktlich wie jeden Sonnabend. Dunkelblauer Rock, grüner Hut. Ging die backsteinerne Fassade entlang, deren strenge Architektur auf den ersten Blick an ein Gefängnis erinnerte, hinter der sich jedoch, wie die Buchstaben über den beiden Eingängen verrieten, die Volksbadeanstalt Wedding verbarg. Verschwand dann im Gebäude, nachdem sie sich noch einmal umgesehen hatte.
Charly wartete einen Moment, bevor sie hinüberging. Ganz wohl war ihr nicht bei der Sache, zu groß war die Gefahr entdeckt zu werden, doch ihr Klient bestand darauf. Nachdem sie im Stillen und mit geschlossenen Augen einmal bis hundert gezählt hatte, überquerte sie die Straße und betrat die Badeanstalt durch den rechten Eingang, den für die Damen. Eine unangenehme Schwüle und ein stechender Geruch empfingen sie. Und eine ganz in weiß gekleidete Frau, die im Kassenkabuff saß und ihr ebenso erwartungsvoll wie unfreundlich entgegenblickte.
„Einmal bitte“, sagte Charly und zückte ihr Portemonnaie.
„Einmal wat? Schwimmen? Baden? Brausen?“
Die Frau hinter der Glasscheibe erinnerte mit ihrer stämmigen Gestalt eher an eine Gefängniswärterin als an eine Bademeisterin. Und so hörte sie sich auch an.
„Muss ich das hier entscheiden?“, fragte Charly. „Kann ich nicht einfach rein?“
„Kommt drauf an, wieviel Jeld Sie ausjeben wollen. Schwimmhalle is teurer als Wannenbad, Wannenbad teurer als Brausebad. Aber bei Schwimmhalle is Brause inklusive. Ohne Abbrausen dürfen Se jar nich ins Wasser.“
„Soso.“
„Und? Wat darf’s denn sein?“
„Das ist mir jetzt irgendwie peinlich.“ Charly schaute sich um, als sei sie noch nie in ihrem Leben in einer Badeanstalt gewesen. „Aber ich bin mit einer Freundin hier verabredet … Weiß nur nicht genau wo.“
Die Frau an der Kasse sagte nichts, sie guckte nur streng.
„Martha müsste vor wenigen Augenblicken erst gekommen sein“, fuhr Charly fort, „hab sie noch hier reingehen sehen. Hab auch gerufen, aber da war sie schon drinne.“ Sie schaute sich um. „Und nun ist sie nirgends zu sehen.“
„Jerade eben hier rin?“ Ein kleiner Schleier des Misstrauens huschte über das Gesicht der Frau; sie schaute Charly prüfend an, ehe sie antwortete. „Is Ihre Freundin so ’ne hübsche Blonde?“
Charly nickte und lächelte.
„Die kommt jeden Sonnabend.“ Die Kassenfrau riss eine Karte von der Rolle. „Einmal Wannenbad also. Um zusammen zu baden, dafür sind Se aber zu spät. Ick könnte Ihnen die Kabine nebenan jeben.“
„Das wäre nett.“
„Brauchen Se ’n Handtuch?“
„Äh, ja … bitte.“
„Denn macht det dreißich Pfennije.“
„Bitte.“ Charly legte die Münzen in die Durchreiche und bekam im Gegenzug ein weißes Handtuch, eine Eintrittskarte und einen Schlüssel, der mit einer Nummer versehen war.
„Kabine hundertfuffzehn, erstet Oberjeschoss. Die Kollegin zeicht Ihnen den Weg. Is direktemang neben Ihre Freundin. Da können Se sich wenigstens unterhalten, während Se im Wasser liegen.“
Mit dem Handtuch auf dem Arm war Charly schon unterwegs zum Treppenhaus, als sie noch einmal gerufen wurde.
„Frollein?“
„Ja?“. Sie drehte sich um.
„Kenn ick Sie nich irjendwoher?“ Die Frau an der Kasse musterte sie eindringlich. „Na sicher, Sie sind bei Blum und Scherer, nich wahr? Anwaltsjehilfin, stimmt’s?“
Charly fühlte sich ertappt, aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie nickte. Und lächelte.
„War mal bei Ihnen“, fuhr die Kassenfrau fort. „Wejen unsere Mieterhöhung. Wissen Se noch? Der Doktor Scherer hat uns da sehr jeholfen.“
„Freut mich.“
„Jrüßen Se man schön, den Herrn Doktor.“
„Gerne. Von Frau …“
„Schwaak. Else Schwaak.“ Sie lächelte. „Kommen Se nächstes Mal zusammen mit Ihre Freundin, dann kriegen Se ’ne jemeinsame Kabine. Spart baret Jeld.“
Sie zwinkerte verschwörerisch, als habe sie gerade Geheimwissen verraten.
Charly drehte wieder um. Als sie die Treppen hochstieg, endlich außer Sichtweite der Kassenfrau, fluchte sie leise vor sich hin. Das war nur passiert, weil diese dämliche Observierung sie in die Nähe der Kanzlei führte! Ausgerechnet einer Mandantin von Blum & Scherer über den Weg zu laufen!
Die Bademeisterin, die sie oben empfing, die Karte kontrollierte und ihr die richtige Kabine zuwies, war weniger redselig. Dafür jünger und hübscher als ihre Kollegin an der Kasse.
„Ick klopfe, wenn Ihre Zeit abjeloofen is. Denn haben Se noch fünf Minuten.“
Das war alles, was sie sagte, als sie Kabine 115 öffnete.
Charly nickte und schloss ab. Während das Wasser in die Wanne lief, schaute sie sich um. Einfache Holzwände trennten die Badekabinen voneinander, Wände, die nicht zum Boden reichten, sondern aufgeständert waren und eine Lücke von einigen Zentimetern ließen, damit man den Fliesenboden besser wischen konnte.
Das einlaufende Wasser machte anständig Lärm. Charly hockte sich auf den Boden und lugte durch den Spalt zu ihrer Linken. Auf dem hölzernen Hocker neben der Wanne lagen ordentlich gefaltete Kleidungsstücke. Sie erkannte den dunkelblauen Rock wieder, den sie eben noch im spiegelnden Glas des Stürmerkastens gesehen hatte. Bis der Rock mit seiner Trägerin im Volksbad verschwunden war, wie jeden Sonnabend. Was Charly bereits gewusst hatte, bevor es die Kassenfrau ihr verraten hatte.
Die Sonnabendnachmittage waren die einzigen dunklen Flecken, die es im Leben von Martha Döring noch gab. Ansonsten wussten sie mehr oder weniger lückenlos Bescheid über den Alltag und die Gewohnheiten der Frau, einer hübschen Mitdreißigerin. Über eine Stunde verbrachte sie jeden Sonnabend in der Badeanstalt, und niemand wusste, was sie dort tat. Dass sie ausgerechnet dort den heimlichen Liebhaber traf, dessen Siegmund Döring, ihr Ehemann, sie verdächtigte und dessentwegen er die Detektei Böhm engagiert hatte, das hielten weder Charly noch ihr Chef Wilhelm Böhm für wahrscheinlich, so streng wurden die Geschlechter hier voneinander getrennt; es gab sogar zwei Schwimmhallen, eine große für die Herren, eine kleinere für die Damen. Deswegen hatten sie bei ihren bisherigen Observierungen immer geduldig im Café gegenüber gewartet, bis Martha Döring wieder aus der Badeanstalt gekommen war, und hatten die Beobachtung erst dann wieder aufgenommen.
Doch das reichte Siegmund Döring nicht. Bei seinem jüngsten Besuch hatte der eifersüchtige Ehemann darauf bestanden, seiner Frau ins Bad zu folgen, also hatte Charly diese Aufgabe übernommen.
Sie holte die kleine Kamera aus der Handtasche und ihren Schminkspiegel, legte den Spiegel auf den Boden und probierte so lange herum, bis der Winkel stimmte und sie die Nachbarkabine, den Stuhl mit der Kleidung und die Kabinentür im Blick hatte, ohne sich auf den Boden hocken zu müssen. Dann setzte sie sich auf den Wannenrand und spannte die Kamera.
Charly kam sich schäbig vor, aber was sollte sie tun? Sie hatte die Spesenrechnung um dreißig Pfennige erhöht, nun brauchte sie auch Beweismaterial. Und wenn es eben der Beweis wäre, dass Martha Döring sich einmal in der Woche ausgiebig ihrer Körperpflege widmete. Vielleicht gab ihr eifersüchtiger Klient dann endlich Ruhe. Charly fand den Kerl unerträglich, aber Männer wie Siegmund Döring brachten der Detektei Böhm nun einmal das Geld.
Die Wanne war beinahe voll, und Charly drehte den Wasserhahn zu. Das Nachplätschern der letzten Tropfen erinnerte sie daran, dass es ratsam wäre, ein paar Geräusche zu machen, die vortäuschten, dass auch in Kabine 115 jemand in der Wanne lag. Sie zog Schuhe und Strümpfe aus und planschte ein wenig herum. Danach musste sie erst einmal das Kameraobjektiv wieder freiwischen. Auch der Spiegel auf dem Boden war beschlagen.
Sie lauschte. Aus der linken Kabine war leises Plätschern zu hören und noch leiseres Summen. Martha Döring schien sich wohlzufühlen. Und Charly saß in der Kabine nebenan auf dem Wannenrand, in der Hand einen Fotoapparat, und fühlte sich völlig fehl am Platz. Vielleicht wäre es sinnvoller, die gut zwanzig Minuten, die ihr noch blieben, für ein Wannenbad zu nutzen und den Fotoapparat wieder einzupacken.
Die warme feuchte Luft machte sie schläfrig, bis ein Klopfen sie hochschrecken ließ. War ihre Zeit etwa schon abgelaufen? Nein, das kam von nebenan, in der Nachbarkabine regte sich etwas. Sie hörte ein Poltern und Plätschern: Martha Döring stieg aus der Wanne.
Charly schaute in den Schminkspiegel und konnte nasse nackte Beine sehen. Hörte, wie der Riegel zurückgeschoben wurde, sah, wie die Tür sich öffnete, dann ein weiteres Paar Beine, Stoffschuhe mit Gummisohle, den Saum eines weißen Kittels. Sie rutschte vom Wannenrand, versuchte, einen günstigeren Blickwinkel zu finden, um das Gesicht der Besucherin zu erkennen. Es war dieselbe Bademeisterin, die ihr die Kabine zugewiesen hatte.
Musste man hier nachlösen, wenn man zu lange badete? Das fragte sich Charly noch, da sah sie, wie die Bademeisterin die Kabinentür wieder zuzog und verriegelte. Von innen.
Die nackten Füße und die weiß beschuhten standen sich für eine Weile gegenüber. Charly lauschte angestrengt, doch kein Wort wurde gesprochen. Sie brachte die Kamera in Anschlag.
Und sah durch den Sucher, was die beiden Frauen machten.
Es war nicht das, was Charly erwartet hatte. Eigentlich hatte sie überhaupt nichts erwartet an diesem Ort. Hatte den Fall für abgeschlossen gehalten, die Eifersucht ihres Klienten für krankhaft und seinen Verdacht für Einbildung. Aber es war keine Einbildung. Martha Döring betrog ihren Siegmund tatsächlich. Allerdings nicht mit einem anderen Mann.













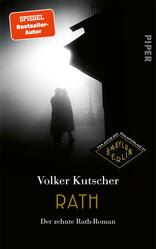









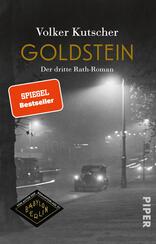

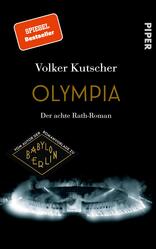



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.