
Mehr Mut als Kleider im Gepäck
Frauen reisen im 19. Jahrhundert durch die Welt
Mehr Mut als Kleider im Gepäck — Inhalt
Mit mutigen Frauen um die Welt
Sie überschritten Ländergrenzen und gesellschaftliche Konventionen: Sieben Frauen verschiedenster Herkunft und Weltanschauung – unter ihnen Anna Leonowens, Gertrude Bell und Alexandra David-Néel – eroberten sich im 19. Jahrhundert mit bewundernswertem Mut ihren Platz in den exotischsten Gegenden der Erde. Ihre Reisen führten sie von den Wüsten Arabiens bis ins geheimnisvolle Siam und zu den Schneefeldern Sibiriens, ob als Schriftstellerin, Studentin der Archäologie oder als Lehrerin am Königshof. Julia Keay, Dokumentarfilmerin der BBC, vereinte gekonnt diese spannenden Biografien, deren Pioniergeist auch heute beeindruckend ist.
Leseprobe zu „Mehr Mut als Kleider im Gepäck“
Einführung
Im 19. Jahrhundert war eine ansehnliche Anzahl europäischer Männer rund um den Globus unterwegs – doch in vielen etwas entlegenen Winkeln der Welt waren Europäerinnen sogar noch hundert Jahre später eine unbekannte Gattung.
Die sieben weiblichen Reisenden, deren Geschichten in diesem Buch erzählt werden, sind alle Frauen des Viktorianischen Zeitalters. Die verschiedensten Gründe führten sie in entfernte Weltgegenden, aber eine Gemeinsamkeit vereint sie: Sie waren alle Individualistinnen par excellence. Jede von ihnen war – freiwillig oder [...]
Einführung
Im 19. Jahrhundert war eine ansehnliche Anzahl europäischer Männer rund um den Globus unterwegs – doch in vielen etwas entlegenen Winkeln der Welt waren Europäerinnen sogar noch hundert Jahre später eine unbekannte Gattung.
Die sieben weiblichen Reisenden, deren Geschichten in diesem Buch erzählt werden, sind alle Frauen des Viktorianischen Zeitalters. Die verschiedensten Gründe führten sie in entfernte Weltgegenden, aber eine Gemeinsamkeit vereint sie: Sie waren alle Individualistinnen par excellence. Jede von ihnen war – freiwillig oder unfreiwillig – mit einem bestimmten Ziel oder in Erfüllung einer bestimmten Aufgabe losgezogen, und keine gab unterwegs auf. Jede „stellte ihren Mann“, machte sich einen Namen, fand ihr Glück und ihren Lebensinhalt in Gegenden der Welt, die oft kaum ein Weißer gesehen hatte: in Australien, Ägypten, Sibirien, Indien, Siam (dem heutigen Thailand), dem Mittleren Osten und in Zentralasien. Und alle waren sie beseelt vom Drang nach Freiheit und vom Wunsch, den erstickenden Einschränkungen, denen Frauen ihrer Zeit in Europa unterworfen waren, zu entfliehen. Dafür nahmen sie Strapazen und Probleme auf sich, die heute kaum mehr vorstellbar sind. Aber: Sie alle erreichten ihr Ziel.
Gertrude Bell drückte – wenn auch auf etwas blumige Weise – das Gefühl der sieben Frauen vor Reisebeginn wohl am besten aus: „… die Pforten des umzäunten Gartens tun sich auf, die Kette vor dem Eingang des Kerkers senkt sich, und siehe da: dort lag die unermesslich weite Welt!“
Emily Eden
Die Pflicht ruft
Freiwillig war Emily Eden bestimmt nicht unterwegs. Auslandsreisen waren das Letzte, woran sie im Frühjahr 1835 dachte. Ganz im Gegenteil wollte sie mehr als alles andere endlich ein eigenes Heim. Es musste gar nicht groß sein. Ein kleines Häuschen auf dem Land mit einem gemütlichen Wohnzimmer und einem Lehnstuhl am Kamin, mit Regalen für ihre Bücher und Wänden, wo sie ihre Bilder aufhängen könnte; außerdem Platz für ihre Pflanzen und vielleicht sogar einen kleinen Garten, wo sie mit ihrem Hund spielen und Rosen und Glyzinien beschneiden konnte. Sie wünschte sich nur ein bisschen Ruhe und Bequemlichkeit für ihre späteren Jahre – sicherlich keine ungewöhnliche Vorstellung für eine alternde Jungfer.
Stattdessen zwangen sie die Umstände zu einem rastlosen Leben. Ihre Sachen waren alle in Kisten verstaut, sie wusste von einem Tag zum anderen nicht, in welcher Truhe eigentlich ihre Kleider waren, und – am schlimmsten von allem – langsam gingen ihr die verheirateten Schwestern aus, bei denen sie abwechselnd wohnen konnte. Alle fünf hatten sie mit herzlicher Gastfreundschaft aufgenommen, aber irgendwann wird eine jüngferliche Tante auch zur Last, egal, wie sehr man sie liebt.
Sie machte die Regierung für diese Schwierigkeiten in ihrem Privatleben verantwortlich. Seit im Jahr zuvor die politischen Geschicke der Liberalen und der Konservativen andauernd auf und ab gingen, war ihr Leben zu einer Karussellfahrt geworden. Es war schon schlimm genug, dass Lord Melbourne ihren Bruder George, Lord Auckland, zum Ersten Lord der Admiralität befördert hatte. Sie musste weinen, als sie sich gezwungen sah, das schöne Haus in Greenwich zu verlassen, in dem sie mit ihrem Bruder zusammen lebte. Die riesige, zugige Repräsentationswohnung im Haus der Admiralität sagte ihr überhaupt nicht zu:
Alle behaupten, wir wären außerordentlich beneidenswerte Leute. Für George gilt das vielleicht, aber ich kann nicht von Glück sprechen, wo ich doch Greenwich verlassen muss. Es war mein Ein und Alles. Nunmehr an London gebunden zu sein … ich hasse London! Und ich soll mir vorschreiben lassen, wen ich zum Abendessen einlade, ohne überhaupt die finanziellen Möglichkeiten zu haben, mich gesellschaftsfähig zu kleiden. Ich wünschte, die Regierung würde auch einmal in Betracht ziehen, dass trotz der Beförderung eines Mannes in eine hohe Position die Frauen im Hintergrund so arm wie eh und je bleiben.
Im Oktober 1834 kam dann das Gerücht auf, Lord Melbourne plane, George als Generalgouverneur nach Indien zu schicken. Es war wirklich nur Geflüster hinter der hohlen Hand, aber es genügte, um Emily in Angst und Schrecken zu versetzen. „Glücklicherweise ist die Gefahr vorbei“, schrieb Emily an ihre beste Freundin, Theresa Lister. „Ich wusste, das wäre zu schlimm, um wahr zu sein – obwohl es auch gefährlich ist, solche Überlegungen anzustellen, denn sie beschleunigen oft eine drohende Katastrophe. Aber dies war ein so extremer Fall, eine derart fürchterliche Vorstellung, dass man sie nur mit Gewalt wegschieben konnte. Selbst die Botany Bay wäre vergleichsweise noch ein Vergnügen gewesen. Wenigstens ist das Klima dort angenehm, und zudem kommt man noch in den Genuss, vorher eine nette kleine Straftat zu begehen. Aber nach Kalkutta …!“ Angesichts ihrer Erleichterung schienen sogar die tristen Räumlichkeiten der Admiralität plötzlich eine gewisse häusliche Wärme auszustrahlen.
Sechs Monate später war die Regierung der Liberalen zusammengebrochen, Sir Robert Peel und seine schrecklichen Tories hatten die Macht übernommen, und der arme George hatte keine Stellung mehr. Obwohl das natürlich eine Enttäuschung war, bedeutete es zumindest, dass sie sich jetzt wieder aufs Land zurückziehen konnten. Doch selbst während Emily überall ihre Freude über diese Aussichten zum Ausdruck brachte, wusste sie doch insgeheim, dass es so nicht kommen würde. George beharrte darauf, dass es keinen Sinn hätte, sich irgendwo fest niederzulassen – die Tory-Regierung schwankte ziemlich und konnte sich wahrscheinlich nicht halten. Melbourne würde sicher wieder Premierminister werden, George konnte davon ausgehen, dann einen neuen Regierungsposten zu erhalten, und so wären sie wieder mit der Notwendigkeit einer häuslichen Veränderung konfrontiert. Besser abwarten, was kommt.
Emily war wieder ohne ein Dach über dem Kopf. In einem, wie sie meinte, völlig gefühllosen Ausbruch versuchte George ihr klarzumachen, dass ihr bei mehr als der Hälfte der englischen Adelssitze alle Türen weit offen standen, falls sie bei keiner ihrer Schwestern mehr unterschlüpfen wollte. Er schien nicht zu verstehen, dass es weit weniger schön war, selbst im herrschaftlichsten Haus zu Gast zu sein, als ein eigenes zu besitzen, und sei es nur „ein Zelt irgendwo unter einer Hecke, wo ich mein müdes Haupt betten kann“.
Doch das Schicksal hatte die Beschwörungen nicht vergessen, mit denen Emily ihm hatte ausweichen wollen. Im April 1835 gab es einen erneuten Regierungswechsel; Peel trat zurück, und Lord Melbourne wurde wieder Premierminister. Innerhalb der ersten beiden Wochen seiner Amtszeit bot er George einen neuen Posten an: Generalgouverneur in Indien. „Was soll ich dazu weiter sagen, außer dass wohl Gottes Wille geschieht“, schrieb Emily an Theresa. „Mir graut es vor dem Klima, und ich kann der Reise nur mit äußerstem Widerwillen entgegensehen.“
Von den vierzehn Kindern William Edens, des ersten Barons Auckland, hatten immer Emily und George die größte Nähe und Zuneigung füreinander empfunden. Beide heirateten nie und teilten vierzehn Jahre lang mit ihrer jüngsten Schwester Fanny ein Haus. Seit den Anfängen von Georges politischer Karriere als Abgeordneter auf den hinteren Rängen des Parlaments und nach dem Tod des Vaters an dessen Stelle im Oberhaus, in seinen Jahren als Präsident der Handelskammer und als Erster Lord der Admiralität hatte Emily die Rolle seiner Lebensgefährtin und Gastgeberin gespielt.
Deswegen hatte sie keine Angst vor der Aussicht, als First Lady in Kalkutta zu agieren. Die Familie Eden bewegte sich schon lange in den exklusivsten Gesellschaftskreisen, durch Blutsverwandtschaft oder Heirat war sie mit den besten Familien des Landes verbunden, nannte den Rest beim Vornamen und zählte auch die königliche Familie zu ihrer näheren Bekanntschaft. Trotz ihrer augenblicklichen Abneigung vor der Politik war Emily durchaus an politischen Dingen interessiert. Nichts machte ihr mehr Spaß als eine leidenschaftliche Debatte mit Georges Kabinettskollegen beim Abendessen. Die eigentliche Bedrohung war die Trennung von Freunden und Familie. Alles, was sie jemals über Indien gehört oder gelesen hatte, verleitete sie zu der Schlussfolgerung, das Land sei ein kultureller und gesellschaftlicher Friedhof. Sobald sie dahin verbannt wäre, glaubte Emily, gäbe es nichts mehr von all dem, was ihr Leben lebenswert machte – die neuesten Bücher und Theateraufführungen, die aktuelle Mode und vor allem der gesellschaftliche Klatsch. „Jeden Tag wird mir das Herz schwerer“, schrieb sie. „Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie mir zumute ist.“
Doch obgleich sie äußerstes Mitleid bekundeten und selbst unter der bevorstehenden Trennung litten, ließen sich Emilys Freunde nicht beeindrucken. Sie wussten, dass Emily unglücklich war, wenn sie nichts zu klagen hatte, und umgekehrt: Je größer ihre Probleme, umso strahlender ihr Lächeln. Auch ihr Aussehen täuschte: Sie war klein, hatte lange, dunkle Haare und einen blassen Teint, der eher auf eine zarte Konstitution schließen ließ. Hinter dieser zerbrechlich wirkenden Fassade war sie allerdings ganz schön zäh, wie ihre Freunde wussten. Sie war klug, hatte eine scharfe Zunge, und da sie Leute, die ihrer Meinung nach Unsinn redeten, nicht leiden konnte, zitterten empfindlichere Naturen vor ihren schnellen Urteilen. Aber sie konnte auch warmherzig sein, sehr witzig und einfühlsam, und sie hatte einen wunderbar trockenen Humor. Diese Eigenschaften machten sie nicht nur zu einer unterhaltsamen, sehr geschätzten Freundin, sondern halfen ihr auch über alle Unannehmlichkeiten hinweg. Die Freunde daheim konnten sicher sein, dass sie ihnen sehr lebensnah von jedem einzelnen ihrer Abenteuer berichten würde.
Allein die Reise hin und zurück würde ein ganzes Jahr dauern. Da Georges Auftrag politischer Natur war, wäre er so lange Generalgouverneur, wie die Liberalen an der Regierung blieben. Emily wusste deshalb, dass sie sechs Jahre lang fort sein könnte. „Ein ungeheurer Einschnitt“, schrieb sie ihrer Schwester Eleanor, der Gräfin Buckinghamshire, „und noch dazu zum völlig falschen Zeitpunkt in meinem Leben. Die Jugendzeit Deiner Kinder werde ich verpassen, und unsere wird gänzlich vorbei sein. Wenn wir uns wiedersehen, bin ich schon eine ziemlich alte Frau.“
Erst 1857 übernahm die britische Regierung kurz nach dem Großen Aufstand der Sepoys[1] die direkte Herrschaft in Indien. Im Jahr 1835 war, zumindest nominell, die Ostindische Kompanie verantwortlich für die Belange jener Gebiete, die sich unter den Schutz der Briten gestellt hatten. Letztendlich aber lag die Macht über alles, was nicht die geschäftlichen Interessen der Kompanie betraf, beim India Office Board of Control (Kontrollbehörde für Indien) in Whitehall. Theoretisch erhielt der Generalgouverneur zwar seine Weisungen von dort, aber es war schlichtweg nicht praktikabel, dass jede Entscheidung in London fiel, wenn zwischen einer Anfrage aus Kalkutta und der Antwort aus London acht Monate vergehen konnten. Obwohl in Kalkutta ein Ministerrat dem Generalgouverneur mit Rat und Tat zur Seite stehen sollte, lag die Regierung von Britisch-Indien schließlich doch in den Händen eines einzigen Mannes. Es war eine ungeheure Verantwortung, doch Emily zweifelte nicht daran, dass George die Aufgaben meistern würde.
Damit sie ausreichend Zeit für eine derart tief greifende Umwälzung der häuslichen und beruflichen Situation hatten, war die Abreise erst für Ende September geplant. Ihre einzige andere unverheiratete Schwester Fanny sollte mit nach Indien gehen und auch William Osborne, Sohn von Schwester Charlotte, der zu Georges Militärattaché ernannt worden war. So musste Emily nicht ganz auf ihre Verwandtschaft verzichten. Während George sich auf seine Aufgaben in Indien vorbereitete, ließ Emily als Erstes Porträts von so vielen Neffen, Nichten und Patenkindern anfertigen, wie in der kurzen Zeit möglich war. Außerdem musste alles, was sie nicht mit nach Indien nehmen würde, in Kisten gepackt, wieder umgepackt und verstaut werden. Sie besorgte für ihre Freunde Abschiedsgeschenke, und selbstverständlich benötigte sie eine völlig neue und ungewohnte Garderobe.
Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was für ein Chaos dieses ganze Einkaufen und Abmessen und Anprobieren in meinem Kopf auslöst. Ich brauche jetzt kurzärmelige Nachthemden, und Schlafhauben aus Tüll, weil selbst Musselin noch zu warm ist. Und dann solche Absonderlichkeiten: Unmengen von Flanell, das trage ich noch nicht einmal hier in diesem kühlen Klima, aber dort sollen wir nachts so etwas anziehen, weil die Kreaturen, die unsere Fächer in Bewegung halten, manchmal einschlafen. Dann wird man durch die extreme Hitze wach, muss nach ihnen rufen, und wenn sie aufwachen, beginnen sie gleich so kräftig zu wedeln, dass man sich bei der plötzlichen Kälte den Tod holen kann. Was für ein Leben! Aber es bringt nichts, wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke.
Am 3. Oktober 1835 wurden an Bord der Jupiter in Portsmouth die Segel gehisst. Außer Emily, George, Fanny und William Osborne waren auch noch ihr Hausarzt Dr. Drummond, sechs Bedienstete, ein französischer Koch, Emilys Spaniel „Chance“ und die sechs Jagdhunde von William mit von der Partie. Nachdem Emily immer behauptet hatte, Wasser so sehr zu hassen, dass sie noch nicht einmal für tausend Pfund pro Tag fünf Monate lang auf See bleiben würde, staunte sie nun, wie sehr sie die Reise genoss.
Die See war sehr ruhig, ich kann lesen, zeichnen oder schreiben, und da es uns allen gut geht, kann ich wirklich kaum klagen. Wer hätte gedacht, dass George und ich mitten im Winter, wenn wir doch normalerweise im dicken gelben Nebel frösteln, jetzt gemütlich zwischen vielen Kissen am Heckfenster seiner Kabine sitzen, er ohne Mantel, Weste und Schuhe, während er im Schweiße seines Angesichts Hindustani lernt, und ich nur in einem Unterrock und einem leichten Hauskleid, in der einen Hand einen großen Fächer, in der anderen meinen Federhalter. Das Leben zur See wird mich sicher nie reizen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemandem gefällt. Doch wo wir vorher so viel über unsere Reise geschimpft haben, ist es erstaunlich, dass wir neunzehn Wochen auf See sein konnten und nur so wenige Unannehmlichkeiten hatten.
Die Jupiter hatte in Madeira, Rio de Janeiro und Kapstadt angelegt und erreichte Kalkutta schließlich am 2. März 1836, Emilys neununddreißigstem Geburtstag. Jedes Schiff aus England war ein Ereignis, das eine Menge Schaulustiger an den Kai trieb. Die Ankunft eines Generalgouverneurs aber war ein unvergleichliches Spektakel. Die Straßen von Kalkutta wimmelten geradezu von einem bunten, unsagbar lauten Wirrwarr von Menschenmassen, wie es sich Emily niemals vorgestellt hatte. George, in Paradeuniform mit vollem Ornat, wurde in die erste Kutsche gebeten, Emily und Fanny nahmen in der zweiten Platz. In der Gluthitze und unter dem Druck der Menge erstickten sie fast in ihren besten Kleidern; Emily bekam in ihrem engen Kragen kaum Luft und fürchtete schon, alle durch eine Ohnmacht zu blamieren. Die kurze Fahrt zum Regierungssitz schien ihr endlos. Nur der Gedanke an Entspannung auf einem bequemen Bett in einem kühlen Zimmer mit heruntergezogenen Jalousien hielt sie in der Kutsche aufrecht. Deshalb ärgerte es sie etwas, als sie gleich bei ihrer Ankunft erfuhr, dass die „etwa achtzig Gäste, die uns zu Ehren zu einem ›kleinen‹ Empfang geladen waren, direkt nach uns eintreffen würden … So fing es an, und ich vermute, so wird es auch weitergehen.“
Ihr neues Leben war so voller Überraschungen, dass Emily erst Ende März wieder zum Schreiben kam: „Wir sind heute auf den Tag drei Wochen hier, aber mir kommt es sehr viel länger vor, fast so, als ob es fast schon wieder Zeit wäre, nach Hause zu fahren. In vieler Hinsicht ist es eine seltsame, traumähnliche Atmosphäre, aber schrecklich ermüdend. Alles ist wie eine einzige Theateraufführung, sehr pittoresk und unenglisch.“
Ihre Befürchtungen über den Mangel an Bekannten und die Beschränktheit der dortigen Gesellschaft sollten sich erst noch bewahrheiten – zunächst musste sie sich an Grandezza gewöhnen:
Ich stehe um acht Uhr auf und schaffe es mithilfe von drei Zofen, bis neun Uhr ein Bad genommen und mich für das Frühstück angezogen zu haben. Wenn ich mein Zimmer verlasse, sitzen meine beiden Schneider schon mit gekreuzten Beinen im Flur auf dem Boden und nähen an meinen Kleidern. Daneben kehrt einer mit dem Besen jedes Staubkorn auf, zwei Diener bewegen ständig die Fächer, und ein Wachtposten passt auf, dass keiner von ihnen etwas stiehlt. Mein Chefdiener, der hier „Dschemadar“ betitelt wird, folgt mir die Treppe hinunter, dahinter kommen vier Hurkarus oder Kuriere, die mein persönliches Gefolge darstellen, und mein Spaniel Chance, der von seinem eigenen Diener unter dem Arm getragen wird. Am Fuß der Treppe stehen zwei Träger mit einer Sänfte bereit, falls ich zu erschöpft sein sollte, allein in die riesengroße Marmorhalle zu gehen, wo wir zu speisen pflegen. All diese Männer tragen Kleider aus weißem Musselin mit rot-goldenen Turbanen und Schärpen. Sie sehen so malerisch aus, dass ich sie für mich Modell sitzen lasse, wenn ich keine andere Beschäftigung mehr für sie finden kann.
Während der ganzen Zeit in Indien ging Emily mit viel Freude ihren künstlerischen Interessen nach. Land und Leute versorgten sie unerschöpflich mit Material für ihr Skizzenbuch. Heute noch sind ihre Aquarelle und Zeichnungen fast genauso bekannt wie ihre ausdrucksvollen Briefe. Ihren Freunden versicherte sie allerdings, dass ihr Leben in Indien trotz all des Luxus um sie herum keineswegs aus Müßiggängerei bestand. Seit der Abreise von Lord William Bentinck, Georges Vorgänger, hatte der Junggeselle Sir Charles Metcalfe den Generalgouverneur vertreten. Mit der Ankunft von Lord Auckland und seinen Schwestern wurde der besseren Gesellschaft von Kalkutta – wenn man sie so nennen wollte – zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder eine Gastgeberin im Regierungssitz beschieden, genau genommen nicht eine, sondern gleich zwei. Emilys und Fannys Kalender war fast so voll wie der von George. Montags mussten sie die offizielle Dinnerparty des Generalgouverneurs geben, mittwochs wurde von ihnen erwartet, dass sie „zu Hause“ waren für die auserwählte Gruppe von Nobilitäten, deren Namen die sogenannte „Regierungssitzliste“ zierten, Dienstag und Donnerstag vormittags mussten sie jeden empfangen, der darum ersuchte – „manchmal hundert oder sogar hundertzwanzig Leute in zwei Stunden“. Bei diesem aktiven Leben in der Öffentlichkeit brauchte Emily nicht lange, um sich ihre Meinung über die „Gesellschaft“ von Kalkutta zu bilden. Es war noch schlimmer, als sie befürchtet hatte.
Es gibt hier eigentlich keine interessanten Themen im landläufigen Sinn. Ich glaube, dass hier viel getratscht wird, aber erstens kenne ich die Leute gar nicht gut genug, um die richtige Geschichte mit dem richtigen Gesicht in Verbindung bringen zu können, selbst wenn ich diese Dinge wirklich hören wollte. Engere Bekanntschaften kann es gar nicht geben, auch wenn wir sie uns wünschen würden. Denn da unsere despotische Regierung das gesamte Patronatsrecht dieses riesigen Landes in die Hände des Generalgouverneurs gelegt hat, würden alle hier vor Wut kochen beim geringsten Anschein, dass eine Person bevorzugt wird. Es ist so schon heiß genug hier, man muss es nicht noch künstlich anheizen. Es ist so ungeheuer HEISS, dass ich das Wort gar nicht groß genug schreiben kann.
Je weiter der Sommer vorrückte, umso mehr verblasste vor den Schrecknissen des Klimas Emilys Entsetzen über die „gute Gesellschaft“ von Kalkutta. Im November beschwerte sie sich immer noch, „dass ich, obwohl jetzt die netterweise ›kalt‹ genannte Jahreszeit angebrochen ist, weder tagsüber noch nachts für fünf Minuten ohne meinen Fächer auskommen kann. Wenn auch nur ein Sonnenstrahl in Sicht ist, lassen wir die Jalousien herunter.“ Sie beklagte auch weiterhin, dass es in ihrer gesamten Bekanntschaft unter den Europäern in Indien nicht eine angenehme oder erfolgreiche Frau gäbe. Gegenüber den Engländerinnen – besonders den jüngeren – nahm sie jetzt eine erheblich mildere Haltung ein. Sie konnte es kaum ertragen, die frischen, fröhlichen Gesichter der Neuankömmlinge aus England zu sehen. Nur die größten Glückspilze unter ihnen konnten hoffen, Indien nach zehn oder zwanzig Jahren wieder lebendig zu verlassen. Viele würden lange vorher an einer Krankheit oder am Klima sterben. Andere mussten sich mit dem grausamen Schicksal abfinden, ihre Kinder in Indien zu begraben, und auch diejenigen, die sie vorsichtshalber in England in die Schule gehen ließen, „können einem so leid tun, dass man dafür keine Worte findet“.
Emilys eigene Gesundheit schien den Anstrengungen einigermaßen gewachsen zu sein. „Obwohl ich schon seit zehn Tagen vor mich hin kränkele, bin ich im Allgemeinen gesünder als jemals daheim“, schrieb sie am Jahrestag ihrer Ankunft in Kalkutta. Im Dezember 1837 klang sie schon anders:
Alle, die hier waren, als wir eintrafen, sind entweder zurück nach Hause gegangen oder aufs Land gezogen. Wir sind jetzt eine sehr kleine Gruppe und haben jeglichen Anflug von Kultiviertheit verloren. Tatsächlich glaube ich, dass wir fast schon zu Wilden geworden sind – nicht angriffslustig, keine Kannibalen, nicht einmal gemein –, ganz einfach liebe, harmlose Wilde, die schöne Kleider, Juwelen und Tabak lieben und dabei recht unwissend, träge und ziemlich dumm sind. Wir sterben hier alle weg an einem Fieber, das die Regenzeit mitgebracht hat. Das einzig interessante Gesprächsthema ist unsere bevorstehende Reise. Mir ist jedenfalls klar, dass ich das alles nur einigermaßen überstehen kann, wenn ich nicht aufhöre zu zeichnen.
Diese Reise hatte Lord Auckland als Antwort auf das Hauptproblem geplant, das seine gesamte Amtszeit beherrschen sollte: Afghanistan. Die Gefahr einer russischen Invasion Indiens von Zentralasien her hing schon mehr als dreißig Jahre über den Köpfen verschiedener Generalgouverneure. Nach den kürzlichen Erfolgen der Russen im Krieg mit Persien war diese Bedrohung jetzt nicht nur politisch wahrscheinlicher geworden, sondern auch geografisch nähergerückt. Die britische Regierung war überzeugt, dass Russland als Nächstes den Vormarsch auf die afghanische Hauptstadt Kabul beginnen würde: der bestgeeignete Ausgangspunkt für einen Einmarsch nach Indien.
Diese Ängste schürte seit Kurzem auch noch das Gerücht, die Afghanen wollten bei ihrem langen Territorialstreit mit Ranjit Singh aus dem Pandschab die Russen um Hilfe bitten. Ohne Frage musste dringend etwas unternommen werden, um dieser gefährlichen Allianz einen Riegel vorzuschieben. Nach monatelangen Diskussionen und Debatten sowohl mit der Regierung in England als auch mit seinen Ratgebern in Indien beschloss Lord Auckland, eine ausgedehnte Goodwill-Tour durch die Grenzstaaten zu unternehmen. Höhepunkt der Reise sollte ein Staatsbesuch am Hofe von Ranjit Singh sein, dem einflussreichsten Herrscher in all diesen unabhängigen Ländern. Eine nachhaltige Lösung des Afghanistan-Problems ließe sich wesentlich einfacher mit der Kooperation und Hilfe des „Löwen des Pandschab“ erreichen.
„Ich habe keine Einwände“, schrieb Emily, „obschon ich eines sagen möchte: Gemessen daran, dass ich nichts weiter erwartete, als ungestört mein kleines Haus mit Garten in Greenwich genießen zu können, mit all den unbedeutenden Cockneyvergnügungen und -geschichten, ist mir ziemlich hart mitgespielt worden.“
Das war Emily in Hochform. Allerdings ließ sich niemand von ihren Klagen täuschen. Sie war so froh über die Aussicht, Kalkutta verlassen zu können, dass sie sich nicht einmal bemühte, es zu verbergen. In den vergangenen zwanzig Monaten hatte sie als einzige Ausflüge aus der Stadt einige Wochenenden in Barrackpur verbracht, dem offiziellen Landsitz des Generalgouverneurs. Die Reise „ins Landesinnere“ würde lang, wahrscheinlich auch langweilig und bestimmt äußerst unbequem werden. Doch sie war mit allem einverstanden, wenn es nur einen Ortswechsel bedeutete und ihr die dauernde Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit ersparte, die ihr jegliche Energie raubten und ihre Haut mit einem „delikaten Gelbton“ überzogen hatten.
Diese Kavaliersreise war ein Unterfangen von mammutartigen Größenordnungen. George rechnete von vornherein damit, dass sie achtzehn Monate unterwegs sein würden, aber er warnte seine Schwestern, sich nicht darauf festzulegen; man konnte unmöglich voraussagen, wie schnell oder langsam in vorsichtigen Verhandlungen irgendeine Einigung mit Ranjit Singh erzielt würde. Zahlreiche Unterbrechungen der Reise waren vorgesehen, um Feste für die Fürsten und Radschas zu geben, durch deren Gebiete die Karawane zog, und auch, um die Einladungen dieser Herrscher wahrzunehmen. Da man in den heißen Sommermonaten unmöglich reisen konnte, planten sie für diese Zeit einen langen Aufenthalt in Simla. Wie schnell sie vorankamen, hing auch von der Größe der offiziellen Entourage ab. Der Haushalt des Generalgouverneurs und die Bediensteten stellten mit fünfhundert Personen nur einen kleinen Bruchteil des ganzen Reisetrosses dar. Ein Begleitregiment von achttausend Mann sollte mitmarschieren, ebenso militärische und politische Berater, Aides-de-camp, Ärzte, Beamte und Geistliche, jeweils mit ihren Familien und Bediensteten. Dazu Lastenträger, Köche, Schneider und Boten, Kamel- und Elefantentreiber und Pfleger für achthundertfünfzig Kamele, hundertsechzig Elefanten und Tausende von Pferden. Hunderte Tonnen Lebensmittel und anderer Proviant mussten transportiert werden. Alles in allem würden zwölftausend Menschen von Kalkutta zu der dreitausend Kilometer langen Reise aufbrechen – eine beeindruckende Kavalkade, selbst bei dem aufwendigen Standard in Britisch-Indien.
Der Großteil des mächtigen Trosses verließ Kalkutta schon vorher, um auf dem Landweg nach Benares zu gelangen. George, Emily und Fanny legten diese erste Reiseetappe per Boot den Ganges flussaufwärts zurück; der Marsch an sich würde erst beginnen, wenn sie in Benares zu dem Reisezug stießen. Am 21. Oktober 1837 brachen sie auf.
Während der ersten dreieinhalb Wochen, die sie für die tausend Kilometer nach Benares brauchten, war das Wetter so schwül und die Landschaft so monoton, dass Emily sich ernsthaft zu fragen begann, ob das alles tatsächlich dem Leben in Kalkutta vorzuziehen sei. Als sie in Benares zum erstenmal die Zelte erblickte, die von nun an ihr Zuhause sein sollten, musste sie schlucken: „Wir kamen um fünf Uhr an und fuhren sechs Kilometer durch enorme Menschenmengen und Staubwolken zu unserem Lager. Der erste Abend im Zelt war unbequemer, als ich es mir je vorgestellt hatte. Alle sagten immer wieder: ›Was für ein wunderbares Camp‹, ich dagegen konnte mich nicht erinnern, jemals ein so schmutziges, melancholisches Elend gesehen zu haben.“
Bemerkenswert ist, dass Emily und Fanny zwar sehr viel Zeit miteinander verbringen mussten, sich jedoch von allen Eden-Schwestern am wenigsten ähnlich waren. Sie mochten sich gern, aber in ihren Interessen und Ansichten waren sie Welten voneinander entfernt. Fanny war nur sechs Jahre jünger, aber der Altersunterschied hätte leicht doppelt so groß sein können. Voller Lebenslust und unbeschwert genoss sie den Aufenthalt in Indien durch und durch. Die Hitze schien ihre Lebensgeister geradezu anzuregen. Von Kalkutta aus hatte sie schon öfter zusammen mit William und seinen Freunden Ausflüge „aufs Land“ unternommen und war ein alter Hase in dem, was Emily voller Abscheu „dieses unstete Leben“ nannte. Die unterschiedliche Einstellung zum Leben spiegelte sich in den persönlichen Einstellungen der beiden zu ihren Zelten: Während Emily ihres „Elendshalle“ und das von George „Ekelspalast“ schimpfte, taufte Fanny ihr Zelt „Feenschloss“ und schwor, dass sie recht glücklich bis an ihr Lebensende darin leben könnte.
Emilys „melancholisches Elend“ bestand aus vier privaten Zelten für den Generalgouverneur und seine Verwandten; jeder hatte eines für sich, Emily und Fanny dazu noch gemeinsam eine Art Salonzelt, das das Viereck vervollständigte. „Elendshalle“, „Ekelspalast“ und „Feenschloss“ waren jeweils unterteilt in Schlafzimmer, Ankleideraum und Wohnzimmer, alles reichlich mit spitzenbesetzten Wandbehängen ausgestattet und durch Gänge miteinander verbunden. Neben dem Zelt des Generalgouverneurs stand noch ein großes Festzelt für offizielle Dinnerpartys und daneben ein noch prächtigeres Durbar-Zelt, in dem George größere Empfänge und Bälle geben konnte. Von diesem Zentrum aus erstreckte sich der Rest des Lagers, ein Zelt neben dem anderen in richtiggehenden Straßenzügen angeordnet – Küchenzelte, Zelte für die Stallungen, Krankenzelte und natürlich Schlafstätten für den gesamten Begleittross. Doch obwohl Emily diesen Anblick zugegebenermaßen beeindruckend fand, konnte sie sich doch nicht dazu durchringen, ihn auch noch schön zu finden: „Es hat einfach etwas Lagerartiges, Instabiles“, schrieb sie. „Ich habe immer schon richtige Häuser vorgezogen, und das wird auch weiterhin so sein.“
Täglich musste diese kleine Stadt abgerissen und wieder aufgebaut werden. Emily, Fanny und George hatten sich schon bald daran gewöhnt, dass ihnen ihre Möbel jeden Abend buchstäblich unter dem Allerwertesten weggezogen wurden, damit man für den frühzeitigen Aufbruch zusammenpacken konnte. Allerdings bestand ihr Mobiliar keineswegs aus Klapptischen, Gartenstühlen und Papptellern. Schließlich repräsentierte der Generalgouverneur den Union Jack: Abends gab es ein ausgeklügeltes Menü an richtigen Esstischen und vom besten Porzellan des Regierungssitzes in Indien, den Erdboden bedeckten dicke Teppiche; sogar die kompletten Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme eines Theaters führte man ständig mit, damit den geladenen Gästen nicht etwa langweilig würde. Wenn die gesamte Kolonne unterwegs war, erstreckte sie sich über fast zwei Kilometer; oft traf das vordere Ende schon am Etappenziel ein, bevor die Nachhut das Camp des Vortags überhaupt verlassen hatte.
Obwohl Emily ständig darüber schimpfte, jeden Morgen um halb sechs aufstehen und um sechs Uhr unterwegs sein zu müssen, war sie doch froh über die Regelung, dass niemand vor dem Generalgouverneur aufbrechen durfte.
So entgehen wir wenigstens all dem Staub. Die Hälfte der Strecke bringen wir auf dem Rücken eines Elefanten hinter uns, die andere zu Pferde. Zu dieser Tageszeit ist es angenehm kühl, wirklich schönes Wetter. Manchmal legen wir nur sieben oder acht Meilen zurück. Irgendwie scheint es schon absurd, zwölftausend Menschen mit all ihren Kamelen und Elefanten und Pferden und Zelten und Kisten so ein kurzes Stück durch die Gegend zu bewegen, aber es geht eben nicht anders.
Je weiter sich die riesige Kavalkade westwärts schob, um so weniger Gedanken machte sich Emily über ihre persönlichen Unannehmlichkeiten. Der Regierungssitz in Kalkutta war weitgehend ein Elfenbeinturm, in dem Emily und Fanny und zu einem gewissen Grad auch George weit am Großteil der indischen Bevölkerung vorbeilebten. Jetzt sah sie zum erstenmal das reale Indien. Wirkliche Menschen, wirkliche Gerüche, eine wirkliche Landschaft. Mit einem Blick, der nicht durch ihre abgeschirmte Existenz und schwere gusseiserne Gitter beeinträchtigt wurde, sah sie sicherlich nicht nur angenehme Dinge, und wenn ihre empfindliche Nase oder ihr Künstlerauge verletzt wurden, zögerte sie keineswegs, das auch zum Ausdruck zu bringen: „Das Fazit meines Indienaufenthaltes ist, dass es sich um die malerischste Mischung von Menschen handelt, die ich je gesehen habe, und um die hässlichste Landschaft, die man je zusammengewürfelt hat.“ Das war ihr Urteil nach einem Monat Reisen. Dennoch war sie auf erfrischende Weise frei von den scheinheiligen Vorurteilen, die spätere Generationen von Anglo-Indern so schwer befallen sollten: „Ich wünschte, Du bekämst zur Abwechslung einmal ein kleines braunes Baby“, schrieb sie an eine ihrer gebärfreudigen Schwestern. „Sie sind so viel hübscher als weiße Kinder.“
Nach England sehnte sie sich noch immer, und die Höhepunkte ihrer Reise waren die Tage, an denen die dak, die Postboten, im Camp vorbeikamen. Die Nachrichten von den Vorbereitungen für die Krönung der jungen Königin Viktoria versetzten sie in helle Aufregung. Genau diese Art von Ereignissen liebte sie über alles, und sie konnte es fast nicht ertragen, all die Feierlichkeiten zu verpassen. Allerdings gab es genügend Ausgleich, zum Beispiel ihren Besuch bei einem besonders reichen Maharadscha in der Nähe von Allahabad. Er schickte ihnen sogar seine eigenen Elefanten, die sie zum Palast brachten. Als sie in der Abenddämmerung dort eintrafen, war nicht nur der Palast hell erleuchtet, sondern auch das ganze Dorf. Millionen kleiner Öllämpchen zierten jede Tür, jeden Torbogen und jeden Fenstersims. Emily war beeindruckt.
Eine so unglaubliche Festbeleuchtung habe ich bisher noch nicht gesehen. Auf Elefanten ritten wir wie Timur der Tatar durch das große Eingangstor in den Hof. All die Fackeln und Trommeln und Speerträger und überhaupt die Menschenmenge – es erschien mir wie ein Melodrama, das man, ins Unendliche vergrößert, durch ein Mikroskop betrachtet. Vor dem Tor eines unglaublich großen Hofes stiegen wir ab, während die Diener des Maharadschas für uns einen Teppich aus scharlachrotem und goldenem Brokat ausbreiteten. Wenn man sich vor Augen hält, dass der halbe Meter mehr als ein Pfund kostet und ich gerade festgestellt hatte, dass ich mir das für ein Abendkleid nicht leisten konnte, dann war es eine Schande, einfach darauf herumzutrampeln.
Die Strapazen, die sie hinnehmen musste, erschienen völlig unbedeutend im Vergleich zu den Entbehrungen der Briten in den entlegeneren Siedlungen. Emily konnte sich ganz und gar nicht vorstellen, wie sie überhaupt jene „schreckliche Einsamkeit“ überstanden. Sie fand es furchtbar, wenn sie an das isolierte, abgeschiedene Dasein dachte, das die Briten selbst in Bengalen und den anderen Protektoraten führten, obwohl dort so viele Militärangehörige und zivile Beamten mit ihren Familien lebten, dass man schon von einer „Ausländergemeinde“ sprechen konnte.
Die Ankunft des Generalgouverneurs und seiner mächtigen Entourage war deshalb für „diese armen, vergessenen Wesen“ ein Ereignis, dem sie entgegenfieberten. Die Präsenz von Lord Auckland und seinen berühmten Schwestern musste ihnen wie ein Gottesgeschenk erscheinen, dazu noch der riesige Begleittross – plötzlich waren sie von mehr Landsleuten umgeben, als sie in Jahren an einem Ort gesehen hatten. Eine einmalige Gelegenheit, lang vergessene Freuden wiederzubeleben: sich herauszuputzen, zu tanzen, vertraute Musik zu hören und sogar gepflegte Konversation zu treiben, falls die Gehirne von der Einsamkeit noch nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen waren.
Wie viel den Anglo-Indern ihre Anwesenheit bedeutete, merkte Emily daran, dass ihre Gäste bereitwillig anstrengende Dreitagesreisen auf sich nahmen, nur um bei einem offiziellen Mittagessen dabeizusein. Bei Emily bewirkte die Freude, mit der ihre Landsleute diesen dringend benötigten Kontakt mit ihresgleichen begrüßten, eine deutliche Steigerung ihres Selbstwertgefühls. Wenn es Aufgabe von George war, die Beziehungen zu den Herrschern der autonomen Staaten, durch die sie reisten, zu verbessern, dann war es Fannys und ihre Sache, alles zu tun, um das „Elend“ der dort ansässigen Briten zu vermindern. Ihretwegen ertrug sie einen schier endlosen Reigen von Partys, Bällen und Empfängen, bewunderte die Abendtoiletten der Damen und teilte ihre nostalgischen Gefühle für Kricket, kalte Temperaturen und andere heimatliche Genüsse. Sie hörte den Menschen, die ihr das Herz ausschütteten, so interessiert und teilnahmsvoll wie möglich zu, „obwohl viele von ihnen schon so lange im Dschungel leben, dass es auch mit ihren Manieren ziemlich vorbei ist – sozusagen vom Urwald ausgetrieben. Glücklicherweise spielt die Kapelle auch während des Essens so laut, dass der Großteil der Unterhaltung dabei untergeht.“
Ihr Mitgefühl galt vor allem den jungen, alleinstehenden Männern, hauptsächlich Plantagenbesitzern, Händlern und zivilen Angestellten der Ostindischen Kompanie, die außerhalb des britischen Territoriums leben und arbeiten mussten. Für Emily schien deren Schicksal die schlimmste aller vorstellbaren Qualen zu sein: „Wie sehr müssen manche dieser jungen Männer ihr Leben doch verfluchen! Letzte Woche haben wir einen getroffen, den wir aus Kalkutta kannten, und er wurde fast verrückt vor Freude, uns zu treffen. Drei Monate lang kein europäisches Gesicht zu sehen und kein einziges englisches Wort zu hören sei so schrecklich, dass man das seiner Meinung nach kaum beschreiben könne.“ Sie hörte voller Schaudern, dass er gegen Ende der Regenzeit, wenn Gesundheit und Laune ihren absoluten Tiefpunkt erreicht haben, das sichere Gefühl hatte, sterben zu müssen, und niemand wäre da gewesen, der ihn hätte begraben können. Noch bezeichnender fand Emily ihr Zusammentreffen mit dem Stiefsohn von „Mrs. O.“, einer ihrer Bekannten aus London: „… der, dessen Bild sie ständig mit sich herumtrug, weil er so ein wunderschönes Geschöpf war“. Jetzt war dieser Adonis „ein glatzköpfiger, fahler, zahnloser alter Mann, der außer von der Tigerjagd von nichts mehr eine Ahnung hat. Lass bloß keinen Deiner Söhne nach Indien“, warnte sie ihre Schwester Eleanor, „das ist die Lehre aus alldem. Und denke immer daran, dass auch ich als alte, schwache Frau aus Indien zurückkehren werde.“
Während der ersten beiden Monate ihrer Reise war Emily allerdings alles andere als schwach. Da sie so viel Mitgefühl für ihre Landsleute empfand, trat ihr typisches Selbstmitleid vorübergehend so weit in den Hintergrund, dass sie zugab, sich zu amüsieren. In jedem ruhigen Moment nahm sie sich ihr Skizzenbuch vor und hatte bald ein ansehnliches Portfolio mit vielen Zeichnungen und Aquarellen von Menschen, Tempeln, Statuen und Landschaften beisammen. In ungewohnter Unternehmungslust zog sie sogar ab und zu auf eigene Faust los, um besonders beeindruckende Szenerien festzuhalten.
Doch ihre gute Laune sollte nicht andauern. Zum Jahreswechsel 1837/38 schob sich die gewaltige Karawane durch das Königreich Audh. Der König hieß sie so aufwendig willkommen, wie sie es bisher noch nirgendwo erlebt hatten, und seine Paläste entsprachen in ihrer Pracht inzwischen dem gewohnten Bild. Doch wo Emily angesichts des vielfarbigen Kaleidoskops von Indien erst die Augen übergegangen waren und sie sich dann geblendet fühlte von der Opulenz, mit der man sie empfing, sah sie nun direkt das Elend hinter den großartigen Fassaden. Bei dieser ersten Konfrontation trieb es ihr die Tränen in die Augen. Als sie Kanpur verließen, bot sich ihnen die ganze Tragödie von Indien dar.
Jetzt kamen wir in die Hungergebiete. Seit anderthalb Jahren hat es hier nicht mehr geregnet, alles Vieh ist weggestorben. Auch die Menschen sind fortgegangen oder gestorben. Das Elend ist furchtbar, man kann sich diese schrecklichen Dinge gar nicht vorstellen, die wir hier zu Gesicht bekommen. Besonders die Kinder sind zum Großteil nur mehr Skelette, ihre dünne Haut spannt sich über den Knochen, sie haben keinen Fetzen Kleidung am Leib und ähneln kaum noch menschlichen Wesen. Ihr Anblick ist unbeschreiblich; die Frauen sehen aus, als seien sie schon begraben, ihre Schädel sind einfach schreckenerregend. Ich glaube, mit so einem verhungernden Kind gäbe es kein Verbrechen, das ich nicht für ein bisschen Nahrung begehen würde. Ich darf gar nicht aufhören, über das Unrecht dieser ganzen Sache nachzudenken.
Es war typisch für Emily, dass sie dieser Tragödie nicht den Rücken kehrte. Für sie galt die strikte Tradition des noblesse oblige. Wo viele ihrer Zeitgenossen eher das parfümierte Taschentuch fest vor die empfindliche Nase gedrückt hätten und schnellstens vorbeigeeilt wären, sah Emily es als ihre Pflicht an zu helfen, wo sie nur konnte.
Als ich gestern vor dem Frühstück zu den Ställen ging, fand ich ein elendes kleines Baby, das eher wie ein uraltes Äffchen aussah, aber mit ganz stumpfen, verschleierten Augen. Du hättest sicher geweint, wenn Du gesehen hättest, mit welcher Hast das kleine Etwas auf eine Tasse Milch flog. Inzwischen haben wir die Mutter gefunden, aber sie ist auch nur ein Skelett und sagte uns, dass sie schon seit einem Monat kein Essen mehr für das Baby hatte. Dr. Drummond meint zwar, dass das Kleine schon zu unterernährt ist, um zu überleben, aber ich will versuchen, es durchzubringen.
Dank Emilys Fürsorge überlebte das Kind tatsächlich. Aber mehr als achthunderttausend Menschen fielen dieser Hungerkatastrophe zum Opfer. Obwohl die Küchenmeister im Tross des Generalgouverneurs den Hungernden zukommen ließen, so viel sie nur konnten, verschlimmerte die Anwesenheit von zwölftausend zusätzlichen Menschen die Lage nur noch. Zwei Wochen lang waren sie so schnell wie möglich unterwegs, um aus dem Hungergebiet herauszukommen. Keine Festlichkeiten mehr, keine Zeit zum Skizzieren und Malen, kaum Erholungspausen. Der Staub schien sich überall festzusetzen, die Straßen wurden immer schlechter, und die Hitze, die sie eine Weile verschont hatte, schlug wieder unerbittlich zu. Als sie Ende Februar Delhi erreichten, war Emily vollkommen erschöpft.
Die Gegensätze von Hunger und Überfluss, von nie gesehener Armut und groteskem Reichtum und überhaupt die Konfrontation mit all den indischen Widersprüchlichkeiten, Frustrationen und Unzulänglichkeiten hätten Emily Indien gänzlich verleiden können. Doch obwohl sie weiterhin über das Klima, die Landschaft und vor allem über die Tatsache schimpfte, dass sie hier war anstatt in ihrem geliebten England, entwickelte sie doch echte Sympathie für das Land und seine Bewohner. Anfangs war ihre instinktive Reaktion auf alles Fremdländisch-Indische eine etwas spöttische Ungläubigkeit. Beschreibungen und Anekdoten, mit denen sie ihre Briefe ausschmückte und die ihren Empfangern so viel Vergnügen bereiteten, hatten eher Karikaturen geglichen. Das änderte sich jetzt. Je mehr sie kennenlernte, umso größer wurde ihr Respekt für die Menschen, die in diesem riesigen Land lebten. Je deutlicher sie die Position der Engländer in Indien als Anomalie empfand, umso mehr wurden anstelle der Inder ihre eigenen Landsleute zur Zielscheibe ihres Missfallens. Während sie in besonderen Fällen Mitleid hatte, war sie nun schnell dabei, die Auswüchse im Verhalten der Gruppe insgesamt zu kritisieren. „Ich mag Engländer außerhalb ihres eigenen Landes nicht besonders“, schrieb sie aus Delhi. „Diese Stadt ist ein eindrucksvolles Lehrbeispiel. Solche unglaublichen Überreste von früherer Macht und einstigem Reichtum sind jetzt im Verschwinden begriffen, und irgendwie fürchte ich, dass wir schrecklichen Engländer hier gnadenlos zugeschlagen haben … einfach dahergekommen, alles ausgebeutet und verdorben haben.“
Von Delhi aus bewegten sie sich endlich nach Norden auf das Gebirge zu. Doch die sechswöchige Etappe bis Simla wurde der deprimierendste Teil der bisherigen Reise. „Unsere Schwierigkeiten werden von Tag zu Tag größer“, lamentierte Emily. „Die Straßen sind in einem derart teuflischen Zustand – es tut mir leid, aber ich finde keine anderen Worte dafür –, und ich bin so erschöpft, dass ich mich kaum noch auf einem Pferd halten kann.“ Am schlimmsten aber war die Tatsache, dass der „liebe George“ in sehr schlechter Stimmung zu sein schien.
Tatsächlich war der „liebe George“ völlig am Ende seiner Kräfte vor Sorgen und Frustrationen, denn seine Kundschafter in Afghanistan schickten ihm immer beunruhigendere Berichte über die dortige Situation. Alle Versuche, Dost Mohammed zu einer Allianz zu überreden, waren fehlgeschlagen. Die Stadt Herat in Westafghanistan wurde von einer persischen Armee belagert, die von den Russen unterstützt, finanziert und wahrscheinlich auch befehligt wurde. Angeblich befanden sich überall russische Spione, und Lord Auckland wusste, dass die Zeit knapp wurde. Wenn er nicht bald handelte, konnte Herat fallen, für die Russen wäre damit über Kandahar der Weg nach Indien frei, und die gefürchtete Invasion könnte stattfinden. Aber Emily vertraute derart unbeirrt auf die Fähigkeiten ihres Bruders, dass ihr nie in den Sinn kam, er könnte die Situation nicht völlig unter Kontrolle haben – selbst wenn sie nie richtig verstanden hatte, was in Afghanistan eigentlich vor sich ging. Deshalb schob sie seine irritierte Stimmung auf die Strapazen der Reise.
Mitte März erreichten sie die Vorgebirge des Himalaja. Von nun an kamen sie wegen der steilen, gewundenen Bergstraßen noch langsamer voran, aber allein der Anblick der Berge und die Aussicht auf kühleres Wetter verbesserten Emilys Laune erheblich. Sie ließ sich sogar klaglos von ihren Trägern in einer offenen Sänfte über abgrundtiefe Schluchten tragen, wobei sie nur höflich darum bat, man möge doch nicht um die Wette rennen …
Schließlich trafen sie am 3. April in Simla ein. Emily war außer sich vor Freude:
Der ganze Aufwand hat sich wirklich gelohnt. Es ist wunderschön hier, und erst das Wetter! Wir bekamen ja nie auch nur einen Hauch von frischer Luft zum Atmen. Jetzt erst kann ich mich erinnern, wie sich das überhaupt anfühlt. Kühl, erfrischend, süß und sehr angenehm für die Lungen. Unser Haus ist perfekt, wenn es erst mit all den guten Möbeln und Teppichen eingerichtet ist, die wir so weit mitgeschleppt haben. In jedem Zimmer gibt es einen Kamin, wir können die Fenster offen lassen, überall rote, blühende Rhododendronbäume und wunderschöne Wege mit Büschen, wie in England … Mir erscheint dies als der schönste Teil von Indien. Nicht, dass ich nicht sofort wieder aufbrechen und in Windeseile durch die heißen Ebenen und durch den warmen Wind stürmen würde, wenn mir jemand verspräche, ich könnte die Segel hissen und nach Hause fahren, sobald ich wieder in Kalkutta sei … Aber da mir niemand so ein Angebot macht, kann ich hier besser abwarten als irgendwo anders. Es ist wie mit Frischfleisch, man hält sich einfach besser hier.
Obwohl es noch zwanzig Jahre dauern sollte, bis diese lebendige kleine Gebirgsstadt die offizielle Sommerresidenz des britischen Machthabers wurde, gab es doch schon eine größere Ansiedlung von Engländern, die vor der Hitze der Ebenen hierher geflohen waren und so taten, als befänden sie sich überhaupt nicht in Indien. Der Generalgouverneur wollte mit seinem Tross so lange hierbleiben, bis der Staatsbesuch bei Ranjit Singh im Pandschab vorbereitet wäre. Nur aufgrund ihrer Loyalität zu George versagte Emily sich die inständige Hoffnung, dass die Arrangements niemals zustande kämen.
Je näher der Sommer rückte, umso mehr bevölkerte sich die kleine Siedlung in den Bergen: Militärangehörige auf Urlaub, Jagdgesellschaften, Familien mit Töchtern im heiratsfähigen Alter – alle in Ferienstimmung. Jeder Tag brachte neue Unterhaltungen und Zerstreuungen: Dinnerpartys, Whistspiele, Laienschauspiele, Picknicks auf dem Land und Feste, Pferderennen, Hochzeiten und Bälle. Das unerträglich heiße Klima von Kalkutta und die Strapazen der Reise schienen weit weg: „Wenn nur der Himalaja bloß eine Verlängerung von Primrose Hill oder Penge Common wäre, hätte ich nichts dagegen, den Rest meines Lebens hier zu verbringen.“
Emilys wiedergewonnene Vitalität erstaunte vor allem ihre Bediensteten; dass die Burra Memsahib derart häuslich sein konnte, hatten sie nicht geahnt. Ihren Schneidern zeigte sie, wie die neuen Chintzvorhänge für das Wohnzimmer genäht werden sollten, sie brachte ihrem Koch bei, wie man Erdbeereis macht, und füllte mehrere Skizzenbücher mit Porträts und Landschaften.
Doch so sehr sie all diese englischen Vergnügungen schätzte und genoss, so wurde ihre Freude doch durch das deutliche Gespür für die Absurdität der Situation gedämpft: „Hier sitzen wir nun“, schrieb sie nach einem Tag auf einem „Jahrmarkt“, „einhundertfünf Europäer, umgeben von mindestens dreitausend Bergbewohnern, die in ihre Decken gehüllt dahocken, unsere kleinen Amüsements beobachten und sich bis zum Boden verneigen, wenn ein Europäer auftaucht. Ich frage mich manchmal wirklich, warum sie uns nicht einen Kopf kürzer machen, und damit hätte es sich dann.“ Zwischen ihren Verpflichtungen pusselte Emily gern im Garten der Residenz des Generalgouverneurs herum (die George zu Ehren umgetauft wurde und nun Auckland House hieß), überwachte das Anpflanzen neuer Büsche oder Spargelbeete, oder sie saß ganz einfach da und freute sich an der atemberaubend schönen Aussicht, genoss das kühle Wetter oder das Zwitschern der „englischen Amseln“ in den Bäumen.
George amüsierte sich allerdings keineswegs so prächtig. Er verfügte über viele herausragende Eigenschaften; im Privatleben galt er als sehr freundlicher und rücksichtsvoller Mensch, in offizieller Funktion genoss er den Ruf, sehr gewissenhaft, ordentlich und fair zu sein. Aber er hatte einen Fehler, der dazu führte, dass er von der Geschichte als der unfähigste aller Generalgouverneure verdammt werden sollte: Er war auf eine gefährliche – und im Falle Afghanistans fatale – Art entscheidungsscheu. Dort hatte es zwar bereits lange vor ihrem Aufbruch aus Kalkutta Probleme gegeben. Doch bis sie Simla erreichten, hatte George immer noch in keiner Weise gehandelt. Fairerweise muss man sagen, dass die politischen und persönlichen Animositäten zwischen seinen beiden wichtigsten Ratgebern, Oberst Wade im Pandschab und Hauptmann Burnes in Kabul, die Situation für ihn nicht leichter machten. Während Burnes für Konzessionen und eine endgültige Einigung mit Dost Mohammed eintrat, übte Wade Druck aus auf George, Dost Mohammed zu stürzen, da er wegen seiner mangelnden Kompromissbereitschaft ohnehin kein geeigneter Verbündeter sei. Wade wollte ihn lieber durch einen versöhnlicheren Monarchen ersetzt wissen und hatte auch bereits seinen Kandidaten – Schah Schuja Mirza, den Sohn des früheren Königs von Afghanistan, den Dost Mohammed selbst vom Thron verjagt hatte.
Burnes’ Plan einer Einigung mit Dost Mohammed würde aber ganz unweigerlich Ranjit Singh vor den Kopf stoßen, und dieser wiederum war ein wertvoller potenzieller Verbündeter. Wades Plan, Dost Mohammed zu stürzen und Schah Schuja einzusetzen, konnte allerdings nur mit militärischer Gewalt durchgeführt werden. Lord Auckland sah sich einfach nicht in der Lage zu entscheiden, welches das kleinere Übel war. Erst als William McNaghten, sein politischer Sekretär, sich ganz auf die Seite von Wade stellte, rang George sich zu einer – katastrophalen – Entscheidung durch. Dost Mohammed musste beseitigt werden.
Im August schrieb Emily:
All diese Kriegsvorkehrungen sind auf sehr viel Nervosität zurückzuführen. Der arme George, er trägt schwer an der Verantwortung. Keine Minister, kein Parlament an seiner Seite, und sein Kabinettsrat, wenn man das so nennen kann, ist unten in Kalkutta; er muss alle Antworten allein finden, und ich glaube, dass er das sehr gut macht.
Emilys Vertrauen in Georges weise Entscheidungen war so unerschütterlich, dass sie nur die positiven Seiten eines möglichen Krieges sehen wollte, obwohl ihr vor dem Gedanken an Blutvergießen graute. „Etwas Gutes hat dieser Krieg für uns. Man hält es nicht für angebracht, dass George Ranjit Singh gegenübertritt, ohne nicht zehntausend Mann hinter sich zu haben, die unsere Armee allerdings erst im November bereitstellen kann. So haben wir noch drei Wochen hier in diesem kühlen Klima, und das sind drei heiße Wochen weniger in der Ebene.“
Allerdings kam zu den Verhandlungen mit Ranjit Singh eine weitere Dimension hinzu, denn George wollte ihn überreden, sowohl Geld als auch Truppen beizusteuern, um den Sturz von Dost Mohammed zu gewährleisten. Aus diesem Grund schickte er eine Abordnung zum Hof des Maharadschas in den Pandschab und empfing seinerseits in Simla eine Delegation zum Gegenbesuch. Deren Ankunft verursachte viel Aufregung, und Emily meisterte die Situation mit Bravour – obwohl ihre Anstrengungen keineswegs voll gewürdigt wurden.
Diese Delegation der Sikhs ist nun schon fast eine Woche bei uns. Sie kleiden sich wunderbar und erzählen den unsäglichsten Unsinn, den man sich vorstellen kann, über Rosen, die im Garten der Freundschaft blühen, und Nachtigallen, die aus den Tiefen der Zuneigung trällern, seit die zwei Mächte aufeinander zugegangen sind. Wir bewirten sie im ganz großen Stil, und ich bemühe mich nach Kräften, George beim Austausch von Komplimenten mit ihnen zur Seite zu stehen. Sie schätzen es allerdings überhaupt nicht, mit einer Frau sprechen zu müssen. Diesen armen, unwissenden Kreaturen ist nicht im mindesten bewusst, was für ein edles Wesen eine Engländerin ist. Wenn sie einmal einen Gedanken an uns verschwenden, dann ist es nichts als Verachtung. Ein schwerer Fehler …
Die Sikh-Abgeordneten folgten nur den strikten Anordnungen ihres Herrschers. Ranjit Singh war sehr angetan davon, dass sein Erzfeind entthront werden sollte. Nur hatte er nicht vor, seine eigenen Leute oder sein eigenes Geld in diesen Coup zu investieren. Das von vorneherein klarzustellen hätte allerdings einen Plan ins Wanken gebracht, der ihm sehr gelegen kam. Der „unsägliche Unsinn“ war wohlkalkuliert, sollte schmeicheln und irreführen, und er verfehlte seine Wirkung nicht. Als schließlich die letzten Vorbereitungen für die große Begegnung abgeschlossen waren, lebte George immer noch glücklich in der Illusion, dass die erwünschte Hilfe gewährt werde.
Heute in vierzehn Tagen werden wir wieder in diesen furchtbaren Zelten leben – ich könnte einen hysterischen Anfall bekommen, wenn ich nur daran denke. Alles wird bereits eingepackt, und alle geben wie immer ihr Bestes, um es uns ohne Nachsicht so ungemütlich wie möglich zu machen. Die Vorbereitungen nehmen schon schreckenerregende Ausmaße an, Kisten und Vorräte werden bereits auf Kamelen abtransportiert. Diese Woche müssen schon viele Leute hinunterziehen in die Ebene. Die Armen, das ist etwa so klug, als ob ein Stück Brot vom Teller springen und sich gleich selbst zum Toasten begeben würde.
Mit dem Idyll war es nun vorbei. Nach sieben wunderbaren Monaten in Simla nahmen sie ab dem 9. November 1838 wieder ihr „Wanderleben“ auf. Diesmal gab es keinerlei Vorfreude wie damals, als sie von Kalkutta aus aufbrachen, keine Spur der Erleichterung, endlich der feuchten Hitze zu entkommen, die Emily vormals so aufgebracht hatte, dass sie sich sogar mit den Unbequemlichkeiten des Zeltlebens abgefunden hatte. Der Reiz, neue Menschen und Orte kennenzulernen und so einen Ausgleich für die fehlenden Freunde und Bekannten zu finden, wirkte bei diesem erneuten Aufbruch überhaupt nicht. In Simla hatte sie ihre Kisten auspacken und ihre Träume von England auffrischen können. Hier, inmitten von Rhododendronbüschen, Tulpen und viel frischer Luft konnte sie das alles in einer Art Ebenbild rekonstruieren. Jetzt wurde sogar dieses zerbrechliche Gebäude niedergerissen, England entglitt ihr wieder. Obwohl George seinen Schwestern gegenüber die ernste Lage in Afghanistan herunterspielte, um sie nicht zu beunruhigen, blieb es nicht aus, dass sie die gespannte Atmosphäre zwischen den Männern bemerkten. Ein seltsamer, wenngleich schwer fassbarer Schatten schien über ihnen allen zu lasten und ihre Abreise zu verdunkeln. Und Emilys Verzweiflung wurde durch das Wetter noch verstärkt:
Seit sechs Tagen sind wir nun schon in diesem Zeltlager, und es schüttet, wie das überhaupt nur in Indien möglich ist. Dies grässliche Elend kann man gar nicht beschreiben; um jedes Zelt – manchmal auch mitten durch – laufen kleine Gräben voller Schlamm, in den man unweigerlich hineintritt. Die Bediensteten sind pudelnass und wirken sehr unglücklich, und sogar die Kamele rutschen ständig aus. Wenn ich zu Georges Zelt gehen will, brauche ich einen Regenschirm, und zum Esszelt werden wir in überdachten Sänften getragen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was jemanden dazu verleiten könnte, nach Indien zu gehen und durch das Land zu ziehen – wenn die Leute doch in der Nähe des Manchester Square in einer Mansarde mit Kamin und Bretterboden wohnen und von ihrer Arbeit (vielleicht mit einem Zubrot durch Waschen und einfache Tätigkeiten) leben können.
Es war vereinbart worden, dass das große Treffen zwischen dem Generalgouverneur von Indien und dem „Löwen des Pandschab“ in Ferozepur an der Grenze zwischen Britisch-Indien und dem Pandschab stattfinden sollte. Ranjit Singh hatte sein Lager bereits am Westufer des Flusses Sutlej aufgeschlagen; die britische Indus-Armee war mit vierzehntausend Mann schon am Ostufer stationiert und bereit, dem afghanischen Thronbewerber Schah Schuja das Geleit nach Kabul zu geben. Am 26. November traf schließlich auch Lord Auckland mit seiner Begleitung ein.
Im Gegensatz zu der ordentlichen, beinahe zivilisierten kleinen Zeltstadt, die sie bisher auf jeder ihrer Stationen seit der Abreise aus Kalkutta aufgebaut hatten, erschien Emily das Lager am Sutlej wie eine Irrenanstalt: „Die Kavallerie liegt gleich hinter unseren Zelten“, klagte sie. „Und immer wieder reißt sich irgendein Pferd los, beißt all die anderen, die wiederum schlagen aus und reißen sich auch los. Dann wachen die Pferdeburschen auf und fangen an zu brüllen. Die Knechte müssen die Zelthaken neu einschlagen, während überall die Pferde wiehern, bis sie wieder angebunden sind. Dazu gibt es noch einen (oder mehrere) völlig verrückte Trommler im Regiment, die morgens um fünf Uhr zu trommeln anfangen und bis sieben Uhr nicht aufhören. Wahrscheinlich ist das ein militärisches Manöver, aber darauf könnte ich verzichten.“
Das Klima, der Lärm und vor allem die gespannte Atmosphäre im Lager drohten ihr den letzten Rest Geduld und Nervenkraft zu rauben. Seit ihrer Abreise aus Simla litt sie dauernd unter Kopfschmerzen. Die ganze Strecke nach Ferozepur hatte sie hinter geschlossenen Vorhängen in einer Kutsche zurückgelegt, sich geweigert, etwas zu essen, mehr zu sprechen als unbedingt nötig, und keine Briefe mehr geschrieben. Als sie den Sutlej erreichten, blieb sie ganz im Bett.
Aber die Neugier war ein kräftiges Heilmittel. Nachdem in der Zeltstadt endlich etwas Ruhe eingekehrt war, bat George Ranjit Singh zum Auftakt einer langen Reihe von Empfangen, Paraden, Einladungen zum Tee oder Frühstück und anderen Festen, die zur Feier dieser historischen Begegnung geplant waren. Es hätte schon etwas Härteres als Kopfweh sein müssen, um Emily von diesem ersten Treffen mit dem sagenhaften Maharadscha fernzuhalten. Kurz nach ihrer ersten Begegnung griff sie gleich zur Feder; ihr ganzes Leiden war vergessen.

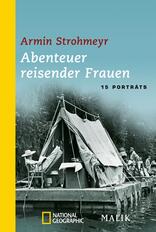
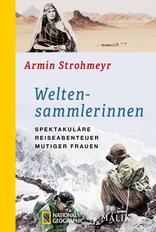
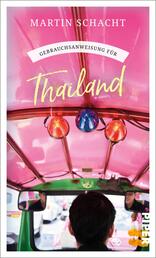
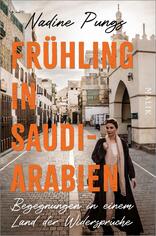
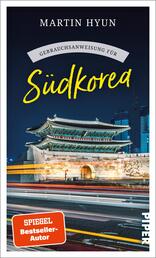





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.