
Meine abgeschminkten Jahre — Inhalt
Die junge Hamburger Geschäftsfrau Stefanie Giesselbach ist keine 30, als sie in Chicago verhaftet wird. Nach und nach begreift sie, dass sie für die dubiosen Zollgeschäfte ihres Arbeitgebers büßen soll. Sie verliert ihren Job, ihr Einkommen und ihren Partner und durchlebt vier Jahre Zwangsaufenthalt in den USA, schließlich muss sie für zehn Monate ins Gefängnis. Im Frauenknast erlebt sie Denunziation, Gewalt und Drogengeschäfte – aber auch Fürsorge und Zusammenhalt. Sie trainiert Hunde für Behinderte und eröffnet ihre eigene Eisdiele. Dabei notiert sie alles, was sie in dieser seltsamen Parallelwelt erlebt. Als sie endlich nach Hamburg zurückkehrt, hat sie fünfeinhalb Jahre verloren – aber eine Stärke gewonnen, die ihr niemand mehr nehmen kann.
Leseprobe zu „Meine abgeschminkten Jahre“
Kapitel 1
Die Letzten, von denen ich mich in Chicago verabschiede, sind Susan und Kurt. Meine Nachbarin kuriert gerade eine Krankheit aus und ist noch schwach auf den Beinen. Doch für einen kurzen Moment verwandelt sie sich wieder in das quirlige Energiebündel, als das ich sie eigentlich kenne. Sie rappelt sich vom Sofa hoch, springt aufgeregt um mich herum und umarmt mich. „Wir sehen uns wieder!“, versichern wir uns, lachend und zugleich mit Tränen in den Augen. „Schon bald! In Deutschland oder irgendwo sonst auf der Welt!“
Kurt hilft mir, meine beiden [...]
Kapitel 1
Die Letzten, von denen ich mich in Chicago verabschiede, sind Susan und Kurt. Meine Nachbarin kuriert gerade eine Krankheit aus und ist noch schwach auf den Beinen. Doch für einen kurzen Moment verwandelt sie sich wieder in das quirlige Energiebündel, als das ich sie eigentlich kenne. Sie rappelt sich vom Sofa hoch, springt aufgeregt um mich herum und umarmt mich. „Wir sehen uns wieder!“, versichern wir uns, lachend und zugleich mit Tränen in den Augen. „Schon bald! In Deutschland oder irgendwo sonst auf der Welt!“
Kurt hilft mir, meine beiden Koffer nach unten zu bringen. In Flip-Flops, knielangen Shorts und locker über dem Hosenbund hängendem T-Shirt sehe ich ihn noch in der Auffahrt des Park View Palace stehen und winken, bis er aus meinem Blickfeld verschwindet.
Moritz, mein Vorgesetzter, holt mich ab, um mich in seinem dunkelblauen Firmenwagen zum Flughafen zu bringen. Wir fahren pünktlich los, aber schon auf der Auffahrt zum Highway staut sich der Verkehr. Das Wetter ist frühsommerlich warm an diesem 23. Mai 2008 in Chicago, und bereits Freitagmittag scheinen sämtliche drei Millionen Einwohner der Stadt in ein verlängertes Wochenende aufzubrechen. Am Montag ist Memorial Day, der Feiertag zu Ehren der für Amerika gefallenen Soldaten.
Als wir endlich am Flughafen O’Hare ankommen, ist es schon so spät, dass Moritz gar nicht erst das Parkhaus ansteuert. Er bremst direkt vor dem Abflugterminal und lässt seinen Wagen mit eingeschaltetem Warnblinker stehen. Wir schnappen uns meine beiden Koffer, rennen zum Air-France-Schalter und verabschieden uns mit einer herzlichen Umarmung voneinander. „Wir sehen uns! Vielleicht schon bald in Hamburg!“
Ein bisschen verschwitzt und atemlos reihe ich mich zum Check-in ein. Ich bin froh. In elf Stunden wird Christoph mich am Hamburger Flughafen in seine Arme schließen. Anderthalb Jahre Fernbeziehung liegen dann endgültig hinter uns. Und auch meine Eltern, meinen Bruder und all meine Freundinnen und Freunde kann ich ab morgen endlich wieder sehen, wann immer mir danach ist.
Moritz entdeckt durch die Schiebetüren des Abflugterminals eine grimmig dreinblickende Politesse, die auf seinen Audi zusteuert, und spurtet los. Fast gleichzeitig mit der Ordnungshüterin kommt er bei seinem Auto an. Aus der Ferne beobachte ich, wie er wild gestikulierend auf die Frau einredet, um dann schnell in sein Auto zu springen und wegzufahren.
Meine Reisepapiere halte ich schon in der einen Hand, während ich mit der anderen und einem Knie meine Gepäckstücke vorwärtsbugsiere. Wenig später reiche ich den weinroten Reisepass und den Ausdruck meiner Online-Buchung über den Tresen. Eine freundliche Air-France-Mitarbeiterin beginnt mit dem Check-in, während ich einen der Koffer auf die Gepäckwaage wuchte.
„Stefanie!“, für einen Moment habe ich den Eindruck, dass jemand nach mir ruft. Ich achte nicht weiter darauf. Es ist unwahrscheinlich, dass ich gemeint bin. Wer sollte mich hier auf dem Flughafen schon kennen?
„Stefanie!“ Jetzt höre ich es laut und deutlich.
Merkwürdig. Da spricht jemand meinen Vornamen englisch, mit einem spitzen „S-t“ aus. Suchend drehe ich mich um.
Ich erkenne die drei sofort: Die beiden Männer und ihre Chefin sind von der amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Es ist knapp zwei Monate her, dass sie mich hier, am Flughafen, unverhofft in Empfang genommen haben, als ich von einem Osterurlaub aus Hamburg zurückkam. In einem ihrer Konferenzräume haben sie mich damals eingehend nach den Geschäftspraktiken meines Arbeitgebers befragt.
Ich starre die drei verständnislos und etwas genervt an. Was wollen sie denn jetzt noch? Auf den letzten Drücker, am Flughafen? Gab es vorher nicht genug andere Möglichkeiten, mich um eine Gespräch zu bitten?
„Stefanie, Sie sind verhaftet!“
Die Stimme der Chefermittlerin klingt feindselig und hart.
Ich reagiere so ungläubig, dass sie sich veranlasst sieht, jedes einzelne Wort ganz langsam und mit sichtlicher Genugtuung zu wiederholen. „Stefanie! Sie. Sind. Verhaftet.“
Für einen Augenblick steht die Zeit still. Verhaftet? Verhaftet? Verhaftet? Nur langsam nimmt mein Gehirn seine Tätigkeit wieder auf.
„Soll das ein Witz sein?“, frage ich gereizt.
„Umdrehen!“, schnappt sie.
Die Frau, die, wie ich mich jetzt erinnere, Mary heißt, will mir Handschellen anlegen. Ich bemühe mich, gelassen zu bleiben, um sie, aber auch mich selbst zu beruhigen.
„Nicht nötig. Ich komme freiwillig mit. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses Missverständnis aufklärt.“
„Umdrehen!“, wiederholt die Ermittlerin herablassend, als habe sie meinen Einwand nicht gehört. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meine Arme hinter dem Rücken zu verschränken. Dann höre ich es klicken. Schmerzhaft fest packt sie mich am linken Oberarm und schiebt mich durch die Menschenmenge in der Abflughalle.
Ein paar Tage zuvor habe ich in Chicago eine kleine Abschiedsparty gegeben. Allzu viele neue Freundschaften haben sich hier in anderthalb Jahren nicht entwickelt, aber einige Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen. Allen voran Susan und Kurt, meine Nachbarn im Park View Palace. Und Susans Freundin Terri mit ihrem Mann David, die mit ihrer kleinen Tochter zwei Etagen unter uns wohnen. Eins der netten schwulen Paare, von denen in unserem Hochhaus ziemlich viele wohnen, zählte auch zu meinen Gästen. Und dann noch eine Kollegin aus der Außenhandelsbranche sowie mein Vorgesetzter Moritz mit seiner Ehefrau.
Gemeinsam blickten wir aus meinem Wohnzimmer im 47. Stock auf den Michigan-See hinunter, der sich im Licht der untergehenden Sonne dunkelrot verfärbte, und auf die aufblühenden Bäume. Der Ausblick war fantastisch. Etwas Vergleichbares würde ich in Hamburg wohl kaum finden.
Auch meine Mutter war noch einmal für ein paar Tage zu Besuch in Chicago. Begeistert klapperte sie tagsüber die vielen Museen und Sehenswürdigkeiten der Stadt ab, während ich im Büro über der Abwicklung letzter Geschäftsvorgänge schwitzte. Wahrscheinlich kannte sie die Windy City – die Stadt, in der stets ein Wind weht – inzwischen besser als ich.
Als ich sie zum Flughafen brachte, war sie ungewöhnlich sentimental. Meine Mutter ist sonst keine Glucke, die mir mit ihren Ängsten und Sorgen die Luft zum Atmen nimmt. Aber diesmal schloss sie mich lange und fest in die Arme. „Steffi, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl“, sagte sie. „Willst du nicht lieber sofort mit mir nach Hause fliegen?“
„Jetzt gleich?“ Ich sah sie ungläubig an.
„Ja. Sofort“, setzte sie nach und war dabei ein bisschen blass um die Nase. Ich wischte ihre Bedenken mit einem Lachen fort. „Ach, Mama! Ich hab hier doch noch ein bisschen zu tun. Und in einer Woche sehen wir uns schon in Hamburg!“
Mary schiebt mich weiter durch die Abflughalle. „Was ist eigentlich los? Was soll das alles?“, frage ich immer wieder.
„Das werden Sie noch früh genug erfahren!“, gibt sie barsch zurück.
Sobald sie merken, was hier vor sich geht, weichen die Reisenden erschrocken vor uns zurück. Die beiden Männer haben sich mein Gepäck und meinen Ausweis gegriffen und folgen uns unnatürlich dicht. Sie tragen zwar Zivil, aber ihre Handschellen und Waffen am Hosenbund stellen sie offen zur Schau. Erst als wir schon fast am Ausgang sind, kommt Mary auf die Idee, mir meine leichte Sommerjacke so über die Schultern zu legen, dass die gefesselten Handgelenke verdeckt sind.
Vor einem Schild mit dem Schriftzug Welcome to Chicago wartet eine ganze Wagenkolonne auf uns. Homeland Security steht in fetten Lettern auf den Autos.
„Wir fahren zum Gericht. Ins Zentrum“, verkündet Mary.
Bis in die Innenstadt, denke ich verwirrt, das kann ganz schön dauern. Dabei muss ich dringend auf die Toilette.
Eigentlich wollte ich das gleich nach dem Check-in erledigen.
„Ich muss mal“, melde ich schüchtern bei Mary an.
Sichtlich genervt geleiten mich die Ermittler zurück ins Terminal. Über Rolltreppen, quer durch die Ankunftshalle und an einem Burger-Restaurant vorbei bringen sie mich zu ihrem Büro. Erst im Vorraum der Toilette nimmt Mary mir die Handschellen ab.
„Lassen Sie die Tür offen stehen!“, ordnet sie barsch an. Mir liegt die Frage auf der Zunge, ob sie mir auch noch den Hintern abwischen will. Aber ich beherrsche mich und halte den Mund.
Zurück vor dem Flughafengebäude, schieben sie mich nicht etwa in eines ihrer Dienstautos, sondern auf die Rückbank von Marys privatem Kleinwagen. Ein junger Ermittler mit Bürstenschnitt setzt sich nach vorne auf den Beifahrersitz. Er war auch bei der Befragung vor zwei Monaten dabei. Als arrogant und anmaßend habe ich ihn in Erinnerung. Er hat damals versucht, mich einzuschüchtern, mir gedroht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiederbegegnen würden.
Mary stellt ein mobiles Blaulicht auf das Autodach, dann rasen wir auf dem Standstreifen an den Verkehrsstaus vorbei. Nach einiger Zeit gehen Funksprüche im Auto ein, aufgeregte Durchsagen wechseln hin und her.
„Wir haben ihn“, verstehe ich als Erstes. Dann schält sich ein Name aus dem Rauschen und Knattern des Sprechfunks heraus: Moritz Böhm.
Ich schlucke. Auch mein Kollege ist verhaftet?
Wie ich später erfahre, haben sie ihn in einer spektakulären Aktion auf der Autobahn gestellt, als er vom Flughafen zurück in die Stadt fuhr: Hände über dem Kopf, Beine gespreizt, den Oberkörper gegen das Wagendach gepresst.
„Und wir haben die Giesselbach!“, ruft Mary triumphierend ins Funkgerät. „Einfache Festnahme. Kein Fluchtversuch, kein bewaffneter Widerstand.“
Ich schüttele den Kopf. Hat etwa jemand damit gerechnet, dass ich einen Revolver ziehe und wild um mich schieße? Und was ist mit meinem Flug? Die Maschine nach Deutschland hebt in einer Stunde voraussichtlich ohne mich ab. Ob ich heute noch wegkomme? Ob ich mein Ticket auf einen anderen Flug umbuchen kann? Erst ganz allmählich dämmert mir der Ernst meiner Lage.
Im Zentrum von Chicago stoppt unser Konvoi vor der Einfahrt zu einer Tiefgarage. Die Ermittler zücken Plastikkarten, die sie als Mitarbeiter von ICE ausweisen. Dann tauchen wir in den dunklen Bauch des Gebäudes ab.
Während die Männer und Frauen aus ihren Fahrzeugen springen, einander auf die Schulter klopfen und sich dröhnend und gut gelaunt zu ihrem Fang gratulieren, muss ich im Auto auf meinen hinter dem Rücken verschränkten, gefesselten Händen sitzen bleiben. Als mich einer der Männer schließlich von der Rückbank des Kleinwagens befreit und auch ich aussteigen darf, entdecke ich Moritz, der in einiger Entfernung zwischen mehreren Agenten steht. Auch ihm haben sie Handschellen angelegt. Es ist merkwürdig und irreal, dass wir uns so schnell und unter diesen Umständen wiedersehen: überrumpelt, hilflos und vorgeführt. Das kann alles nicht wahr sein, signalisieren wir einander mit Blicken. Einzeln werden wir eine Rampe hinaufgeführt.
Im Fahrstuhl mustert mich Mary von oben bis unten.
„Sind die Schuhe und die Tasche echt?“, fragt sie, als hätten wir uns gerade in einer Disco kennengelernt. Ein neidvoller Ton schwingt in ihrer Stimme mit. Ich nicke knapp.
Ich trage sommerlich leichte goldene Sneakers meiner Lieblingsmarke. Die dazu passende Tasche ist mir bereits am Flughafen abgenommen worden und hängt nun über dem Arm des zweiten Ermittlers.
„Waren bestimmt nicht ganz billig“, kommentiert sie.
Ich bin überrascht und irritiert zugleich. Was geht es sie an, wofür ich mein Geld ausgebe? Aber ich schweige. Ich bin zu eingeschüchtert, um mich mit ihr anzulegen.
Durch einen breiten Flur bringen sie mich zu einem Gerichtssaal. Noch immer ahne ich nicht, was mich erwartet. Das riesige Türschild mit der Aufschrift Magistrate Judge Asher nehme ich kaum wahr. Erst später begreife ich, dass dies mein erster Termin vor dem Haftrichter ist.
Moritz ist schon vor mir angekommen. Er ist in dem imposanten Raum an einem der eleganten ovalen Holztische mit ein paar Herren in teuren Anzügen ins Gespräch vertieft.
Neben mir steht ein klein gewachsener Mann von südländischer Erscheinung. Er trägt eine feine Brille mit Goldrand. Vielleicht kann er mir erklären, was hier vor sich geht?
„Entschuldigung … Ich habe eine Frage“, setze ich vorsichtig an, doch da fällt er mir schon ins Wort.
„Sie haben kein Recht, mich anzusprechen!“, bellt er und wendet sich demonstrativ ab.
Ein Uniformierter befreit mich von den Handschellen und schiebt mich zu einem Tisch, an dem ein dicklicher Mann mit dunklem Teint sitzt. Freundlich lächelnd reicht er mir die Hand und stellt sich vor: Jorge Lopez, Public Defender – mein Pflichtverteidiger für heute.
Ich verstehe. Und bekomme es mit der Angst zu tun. Für Moritz ist anscheinend ein ganzes Team hoch bezahlter Anwälte angerückt. Auf mich wartet ein Armenanwalt, der vermutlich den ganzen Tag hier verbringt. Zwar habe ich in Chicago auch einen eigenen Anwalt, aber hat ihn jemand über meine Verhaftung informiert?
Vereinigte Staaten von Amerika gegen Stefanie Giesselbach und Moritz Böhm, steht auf einem eng bedruckten Schriftstück, das mir mein Pflichtverteidiger jetzt herüberschiebt. Schon der Titel erschreckt mich. Ganz Amerika, dieses riesige Land, klagt Moritz und mich an? Mit klopfendem Herzen und weichen Knien lese ich weiter.
Man wirft uns vor, die USA um Zölle geprellt zu haben. Angeblich haben wir außerdem einen Container Honig importiert, der positiv auf ein Breitbandantibiotikum getestet war.
Wütend wende ich mich an den Anwalt. „Was für ein Schwachsinn! Das stimmt doch alles hinten und vorne nicht.“
„Jetzt nicht!“, zischt mein Pflichtverteidiger mir zu. „Halten Sie besser den Mund. Sie werden hier nicht zur Sache aussagen!“
Wann denn dann?, frage ich mich. In was für einem schlechten Film bin ich hier gelandet? Verzweifelt blicke ich mich um. Rechts und links von der Tür stehen ein paar Sitzbänke wie in einem Kirchenschiff. Ganze vorne, in der ersten Reihe, entdecke ich die Ehefrau von Moritz. Sie wirkt angespannt. Wahrscheinlich ist sie direkt von ihrem Arbeitsplatz hierhergehetzt.
Dann bemerke ich einen Mann mit einem akkuraten Seitenscheitel in der zweiten Sitzreihe. „Gut gemacht, Jungs! Super Arbeit!“, dröhnt er quer durch den Saal, lehnt sich breit grinsend zurück und reckt demonstrativ die Daumen in die Höhe. Die Ermittler strahlen wie Schuljungen, die eine gute Zensur bekommen haben.
„Das ist einer der beiden ermittelnden Staatsanwälte“, raunt mir mein Pflichtverteidiger zu. „Der andere wird vermutlich gleich plädieren.“
„Alle aufstehen!“, ruft ein Gerichtsdiener. Ehrfürchtig erheben sich die Männer um mich herum. Richter Asher betritt in einer schwarzen Robe den Raum. Sofort bringt sich die Anwaltstruppe von Moritz in der Mitte des Raums in Stellung, auch Lopez gesellt sich dazu. Uns beiden wird mit einer kurzen Handbewegung signalisiert, wo unser Platz ist.
Vorhang auf, Bühne frei, Auftritt für die Staatsanwaltschaft. Es ist der Mann mit der Goldrandbrille, der mich beim Betreten des Raums so harsch abgebügelt hat. Blitzschnell, redegewandt und aggressiv fasst er jetzt die Straftaten zusammen, derer wir angeklagt werden sollen. Seine Darstellung klingt so, als wären den Fahndern zwei Schwerkriminelle ins Netz gegangen. Er als Vertreter der amerikanischen Regierung werde nun dafür sorgen, dass wir ordnungsgemäß vor Gericht gestellt würden. Sein Plädoyer gipfelt in der Behauptung, dass bei Moritz und mir von höchster Fluchtgefahr auszugehen sei. Schließlich habe man mich erst in allerletzter Minute am Flughafen geschnappt! Was mich außerdem sehr verdächtig mache: Ich sei – genau wie mein Vorgesetzter – im Besitz von zwei Reisepässen.
Auch dieser Vorwurf ist absurd. Meine beiden Ausweise sind völlig legal ausgestellt worden. Viele meiner Kollegen, die im Ausland wohnen und dienstlich viel reisen, haben zwei Pässe. Damit vermeidet man Schwierigkeiten, wenn man abwechselnd in miteinander verfeindete Länder einreist.
Doch ich habe keine Chance, diesen Punkt aufzuklären. Ich komme schlicht und ergreifend überhaupt nicht zu Wort und will nur noch eins: aus diesem Albtraum erwachen.
„Wir bieten an, für unseren Mandanten eine Kaution zu stellen“, erklären Moritz’ Anwälte.
Kaution? Noch wehrt sich mein Gehirn, zur Kenntnis zu nehmen, dass sie uns ins Gefängnis sperren wollen. Trotzdem überlege ich fieberhaft, an wie viel Geld ich auf die Schnelle herankommen könnte. Vermutlich an nicht mehr, als der Dispokredit meines Kontos hergibt.
„Abgelehnt“, erwidert der Richter bereits. „Wir werden uns mit der Frage, ob Sie Sicherheiten anbieten können, erst beim nächsten Termin befassen.“
Die Anwälte scheinen damit gerechnet zu haben, jedenfalls wirken sie nicht besonders empört. Geschäftig zücken die Herren ihre Terminkalender, um einen zweiten Haftprüfungstermin für die nächste Woche zu verabreden.
„Die Angeklagten werden vorerst in die Obhut der Vollzugsbehörden übergeben“, verkündet Richter Asher.
Das ist eindeutig: Sie sperren uns ein.
Mein Blick fällt auf Moritz’ Ehefrau, die wie erstarrt in der ersten Reihe sitzt. Sie ist die Einzige, die Christoph benachrichtigen könnte, schießt es mir durch den Kopf. Er erwartet mich doch in wenigen Stunden am Flughafen Fuhlsbüttel.
Ich muss all meinen Mut zusammennehmen, um mich noch einmal an den kleinwüchsigen Staatsanwalt zu wenden.
„Wäre es möglich, Frau Böhm zu bitten, dass sie meine Angehörigen in Hamburg benachrichtigt?“, frage ich.
Widerwillig nickt er: „Machen Sie es kurz. Und auf Englisch. Keine Privatgespräche!“
Schnell trete ich auf sie zu und diktiere ihr zitternd Christophs Mobilnummer. „Er soll auch meinen Eltern Bescheid sagen!“, füge ich hinzu.
„Versteht sich von selbst. Ich ruf ihn an und sag ihm, was passiert ist.“
Lopez, mein Pflichtverteidiger, hat den Saal schon verlassen. Wahrscheinlich wartet der nächste Fall auf ihn. Mir werden die Handschellen wieder angelegt.
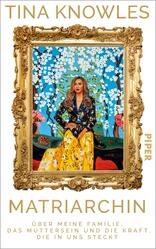
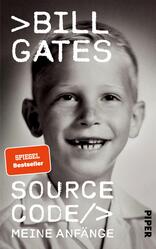
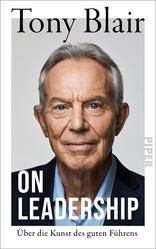

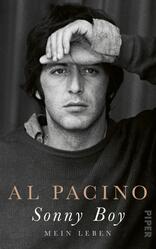





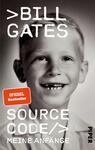

Hallo, interessanter teaser. Habe ohne ein Gefängnis von innen sehen zu müssen ähnliches in den USA erlebt. Deswegen bin ich 2012 wieder nach D gezogen. Man hat manchmal das Gefühl, die haben ein Rad ab. Nur zu Sxcherzen sind die nicht aufgelegt... Schön, dass Sie wieder in HH sind...;)
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.