

Meine wilden Inseln Meine wilden Inseln - eBook-Ausgabe
Wie ich auf den Färöern zwischen Wellen, Wind und Schafen mein Glück fand
— Unterhaltsame Insel-Abenteuer im nordatlantischen Naturparadies„Aus der Ich-Perspektive berichtet sie kurzweilig vom ersten Sommer, der erfüllenden Freude des Schafe-Scherens und Freunden wie Frida, die ihr Färöisch beibringt.“ - Ostthüringer Zeitung
Meine wilden Inseln — Inhalt
Das Glück in Gummistiefeln
Eine Liebeserklärung an die nordische Seele
18 Inseln im Nordatlantik, schroffe Klippen, raues Wetter, mehr Schafe als Menschen: Als Anja Mazuhn und ihr Mann zufällig eine Dokumentation über die Färöer sehen, trifft es sie beide mitten ins Herz.
Nach einem spontanen Urlaub auf Eysturoy, der zweitgrößten Insel, erkennen sie ihre große Chance auf Veränderung in einem kleinen Haus mit Meerblick und ergreifen sie kurzerhand.
Ein mutiger Neuanfang zwischen hohen Bergen und tiefen Fjorden
Voller Begeisterung entdeckt Anja Mazuhn eine neue Heimat mit atemberaubender Natur, faszinierenden Menschen und einer komplizierten Sprache. Sie lernt färöische Gelassenheit und findet wie nebenbei, was sie immer gesucht hat: Glück, Gemeinschaft und Abenteuer.
Mit 24 Seiten Farbbildteil, Illustrationen und zwei Karten
Leseprobe zu „Meine wilden Inseln“
Prolog
Jetzt stehe ich schon seit vier Stunden hier, und wer weiß, wie lange es noch dauern wird. Die Schere in meiner Hand ist überdimensional groß, aus einem u-förmigen Stück Stahl geschmiedet und schmierig. Jedes Mal, wenn ich eine Faust mache und die federnden Bügel der Schere mit Kraft zusammendrücke, schneiden ihre Klingen. Wenn ich meine Hand wieder entspanne, öffnet sich die Schere. Ich fange immer mit einer geraden Linie an. So, als ob ich erwartungsvoll ein mit Herzchen verziertes Paket am Klebeband entlang aufschneiden würde. Nur dass die [...]
Prolog
Jetzt stehe ich schon seit vier Stunden hier, und wer weiß, wie lange es noch dauern wird. Die Schere in meiner Hand ist überdimensional groß, aus einem u-förmigen Stück Stahl geschmiedet und schmierig. Jedes Mal, wenn ich eine Faust mache und die federnden Bügel der Schere mit Kraft zusammendrücke, schneiden ihre Klingen. Wenn ich meine Hand wieder entspanne, öffnet sich die Schere. Ich fange immer mit einer geraden Linie an. So, als ob ich erwartungsvoll ein mit Herzchen verziertes Paket am Klebeband entlang aufschneiden würde. Nur dass die Pakete hier keine Geschenke in Pappkartons sind, sondern laut blökende, kreuz und quer durch einen Pferch springende Schafe.
Ich ziehe die lockere Wolldecke am Hinterteil des Tieres so weit wie möglich hoch, steche die Schere vorsichtig in den mit Schafdampf gefüllten Zwischenraum hinein, fahre gerade den Rücken entlang bis zum Hals und schneide anschließend die Seiten und um den Kopf herum. Die meisten Schafe, die auf meinem Tisch landen, haben anfänglich nicht die geringste Lust stillzuhalten. Auf dem kniehohen, kotverschmierten Holzpodest vor mir bocken sie wie Bullen beim Rodeo, knurren, werfen sich auf den Bauch oder versuchen, den Riegel der zweigeteilten, oval ausgeschnittenen Holzplatte aufzuschieben, in der ihr Kopf steckt. Um sie zu beruhigen, tätschle und kraule ich sie und murmle – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg – freundliche Worte, so was wie „Ist schon gut“, „Keiner tut dir was“, „Du bist aber eine Hübsche“ und „Zeit für einen neuen Haarschnitt“.
Am besten kann ich Kurzhaarfrisuren mit Stufen. Und als Massage streiche ich den Schafen sanft über das Fell. Unter ihrem struppigen Haarkleid spüre ich einen pochenden Herzschlag, der mich an mein altes Leben erinnert, an dieses glitzernde, dröhnende Großstadt-Bum-Bum, das lange mein Antrieb war. Über zwanzig Jahre habe ich in Berlin als Journalistin gearbeitet, zehn davon als Society-Reporterin, die Hollywoodstars jagte und von Filmpremieren, Bällen und Wirtschaftsempfängen berichtete. Früher war ich die Klatschreporterin in High Heels, die auf dem Gesellschaftsparkett der Berliner Republik jeder kannte. Jetzt bin ich die, die in Gummistiefeln auf einem winzigen Archipel steht und mit den Schafen spricht.
Färöer. Achtzehn von Wind und Wetter umtoste Inseln mitten im Nordatlantik, irgendwo zwischen Island, Schottland und Norwegen. Bewohnt von ungefähr 53 000 Menschen und 70 000 Schafen. Die Inseln, die ich zu meinem zweiten Zuhause gemacht habe.
Ich mag alle Schafe um mich herum, die wilden, die ruhigen und die, die den Kopf schief legen, wenn ich sie mit meinen Fingerspitzen kraule; ich mag ihren Freiheitsdrang, ihr Temperament und wie sie aussehen, ihre Ohren, die sich wie Radarschirme drehen, sobald sie das leiseste Geräusch hören, ihre großen, seitlich am Kopf sitzenden Augen, ihre frechen und sanften Gesichter, ihr milchweißes, kakaobraunes, kastanienrotes und schwarzgraues Fell, uni und gescheckt, und ihre Wolle, die sich, Wasserfällen gleich, mit einer verschwenderischen Fülle aus Korkenzieherlocken und zotteligen Fransen über ihre Flanken ergießt. Dünne Beinchen tragen diese Tiere an die unglaublichsten Orte. Manchmal sehe ich sie am Rand einer senkrecht abfallenden Klippe grasen, oben die Schafe und 300 Meter weiter unten die aufgewühlte See. Ebenso mühelos trippeln und springen sie hinauf in die Berge, an steilen, grasbewachsenen Hängen entlang, über Geröll und treppenförmige Felsformationen bis hoch zu den nebelverhangenen Gipfeln der Färöer.
Von meinem Platz im Schafgatter aus sehe ich gezackte Bergrücken, ein tief eingeschnittenes Tal und mit Veilchen und Dotterblumen betupfte Juliwiesen. Und wenn ich mich, so wie jetzt, einmal im Kreis drehe, außerdem einen Feldweg, Pick-ups, schwanzwedelnde Border Collies, einen Stapel Pfannkuchen, auf Zaunlatten aufgetürmte Vliese, Nachbarn, meinen Mann und die versammelte schafscherende Dorfgemeinschaft. Mit meiner Freundin Malan, die auf der Tasche ihrer ausgebeulten Jogginghose ein Clipboard abstützt, tausche ich ein Lächeln aus. Ansonsten halte ich es wie die Färinger und Färingerinnen: bei der Schafschur viel schneiden und wenig reden. Meine Jeans, die am Knie gerissen ist, der heute früh noch dunkelblaue und nun mit wollweißen Fusseln übersäte Fleecepullover, die Uhr, die ich trage, meine mit einem ausgeleierten Frotteehaargummi zusammengebundenen Haare: Alles riecht nach Schaf. Die Hand, mit der ich die überdimensionale Schere halte, schmerzt, aber das cremige Lanolin, das in der Schafwolle steckt, hat sie weich gemacht.
Wind kommt auf, der salzige Luft vom nahen Ozean herüberträgt und im Tal Myriaden flaumweicher Wollgräser durchweht, ein Meer sanft schaukelnder Wattebäusche; direkt vor mir das wogende Heer der Schafe. Dreck spritzt, und weil ich mich gerade bücke, landet er nicht nur auf meiner Hose, sondern auch in meinem Gesicht. Wegwischen? Selbst wenn ich wollte, es wäre sinnlos. An mir klebt überall Schaf. Schmutziger könnte ich kaum sein. Aber auch nicht glücklicher.
Das metallische Schneidegeräusch meiner Schere, das Knarzen sich öffnender und schließender Gattertore, der sporadische Singsang melodisch-klarer und zischend-fließender, leichtzüngiger Worte: Mit einem Mal wird alles um mich herum leise und alles in mir drinnen laut. Eine Emotionswelle trifft mich, und Glückstränen schießen in meine Augen. Jetzt bloß nicht weinen. Auf gar keinen Fall will ich, dass mich irgendjemand so sieht. Nicht einmal die Schafe. Um wieder herunterzukommen, stelle ich mir vor, dass ich in der Yoga-Position Baum auf einer Schäfchenwolke stehe, die in Zeitlupe nach unten sinkt. Die Wolke ist mein Herzschlag, und der wird langsam wieder normal.
Eine Stunde später greife ich nach dem letzten Schaf. Zum letzten Mal an diesem Tag wate ich durch Schlamm, Schafkot und durchweichte Büschel gekräuselter Schafwolle. Mit dem Wasserschlauch am Pferch spüle ich meine Gummistiefel ab und werfe sie auf die Ladefläche unseres Wagens. Die 500 Meter bis nach Hause fahren wir mit dem Auto. Mit steifen Bewegungen ziehe ich mir die verdreckte Kleidung aus und gehe unter die Dusche. In den heißen Wasserstrahl, der auf mich herunterprasselt, mischen sich Lachen, Tränen und so ein Gefühl, die Welt umarmen zu wollen. So wie damals als Kind, als mir mein Kaninchen entwischte und mein Vater auf dem Friedhof, der an das Grundstück unserer Nachbarn grenzte, auf ein Grab hechtete und es wieder einfing.
Der Spiegel, die Wände, die Türen der Duschkabine: Alles beschlägt, aber ich sehe glasklar. Glück kann man nicht bestellen, aber man kann es wagen. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann stehst du irgendwann in einem Haus mit Grasdach am Panoramafenster im Wohnzimmer und schaust zu, wie in der Bucht und über dem kleinen Dorf, das zu deinem zweiten Zuhause geworden ist, erdbeerrote und lilafarbene Wolken segeln. Es ist inzwischen kurz vor Mitternacht, meine Haare sind nass, mein Bauch ist voller Suppe, und in meinen butterweichen Händen, die immer noch ein bisschen nach Schaf riechen, halte ich ein Glas Rotwein.
Der nächste Morgen. Ab zur Tür, den kleinen orangefarbenen Rucksack auf dem Rücken. An den Füßen trage ich Wollsocken und meine Lieblingsgummistiefel, Naturkautschuk mit Profil, leicht, elastisch und dehnbares Innenfutter aus Jersey, dazu eine Jogginghose, ein T-Shirt und einen braun-weiß gemusterten Färöerpullover. Raus, das Knirschen von Schotter unter meinen Stiefeln, zwischen eng beieinanderstehenden Häusern und Schuppen hindurch – so eng, dass ich, wenn ich die Arme ausstrecke, links ein Holzpaneel und rechts ein Fundament aus Stein berühre. Ein bisschen mehr Dorf, halbe Gardinen, Blumentöpfe, Ferngläser und Buddelschiffe hinter Fensterglas. Der blaue Dorfbriefkasten. Die weiße Holzkirche mit dem grünen Wellblechdach, darunter das von der Decke hängende Modell eines Ruderbootes, Altarkerzen und die Gedenktafel für die Männer, die hinaus auf See fuhren und nicht zurückkamen. Jetzt das letzte Stückchen Dorf, karierte Hemden und selbst gestrickte Socken auf Wäscheleinen, ein Rhabarbergärtchen, eine Outdoorbadetonne, und dann patsche ich mit meinen Gummistiefeln auch schon durch Pfützen und Schlaglöcher, in denen Regenwasser steht, weiße Schafgarbenblüten, gelbes Habichtskraut und lilafarbene Braunellen am Wegesrand.
Stórá, der Bach, der aus den Bergen kommt, sich durchs Tal und unser Dorf schlängelt, unter der Brücke hindurchfließt und sich am Ende seiner Reise in den Nordatlantik ergießt, glitzert im Sonnenlicht. Am Holztor neben dem Schafgatter schiebe ich hinter mir den Riegel zu und laufe über sumpfigen, hügligen Grund hinein ins Tal. Eine liebliche Graslandschaft, an deren Seiten sich felsige und schroffe Hänge erheben. Die Häuser hinter mir werden kleiner und kleiner, bis sie nur noch bunte Punkte sind, über denen ich als blauen Streifen den Ozean sehe; darüber die abgeschnittene Silhouette unserer Nachbarinsel Kalsoy und ganz oben im Bild, das die Natur für mich malt, Schichten aus Sahnebaiserwolken und blauem Himmel.
Weiter, immer tiefer hinein ins Tal, der Quelle entgegen, über steiniges Terrain und mit Findlingen übersätes Grasland, laufe und klettere ich, neben mir rauscht der Bach in Gestalt eines kleinen Wasserfalls, um mich herum Berge, von denen ich weiß, dass sie über 700 Meter hoch sind; an ihren Flanken und um die Spitzen herum immer noch Flecken aus reinweißem Schnee.
Zwei Stunden nachdem ich losgelaufen bin, hänge ich auf einem majestätischen Bergplateau meinen Rucksack über einen Holzpfahl, ziehe mir die Gummistiefel, mit denen man auf nassem Gras nicht rutscht, den Pullover, das T-Shirt, die Jogginghose und die Wollsocken aus, lege ein Handtuch über ein Stück verbogenen Drahtzaun und steige in den Bergsee. In seiner Oberfläche spiegeln sich die Wolken und der Himmel. Das Wasser ist flach, klar und kalt, aber ich friere nicht. Aus der Mitte des Sees ragt ein Findling heraus, auf den ich mich setze. Hochgetürmte, steingrau lichte Breite und Weite. Moosgrün gepolsterte Stille. Gipfelstürmendes, bergseeblaues Glück.
Reif für die Insel
Ein ungemütlicher Tag im Februar mit Nieselregen und Temperaturen knapp über null. Das Taxi mit dem Duftbaum am Rückspiegel rollt im Berliner Stadtteil Grunewald an Erkertürmchen, Luxusapartmenthäusern und parkähnlichen Grundstücken vorbei und hält in der Brahmsstraße vor einem großen schmiedeeisernen Tor.
„So, da sind wa“, verkündet der Fahrer. „Det macht zweiundzwanzig fuffzig.“
Ich krame 25 aus meinem Portemonnaie, „danke, stimmt so, auf Wiedersehen“, und steige aus dem Taxi. Kaum habe ich die Tür geöffnet, kommt auch schon ein Portier mit einem Regenschirm auf mich zugeeilt. „Willkommen im Schlosshotel, schön, Sie wieder bei uns zu haben“, sagt er und geleitet mich zum Eingang. Eine Villa mit verzierter Kassettendecke, Wandverkleidungen aus dunklem Holz und rostroten Seidentapeten, in deren tennisplatzgroßer, zwei Stockwerke hoher verwaister Mitteldiele ich unter Kronleuchtern in einem monströsen Sessel sitze und mit kleinen Schlückchen heißen grünen Tee trinke. Meine Handtasche, die neben mir liegt, ist eine karamellfarbene der Marke Tod’s, die perfekt zu meinen hochhackigen Stiefeletten passt. Eine Weile geschieht nichts. Dann höre ich, wie das Tor über den Boden schleift und Autos vorfahren. Ich beiße mir auf die Lippe – jetzt bloß nicht den richtigen Moment verpassen, da, mitten im Tross, ist er! – und drücke auf den Auslöser einer Kamera, die ich zuvor aus meiner Handtasche genestelt habe.
Wer zuerst erstarrt, Leonardo DiCaprio, Star der Filmfestspiele, oder ich, die Gesellschaftsreporterin der Zeitung Die Welt, kann ich nicht sagen. Aber eines weiß ich ganz genau: Ich habe vergessen, das Blitzlicht auszuschalten. Augenblicklich gehe ich hinter der Lehne meines Polstermöbels in Deckung. Was am Empfang gesprochen wird, höre ich nicht. Nur, dass es laut und hektisch wird. Am liebsten würde ich immer tiefer und tiefer in meinen Sessel hineinrutschen und mich dabei in Luft auflösen. Weil es diese Option aber nicht gibt, bleibe ich sitzen und warte.
Ich bin mir absolut sicher: Gleich kommt einer der Bodyguards zu mir herüber und staucht mich zusammen. Passiert aber nicht. Stattdessen sehe ich, wie Leonardo DiCaprio, Jeans, Sweatshirt und Baseballkappe, angereist für den Film „The Beach“, im Stockwerk über mir in der Bibliothek steht und mit unbeweglicher Miene zu mir hinunter in die Halle starrt. Zwei, drei Sekunden vielleicht. Dann verschwindet das Fenster zu Hollywood hinter Stoffvorhängen. Langsam richte ich mich wieder auf. Höchste Zeit, dass auch ich verschwinde.
Draußen hat es aufgehört zu nieseln. Vorbei an Autogrammjägern und Fotografen, die mittlerweile das Portal belagern, haste ich den Bürgersteig entlang bis zur nächsten Straßenlaterne. Dort ziehe ich mein Mobiltelefon aus meinem schwarzen Wollmantel und mache drei Anrufe. Anruf eins: Taxizentrale. Anruf zwei: Mailbox. Anruf drei: mein Kontakt.
„Hallo, ich bin’s. Tut mir total leid. Soll ich dir den Film geben?“
Pause. Dann: „Nee, hier ist wieder alles okay. Lass mal.“
„Sicher?“
„Sicher.“
Gewonnen.
Am nächsten Tag haben wir von der seriösen Welt Leonardo DiCaprios Ankunft exklusiv, und die Zeitschrift Bravo kauft mein Foto. Damals, Gerhard Schröder ist Bundeskanzler, Harry Potter fegt mit seinen ersten Abenteuern über die Bestsellerlisten, und das Nokia 3310 kommt auf den Markt, ist meine Journalistenwelt noch in Ordnung und der Beruf mein Leben.
Ich arbeite als Redakteurin, zuerst in der Lokalredaktion der B. Z., dann als Redakteurin und Society-Reporterin mit Vertrag und eigener Kolumne für Die Welt. Den Anbruch des neuen Jahrtausends feiere ich mit Freunden und Nachbarn auf unserer Gemeinschaftsdachterrasse in Berlin-Kreuzberg. Nachts, wenn ich nach Hause komme, fahre ich mit dem Fahrstuhl an Büroetagen vorbei bis hoch zum Penthouse und schließe die Tür zu meiner Maisonettewohnung auf. Der Ausblick von meinem Sofa durch die Glasfront: Großstadt pur. Die Lichter der wiedervereinigten Stadt: mir zu Füßen. Das Verlagshaus: immer in Sichtweite. Meinen ersten Artikel habe ich über DDR-Grenzschutzhunde und den Todesstreifen geschrieben, bald darauf bin ich von früh bis spät für die Stars und Sternchen zuständig.
Bono von U2 klettert im Prominentenrestaurant Borchardt nachts um halb eins auf eine Sitzbank und küsst George Clooney ab: Ich bestelle gerade ein Wiener Schnitzel. Champagnerparty im Mitte-Stadthaus eines Investors und Kunstsammlers: Ich inspiziere seine Rauchs, Richters und den Wasserfall im Entree. Modedesigner Emanuel Ungaro, schwarzes Cordjackett, pinkfarbenes Einstecktuch, rote Schuhe, bittet zum Lunch ins Hotel Adlon: Ich sitze mit am Tisch. Neujahrsempfänge im Januar. „Goldene Kamera“ der Zeitschrift Hörzu und „Berlinale“ im Februar. Musikpreisverleihung „Echo“ im März. „Deutscher Filmpreis“ im Juni. Hoffest des Regierenden Bürgermeisters im September. Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung im November. Bleigießen im Borchardt. Und Jahr für Jahr im Januar geht alles von vorne los.
Ich rufe Schauspielerinnen an und frage sie, ob sie schwanger sind. Ich schreibe, dass Anke Engelke einen langen Rock aus Taft und ein bauchfreies Top mit Blumenmuster trug. Ich lasse mir von Moderatorinnen erzählen, wohin sie in den Urlaub fahren. Ich rase in den Fünf-Sterne-Fitnessclub, für den ich eine goldene Mitgliedskarte habe, und jogge auf dem Laufband neben Nick Nolte. Ich mache in meiner Freizeit Pressereisen für unsere Reiseredaktion: Flusskreuzfahrt in China, pinkfarbener Sandstrand auf Bermuda, Privatinsel und Schnorcheln in der Karibik. Ich rufe eine Schulfreundin an und erzähle ihr, dass ich einsam bin. Ich frage mich, ob ich nicht doch Biologin hätte werden sollen, das hatte eine Zeit lang zur Debatte gestanden; oder vielleicht Expeditionsgeologin; Atmosphärenchemikerin; eine Eisblumen erforschende Schneephysikerin. Nun bin ich Journalistin. Ich möchte das Ressort wechseln. Ich hänge fest im Klatsch. Ich friere an roten Teppichen, habe Kopfschmerzen, bekomme Gehaltserhöhungen und warte auf Paris Hilton. Ich stehe auf Partys und weiß nicht mehr, was ich die immer selben Leute fragen soll. Ich stelle mir vor, anders zu leben, weiß aber nicht, wie, mit wem und warum. Ich bin verliebt und wieder Single. Ich ziehe dreimal um. Ich bin die Hauptstadt-Society-Reporterin der Welt, und das Bum-Bum in meinem Kopf wird immer lauter.
Was tun, wenn das Gefühl von Sinn schwindet, immer kleiner wird am Horizont, während man auf einem Meer alltäglicher Verpflichtungen treibt, zwischen Glitzer, Glamour und Oberflächlichkeiten? Irgendwann, irgendwo ist man vom Kurs abgekommen, und nun kreiselt man vor sich hin, Runde um Runde, gefangen im Sog des Mahlstroms, ewige Fahrt, in einem Boot ohne Segel, ohne Kompass, ohne Ziel. Wie zieht man die Reißleine, ohne über Bord zu gehen? Wo geht man an Land?
Was macht das Leben auf einer Insel so besonders?
„Das Stück Land, auf dem man sich bewegt, sobald man eine Insel betreten hat, ist begrenzt. Das gibt ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Zum Wesen einer jeden Insel gehört es, vom Meer umspült zu werden. Wenn man am Wasser wohnt, liegt man im Bett und hört die Wellen rauschen. Seevögel fliegen. Bis in den Traum. Mit Inseln ist das so eine Sache: Sobald wir das Wort „Insel“ auch nur hören, läuft in unseren Köpfen ein Film ab. Die einen denken an Gauguin auf Tahiti, andere an Robinson, Atlantis und Thule; „reif für die Insel“; Lord of the Flies. Inseln sind magisch. Sie lassen uns über Sinnfragen, Formen menschlichen Zusammenlebens und unsere winzige Rolle im großen Spiel des Universums nachdenken.
Und sie haben eine eigene Zeitrechnung. Die Zeit auf den Färöern läuft langsamer als anderswo; die Uhren ticken im Rhythmus der Natur. Wenn Windhosen über Dächer tanzen und die Wasserfälle nach oben fließen, kann man nicht über die Straße, die am Fjord entlangführt, bis zum nächsten Supermarkt fahren. Dann eben morgen. Oder übermorgen? Kanska, vielleicht. Ich mag das. Man lernt Gelassenheit und ergreift Gelegenheiten. Ein Inselphänomen: Viele Färinger machen viele verschiedene Dinge gleichzeitig. Also jemand ist Mathelehrer, gießt in seiner Freizeit Betonfundamente, veröffentlicht Gedichte, spielt in einer Heavy-Metal-Band und hält Schafe. Wenn man die Färinger fragt, warum, sagen sie: Wir machen das, weil uns die Inseln die Möglichkeit dazu bieten. Wenn man ein Interesse hat, ist es einfach, in diesem Bereich zu arbeiten oder etwas zu erfinden. Wir sind ja nicht so viele.“
Wie war es, sich auf ein neues und so anderes Leben einzulassen?
„Spannend, rückschauend-emotional – und letztendlich sehr befreiend. Das muss man aber am besten von der Vorgeschichte aus denken. Über zwanzig Jahre habe ich in Berlin als Journalistin gearbeitet, zehn davon als Society-Reporterin. Ich hatte also durchaus ein Leben, sogar eines mit vermeintlich tollem Job und Erfolg. Der Bruch kam schleichend; als Wunsch nach Veränderung, der immer präsenter wurde, verbunden mit einer Erkenntnis: Irgendwann, irgendwo ist man vom Kurs abgekommen, und nun kreiselt man vor sich hin. Und so war das dann auch.
Bis zu einem Fernsehnachmittag mit meinem Mann. Wir schauten eine Dokumentation über die Färöer und dachten: Da müssen wir unbedingt hin. Drei Tage später reisten wir auf die Inseln und machten eine Woche Urlaub. Drei Monate später eröffnete mir mein Mann: Wir fliegen wieder auf die Färöer, und diesmal kaufen wir ein Haus. Ich war völlig perplex. Zugleich habe ich gewusst: Das ist der Moment. Die Chance. Es hätte auch schiefgehen können, aber das Risiko war es mir wert. Darüber hinaus war es keine freie Entscheidung. Die Inseln haben mich gezwungen. Ein kleines Haus mit Meerblick. Zottelschafe. Gummistiefel und Löcher im Pulli. Ungezähmte Natur. Also, ich konnte da nicht widerstehen.“
Wo kannst du auf den Inseln am meisten Glück und Kraft schöpfen?
„Tatsächlich in Elduvík; dem Dorf, das wir zu unserem zweiten Zuhause gemacht haben. Dreizehn Einwohner, eine Kirche, ein Friedhof, Bootshäuser; kein Laden, keine Bushaltestelle, keine Meetings. Ich sitze am Strand, zähle Wellen, die auf meine Stiefel zurollen und beobachte vagabundierende Gänse und Schafe. Später besuche ich den Kapitän. Die Barentssee ist sein Revier, bei uns im Dorf hat er sein Sommerhaus. In seiner Küche sitzen wir am Fenster, trinken Kaffee und essen heiße Waffeln, die nach Kardamom duften. Dazu lasse ich mir Seefahrer-Geschichten erzählen. Bald darauf wütet der erste Herbststurm, und dann kommt der Winter. Schneeflocken rieseln auf Grasdächer, Nordlichter tanzen. Als wieder Sommer ist, treibt die Dorfgemeinschaft die Schafe ins Tal und schert die Tiere im Pferch per Hand. Nachts ist der Himmel mit rosafarbenen Tupfern übersät. Nach Mitternacht laufe ich über bröckelige Betonstufen hinab in unseren alten Hafen. Neben dem Anleger, auf den ich mich setze, schwanken Tangwälder unter der Wasseroberfläche; Seepocken und bunte Flechten besiedeln bizarr geformte Felswände. All das macht Elduvík für mich aus; und Kraftschöpfen und Glück.“
Für alle Fans von „Meine wilden Inseln“ gibt es hier ausgewählte Videonotizen und Audioaufnahmen aus Anja Mazuhns ganz persönlicher Bibliothek der guten Geräusche und Gefühle. Taucht ein in die einmalige Welt der Färöer. Viel Spaß!
Die SoundCloud-Playlist findet ihr hier: Sounds Färöer
Alle Videos findet ihr in dieser Playlist: Färöer. Meine wilden Inseln von Anja Mazuhn.
„Erst war es nur ein unterschwelliges Gefühl, eine leise Stimme im Hinterkopf, die fragte: ‚Bist du glücklich‘? Heute, rund zehn Jahre später, hat Anja Mazuhn ihr altes Leben in der Großstadt hinter sich gelassen. Vor allem die Natur mache die Faszination der Färöer aus. ‚Mein Leben zwischen Wellen, Wind und Schafen‘: Die schönsten Geschichten von den Inseln hat Anja aufgeschrieben.“
„Kenntnisreicher Einblick in eine stürmische Welt“
„In der ungebändigten Natur zwischen den Elementen Wind und Wasser, umgeben von freiheitsliebenden Menschen und Tieren nimmt die Autorin und Journalistin den Leser mit auf eine emotionale und eindringliche Reise.“
„›Meine wilden Inseln‹ weckt die Lust, selbst auch mal ein Abenteuer zu wagen.“
„›Meine wilden Inseln‹ ist eine Hymne auf die Natur.“
„Meine wilden Inseln ist kein Reisebuch, kein Reisebericht. Lust- und liebevoll und dabei ungeschönt beschreibt sie die Menschen, Landschaften ihrer neuen Heimat, die mächtige Natur, ein Bad alleine und nackt im klaren Bergsee oder auch Faröer Küche wie Dorschkopf mit Rhabarbersuppe, Lachskuchen, gekochtes Grindwalfleisch mit Pellkartoffeln, geschmorte Trottellumme.“
„Man kann und soll sich einlassen auf diese emotionale Reise, bei der schon das Lesen Abenteuerlust weckt und vielleicht auch den Gedanken, über das eigene Glück intensiver nachzudenken. Denn das ist vielleicht – neben der Liebeserklärung an die Färöer, ihre Menschen und Schafe – das Wesentliche dieses Buches: Wollen wir im Einklang mit uns selbst leben, brauchen wir Geschichten, Menschen, Freundschaften, und die Natur um uns herum.“
„Aus der Ich-Perspektive berichtet sie kurzweilig vom ersten Sommer, der erfüllenden Freude des Schafe-Scherens und Freunden wie Frida, die ihr Färöisch beibringt.“
„Man spürt in jeder Zeile, wie sehr die Autorin ihre neue Heimat respektive ihr neues Leben liebt. Es ist schön zu sehen, mit wie wenig man zufrieden und glücklich sein kann und wie erfüllend es sein muss den Ort gefunden zu haben, der das Beste aus einem herausholt.“
„Mazuhns Schilderungen nehmen einen sofort mit auf die Inseln im Nordatlantik und wecken die Sehnsucht nach Ruhe und Einsamkeit und Natur.“














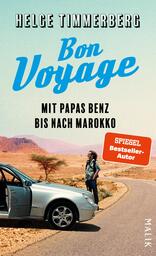












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.