

Mitternacht Mitternacht - eBook-Ausgabe
Roman
„In wundervollen Worten erzählt, so wie alle von Marzis Geschichten.“ - Ruhr Nachrichten
Mitternacht — Inhalt
Es gibt einen Ort, an dem die Geister leben, eine Welt, die unsere berührt, eine Stadt, in der mit Geschichten und Albträumen Handel getrieben wird. Ein Missgeschick lässt Nicholas James, den alle nur den „gewöhnlichen Jungen“ nennen, diese Welt betreten – und alles ändert sich: Peter Chesterton, ein reisender Geist, nimmt sich seiner an. Das Findelgeistmädchen Agatha stiehlt sein Herz. Und etwas, das im Dunkeln lauert, gewinnt an Macht. Die Wege, die Nicholas beschreitet, führen ihn dorthin, wo alle Hoffnungen geboren und alle Träume gestorben sind, an einen Ort, den die Geister voller Ehrfurcht „Mitternacht“ nennen. Eine Geschichte von der Macht der Bücher und der Gefahr des Vergessens, in einer Welt der Geister.
Leseprobe zu „Mitternacht“
Kapitel 1
Alle Bücher träumen von Geschichten. Diesen Satz dachte Nicholas James, als er erwachte. Sie fürchten sich vor dem Vergessenwerden.
Der Gedanke fühlte sich fremd an, wie etwas, das eigentlich nicht ihm gehörte, aber dennoch zu ihm gekommen war wie ein Fundstück, über das man zufällig stolpert, während man abwesend an etwas ganz anderes denkt. Er öffnete die Augen und blinzelte in die schattenhelle Kajüte, die ihm selbst jetzt, in der Nacht, vertraut war. (Kein Wunder, sie war auch nicht besonders groß.) Das Licht der Straßenlaterne vom Uferweg [...]
Kapitel 1
Alle Bücher träumen von Geschichten. Diesen Satz dachte Nicholas James, als er erwachte. Sie fürchten sich vor dem Vergessenwerden.
Der Gedanke fühlte sich fremd an, wie etwas, das eigentlich nicht ihm gehörte, aber dennoch zu ihm gekommen war wie ein Fundstück, über das man zufällig stolpert, während man abwesend an etwas ganz anderes denkt. Er öffnete die Augen und blinzelte in die schattenhelle Kajüte, die ihm selbst jetzt, in der Nacht, vertraut war. (Kein Wunder, sie war auch nicht besonders groß.) Das Licht der Straßenlaterne vom Uferweg flutete sanft die Stille und streifte das Durcheinander in der schmalen und engen Behausung gemeinsam mit dem Mondlicht, das sich nicht von den Gardinen einfangen ließ. Durch das gekippte Fenster wehte kühle Luft herein, das leise Plätschern des Wassers im Kanal und die fernen Nachtgeräusche von Camden Town im Schlepptau. Benommen dachte Nicholas zuerst an das Notizbuch, das drüben auf dem Esstisch lag und das er mit einem Roman, seinem zweiten, zu füllen gedachte. Das, was er gerade gedacht hatte, würde bestimmt einen guten Anfang für einen Roman abgeben. Alle Bücher träumen von Geschichten. Er überlegte, ob er aufstehen sollte, um den Satz zu notieren, doch lieber gähnte er und blieb liegen. Dann dachte er an den Traum, den er gerade vergessen hatte. Das tat er eigentlich fast immer: Er träumte – und dann vergaß er, wovon er geträumt hatte, aber er spürte, dass da bis vor wenigen Augenblicken noch ein Traum gewesen war und ihn beschäftigt hatte. Kurz fragte er sich, ob dieser Satz womöglich aus jenem frisch vergessenen Traum stammte. Egal! Er lächelte verschlafen und zufrieden, drehte sich auf dem schmalen Bett zur Seite und knüllte sich das Kopfkissen bequem.
In dem Moment bemerkte er die Silhouette des Mannes, der neben seinem Bett stand und ihn beobachtete. Das war der Augenblick, in dem sich sein Leben änderte und die Dinge ins Rollen kamen.
„Wer sind Sie?“ Nicholas setzte sich ruckartig auf. Das Herz schlug ihm auf einmal bis zum Hals.
Der Mann, der nur ein Schatten und darüber hinaus noch sehr dünn war (ein dünner Schatten, könnte man sagen), erschrak ebenfalls. So jedenfalls schien es. Er fuhr zurück, ein wenig nur, machte aber keine Anstalten abzuhauen. „Niemand“, sagte er leise. Eine Stimme wie Honig, Whiskey, Sturm. Er klang überrumpelt. War das etwa ein Akzent? Schottisch? Nicholas James erkannte die Sprache seiner Heimat, auch wenn jemand die Sprachmelodie zu verbergen versuchte.
„Was tun Sie hier?“
Der dünne Schatten kam näher. Er hatte stechend blaue Augen in einem hageren Gesicht, zornig aussehende Brauen, dazu weißes Haar, widerborstig hoch stehend, und dennoch eine elegante Erscheinung, fast ein Gentleman aus dem Fernsehen.
„Das ist wirklich bemerkenswert“, murmelte der Besucher. „Hm, in der Tat.“ Er sah sehr streng aus, irgendwie ungeduldig. Und neugierig hinter der Aura des Geheimnisvollen. „Er kann mich sehen?“ Die Frage galt wohl ihm selbst. „Nein, das ist nicht möglich.“
Was sollte der Blödsinn?
„Doch, es ist möglich“, betonte Nicholas, noch immer verschlafen, wenngleich ein wenig wacher als vorhin. Der Mann schüttelte energisch den Kopf. „Das muss ein Irrtum sein.“ Dann hielt er inne, zweifelnd: „Andererseits ist es offenbar doch möglich. Ein Rätsel.“ Er betrachtete Nicholas, als sei der eine Kuriosität, und fuchtelte wie ein Magier mit den Händen vor seinem Gesicht herum.
„Lassen Sie das“, herrschte Nicholas ihn an. „Sie haben hier nichts zu suchen. Wer sind Sie?“ Er fühlte sich bedrängt, irgendwie überfallen, dem ungebetenen Eindringling ausgeliefert. Wer war der Kerl und was wollte er von ihm? Hatte er ihn beobachtet? Wie lange stand er schon da neben dem Bett? Wo kam er her? Warum wirkte er so ganz und gar nicht wie ein Einbrecher? Und überhaupt, was sollte er bei ihm stehlen? Zu guter Letzt die wichtigste Frage: War der Kerl gefährlich?
„Noch einmal.“ Nicholas versuchte, wütend und beherrscht zu klingen. „Wer sind Sie?“
Der dünne, elegante Schatten nahm Haltung an. „Sie haben sich geirrt“, sagte der Fremde mit fester Stimme.
Nicholas rieb sich die Augen. Das war doch verrückt. Worin sollte er sich geirrt haben?
„Ich bin gar nicht hier.“
Was sollte das denn nun wieder?
„Natürlich sind Sie hier“, sagte Nicholas und gab sich Mühe, hinreichend wütend zu klingen.
„Nein, bin ich nicht.“
„Ich kann Sie sehen.“ Nicholas fand, dass dies ein sehr gewichtiges Argument war.
Der Fremde winkte ab. „Sie haben ja noch den Schlaf in den Augen.“
„Was hat das denn damit zu tun?“
„Glauben Sie mir, Sie haben sich geirrt. Ich bin gar nicht hier.“
Nicholas rieb sich noch mal die Augen.
„Nie gewesen …“
„Was …?“
Da war niemand mehr.
Wie konnte das sein?
Nicholas knipste das Licht an, dann sprang er aus dem Bett, stieß sich den Kopf an der niedrigen Decke und fluchte. Sein Atem ging schnell, er zitterte. Er schaute sich um: So schnell konnte niemand aus der Kajüte verschwinden, unmöglich.
Ich bin gar nicht hier.
Die Stimme hallte in der Stille wider wie ein Echo.
Nie gewesen …
Nicholas begutachtete die Kajüte. Die Tür nach draußen war verschlossen. Wie also war der Fremde hier heraus gekommen (und wie hinein)? Die Antwort: Gar nicht! Etwa, weil er gar nicht da gewesen war? Hatte er sich das alles doch nur eingebildet? Wenn ja, dann war dies der intensivste Traum gewesen, den er je gehabt hatte (und zudem auch noch einer, an den er sich erinnerte). Wäre Erika jetzt bei ihm, dann hätte ihr Geschrei ohne Zweifel die Nachbarn in den anderen Booten geweckt und irgendwer würde jetzt von draußen gegen das Fenster klopfen und sich erkundigen, ob alles in Ordnung sei auf der Dorian Gray (das war der Name von Nicholas’ Hausboot). Aber Erika war nicht hier. Sie hasste das Hausboot („Es ist zu eng für alles“, pflegte sie zu sagen, und: „Das ist kein Bett, sondern ein Sarg; viel zu eng für alles.“). Nicholas rieb sich erneut die Augen. Er könnte sie anrufen und ihr schildern, was er erlebt hatte, aber würde sie ihm glauben? Wohl kaum. Er seufzte noch einmal, diesmal laut in die Stille hinein – weil laut zu seufzen manchmal guttat.
Eine Freundin zu haben, die nicht immer da war, konnte von Vorteil sein. Jetzt aber wünschte er sich, sie wäre hier. Sie hätte den schattenhaften Besucher gesehen und laut geschrien, was nervig gewesen wäre und die Nachbarn alarmiert hätte, aber dafür hätte er die Gewissheit gehabt, dass da wirklich jemand gestanden hatte. Jetzt zweifelte er an sich selbst.
„Du hast dir den Mann nur eingebildet“, würde Erika ihm antworten und nicht ohne einen Hauch von Herablassung hinzufügen: „Das macht nur dein Schriftstellergehirn.“ Genau deswegen rief Nicholas sie jetzt nicht an. Es wäre uncool. Sie würde spüren, dass er aufgeregt war, und dann würde sie ihm verkünden, wie unmännlich es ist, sich vor seinen eigenen Träumen zu fürchten und erst recht vor geisterhaft auftauchenden Gestalten. Es könnte eine dieser Reden über ihr Rollenverständnis von Männern und Frauen folgen, die ihn langweilten, seitdem er herausgefunden hatte, wie gerne sie sich selbst reden hörte. Nein, es war gut, dass sie nicht hier war
„Hallo?“
Blöde Frage. Wer sollte denn antworten?
„Whoopie?“ Die Katze lag auf ihrem Kissen am Fenster und schlief. Sie hatte also niemanden gehört.
Nicholas rekelte sich und gähnte. Er schlurfte rüber ins Bad, das aus kaum mehr bestand als einer Toilette, einer sehr kleinen (und für ihn etwas zu kurzen) Badewanne und einem Waschbecken, die durch eine Tür vom Rest der Kajüte abgetrennt waren, und zwar am Bug des Hausboots. Dort starrte er in den Spiegel: rotblondes Haar, das wie vom Wind verweht aussah, verdreht und lockig (dabei war Nicholas eindeutig Schotte), hellbraune Augen, müde, aber dennoch wachsam (das Herz schlug ihm noch immer wie wild in der Brust), in den Mundwinkeln ein ungläubiges, skeptisches Hm-tja.
Mit ein wenig Photoshop könnte man aus dem Gesicht den „gewöhnlichen Jungen“ zaubern. Er dachte daran, wie sehr Erika sein offizielles Autorenfoto mochte. Bisher gab es nur dieses eine – sehr intellektuell in weich gezeichnetem Schwarz-Weiß.
Nicholas pinkelte und ging dann ins Bett zurück. Sein Herz schlug jetzt nicht mehr ganz so schnell wie vorhin. Er schaute aus dem Fenster. Draußen auf dem Uferweg war alles ruhig. Vermutlich hatte er sich das alles wirklich nur eingebildet. Nur ein Traum
Alle Bücher träumen von Geschichten.
In einem Traum in einem Traum.
Sie fürchten sich vor dem Vergessenwerden.
In einem Traum.
Sie haben sich geirrt.
In einem Traum.
Ich bin gar nicht da.
In einem Traum.
Vergessenwerden.
In einem Traum.
Gar nicht.
Da.
Nicholas knipste das Licht aus und hing noch eine Weile einem wild durcheinandergeratenen Geflecht aus Gedanken nach.
Sie haben sich geirrt.
Irgendwo im Dunkel der Kajüte schnurrte wie von fern die Katze.
Ich bin gar nicht da.
Nicholas wusste genau, welches Gesicht sie dabei machte.
Vergessenwerden.
Schließlich schlief er ein.
Früh am nächsten Morgen. Bevor Camden Town erwachte, schnatterten bereits die Enten auf dem Kanal. Sie waren immer die Ersten, die den Tag begrüßten, paddelten unter dem Fenster vorbei und sahen so aus, als würden sie geheime Pläne für den Tag schmieden. Die Enten waren die heimlichen Herrscher vom Regent’s Park, von Little Venice und überhaupt von all den Kanälen, die London durchzogen. Darüber hinaus herrschten sie auch über die meisten anderen Parks in der Stadt.
Das Hausboot, das Nicholas nun schon seit ein paar Monaten bewohnte, lag direkt am Uferweg hinter St. Martin’s Crescent und hier fühlte er sich daheim. Ein Zuhause, das zwei Meter breit und zwölfeinhalb Meter lang war, ziemlich eng, aber groß genug für das Leben, das er führte (und definitiv zu klein für das Leben, das Erika sich vorstellte). Drinnen war der Raum gerade groß genug für einen Tisch, zwei Stühle, einen Ofen, eine mickrige Küchenzeile mit Gasherd, dazu ein kleines Bad und, hinten im Heck, das Bett. Ein paar Bücher standen auf den wenigen Regalen, recht dürftig für jemanden, der das Lesen mochte (und das Schreiben). Aber seitdem er hier auf dem Hausboot lebte, hatte Nicholas sich angewöhnt, seine Bücher in der Bibliothek auszuleihen. Was es auf dem Hausboot nicht gab, war Platz.
Als er vor drei Jahren nach London gekommen war, hatte er auf einem anderen Hausboot gewohnt, doch Kadir Jones, der das Boot gemietet hatte, besaß keine Lizenz für einen festen Anlegeplatz. So etwas war teuer. Dann musste man alle zwei Wochen den Anker lichten und ein Stück den Kanal rauf- oder runterfahren, um sich einen neuen Platz für die nächsten beiden Wochen zu suchen. Das hatte den Vorteil, dass man sich frei fühlte und ein Vagabund auf den Kanälen war. Andererseits hatte man keinen festen Wohnsitz, was aber eigentlich nur dann zu einem Problem wurde, wenn man ein Päckchen erwartete.
„Wir sind Kanalnomaden“, pflegte Kadir oft zu sagen. „Die Wasserwanderer von London.“
Zugegeben, das klang romantischer, als es war. Aber es war auch romantischer, als man dachte.
Nicholas war aus Edinburgh nach London gekommen, um Sprachwissenschaften zu studieren, nicht ahnend, wie schwierig es sich gestalten würde, ein Dach über dem Kopf zu finden. Nichts von dem, was verfügbar war, konnte er sich leisten. Nichts von dem, was er sich leisten konnte, war verfügbar. Durch eine glückliche Fügung hatte er Kadir Jones kennengelernt, der auf einem Boot in Little Venice lebte. Dort zog Nicholas ein, erst mal nur für den Übergang, bis er eine Bude gefunden hätte. Am Ende hatte der Übergang fast zwei Jahre gedauert, eine Zeit, in der er sich vornehmlich mit diversen Jobs herumgeschlagen hatte und nur selten in den Vorlesungen aufgetaucht war. Kadir war geduldig, sie teilten sich die Miete für das Hausboot, und mit der Enge kamen sie gut zurecht, zumal sie aufgrund ihrer Jobs sowieso selten gleichzeitig da waren.
Dann, eines Nachmittags, hatte Nicholas damit begonnen, einen Roman zu schreiben, und die Geschichte floss ihm leichter von der Hand, als er es sich vorgestellt hatte. Die anderen Studenten, die Schreibkurse belegten, brüsteten sich immer damit, eine extrem schwierige Arbeit erledigt zu haben, aber Nicholas machte das Schreiben Spaß, und es schien weniger anstrengend zu sein als die Stunden, die er als Briefträger, Verkäufer oder Kellner verbrachte. Einen Roman auf einem Hausboot zu schreiben war jedenfalls eine feine Sache gewesen. Es hatte etwas herrlich künstlerisch Abenteuerliches.
„Außerdem kommt es fantastisch bei den Frauen an“, pflegte Kadir Jones zu sagen. Womit er nicht ganz unrecht hatte.
„Ich bin ein richtiger Bohemien“, stellte Nicholas James stolz fest. Es war ein gutes Gefühl, Schriftsteller zu sein.
„Glaubst du, dass du einen Verlag findest?“, wollte Kadir wissen.
„Zuerst muss ich die Geschichte beenden.“ Nicholas glaubte fest daran, immer einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Eines Tages jedenfalls (der Roman war noch nicht fertig) legten sie genau hier, am Ufer hinter dem St. Martin’s Crescent an und Nicholas verbrachte die Nachmittage damit, oben an Deck zu sitzen, auf einem recht wackligen Klappstuhl vor einem nicht minder wackligen Gartentisch, und die Geschichte, die ihm nicht mehr aus dem Kopf ging, in ein einfaches Notizbuch zu schreiben. Er wusste, dass es Computer gab, und er hatte nichts gegen Laptops, aber beim Schreiben bevorzugte er das Gefühl, mit einem richtigen Stift auf richtigem Papier zu schreiben. Es wirkte einfach wahrhaftiger. Es tat gut und fühlte sich echt an.
Auf dem Hausboot, neben dem sie angelegt hatten (der Dorian Gray), saß an denselben Nachmittagen ein großer, beleibter Mann mit Laptop. Er schaute hin und wieder zu Nicholas rüber, sagte aber erst nach einer Woche etwas, abgesehen von einem gelegentlichen höflichen, aber knappen nachbarschaftlichen Gruß zwischen Bootsbewohnern.
„Ich habe dich beobachtet, Nachbar.“ Genau so begann er das Gespräch. Er wirkte ruhig, nahezu behäbig, und schlau. „Mir ist nicht entgangen“, fuhr er fort, „dass du jeden Tag in ein Notizbuch schreibst.“ Er stand auf dem Uferweg vor dem Boot, als Nicholas sein Fahrrad an Bord tragen wollte. „Ich erkenne einen Schriftsteller, wenn ich ihn sehe.“ Er lächelte. „Die Geschichten stehen den meisten, denen sie einfallen, ins Gesicht geschrieben. Habe ich recht?“ Bevor Nicholas etwas erwidern konnte, stellte der Mann sich ihm vor: „Ich bin Jonathan Fry.“ Bereits beim nächsten Satz stellte sich heraus, dass er Lektor bei Pluckley House war. „Ich bin neugierig und immer auf der Suche nach Neuem, könnte man sagen.“ Er lachte.
Nicholas wusste nicht so recht, was genau er meinte. Er ahnte natürlich, dass er Romanmanuskripte meinte, wurde das Gefühl aber nicht los, es könnte auch noch etwas anderes sein. „Wenn du möchtest, kann ich es lesen. Dein Manuskript. Wenn es fertig ist. Ganz wie du willst. Ich kann dir aber nichts versprechen, Nachbar. Wenn es schlecht ist, werde ich es dir sagen. Wenn es gut ist …“ Wieder grinste er. „Nun ja, wenn es gut ist, dann ist alles möglich.“
Nicholas vertröstete ihn an diesem Tag, und im Lauf der nächsten Woche schrieb er die Geschichte fertig. Sie hieß Malvina und war keine zweihundert Seiten lang (sauber abgetippt in Word).
„Es ist eine Geistergeschichte“, sagte er, als er sie Mr. Fry überreichte. Er war extra mit dem Fahrrad zum Hausboot gefahren, um eine Kopie des Manuskripts zu übergeben, denn Kadir Jones hatte mittlerweile ablegen müssen und war erneut drüben in Little Venice vor Anker gegangen.
„Wie passend“, meinte Mr. Fry, der Zeitung lesend auf dem Dach der Dorian Gray saß.
Nicholas sah ihn fragend an.
„Dein Name. Nicholas James. Wie M. R. James.“ Fry betrachtete die erste Seite. „Du weißt schon: Montague Rhodes James.“ Er lächelte süffisant. „Nicht zu verwechseln mit E. L. James.“ Er zog ein Gesicht wie jemand, der gerade an verdorbenes Essen denken musste. „Außerdem, nenn mich Jonathan.“
„Ist gut“, sagte Nicholas.
Und dann?
Malvina, die Geschichte einer alten Frau aus Schottland, die glaubt, den Geist ihres verstorbenen Mannes zu sehen, wurde veröffentlicht. Sie gefiel den Kritikern und auch einigen Lesern. Sie machte Nicholas zwar nicht reich, aber das Geld, das sie einbrachte, war willkommen und mehr, als er an sechs Tagen die Woche als Briefträger verdiente. „Erfolgreich genug, um an deinem nächsten Buch interessiert zu sein“, drückte es Jonathan aus. Also freute sich Nicholas – nicht zuletzt, weil er sich jetzt wie ein richtiger Schriftsteller fühlte, und das schon im Alter von vierundzwanzig Jahren. Als Jonathan ihm ein Interview beim Guardian besorgte, entfuhr ihm der Satz, der ihn von da an begleiten sollte: „Ich bin nur ein gewöhnlicher Junge.“ Mehr brauchte die Presse nicht. Von da an war er der gewöhnliche Junge.
Er beschloss, bald einen weiteren Roman zu schreiben, aber ihm fiel vorerst nichts ein. Nicht, dass ihm das Kopfzerbrechen bereitet hätte.
„Weißt du, was das Wichtigste für einen Schriftsteller ist?“, fragte ihn Jonathan bei einem Glas Wein an Deck.
„Inspiration?“
Der beleibte Lektor schüttelte den Kopf. „Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist es, einen Beruf zu haben, der ihm ein Einkommen verschafft. Wenn du also nicht enden willst wie viele, die Tag für Tag Scheiße schreiben, nur weil sich die Scheiße verkauft, dann beende dein Studium und behalte den Job bei der Post.“ Er hob sein Glas. „Wenn dir jemand einen kostenlosen Rat gibt, dann solltest du ihn beherzigen.“
„Ist gut“, sagte Nicholas. Er kündigte den Aushilfsjob bei der Post nicht, sondern reduzierte die Arbeit nur auf vier von sechs Wochentagen. Er besuchte Seminare an der UCL und teilte sich weiterhin die Miete mit Kadir Jones. Und er verliebte sich in Erika Hallberg, die beim Lehrstuhl für Moderne Literatur als studentische Hilfskraft arbeitete. Die beiden wurden schnell ein Paar.
Vor knapp einem halben Jahr, kurz vor Weihnachten, verkündete Jonathan Fry plötzlich, dass er auf Weltreise gehen wolle.
„Es ist an der Zeit, den Spuren Lord Byrons zu folgen. Nun ja, im Geiste.“ Ein vielsagendes Lächeln folgte. „Ich werde einen Reiseführer schreiben für Menschen, die das Reisen hassen. Koffer packen, Koffer schleppen, Koffer suchen, wer mag das schon? In den meisten Ländern ist es heiß und es gibt Moskitos. Kurz und gut. Ich werde zwei Jahre fort sein, und ich brauche jemanden, der sich während dieser Zeit um die Dorian Gray kümmert. Den Kräutergarten, die rostigen Stellen und die Katze, du weißt schon, Whoopie.“ Er zwinkerte Nicholas zu. Sie saßen im Ye olde Cheshire Cheese bei einem Ale zusammen. „Na, wie sieht’s aus?“
Die Antwort lautete: „Wow!“
„Sehr prägnant, gefällt mir.“ Jonathan lachte.
Einen Handschlag später war es beschlossene Sache.
So bezog Nicholas seinen ersten festen Wohnsitz in London. (Sah man vom leichten Schaukeln auf den Wellen ab.) Er wohnte auf der Dorian Gray, kümmerte sich um die Kräuter und die Katze (und die rostigen Stellen am Boot) und wartete auf den Sommer.
„Der Anlegeplatz gehört mir“, hatte Jonathan ihm schon vor einiger Zeit erklärt. „Der Vorteil, wenn man ein gutes Lektorengehalt verdient, hm?“
Jeden Morgen, so wie heute, wenn Nicholas hinaus an Deck ging, sich mit einer Tasse frisch aufgebrühtem Kaffee in den Liegestuhl fallen ließ, die Kräuter, die aus den vielen Holzkisten wucherten, roch, den Uferweg betrachtete – zu dieser Uhrzeit trieben sich meist nur ein paar Jogger dort herum und Anwohner des Crescent, die ihre Hunde ausführten –, dann war er dankbar, genau dieses Leben zu führen. Whoopie, die Katze, kam meist erst am späten Nachmittag vorbei.
Der Mai in London ist wie ein leicht verschlafener Sommer. Nicholas mochte den Mai.
Das Einzige, was ihm den Genuss des Kaffees und die taufrische Morgenstimmung an Bord ein wenig verdarb, war die Erinnerung an den seltsamen Mann mit den zornigen Augenbrauen, der neben seinem Bett gestanden hatte. Andererseits, warum sich grämen und grübeln? Es war ja nichts passiert, außer dass er sich erschrocken hatte. Vermutlich hatte er tatsächlich nur intensiv geträumt, nicht mehr.
Trotzdem wollten ihm die Worte des dünnen Mannes nicht aus dem Sinn gehen: Ich bin gar nicht hier. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass er ihn wiedersehen würde. Keine Ahnung, warum.
„(Christoph Marzis) märchenhaft-urbanen Romane bereichern die Szene.“
Wunderschön geschriebenes All Age-Abenteuer über eine geheimnisvolle Welt der Toten.
Die spannende, sehr bildliche und manchmal auch gruselige Handlung wirkt mitreißend und die humorvollen Elemente machen Spaß.
In „Mitternacht“ schafft Christoph Marzi eine Parellelwelt voller Geister und eine geheimnisvolle, verträumte Leseatmosphäre.
Das ganze Buch fesselt und zerstört einen vor Spannung.
„Die Idee und die Atmosphäre machen das Buch zu einem Lesevergnügen für alle Mystery-Fans und Leseratten, die es gerne etwas unheimlicher mögen.“
„Christoph Marzis Romane sind immer etwas Besonderes. Sie zeichnen sich durch einen eigenen, märchenhaften Stil aus, der die Leser mit feinen Charakteren und stimmungsvollen Beschreibungen der Handlungsorte verzaubert.“
„In wundervollen Worten erzählt, so wie alle von Marzis Geschichten.“

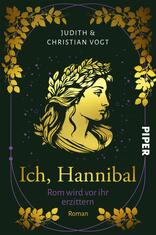









Kurzmeinung: Grandiose Idee, perfekter Anfang, lässt am Ende leider nach. Nicholas lebt in London, bis er eines Nachts auf dem Hausboot eine Person sieht, die sich dann als eine Art Geist entpuppt und mit ihm ins „andere“ London wechselt. Dort trifft er auf den Findelgeist Agatha und ist plötzlich mitten in einem Abenteuer und dem Kampf gegen die drohende Dunkelheit, die beide Welten übermannen wird. Dieses Buch lässt mich mit gemischten Gefühlen zurück. Christoph Marzi hat einen eigenen, ganz besonderen Stil, der mich jedes Mal mitnimmt. Ich war auch dieses Mal ab dem ersten Erlebnis gefesselt. Die Idee mit der zweiten Welt, die parallel zu unserer existiert und ihn die Dinge kommen, die auf unserer Welt sterben, finde ich sensationell. Die Geschichte ist in der 3. Person geschrieben und Nicholas James, ein junger Student, der nebenbei etwas jobbt, steht im Mittelpunkt. Er ist ein offener, junger Mann, lebt in den Tag und hat keine zu hohen Ansprüche an das Leben. Er war mir gleich sympathisch, wobei er auch mehr hätte hinterfragen können. Er nimmt das alles sehr leicht hin. Die Geschichte ist überraschend, hat mich zum Schmunzeln gebracht und ist auch gerne mal etwas poetisch. Zitate: „Was war das hier? Olivanders Zauberstabladen für Regenschirme?“ „Den Geruch der Sonne genießen und im Schatten lesen, all die losen Gedanken freilassen, bis sie irgendwann im hellen wolkenlosen Himmel wie Seifenblasen zerplatzen“ Durch die bildhafte Sprache kann man in die Nebelwelt eintauchen und ich war gefesselt von den Abenteuern. Die teils langen Sätze haben meinen Lesefluss nicht gestört und ich war begeistert, bis zum Ende hin alles zu schnell abgehandelt wird. Was letztendlich auch erklärt wird, denn der Autor ist schwer erkrankt. Die Bewertung fällt mir demnach recht schwer. Respekt, das die Geschichte beendet wurde, aber auch Unsicherheit, ob der Autor nicht vielleicht hätte warten sollen, bis er wieder gesund ist. Ein faszinierendes Buch, das Luft für eine Fortsetzung lässt, wie auch der Autor verlauten lässt. Dennoch kam mir das Ende zu abrupt und ich hätte da gerne noch ein paar Erklärungen gehabt.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.