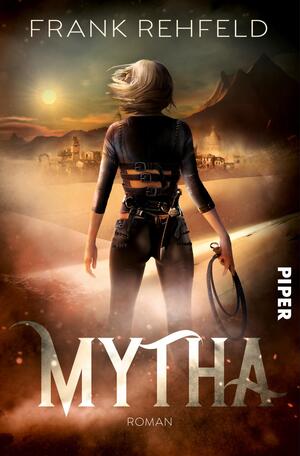
Mytha (Mytha) — Inhalt
Sie sind Meister ihres Fachs und auf jeden von ihnen ist ein horrendes Kopfgeld ausgesetzt: Mytha, die Diebin. Olimarch, der Giftmischer. Adamurt, der Meuchelmörder. Linton, der Söldner. Nariz D'huzhoryn, die schwarze Magierin. Skrupel sind für sie ein Fremdwort und sie verabscheuen einander, doch als der undurchsichtige Silvan sie für einen Auftrag anheuert, können sie der Aussicht auf unermesslich reiche Beute nicht widerstehen und raufen sich zusammen. Sie folgen ihm ins Reich der Dämonen und Schattenwesen, bevölkert von Unholden, gegen die selbst ihre eigene Bosheit verblasst. Zu spät erst erkennen sie, was Silvan wirklich plant, und dass es für sie eine Reise ohne Wiederkehr werden soll …
Leseprobe zu „Mytha (Mytha)“
Der Fremde
1
Der Fremde sah verdächtig aus, deshalb beschloss Petrolo, ihn im Auge zu behalten. Er ahnte, dass dieser Mann Ärger machen würde. Gut so. Je mehr Ärger einer machte, umso mehr Gelegenheiten zum Zugreifen. Solche boten sich nahezu immer und überall, wenn man nur die Augen offen hielt. Wer in den Slums von Meridor überleben wollte, lernte diese Lektion bereits von Kindesbeinen an, und obwohl gerade erst zwölf geworden, hielt Petrolo sich für absolut nicht auf den Kopf gefallen.
Aber Gelegenheiten waren tückisch. Oftmals tarnten sie sich mit dem [...]
Der Fremde
1
Der Fremde sah verdächtig aus, deshalb beschloss Petrolo, ihn im Auge zu behalten. Er ahnte, dass dieser Mann Ärger machen würde. Gut so. Je mehr Ärger einer machte, umso mehr Gelegenheiten zum Zugreifen. Solche boten sich nahezu immer und überall, wenn man nur die Augen offen hielt. Wer in den Slums von Meridor überleben wollte, lernte diese Lektion bereits von Kindesbeinen an, und obwohl gerade erst zwölf geworden, hielt Petrolo sich für absolut nicht auf den Kopf gefallen.
Aber Gelegenheiten waren tückisch. Oftmals tarnten sie sich mit dem Mantel der Belanglosigkeit; dann wieder zeigten sie sich in goldene, weithin strahlende Gewänder gehüllt, dabei verbarg sich hinter dem schönen Schein oftmals nur Leere. Man musste schon den richtigen Blick für Menschen besitzen und bereit sein, im richtigen Moment entschlossen zuzupacken.
Hier jedoch bot sich eine echte Gelegenheit, das spürte Petrolo sofort. Vielleicht eine günstige Möglichkeit, den Fremden um seine Geldbörse zu erleichtern. Bei unbedeutenden Taschendiebstählen drückte sogar die Diebesgilde beide Augen zu, die es sonst gar nicht schätzte, wenn jemand in ihrem Revier wilderte. Vielleicht schnappte er aber auch nur ein paar Worte auf, die interessant genug waren, um sie anschließend zu verkaufen. Informationen gehörten zum Lebenselixier der Stadt, und wenn sie ungewöhnlich waren, gab es immer einen Abnehmer dafür.
Die Tatsache, dass ein Fremder nach Meridor kam, war für sich allein zunächst noch nichts Besonderes. Täglich legten zahlreiche Schiffe an, Karawanen trafen ein oder brachen auf, und Händler hielten Ausschau nach günstigen Schnäppchen, wie es sich für das fraglos bedeutendste Handelszentrum des Reiches gehörte.
Auch den Fremden konnte man leicht für einen Händler halten, den die Hoffnung auf gute Geschäfte hierher verschlagen hatte. Er mochte um die dreißig Jahre zählen, war hochgewachsen, mit kurz geschnittenem schwarzem Haar und einem sorgsam gestutzten Vollbart. Seine gebräunte Haut, in die Wind und Wetter bereits erste Falten um Mund- und Augenwinkel gegraben hatten, verriet, dass er sich viel im Freien aufhielt. Seine Kleidung war von einer längeren Reise etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber sie war zweifellos teuer gewesen und verriet einen gewissen Wohlstand, wirkte jedoch zugleich zweckmäßig und nicht so übertrieben vornehm, wie Angehörige des Adels sie bevorzugten. Alles in allem verkörperte der Fremde das fast perfekte Bild eines mittelmäßig wohlhabenden Händlers, der sich in nichts von den zahlreichen anderen Händlern zu unterscheiden schien, die an diesem Nachmittag über den Markt schlenderten.
Auf den ersten Blick.
Sah man jedoch genauer hin, merkte man rasch, dass dieses Bild nur Fassade war, und Petrolo besaß einen ausgeprägten Blick für Details.
Da war zunächst einmal das Schwert, das der Mann am Gürtel trug. Es war groß und vermutlich ziemlich schwer, man brauchte offensichtlich viel Kraft, um es zu schwingen. Keine Waffe, wie sie ein Händler mit sich herumzutragen pflegte, der sich zudem noch auf den Schutz zweier Leibwächter verlassen konnte, die einen halben Schritt hinter ihm gingen. Eine solche Waffe wurde nur von Kriegern getragen.
Gleiches galt für seine Bewegungen. Sie waren viel zu geschmeidig für einen Mann, dessen Hauptbeschäftigung im Aushandeln von Geschäften, im Ankauf und Verkauf von Waren bestand. Dazu passten auch seine kräftigen Hände, in denen er sich wesentlich besser das Heft des Schwertes als einen Federkiel vorstellen konnte. Dazu passte die fast fingerlange Narbe an der Stirn, die nur unvollständig durch sein Haar verdeckt wurde. So etwas zog man sich nicht beim Blättern in Bilanzen zu.
Nein, etwas stimmte mit dem Fremden nicht. Er war kein Händler, sondern versuchte nur wie ein solcher zu wirken. Sein Geschäft war das Kriegshandwerk. Das machte ihn auf jeden Fall zu etwas Besonderem in Meridor.
Petrolo überlegte, was er mit diesem Wissen anfangen, wie er es am besten in klingende Münze umwandeln konnte. Er könnte zu Maliko gehen. Der fette Glatzkopf war an allem interessiert, was in Meridor vorging, aber er war auch ein Geizkragen und würde sicherlich nicht mehr als einen Dinar für so eine zunächst noch recht dürftige Information herausrücken. Immerhin – in einer Stadt, in der es neben unermesslichem Reichtum auch Hunger und Armut im Überfluss gab, war ein Dinar für einen Waisenjungen schnelles und leicht verdientes Geld. Dafür gab es genug Brot und Fleisch, um für Tage satt zu werden.
Aber Petrolo war davon überzeugt, dass wesentlich mehr aus dieser Sache herauszuholen war, wenn er herausfand, was der Fremde wollte. Mit einer solchen Information könnte er sich statt an Maliko vielleicht sogar an Torrini wenden. Dieser zahlte wesentlich besser, interessierte sich jedoch ausschließlich für ganz besondere Informationen, die anderen nur schwer zugänglich waren; darüber hinaus beschäftigte er eine eigene kleine Privatarmee meist jugendlicher Schnüffler, die ihn über alles auf dem Laufenden hielten. Wenn man es schaffte, in diese Truppe aufgenommen zu werden, brauchte man so schnell keinen Hunger mehr zu leiden. Um dies zu erreichen, musste man Torrini jedoch zunächst einmal seinen Wert beweisen, indem man ihm Informationen von Wert lieferte, die seinen eigenen Schnüfflern entgangen waren.
Unauffällig folgte Petrolo der kleinen Gruppe, wobei er sich kaum Mühe zu geben brauchte. Keiner der drei blickte sonderlich häufig hinter sich. Während seine Begleiter mit ihren Blicken die Umgebung nach Gefahren absuchten, musterte der Fremde zumindest gelegentlich die an den Ständen zur Schau gestellten Waren, schien aber nicht sehr interessiert daran zu sein, irgendetwas zu kaufen. Er machte eher den Eindruck, als würde er nur die Stadt erkunden.
Petrolo blieb an einem Stand für Schnitzwaren stehen und tat so, als würde er einige der Teile bewundern, während er sich verstohlen, aber gründlich ein weiteres Mal umsah, ehe er das Misstrauen des Händlers erweckte und dieser ihn davonjagte. Nach wie vor war keiner von Torrinis Schnüfflern zu erblicken. Dafür hatte Petrolo etwas entdeckt, was ihm mindestens ebenso wenig gefiel: Rattengesicht.
Natürlich hieß der Junge nicht wirklich so, wurde aber allgemein so genannt, weil nicht nur sein Gesicht Ähnlichkeit mit dem eines Nagers aufwies, sondern er auch ähnlich verschlagen, gerissen und feige wie eine Ratte war. Er war vierzehn und somit schon fast erwachsen, und es bereitete ihm Freude, Jüngere zu quälen, während er vor Stärkeren katzbuckelte. Petrolo wusste nicht einmal, wie er wirklich hieß.
Und er war allein.
Wiesel, sein zwei Jahre jüngerer Bruder, der ihm gewöhnlich wie ein Schatten folgte, war nicht bei ihm, was nur bedeuten konnte, dass er bereits zu Maliko unterwegs war, um von den Fremden zu berichten. Den Weg zu ihm konnte Petrolo sich also sparen.
Jetzt blieb ihm gar nichts anderes mehr übrig, als mehr über die Absichten und Vorhaben des Fremden in Erfahrung zu bringen, wenn er aus dessen Erscheinen noch irgendwelchen Profit schlagen wollte. Durch Rattengesicht war diese Aufgabe allerdings nicht gerade leichter geworden, und viel Zeit blieb ihm auch nicht mehr, denn er hatte es jetzt mit gleich dreifacher Konkurrenz zu tun. Da war zum einen der Zufall, der jederzeit noch andere auf die Spur seines Opfers locken konnte, dann würde Maliko sicherlich weitere Schnüffler losschicken, sobald Wiesel ihm Bericht erstattete, und letztlich war da noch Rattengesicht selbst. Nicht mehr lange, dann würde der Fremde einen ganzen Rattenschwanz an Beschattern hinter sich herziehen, die sich gegenseitig auf die Füße traten, und dann wäre auch für Petrolo jegliche Chance dahin.
Im Moment jedoch bildete Rattengesicht seine einzige und direkte Konkurrenz. Wenigstens schien er ihn umgekehrt noch nicht entdeckt zu haben. Dies war Petrolos einziger Trumpf, und er war entschlossen, ihn nicht aus der Hand zu geben.
Noch vorsichtiger als bisher folgte er der kleinen Gruppe, behielt einerseits den Fremden und seine Begleiter im Auge und bemühte sich gleichzeitig, von Rattengesicht nicht gesehen zu werden. Unentdeckt zu bleiben wurde allerdings immer schwieriger, da der Fremde sich allmählich anschickte, den stark bevölkerten Marktbereich zu verlassen, und sich dem heruntergekommenen Osten der Stadt näherte. Die Stände wurden weniger und schäbiger und nur noch wenige Menschen waren auf den Straßen.
Zähneknirschend musste Petrolo einen größeren Abstand zu Rattengesicht und damit auch zu dem Fremden einhalten. Jede Deckung nutzend, die sich ihm bot, huschte er langsam vorwärts, verbarg sich hinter den auch hier noch vereinzelt stehenden Ständen und presste sich immer wieder in Hauseingänge oder Lücken zwischen den Häusern. Lange konnte es nun nicht mehr dauern, bis weitere Beschatter auftauchten. In dieser heruntergekommenen Gegend fiel jemand wie der Fremde noch mehr auf als im Trubel des Marktes.
Petrolo sah, wie der Mann auf eine Gruppe von vier Bettlern zutrat, die an eine Hauswand gelehnt dasaßen und sich bemühten, einen möglichst mitleiderregenden Eindruck zu machen. Er warf ein Geldstück in die Mütze des lahmen Olofs, der in Wahrheit keineswegs lahm, sondern sogar äußerst flink war, und sagte etwas zu ihm. Um was es sich handelte, konnte Petrolo zu seinem Leidwesen nicht verstehen, doch es schien dem Bettler nicht zu gefallen, denn ein wachsamer Ausdruck erschien auf seinem Gesicht, während er den Kopf schüttelte. Auch die drei anderen wirkten plötzlich angespannt; ihre Hände glitten näher an ihre Gürtel, wo sie unter ihrer Kleidung zweifellos ein Messer oder einen Dolch verborgen trugen.
Was ging dort vor?
In Gedanken fluchte Petrolo erbittert darüber, dass er sich so weit entfernt befand und nichts von dem Gespräch verstehen konnte. Was immer der Fremde wissen wollte, es musste etwas äußerst Wichtiges sein, um so eine Reaktion hervorzurufen. Er huschte ein Stück vorwärts bis zum Durchgang zu einem Hinterhof, von wo aus er wenigstens ein bisschen verstehen konnte.
„… keinen Adamurt“, hörte er Olof sagen. „Und ich … nichts über irgend… Katakomben.“
Petrolos Augen weiteten sich und sein Herz begann schneller zu schlagen. Fast hätte er einen leisen Pfiff ausgestoßen. Ein Kopfgeldjäger? Das passte zu dem Bild, das er sich von dem Fremden gemacht hatte. Noch bedeutungsvoller aber war der Name, den er gerade aufgeschnappt hatte.
Adamurt, der Meuchelmörder.
Wenn der Fremde nach einem Einstieg in die Unterwelt suchte, um Jagd auf Adamurt zu machen, den berüchtigtsten Mörder in weitem Umkreis, dann war das allerdings eine Information von beträchtlichem Wert. Gespannt lauschte er weiter.
„… zahle gut“, sagte der Mann mit fremdartigem Akzent. Er zog eine Geldkatze aus der Tasche und wog sie so in der Hand, dass deutlich das Klimpern vieler Münzen zu hören war. „Mach … nichts vor … Weg in … Katakomben kennst. Nimm das Geld, oder …“ Er verstummte, aber seine Begleiter legten in stummer Drohung die Hand auf den Griff ihrer Schwerter.
Eine äußerst dumme Geste, die verriet, dass sie weder wussten, wen sie vor sich hatten, noch wie die Dinge in Meridor zu laufen pflegten.
Olof sprang blitzartig auf, zog ebenso blitzartig sein Messer und stieß es vor, dass die Spitze der Klinge nur kaum eine Handbreit vor der Kehle des Fremden entfernt zum Halten kam. Auch seine Begleiter erhoben sich und zogen ihre Waffen.
„Sieh an, eine wundersame Heilung“, höhnte der Fremde.
„Geh!“, zischte Olof. „Geh und behalte dein schmutziges Geld. Wir wollen hier keine Kopfgeldjäger! Niemand wird dir helfen.“
Auch die beiden Leibwächter hatten ihre Schwerter gezogen. Drohend standen sich die beiden Grüppchen gegenüber, doch der Fremde bedeutete seinen Begleitern, ihre Waffen zu senken. Die Geldbörse hatte er wieder eingesteckt.
„Du irrst dich“, behauptete er. Auch er sprach jetzt so laut, dass Petrolo jedes Wort verstehen konnte. „Ich bin kein Kopfgeldjäger. Bring mich einfach nach unten und es soll dein Schaden nicht sein. Das gilt für jeden von euch.“
Er warf einen raschen Blick in die Runde. Einige Passanten waren stehen geblieben und verfolgten die Auseinandersetzung aus sicherer Entfernung, trotteten nun jedoch weiter. Selbst wenn einige von ihnen Einstiege in die Katakomben kennen mochten, würde keiner dem Fremden helfen. Wenn der Kopfgeldjäger wirklich hinter Adamurt her war, war er bereits so gut wie tot. Niemand würde es wagen, durch seine Hilfe den Zorn des Meuchelmörders auf sich zu ziehen.
Es wurde Zeit für Petrolo, sich zurückzuziehen. Zu viele neugierige Ohren hatten inzwischen das Ziel des Fremden erfahren. Er musste sich beeilen, wenn er der Erste sein wollte, der Torrini diese Information überbrachte.
In diesem Moment sah er, wie Rattengesicht seine Deckung verließ und mit gebeugtem Kopf raschen Schrittes über die Straße ging, als wäre er nur einer der unbeteiligten Passanten. Allerdings würde sein Weg ihn unmittelbar an dem Kopfgeldjäger vorbeiführen.
Er würde doch nicht so tollkühn sein …
Rattengesicht war so wagemutig – oder dumm, je nach Standpunkt. Offenbar konnte er dem Klang der Münzen nicht widerstehen. Der Fremde und seine Begleiter waren abgelenkt. Noch immer befand sich Olofs Messer nicht weit von seinem Hals entfernt, und Rattengesicht schien entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen. Petrolo sah, wie er seine Hand im Vorbeigehen blitzschnell in die Tasche des Fremden schob, doch offenkundig hatte er den Kopfgeldjäger unterschätzt.
Ungeachtet der auf ihn gerichteten Waffe fuhr dieser herum, packte den Jungen und zog ihn an sich. Gerade noch selbst bedroht, hielt er nun plötzlich einen Dolch in der Hand und richtete ihn auf seinen Gefangenen. Vergeblich versuchte Rattengesicht, sich aus seinem Griff zu winden, während Olof und die anderen Bettler das Durcheinander nutzten, um die Flucht in die hinter ihnen liegende Gasse zu ergreifen.
„Was haben wir denn hier?“, stieß der Fremde hervor. „Eine Schmeißfliege, die mich zu bestehlen versucht?“
„Nein, Herr, das … das wollte ich nicht!“, keuchte Rattengesicht. Sein Gesicht war von Angst verzerrt. Schweißtropfen glitzerten auf seiner Stirn. „Ich kam nur …“
„Und was ist das?“ Der Fremde drehte den Arm des Jungen herum, sodass die Geldkatze sichtbar wurde, die dieser mit seinen Fingern umklammert hielt.
Wild blickte Rattengesicht sich um, während er noch einmal versuchte, aus dem Griff des wesentlich stärkeren Mannes zu entkommen.
„Ich habe gehört, dass Ihr einen Einstieg in die Katakomben sucht“, änderte er seine Taktik. „Ich kann Euch hinführen.“
Der Fremde zögerte kurz, dann nickte er.
„Also gut. Aber ich warne dich, wenn …“
Alles ging so schnell, dass nicht einmal Petrolos scharfe Augen richtig mitbekamen, was geschah. Ein flirrender, silberner Schemen kam aus der Gasse geflogen, in der die Bettler verschwunden waren, und gleich darauf brach ein Blutschwall aus Rattengesichts Mund und Hals und ergoss sich über den Arm des Fremden. Ein Messer hatte sich bis zum Heft in seine Kehle gebohrt.
Der Kopfgeldjäger stieß ihn von sich, zog ein Tuch aus der Tasche und säuberte notdürftig seinen Arm. Rattengesichts Körper zuckte noch ein paarmal, während sich rings um ihn eine Blutlache auf dem Pflaster ausbreitete, dann lag er still.
Vom Attentäter war nichts zu sehen, doch Petrolo war sicher, dass Olof Rattengesicht zum Schweigen gebracht hatte. Die Warnung des Bettlers war eindeutig: Tod allen Verrätern.
Dass der Dolch nicht den Kopfgeldjäger, sondern den Jungen getroffen hatte, ergab Sinn. Adamurt konnte es nicht ausstehen, wenn ihn jemand des Vergnügens beraubte, einen der Idioten selbst zur Strecke zu bringen, der das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld einzustreichen versuchte. Niemand, der halbwegs bei Verstand war, legte sich mit Meridors gefürchtetstem Meuchelmörder an.
„Die Stadtwache!“, ertönte ein Ruf und ließ die meisten der Gaffer sich rasch entfernen.
Auch Petrolo erkannte, dass er bereits viel zu lange gewartet hatte. Noch war es nicht zu spät, seine Informationen an Torrini zu verkaufen, ehe dieser sie aus anderer Quelle erhielt. Aber er musste sich beeilen. Er verließ den Hofeingang und begann zu rennen, doch er kam nur wenige Schritte weit, dann prallte er gegen eine Gestalt, die überraschend hinter einem Verkaufsstand hervortrat. Sie war von Kopf bis Fuß in eine schwarze Kutte gekleidet, ihr Gesicht unter der weit nach vorn gezogenen Kapuze verborgen.
Petrolo spürte, wie die Gestalt seinen Nacken packte, und hörte gleichzeitig fremdartige, gemurmelte Worte. Eine eisige Kälte durchströmte plötzlich seinen Körper und lähmte ihn, machte es ihm unmöglich, auch nur einen Finger zu rühren.
Gefangen, dachte er entsetzt. Er war gefangen und wusste nicht einmal, von wem.
2
Ohne etwas von dem Aufruhr zu ahnen, den die bloße Erwähnung seines Namens verursacht hatte, befand sich Adamurt, der Meuchelmörder, zu diesem Zeitpunkt kaum zweihundert Schritte in nordöstlicher Richtung und rund hundert Meter in die Tiefe vom Ort des Geschehens entfernt in der Unterwelt Meridors und war denkbar schlechter Laune.
Hätte er zu diesem Zeitpunkt bereits von der Ankunft des Fremden erfahren, hätte dies seine Stimmung zweifellos gehoben, denn er schätzte Kopfgeldjäger, die hinter dem auf ihn ausgesetzten Preis her waren. Sie brachten etwas Abwechslung und Würze in das tägliche Allerlei aus Intrigen, Mord und Totschlag. Wenn sie etwas von ihrem Handwerk verstanden – und das sollte man als Mindestvoraussetzung bei einem Jäger erwarten, der sich den meistgesuchten Mörder in diesem Teil der Welt als Beute auswählte – konnte sogar ein längeres, überaus vergnügliches Katz- und Mausspiel daraus erwachsen.
Adamurt liebte solche Spiele. Vor allem liebte er es, die Rollen zu vertauschen und von der Maus zur Katze zu werden, ohne dass sein Gegenspieler es bemerkte. Nicht ohne Wehmut dachte er oft an den Mann von der Bäreninsel im hohen Norden zurück, der vor knapp zwei Jahren auf der Jagd nach ihm nach Meridor gekommen war. Adamurt hatte frühzeitig von seiner Ankunft erfahren und verschiedene Fährten ausgelegt, die zu drei ihm lästig gewordenen Konkurrenten führten. Jedes Mal fest davon überzeugt, ihn vor sich zu haben, hatte der Kopfgeldjäger alle drei für ihn aus dem Weg geräumt, ehe Adamurt des Spiels schließlich überdrüssig geworden war und ihn seinerseits getötet hatte.
Ah, welch exquisites Vergnügen hatte es ihm bereitet! Ausgerechnet den Dummkopf, der gekommen war, um ihn zu töten, unwissentlich zum eigenen Handlanger zu machen. So etwas hatte Stil und Eleganz! Schon mehr als einmal hatte Adamurt seither bedauert, dieses Spiel nicht noch mehr ausgedehnt zu haben.
Von der Hochstimmung, die er damals empfunden hatte, war seine Laune derzeit allerdings denkbar weit entfernt. Wie stets, wenn er Olimarch aufsuchte.
Niemand sonst in Meridor würde es wagen, ihn auch nur eine einzige lausige Minute warten zu lassen. Olimarch hingegen tat es immer! Jedes verfluchte einzelne Mal, wenn sie miteinander zu tun hatten, und vermutlich nicht einmal aus Notwendigkeit, sondern einzig und allein, weil es ihm Vergnügen bereitete und er es sich als Einziger erlauben durfte, ohne dafür Rache befürchten zu müssen.
Olimarch Thephilos.
Letzter Spross einer einst reichen und mächtigen Dynastie, die im Laufe der Zeit jedoch verarmt und in Bedeutungslosigkeit verfallen war, bis er dem Namen neuen Glanz und Ruhm verliehen hatte. Zumindest in gewissen Kreisen.
Wenn der Scheißkerl nur nicht so ein verdammt guter Giftmischer wäre! Aber das war er nun einmal. Er war derjenige, an dem man nicht vorbeikam, wenn man höchste Qualität und garantierten Erfolg erwartete – und dafür bezahlen konnte.
Viel bezahlen. Horrende Summen, aber das waren seine Tränke auch wert. Entsprechend klein, aber erlesen war sein Kundenstamm. Jeder andere hätte seine wenigen treuen Stammkunden besonders zuvorkommend behandelt, doch Olimarch …
Gereizt schritt Adamurt in dem kleinen, bis auf einen selten hässlichen Wandteppich völlig kahlen Warteraum auf und ab. Immer wieder ballte er so fest die Fäuste, dass sich die Muskeln an seinen Armen als knotige Stränge unter der Haut abzeichneten und die kunstvoll verzierten Metallbänder, die sich darumspannten, zu sprengen drohten. Dabei verfluchte er Olimarch insgeheim hundertfach, während er zu spüren glaubte, wie sich das Gift in seinem Körper unerbittlich ausbreitete.
Das Gift!
Auch das war etwas, was er sich von niemandem sonst gefallen lassen würde. Aber leider war Olimarch nicht nur brillant und überheblich, sondern zudem im höchsten Maße paranoid. Auf seinen Kopf war ein nahezu ebenso hohes Preisgeld ausgesetzt wie auf den seinen, und es hieß, dass er sein festungsartiges Höhlensystem in der achten Tiefenebene aus Angst vor einer Festnahme oder einem Mordkomplott neidischer Konkurrenten niemals verließ. Selbst von den zwielichtigen Bewohnern der Katakomben wagten sich nur wenige so weit in die Tiefe, was ihm zusätzliche Sicherheit verlieh. Nur wen er persönlich kannte oder wer ihm durch einen verlässlichen Bürgen vorgestellt wurde, wurde überhaupt eingelassen, doch selbst das reichte ihm nicht, um sein irrwitziges Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen.
Deshalb das Gift. Jeder musste es beim Eintreten trinken, nur einen winzigen Schluck, aber binnen einer Stunde wirkte es tödlich, wenn man nicht rechtzeitig das Gegenmittel erhielt, das es erst gab, wenn man Olimarch wieder verließ. Ein absolut sicheres System: Wer ihn tötete oder sonst wie sein Missfallen erregte, der verurteilte sich damit selbst zum Tode.
Unerbittlich verstrich die Zeit. Adamurt fragte sich, wie lange er nun schon wartete. Vermutlich nicht mehr als zehn oder fünfzehn Minuten, aber ihm kamen sie wie eine Ewigkeit vor. Wie schon mehrfach bei früheren Besuchen fragte er sich, ob Olimarch möglicherweise der Verlockung erlegen war, das Kopfgeld für ihn zu kassieren oder ihn im Auftrag eines Widersachers aus dem Weg zu räumen.
Einige weitere Minuten flossen quälend langsam dahin, dann endlich öffnete Maline, eine unscheinbare, dunkelhaarige Frau, die ihn auch hereingelassen und ihm das Gift verabreicht hatte, die Tür zu Olimarchs Empfangsraum und bat ihn einzutreten. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, stürmte der Mörder an ihr vorbei.
„Der Höllenschlund soll dich verschlingen, du räudiger Bastard einer verlausten Hafenhure!“, brüllte er wütend. „Was fällt dir ein, mich so lange warten zu lassen, du stinkender, verwanzter, krummbeiniger, verfluchter, stinkender …“
„Du wiederholst dich. Stinkend hattest du schon erwähnt“, unterbrach Olimarch ihn mit einem süffisanten Grinsen. Wie stets saß er hinter einem klobigen Schreibtisch, der zusammen mit einem lederbezogenen Sessel für ihn und einem unbequemen Schemel für Besucher die einzige Einrichtung bildete. Durch eine halb offene Tür im Hintergrund konnte man einen kleinen Ausschnitt eines weiteren Raums mit einer Wand voller Bücher und Folianten erblicken, außerdem einen Teil eines Tisches, auf dem zwischen unzähligen Retorten und Fläschchen ein gewaltiger Alambic zum Destillieren stand. „Und ich freue mich auch, dich zu sehen. Leider konnte ich dich nicht eher empfangen, da einige unaufschiebbare Angelegenheiten meine ganze Aufmerksamkeit erforderten, du verstehst?“
„Sicher“, schnaubte Adamurt und stützte sich mit den Fäusten auf den Tisch. „Musstest du dich selbst am Sack kratzen, oder hat Maline das für dich erledigt? Verlass dich drauf, eines Tages werde ich meine Hände um deinen Hals legen und genüsslich jeden Funken deines erbärmlichen Lebens aus dir herauspressen.“
Über den Tisch hinweg starrten die beiden Männer sich an. Ein größerer Gegensatz als zwischen ihnen war kaum vorstellbar. Mit seinen achtundzwanzig Jahren war Adamurt nicht mehr gerade jung, aber sein Gegenüber musste annähernd doppelt so alt sein. Der Mörder war braun gebrannt und von gedrungener, kräftiger Gestalt, Olimarch hingegen klein und so dürr, dass er fast zerbrechlich wirkte, mit einer geradezu widernatürlich bleichen Haut. Graues, gelocktes Haar reichte ihm bis zu den Schultern, während Adamurt bis auf einen dunklen Bart, der seinen Mund von der Oberlippe bis zum Kinn umgab, völlig kahlköpfig war. Olimarch trug ein dunkelgrünes, mit fremdartigen Symbolen besticktes Gewand, das bis zum Boden reichte, Adamurt eine lederne Hose, die in kniehohen Stiefeln verschwand, und darüber eine offene, gleichfalls lederne Weste. Seine Nase war von mehreren lange zurückliegenden Brüchen krumm, während Olimarch eine ausgeprägte Hakennase besaß.
„Wir wissen beide, wie sehr du am Leben hängst und dass du so etwas deshalb nie tun würdest“, entgegnete der Giftmischer ungerührt.
„Vorher würd’ ich natürlich Maline bestechen, dass sie mir das Gegenmittel gibt, nachdem ich auf deinen Kadaver gespuckt habe.“
Olimarchs Lächeln vertiefte sich noch.
„Damit würdest du kaum Erfolg haben, alter Freund. Selbstverständlich habe ich mich entsprechend abgesichert. Auch ihr Leben hängt allein an einem Gegenmittel, das ich täglich neu herstelle. Mein Tod würde auch den ihren bedeuten, deshalb ist sie unbestechlich. Du dürftest mich gut genug kennen, dass ich niemals einen anderen Menschen in meinem Allerheiligsten dulden würde, der mir nicht vollkommen ausgeliefert wäre.“ Das Lächeln verschwand von seinem Gesicht und seine wässrig blauen Augen schienen plötzlich kalt wie Glas. „Aber genug der Höflichkeiten. Du bist sicher nicht nur hier, um mir mit deinem Geschwätz ein wenig die Langeweile zu vertreiben. Was willst du? Ein besonders perfides Gift?“
Adamurts Zorn war längst verraucht. Die Beschimpfungen und Morddrohungen kamen zwar von Herzen, waren aber nicht mehr als Teil eines inzwischen lieb gewonnenen Begrüßungsrituals zwischen ihnen. Nun wurde auch er von einem Moment zum nächsten ernst und ließ sich auf den Schemel sinken.
„Ein Liebeselixier“, sagte er.
„Das läuft in etwa auf das Gleiche hinaus wie Gift. Du wirst doch nicht etwa in Leidenschaft zu einer holden Maid entflammt sein, die deinem unvergleichlichen Charme zu widerstehen vermag?“
„Solchen Unsinn traust du mir doch nicht wirklich zu? Nein, ich soll jemanden töten, der an fast ebenso krankhaftem Verfolgungswahn leidet wie du. Sein Haus ist wie eine Festung geschützt und sein Personal geradezu widerlich loyal. Wenn jedoch eine seiner Dienerinnen in Liebe zu mir entflammen und mich des Nachts unbemerkt hineinlassen würde … Du verstehst, was ich meine.“
Olimarch nickte.
„Ein Hörigkeitstrank würde den gleichen Zweck erfüllen, wäre aber weitaus leichter herzustellen und deshalb deutlich billiger.“
„Daran hab’ ich auch erst gedacht, aber einem aufmerksamen Beobachter fällt auf, wenn jemand unter einem fremden Bann steht. Leerer Blick, schlaffes Gesicht, monotone Stimme … Nein, Verliebtheit ist besser. Die lässt einen höchstens schwachsinnig grinsen, aber meistens nur, wenn man allein ist.“
„Wie du meinst. Einen Liebestrank zu brauen ist für mich kein Problem, obwohl er sehr stark sein muss, um diese Dienerin dazu zu bringen, etwas zu tun, das gegen ihren Willen und ihr Gewissen verstößt. Das wird einiges kosten. Aber es trifft ja keinen Armen.“
Adamurt verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
„Vielleicht sollt’ ich dir miesen Kakerlake zum Dank für das lange Warten die Ohren abschneiden“, überlegte er laut, verschränkte die Hände ineinander und ließ die Knöchel knacken. „Wär’ kein Verlust, da du sie anscheinend nur brauchst, um deinen hässlichen Kopf im Gleichgewicht zu halten. Ich sprach von ’nem Elixier. Was soll ich mit ’nem Trank? Ich kann sie ja wohl nich’ einladen, mit mir gemütlich was trinken zu geh’n, du verlotterter Schwachkopf. Es muss schon ein Elixier sein, mit dem ich sie unauffällig besprenkeln kann.“
Einige Sekunden herrschte Schweigen.
„Ein Elixier, das über die Haut wirkt, hm.“ Der Giftmischer lehnte sich zurück und massierte sein Kinn. „Das ist extrem schwierig herzustellen und wird dich noch eine ganze Menge mehr kosten.“
„Aber es is’ möglich?“
„Habe ich das nicht gerade gesagt?“
„Gut. Und wie viel genau würd’s mich kosten?“
„Sagen wir tausend Dinar. Als Freundschaftspreis.“
Adamurt sog scharf die Luft ein.
„Und wie viel kostet es für Nicht-Freunde? Die Hälfte?“
„Aber, aber, jetzt beleidigst du mich wirklich.“
„Du bist ein elender Halsabschneider und das sag’ ich dir in aller Freundschaft. Achthundert Dinar und nicht einen mehr.“
„Es steht dir natürlich frei, zu Lurilon oder einem der anderen Stümper zu gehen. Die sind billiger, aber was die dir zusammenbrauen, würde deiner holden Dienerin wahrscheinlich eher Durchfall statt Liebesgefühle verursachen. Bei mir kostet ein solches Elixier jedenfalls tausend Dinar und nicht einen Dinar weniger.“
Adamurt schnaubte.
„Irgendwann werd’ ich dir wirklich den Kopf von den Schultern reißen, natürlich ebenfalls in aller Freundschaft.“
„Dann sind wir uns also einig. Brauchst du auch ein Gegenmittel, um die Gefühle der Holden nach erfolgter Missetat wieder erlöschen zu lassen?“
„Wozu? Sie wird es ohnehin nicht überleben.“ Adamurt stand auf. „So viele verlorene Seelen, die ich ins Jenseits geschickt hab’, warten dort mit inbrünstigem Hass auf mich, da kann’s nicht schaden, wenn wenigstens eine mich voller Liebe erwartet“, fügte er mit einem kalten Lächeln hinzu.
„Wie du meinst. Komm morgen um die gleiche Zeit wieder her, dann habe ich dein Elixier fertig. Und vergiss nicht die tausend Dinar.“
„Keine Bange, du verlotterter Scheißer.“ Adamurt wandte sich zur Tür. „Aber verlass dich drauf, dass ich vorher darauf pissen werde.“
Er lächelte zufrieden, als er den Raum verließ und sich von Maline das Gegengift reichen ließ. Der Preis, den Olimarch verlangte, lag im Rahmen dessen, womit er gerechnet hatte, und er würde das Elixier sogar schneller bekommen als erwartet. Schon in der übernächsten Nacht würde sein Opfer ein toter Mann und er selbst einen Tag später um eine beträchtliche Summe reicher sein.
Es war wundervoll, wie sehr ein bisschen Mord und Totschlag einem das Leben versüßen konnten.


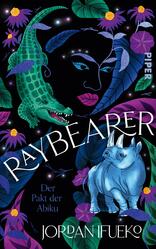


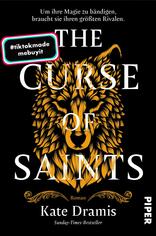





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.