
Neben uns die Sintflut
Wie wir auf Kosten anderer leben
„Der renommierte Soziologe Stephan Lessenich bietet eine sehr konkrete und politisch brisante Analyse der Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse der globalisierten Wirtschaft.“ - Anwalt aktuell (A)
Neben uns die Sintflut — Inhalt
Im Grunde wissen wir es alle: Uns im Westen geht es gut, weil es den meisten Menschen anderswo schlecht geht. Doch nur zu gerne verdrängen wir unseren Anteil an dem sozialen Versagen unserer Weltordnung. Der renommierte Soziologe Stephan Lessenich bietet eine sehr konkrete und politisch brisante Analyse der Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse der globalisierten Wirtschaft. Anders, als wir noch immer glauben möchten, profitieren nicht alle irgendwie von freien Märkten. Die Wahrheit ist: Wenn einer gewinnt, verlieren andere. Und jeder von uns ist ein verantwortlicher Akteur in diesem Nullsummenspiel, dessen Verlierer jetzt an unsere Türen klopfen. Für die Taschenbuchausgabe wurde das Buch umfassend aktualisiert und überarbeitet.
Leseprobe zu „Neben uns die Sintflut“
„Die internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass einige Länder sich im Gewinnen und andere im Verlieren spezialisieren.“
Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas (1973)
Mariana, am 5. November 2015: In der Bergbaustadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais brechen die Dämme zweier Rückhaltebecken, in denen die Abwasser einer Eisenerzmine gesammelt wurden. 60 Millionen Kubikmeter schwermetallhaltigen Schlamms – dem Inhalt von 25000 olympischen Schwimmbecken entsprechend – ergießen sich über die Anrainergemeinde Bento Rodrigues und in [...]
„Die internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass einige Länder sich im Gewinnen und andere im Verlieren spezialisieren.“
Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas (1973)
Mariana, am 5. November 2015: In der Bergbaustadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais brechen die Dämme zweier Rückhaltebecken, in denen die Abwasser einer Eisenerzmine gesammelt wurden. 60 Millionen Kubikmeter schwermetallhaltigen Schlamms – dem Inhalt von 25000 olympischen Schwimmbecken entsprechend – ergießen sich über die Anrainergemeinde Bento Rodrigues und in den Flusslauf des Rio Doce. Laut dem Betreiber der Mine, Samarco Mineração S.A., durch ein leichtes Erdbeben freigesetzt, begräbt der aus den Becken flutende Klärschlamm umliegende Bergdörfer und einen Teil ihrer Bewohner unter sich. Den ehedem „Süßen Fluss“ lässt er auf drei Vierteln seines 853 Kilometer langen Laufs zu einem giftigen Strom aus Rückständen von Eisen, Blei, Quecksilber, Zink, Arsen und Nickel werden, rund 250000 Menschen sind damit jäh von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Nach vierzehn Tagen erreicht die rote Flut die Atlantikküste und ergießt sich, ein verwüstetes Ökosystem hinter sich lassend, ins Meer. Wenige Wochen später spricht die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff auf der Pariser Klimakonferenz von der schlimmsten Umweltkatastrophe in der Geschichte ihres Landes.
So beeindruckend die Bilder von verschlammten Landschaften und verendeten Tieren, vom toten Fluss und seiner sich dreckig rot färbenden Mündung sind, so bedrückend ist der Fall Rio Doce doch gerade nicht in seiner Einzigartigkeit, sondern in seiner perversen Normalität. Denn Rio Doce ist überall. In seinen Ursachen wie in seiner Bearbeitung, in der Absehbarkeit des „Unglücks“ wie auch der Reaktionen darauf steht dieser Fall stellvertretend für die herrschenden globalen Verhältnisse. Er steht sinnbildlich nicht nur für eine ökonomisch-ökologische Weltordnung, in der die Chancen und Risiken gesellschaftlicher „Entwicklung“ systematisch ungleich verteilt sind. Er verweist zudem in geradezu idealtypischer Weise auf das lokal-, regional- und weltpolitische business as usual im Umgang mit den Kosten des industriell-kapitalistischen Gesellschaftsmodells.
Was am Rio Doce passiert ist, war eine ganz normale Katastrophe – und eine mit Ansage. Eine Katastrophe, wie sie sich so oder so ähnlich seit vielen Jahren immer wieder abspielt, in Brasilien und anderswo in den rohstoffreichen Ländern dieser Welt. Als ökonomische Strategie in der globalen Arbeitsteilung setzen diese Länder notgedrungen auf die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen – und sie tun dies auf intensive, im Zweifel rücksichtslose Weise. Wobei dieses „sie tun es“ sofort qualifiziert gehört, denn nicht selten wird das – je nach Weltmarktpreisen – mehr oder weniger lukrative Geschäft an transnationale Konzerne vergeben. Brasilien ist mit fast 400 Millionen geförderten Tonnen (2011) der weltweit drittgrößte Eisenerzproduzent nach China und Australien. Die zunächst staatliche, 1997 privatisierte Vale S.A., ehemals Companhia Vale do Rio Doce, ist neben den britisch-australischen Konzernen Rio Tinto Group und BHP Billiton eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt und mit einem Marktanteil von 35 Prozent der weltgrößte Eisenerzexporteur. Gemeinsam mit BHP Billiton ist Vale über die Tochterfirma Samarco Eigentümerin der Mine in Mariana.
Der bei den Dammbrüchen abgegangene Schlamm sei nicht giftig und bestehe hauptsächlich aus Wasser und Kieselerde, hatte Samarco zunächst mitgeteilt. Diese Aussage erwies sich bald als ebenso falsch wie der Verweis auf Erdstöße als Unglücksursache. Es liegt nahe, diese vielmehr in den typischen Attributen des Verwaltungshandelns in sogenannten „Drittweltstaaten“ zu suchen, also in Korruption, Klientelismus und mangelnden Kontrollen. An der Oberfläche des Geschehens lässt sich denn auch genau dies finden: Die geborstenen Klärschlammbecken wiesen schon seit Längerem bekannte Sicherheitsmängel auf, die von der zuständigen Staatsanwaltschaft bereits im Jahr 2013 gerügt worden waren. Die Behörde wies dabei auch auf die akute Gefährdung des Dorfes Bento Rodrigues hin sowie darauf, dass für dessen Bewohner keinerlei Sicherheitsvorkehrungen bestünden. Die vom Bundesstaat Minas Gerais, dem größten Erzabbaugebiet Brasiliens, geforderten Sicherheitsprüfberichte seien, so heißt es, im Fall Samarco nicht von unabhängigen Expertinnen, sondern von Mitarbeitern des Unternehmens selbst erstellt worden.[1] Fast zeitgleich mit dem Dammbruch votierte eine Kommission des Senats, der höheren Kammer im brasilianischen Nationalkongress, in dem sich die Bergbaulobby stets auf politische Unterstützung verlassen kann, für „mehr Flexibilität“ bei den behördlichen Überprüfungen der Minenbetreiber.
Alles also eine Frage unterentwickelter Staatlichkeit, versagender Institutionen, einer „nicht westlichen“ politischen Kultur? Nun ja. Die andere Seite der Chronik eines angekündigten „Unglücks“ ist, dass die Belastung der nunmehr geborstenen Talsperren erst kürzlich massiv erhöht worden war. Trotz (oder wegen) des zuletzt eingetretenen Verfalls der Weltmarktpreise hatten die beiden Großkonzerne die Fördermenge der Samarco-Mine gegenüber dem Vorjahr um fast 40 Prozent auf 30,5 Millionen Tonnen gesteigert – eine Marktflutungsstrategie, die in Mariana zu einer starken Zunahme des Minenabraums führte und im Effekt zu einer Überflutung des Umlands. Auch das dritte und größte, einstweilen noch intakte Rückhaltebecken der Eisenerzmine in Mariana weist übrigens gefährliche Risse des Staudamms auf. Und dies sind nur drei von insgesamt 450 Dämmen, die allein in Minas Gerais Abwässer aus Bergbau und Industrie zurückhalten. Etwa ein Dutzend dieser Giftstauseen bedrohen den Rio Paraíba do Sul und damit mittelbar die Trinkwasserversorgung der Metropolregion Rio de Janeiro mit ihren zehn Millionen Einwohnern.
Während die Geschehnisse am Rio Doce also eine Katastrophe für die Natur (und für die in und von dieser lebenden Menschen) ist, war sie doch keine Naturkatastrophe. Ihre Hintergründe sind alles andere als „natürlich“: Sie liegen in der Anlage des Weltwirtschaftssystems begründet, in den durch dieses System geprägten Entwicklungsmodellen der rohstoffreichen Länder, in den Weltmarktstrategien der transnationalen Konzerne, im Ressourcenhunger der reichen Industriestaaten, in den Konsumpraktiken und Lebensstilen ihrer Bewohnerinnen. Das, was in Mariana, Minas Gerais, Brasilien, stattgefunden hat und dort jenseits der medial wahrgenommenen Unglücke und Katastrophen alltäglich stattfindet, ist keine Frage der lokalen Verhältnisse – jedenfalls nicht nur oder im wahrsten Sinne des Wortes nur am Rande. Was sich, aus unserer Sicht, an der „Peripherie“ der Welt abspielt, an den Außenposten des globalen Kapitalismus, verweist zurück auf das Zentrum des Geschehens oder, genauer: auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in jenen Regionen, die sich für den Nabel der Welt halten und ihre Machtposition im wirtschaftlichen und politischen Weltsystem nutzen, um die Spielregeln vorzugeben, an die andere sich halten müssen und deren Folgen andernorts spürbar werden.
Zu diesen Spielregeln gehört auch und vielleicht sogar vor allen Dingen, dass nach „Vorfällen“ wie in Mariana schnellstmöglich zur Tagesordnung übergegangen wird. Nicht nur vor Ort, wo der Widerstand gegen die Erzbergbauindustrie aus naheliegenden Gründen schwer zu organisieren ist: Die Menschen in Minas Gerais sind von ihr abhängig, ob sie wollen oder nicht. Vier von fünf Haushalten in Mariana hängen in ihrer Existenz an der Mine. Sollte sie geschlossen werden, könne man auch gleich den ganzen Ort dichtmachen, so der Bürgermeister Duarte Júnior. Nach der „Katastrophe“ gingen dort immer wieder Menschen auf die Straße, um zu protestieren – freilich nicht gegen den Minenbetreiber, sondern dafür, dass die Mine möglichst bald wieder in Betrieb gehen möge. Parallel fanden sich selbstverständlich sogleich „Experten“, die Entwarnung gaben bzw. vor unangebrachter Umwelthysterie warnten. Paulo Rosman, Professor für Küsteningenieurwesen an der Universität von Rio de Janeiro und Autor einer hastig erstellten Folgenabschätzung im Auftrag des brasilianischen Umweltministeriums, erklärte den Rio Doce zwar für „momentan tot“, taxierte die „Wiederherstellungsfrist“ der Natur am Ort des Dammbruchs allerdings auf nur ein Jahr und erklärte die Auswirkungen im Mündungsgebiet des Flusses für „vernachlässigbar“. Die Situation dort werde sich innerhalb weniger Monate bereinigen, die in dieser Jahreszeit zu erwartenden heftigen Regenfälle würden den Rio Doce gewissermaßen „waschen“ – „ein ganz natürlicher Prozess“.
Solcherart Reinwaschen der unansehnlichen Situation ist wiederum ganz nach dem Geschmack nicht nur der vor Ort operierenden multinationalen Bergbaukonzerne, sondern auch des Publikums in den hoch industrialisierten Gesellschaften Europas und Nordamerikas. Die Menschen in diesen Ländern hängen nämlich ganz dick mit drin im Verursachungszusammenhang der brasilianischen Katastrophe. Sie – und also „wir“ – sind Teil der Misere, nicht nur der brasilianischen oder lateinamerikanischen. Sie stehen hinter dem global im großen Stil betriebenen Ressourcenabbau und den damit in den rohstofffördernden Ländern einhergehenden Umweltbelastungen, Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnissen.
Nehmen wir das Aluminiumerz Bauxit, das in vielen Ländern des Tropengürtels lagert. Brasilien ist (Stand 2008) nach Australien und China sowie vor Guinea der drittgrößte Bauxitproduzent der Welt. In allen Ländern mit nennenswerten Lagerstätten ist der Abbau im vergangenen Jahrzehnt stark angestiegen: Das Bergbauunternehmen Rio Tinto etwa steigerte die weltweite Förderung zwischen 2006 und 2014 von 16 auf 42 Millionen Tonnen (und die Eisenerzförderung parallel von 133 auf 234 Millionen Tonnen). Bauxitgestein wurde schon im 19. Jahrhundert in Europa entdeckt und abgebaut, die Vorkommen in den südlichen Weltregionen sind jedoch ungleich größer und produktionstechnisch wertvoller. Praktisch der gesamte Bauxitabbau dient der Herstellung von Aluminium – das wiederum in zahlreichen Gütern des alltäglichen und außeralltäglichen Bedarfs rohstoffnutzender Länder verarbeitet wird. Zum Beispiel in fein säuberlich portionierten und leicht verwendbaren Kaffeekapseln.
Zur Produktion des Kaffeekapselstoffes Aluminium bedarf es eines extrem hohen Energieeinsatzes: Um ein Kilogramm aus dem Rohstoff Bauxit zu gewinnen, werden 14 Kilowattstunden Strom benötigt, wobei etwa acht Kilogramm Kohlendioxid freigesetzt werden. Nicht nur in diesem Lichte betrachtet, ist der werbetechnisch von einem weltbekannten, charmanten und gut aussehenden Schauspieler unterstützte Siegeszug der Aluminiumpads ungeheuerlich: Allein in Deutschland wurden 2014 zwei Milliarden der vor wenigen Jahren noch gänzlich unbekannten Kaffeekapseln geleert, Tendenz steigend. Branchenschätzungen zufolge verkauft die Schweizer Nestlé-Tochter Nespresso mittlerweile weltweit mindestens acht Milliarden Einheiten jährlich – bei einem Kapselgewicht von einem Gramm ergibt schon dies einen Berg von acht Millionen Kilogramm Aluminiumabfall. Wohlgemerkt: in einem Jahr, allein an Kaffeekapselmüll. Dabei wird Nespresso sogar noch dafür gelobt, sortenreine und daher recyclingfreundlichere Kapseln zu verwenden – die Konkurrenz krönt ihre deutlich schwereren Kunststoffdöschen zusätzlich mit einem Aluminiumdeckel. Der Werbeslogan des Unternehmens – „Nespresso. What else?“ – hat also auch umweltpolitisch durchaus seine Berechtigung.
Aber seien wir ehrlich – und unironisch. Lassen wir uns nicht den „unvergleichlichen Kaffeegenuss“ („Entdecken Sie unsere 23 Grands Crus“, „schnelle Lieferung“ mit der „Nespresso Mobile App“) auf der Zunge zergehen, sondern den bitteren Beigeschmack der bestehenden Produktions- und Konsumverhältnisse. Für die kurze Pause zwischendurch in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt werden im brasilianischen Regenwald Bauxitabbaugebiete gerodet. Für unseren Kaffeegenuss am Ende eines köstlichen, aber doch etwas schweren Abendessens werden „irgendwo in Afrika“ die Bodenschätze geplündert, natürliche Lebensräume zerstört, die Giftmüllbecken und -halden gefüllt. Für den Kick für den nächsten Augenblick wirtschaftlicher Wertschöpfung wird in den Verwaltungsbüros global agierender Unternehmen rasch noch ein Kaffee gekippt, denn die Räder dürfen ja nicht stillstehen, sondern müssen am Laufen gehalten werden: die Räder der Produktion unseres Wohlstands, unter die dann – was soll man machen? – in weiter Ferne andere geraten.
Wobei hier bislang überhaupt nur die Spitze des Eisbergs des europäisch-nordamerikanischen Kaffeekapselhypes in den Blick genommen worden ist: Es war ja noch nicht einmal die Rede von den Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten des brasilianischen Erzbergbaus; noch nicht davon, dass der Giftmüll nicht nur bei der Rohstoffproduktion im Tropengürtel dieser Welt anfällt, sondern im Zweifel auch per Müllexport aus den wohlhabenderen Weltregionen wieder dorthin zurückkehrt; oder von den sozialen, ökonomischen und ökologischen Umständen des Kaffeeanbaus, seiner Ernte und seines Transports in die Kaffee konsumierenden Zentren der Welt. Und die Wertschöpfungskette Kaffee wiederum, die Produktions- und Konsumwelt der kleinen Kaffeepads, ist ja nur die Spitze eines weiteren, noch viel größeren Eisbergs, eines gigantischen globalen Prozesses der permanenten Umverteilung von Gewinnen und Verlusten. Ganz gleich, ob man nun die Baumwollproduktion oder den Sojaanbau nimmt, die grassierende SUV- oder Smartphone-Manie: „Rio Doce“ ist überall.
Genauer gesagt: Die Flutung riesiger Landstriche mit giftigen Abwässern aus der Ressourcenförderung für den globalen Norden hätte überall stattfinden können – überall im globalen Süden. Es gibt unzählige „Rio Doces“ auf dieser Welt, und nicht zufällig fließen diese zumeist in deren südlichen Gefilden. Oder sie fließen dort eben nicht mehr, weil ihnen vom Norden aus gleichsam das Wasser abgegraben wird – wie dem Rio Doce, der sich zwischenzeitlich in eine schwerfällig-gallertartige rote Masse verwandelt hat. Die Geschichte des „Unglücks“ am Rio Doce zu erzählen heißt, gleich zwei Geschichten erzählen zu müssen: die verschränkten, verkoppelten, sich kreuzenden Geschichten des Unglücks der einen – und des Glücks der anderen.
Ebendiese Doppelgeschichte soll hier in den Blick genommen werden. Es geht um den Einblick in Zusammenhänge, die Einsicht in Abhängigkeiten, in globale Beziehungsstrukturen und Wechselwirkungen – in die Relationalität des Weltgeschehens. Es geht um die andere Seite der westlichen Moderne, um ihr „dunkles Gesicht“, um ihre Verankerung in den Strukturen und Mechanismen kolonialer Herrschaft über den Rest der Welt. Es geht um Reichtumsproduktion auf Kosten und um Wohlstandsgenuss zulasten anderer, um die Auslagerung der Kosten und Lasten des „Fortschritts“. Und es geht noch um eine weitere, dritte Geschichte: um die Abwehr des Wissens um ebendiese Doppelgeschichte, um deren Verdrängung aus unserem Bewusstsein, um ihre Tilgung aus den gesellschaftlichen Erzählungen individuellen und kollektiven „Erfolgs“. Wer von unserem Wohlstand hierzulande redet, dürfte von den damit verbundenen, verwobenen, ja ursächlich zusammenhängenden Nöten anderer Menschen andernorts nicht schweigen. Genau das aber ist es, was ununterbrochen geschieht.
Man kann das Leben auf Kosten Dritter auch aus einer anderen, sozialstatistischen Perspektive beleuchten. Was zunächst als der abstraktere Blick erscheinen mag, erweist sich rasch als ebenso plastisch wie die Bilder aus der roten Giftmüllhölle Brasiliens. Pünktlich zum Weltwirtschaftsforum 2015 in Davos präsentierte die internationale Hilfsorganisation Oxfam beeindruckende Daten zur weltweiten sozialen Ungleichheit. Der Studie zufolge besaß im Jahr 2016, den jüngeren Trend zur Verschärfung des globalen Wohlstandsgefälles fortsetzend, das reichste Prozent der Weltbevölkerung so viel wie die restlichen 99 Prozent: Eine kleine Gruppe von Begüterten und der große Rest der anderen verfügten zu gleichen Teilen über den Weltwohlstand. Der im Jahr 2011 geprägte Protestslogan von Occupy Wall Street – „wir sind die 99 Prozent“ – erhielt damit im Weltmaßstab statistische Weihen. Auf den ersten Blick noch eindrucksvoller erschien Oxfams Befund, wonach die 80 vermögendsten Personen auf dem Globus über dasselbe Maß an materiellen Ressourcen verfügen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen.
Achtzig zu dreieinhalb Milliarden: So absurd zumal dieses Größenverhältnis anmutet, so sehr drohen entsprechende Zahlen zugleich auch die interessierte Öffentlichkeit in die Irre zu führen – bzw. ihr nach dem Mund zu reden. Legen sie doch die Deutung nahe, dass das Problem der globalen sozialen Ungleichheit maßgeblich an einem extrem kleinen Kreis von Superreichen liege und die Lösung desselben in den Händen einer diese paar Dutzend Multimilliardäre anständig besteuernden Politik (wenn nicht gar, nach dem Vorbild der spendablen Magnaten Bill Gates oder Mark Zuckerberg, in den Händen der Weltgrößtverdiener selbst). Sicher: Die in den Oxfam-Daten zum Ausdruck kommende Vermögenspolarisierung ist durch und durch skandalös. Und gegen eine international koordinierte Steuerpolitik etwa gegenüber globalen Finanztransaktionen, wie sie jüngst auch der neue Star am Ökonomenhimmel, Thomas Piketty, gefordert hat, ist außer der Unwahrscheinlichkeit ihrer politischen Durchsetzung und administrativen Umsetzung wenig einzuwenden.
Doch der Kern des Problems reicht – man mag sagen: leider – deutlich tiefer. Denn die Sozialdiagnose „Alles haben und noch mehr wollen“, so der sprechende Titel besagter Reichtumsstudie (Wealth: Having It All and Wanting More), umschreibt keineswegs nur die Lebensumstände, Interessenlagen und Handlungsziele der „oberen Zehntausend“ dieser Welt. Alles zu haben und dennoch mehr zu wollen: das ist nicht nur die lebenspraktische Agenda jener happy few am obersten Ende der gesellschaftlichen Reichtumsverteilung, auf die man als deutscher Durchschnittsbürger und Otto Normalverbraucherin mit spitzem Moralfinger und scharfen Umverteilungsforderungen zeigen könnte. Es ist im Kern zugleich auch eine durchaus zutreffende Beschreibung der Lebensweisen, Gefühlslagen und Zukunftswünsche breiter gesellschaftlicher Mehrheiten in den wohlhabenden Ländern der Welt. Alles zu haben und noch mehr zu wollen ist kein Einstellungsprivileg derer „da oben“. Den eigenen Wohlstand zu wahren, indem man ihn anderen vorenthält, ist das unausgesprochene und uneingestandene Lebensmotto der „fortgeschrittenen“ Gesellschaften im globalen Norden – und ihre kollektive Lebenslüge ist es, die Herrschaft dieses Verteilungsprinzips und die Mechanismen seiner Sicherstellung vor sich selbst zu verleugnen. Im Weltmaßstab der nationalen Reichtumsverteilung gesehen, stehen nämlich wir Durchschnittsdeutsche „ganz oben“ – und sehen über die Verhältnisse „da unten“ gerne souverän hinweg.
Das ist durchaus verständlich. Und zwar nicht nur, weil es massive und weiterhin wachsende Ungleichheiten „daheim“ gibt, die uns und unserer Wahrnehmung im Wortsinne näherliegen. Sondern auch, weil ein Blick über den Tellerrand der nationalen Wohlstandsverteilung Ungeheuerliches zutage fördern würde. Wer sich die enormen Einkommensunterschiede zwischen den reichsten und den ärmsten Weltregionen auch nur statistisch, in dürren Zahlen, vor Augen führt, kann „eigentlich“ nicht so weitermachen wie bisher. Eine solche Weltungleichheitsskala, wie sie von den US-amerikanischen Soziologen Roberto Korzeniewicz und Timothy Moran für das Jahr 2007 berechnet worden ist, zeigt, dass praktisch alle Einkommensgruppen in den europäischen Ländern dem reichsten Fünftel der Weltbevölkerung zuzurechnen sind – in Norwegen zählt selbst das einkommensschwächste Zehntel global noch zu den wohlhabendsten zehn Prozent. Umgekehrt gehören große Teile des südlichen Afrikas und zum Beispiel auch 80 Prozent der fast 100 Millionen Menschen zählenden äthiopischen Bevölkerung zu dem weltweit ärmsten Zehntel.
Um es ausdrücklich zu betonen: Es geht hier nicht darum, soziale Ungleichheiten mehr oder weniger krassen Ausmaßes innerhalb aller Länder dieser Welt zu verharmlosen oder gar in Abrede zu stellen. Es gibt Armut in Deutschland, ebenso wie es in Äthiopien Reiche gibt. Die Gegenüberstellung der Verhältnisse in den insgesamt wohlhabenden Gesellschaften des globalen Nordens – mit im Durchschnitt hohem Lebensstandard, weiten Optionsräumen der Lebensgestaltung und großem Ressourcenverbrauch – und der Lebensbedingungen in den durchschnittlich ungleich ärmeren, damit auch chancen- und verbrauchsärmeren Gesellschaften des globalen Südens soll nicht die internen Ungleichheiten auf beiden Seiten vergessen machen. Sie soll aber sehr wohl dafür sensibilisieren, dass etwa Pikettys viel gerühmte und hierzulande breit diskutierte Abhandlung über Das Kapital im 21. Jahrhundert einer durchaus einseitigen Sichtweise das Wort redet: Piketty zeigt, dass es in den reichsten Ländern der Welt Reiche gibt, die neuerdings noch reicher werden und die – ganz entgegen der in diesen Gesellschaften herrschenden Leistungsideologie – ihre Position und deren Aufrechterhaltung maßgeblich nicht eigener Anstrengung verdanken, sondern der Verwertung ererbten Kapitals. Was die erhellende Studie des französischen Ökonomen hingegen nicht thematisiert, ist die Tatsache, dass sich im Weltmaßstab eine ganz ähnliche Struktur etabliert hat.
Betrachtet man nicht nur, wie Piketty, die Dynamiken innergesellschaftlicher Ungleichheit in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und Frankreich, mit Seitenblicken auf Japan und Deutschland, sondern weitet den Blick auf die Strukturmuster globaler, zwischengesellschaftlicher Ungleichheiten, so finden sich auch hier die reichen zehn Prozent, die zulasten des Restes immer reicher werden. Zu diesem reichsten Zehntel zählen dann gewissermaßen die fünf genannten Länder als Ganzes – und ihre kollektive Position am oberen Ende der Weltreichtumsverteilung ist nicht und schon gar nicht allein dem „Fleiß“ ihrer Bürgerinnen oder der „Produktivität“ ihrer Wirtschaft geschuldet, sondern maßgeblich auch ihrer strategischen Position in der Weltökonomie und der Verwertung ihres damit gegebenen, historisch ererbten „Kapitals“. Im Weltmaßstab ist die Ungleichheit zwischen den reichen und den armen Ländern größer noch als die Ungleichheit zwischen den reichsten und den ärmsten Bevölkerungsgruppen in den ungleichsten Ländern der Welt, also krasser noch als etwa in Brasilien. Entsprechend sticht auch die relative Chancenungleichheit, die sich aus dem Glück bzw. Unglück ergibt, in Deutschland oder aber in Brasilien geboren zu werden, im Zweifel jene ungleiche Chancenverteilung aus, die von der Lotterie des Lebens für Neugeborene innerhalb der deutschen oder brasilianischen Gesellschaft bereitgehalten wird.
Was also in unseren Breitengraden allzu gerne ausgeblendet wird und was sowohl einem auf den Reichtum von Einzelpersonen fixierten wie einem ausschließlich auf innergesellschaftliche Ungleichheiten konzentrierten Blick entgehen muss, ist der Sachverhalt, dass die damit sichtbar werdenden Verteilungsmuster eingelagert sind in eine umfassendere, globale Ungleichheitskonstellation. Eine Konstellation, die aber offenkundig unsichtbar ist – und auch unsichtbar bleiben soll. Korzeniewicz und Moran machen sich in ihrem Buch Unveiling Inequality (zu Deutsch etwa: „Ungleichheit offenlegen“) den statistischen Spaß, eine fiktive Gesellschaft zu konstruieren, der allein die in US-amerikanischen Haushalten gehaltenen Hunde angehören. Die im Jahr 2008 je Haushalt getätigten durchschnittlichen Ausgaben für die Hundehaltung setzen sie als das „Pro-Kopf-Einkommen“ dieser gedachten Gesellschaft – und siehe da, „Hundeland“ (dogland) positioniert sich im Weltmaßstab unter den Ländern mittleren Einkommens, oberhalb von Staaten wie Paraguay oder Ägypten, besser gestellt als 40 Prozent der Weltbevölkerung. Wohl dem also, der ein Hund ist – zumindest in den Vereinigten Staaten.
Die kleine statistische Spielerei dient den Autoren nur als Illustration des ungeahnten Ausmaßes globaler sozialer Ungleichheiten. Der plötzliche Reichtum der vereinten Kläffer von Amerika verdeutlicht aber nicht minder die Plausibilität der Tatsache, dass wir von diesen extremen Ungleichheiten auch gar keine Ahnung haben wollen. Und schon gar nicht davon, dass unser Reichtum, dessen Abbild die relative Einkommensposition der virtuellen Hunderepublik ja ist, nicht nur der Armut in weiten Teilen der restlichen Welt gegenübersteht, sondern mit dieser auch zusammenhängt: dass unser relativer Wohlstand also nur in Relation zu den geringen Einkommen, Handlungsoptionen und Lebenschancen der großen Mehrheit der Weltbevölkerung zu verstehen ist. Die Positionen in der globalen Ungleichheitsstruktur stehen in einem funktionalen Zusammenhang miteinander: Es geht den einen „gut“ bzw. besser, weil es den anderen „schlecht“ oder jedenfalls weniger gut geht.
Dass dem so ist, will sich aber offenbar partout nicht herumsprechen. Betrachtet man die öffentlichen Debatten in den wohlhabenden Weltregionen, dann scheinen die Verbindungen zwischen „unserem“ wie auch immer ungleich verteilten Reichtum auf der einen und den Arbeits-, Lebens- und Überlebensbedingungen außerhalb der weltwirtschaftlichen und -politischen Zentren auf der anderen Seite immer noch das „Geheimwissen“ von marxistischen Gruppen, entwicklungspolitischen Organisationen und Papst Franziskus I. zu sein. Und es gibt auch durchaus – zumindest subjektiv – gute Gründe, dass wir nichts von diesen Zusammenhängen hören wollen: den Zusammenhängen zwischen Reichtum und Armut, Wohlstand und Entbehrung, Sicherheit und Unsicherheit, Chancenvielfalt und Aussichtslosigkeit. Denn wer diese Zusammenhänge erkennt und anerkennt, kommt nicht umhin, an der Berechtigung der damit gesetzten Ungleichheiten zu zweifeln. Oder wenigstens in akute Rechtfertigungsnöte bezüglich seiner eigenen, privilegierten Position zu geraten.
Die Abwehr entsprechender Einsichten ist also ebenso naheliegend wie die Furcht vor den Konsequenzen, die eine Veränderung der globalen Ungleichheitsverhältnisse mit sich bringen würde. Wir Wohlstandsbürger der Weltgesellschaft haben allemal mehr zu verlieren als nur unsere Ketten. Dass wir insgeheim entsprechende Verlustängste haben, spricht für unsere Ahnung von den globalen Bedingungen, auf denen unsere Lebensführung beruht, mit denen sie steht und fällt. Und dass wir diese Ahnung lieber verdrängen, dass wir um unser Leben auf Kosten anderer nicht wissen wollen oder allfällige Anflüge entsprechenden Unbehagens lieber gleich wieder „vergessen“, überrascht den Gesellschaftsanalytiker nicht. Gegen ebenjenes Vergessen aber richtet sich dieses Buch.
Der bis hierher skizzierte, in seiner ganzen Komplexität einstweilen allenfalls angedeutete Zusammenhang des Lebens der einen auf Kosten der anderen soll mit diesem Buch auf den Begriff gebracht werden, genauer gesagt: auf einen Begriff, nämlich auf den der Externalisierung. „Externalisieren“ bezeichnet den Vorgang, bei dem etwas aus dem Inneren nach außen verlagert wird. Was üblicherweise Organisationen zugeschrieben wird, etwa Unternehmen, die nicht für die von ihnen verursachten Umweltschäden aufkommen und von dieser Abwälzung der Kosten auf unbeteiligte Dritte profitieren, lässt sich auch auf größere Sozialeinheiten übertragen: Die reichen, hoch industrialisierten Gesellschaften dieser Welt lagern die negativen Effekte ihres Wirtschaftens auf Länder und Menschen in ärmeren, weniger „entwickelten“ Weltregionen aus. Die wohlhabenden Industrienationen nehmen diese negativen Auswirkungen nicht nur systematisch in Kauf. Sie rechnen vielmehr mit ihnen, und diese rechnen sich für sie. Denn die gesamte sozioökonomische Entwicklungsstrategie der europäisch-nordamerikanischen Industriegesellschaft beruht – und beruhte von Anfang an – auf dem Prinzip der Entwicklung zulasten anderer. Externalisierung heißt in diesem Sinne: Ausbeutung fremder Ressourcen, Abwälzung von Kosten auf Außenstehende, Aneignung der Gewinne im Innern, Beförderung des eigenen Aufstiegs bei Hinderung (bis hin zur Verhinderung) des Fortschreitens anderer.
Externalisierung ist freilich nicht bloß eine abstrakte „gesellschaftliche“ Strategie, keineswegs nur der Effekt einer gleichsam akteurlos vor sich hin prozessierenden Systemlogik. Sicher, Externalisierung bezeichnet jene Logik, nach der das kapitalistische Weltsystem funktioniert. Aber sie wird getragen von real existierenden sozialen Akteuren. Und ihre Träger sind nicht allein Großkonzerne und Staatslenker, nicht nur wirtschaftliche Eliten und die politisch Mächtigen. Auch wenn die großen Kapitaleigner und transnationalen Konzerne an den Schalthebeln der Externalisierungsgesellschaft sitzen: Sie wird auch getragen von dem stillen Einvernehmen und der aktiven Beteiligung großer gesellschaftlicher Mehrheiten. „Wir“, die Bürgerinnen und Bürger der selbst erklärten „westlichen“ Welt, leben in Externalisierungsgesellschaften – bzw. in der großen Externalisierungsgesellschaft des globalen Nordens. Wir leben in der Externalisierungsgesellschaft, wir leben sie – und wir leben gut damit. Selbstverständlich ist auch das gute Leben hierzulande ungleich verteilt: Es ist das oberste Fünftel der reichen Gesellschaften, das über das globale Maximum an Lebenschancen verfügt. Und dennoch gilt im Weltmaßstab gesehen, dass „wir“ Wohlstandsbürger gut leben, weil andere schlechter leben. Wir leben gut, weil wir von anderen leben – von dem, was andere leisten und erleiden, tun und erdulden, tragen und ertragen müssen. Das ist die internationale Arbeitsteilung, die der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano schon vor nunmehr bald einem halben Jahrhundert kritisch im Blick hatte: Wir haben uns aufs Gewinnen spezialisiert – und die anderen aufs Verlieren festgelegt.
Wir leben in einer Gesellschaft, die sich auf dem Wege der Externalisierung – auf Kosten und zulasten anderer – stabilisiert und reproduziert und die sich überhaupt nur auf diese Weise zu stabilisieren und zu reproduzieren vermag. Diese Form sozialer Organisation, dieser Modus gesellschaftlicher Entwicklung ist keineswegs neu. „Externalisierungsgesellschaft“ ist insofern keine Zeitdiagnose im strengen Sinne – wie etwa Ulrich Becks Diagnose der „Risikogesellschaft“, die im Kern die neuen, mit dem Aufstieg industrieller Großtechnologien verbundenen Lebensverhältnisse in der Nachkriegsmoderne charakterisieren sollte. Die Externalisierungsgesellschaft hingegen gibt es nicht erst seit gestern oder vorgestern; sie ist als solche nicht die neueste, aktuelle Gestalt der modernen Zivilisation. „Externalisierung“ ist weniger eine zeitdiagnostische als vielmehr eine strukturanalytische Formel, „Externalisierungsgesellschaft“ eher Gattungsbegriff als Gegenwartskonzept: Denn die moderne kapitalistische Gesellschaftsformation ist seit jeher und von Anfang an Externalisierungsgesellschaft – auch wenn sie sich dies nicht eingestehen mag. Kapitalistische Gesellschaften sind Externalisierungsgesellschaften, allerdings in historisch wechselnder Gestalt, mit jeweils sich wandelnden Mechanismen und in immer wieder sich verändernden globalen Konstellationen.
Es ist dieser stetige Wandel der Externalisierungsgesellschaft, die lange Geschichte der Konstitution und Reproduktion des westlichen bzw. nördlichen Wohlstandskapitalismus auf Kosten und zulasten des globalen Südens, die dem Begriff – heute geprägt und auf die Gegenwart gemünzt – dann gleichwohl doch auch eine zeitdiagnostische Note verleiht. Denn das gesellschaftliche Struktur- und Prozessmuster der Externalisierung hat im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts mit der Implosion des Staatssozialismus und der globalen Verbreitung des kapitalistischen Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensmodells durchaus neue Konturen gewonnen. Im Prinzip gibt es seither kein weltgesellschaftliches „Außen“ mehr, in das hinein externalisiert werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die sozialen und ökologischen Kosten des industriellen Wohlstandskapitalismus nicht einfach irgendwo anders anfallen, weit entfernt von den Verursacherinnen und Profiteuren, sondern doch auch wieder auf diese – also auf uns selbst – zurückschlagen, ist damit strukturell gestiegen. Und es gehört nicht viel Fantasie, sondern nur Beobachtung und Analyse dazu, von einer massiven Zunahme solcher Rückkopplungseffekte bereits in der näheren Zukunft auszugehen.
Was schon lange deutlich geworden war, bestätigt sich hier also neuerlich: Das nach dem Sieg des Kapitalismus im globalen Systemwettbewerb ausgerufene „Ende der Geschichte“ ist nicht eingetreten. Das Ende des „Realsozialismus“ hat schlicht eine neue Phase der historischen Entwicklung des globalen Kapitalismus eingeläutet. Die „eine Welt“ wird nun Realität. Sie wird Realität in Gestalt radikalisierter Externalisierung – und in Form von zunehmenden Schwierigkeiten, die externalisierten Kosten auch tatsächlich extern halten zu können, auch wenn wir dies noch nicht wirklich wahrhaben wollen. Der Wohlstandskapitalismus fordert seinen Tribut typischerweise jenseits seiner Grenzen – nun aber scheint es allmählich so, dass das Imperium zurückgeschlagen wird, dass die Externalisierungsfolgen gleichsam nach Hause zurückkehren. Deutschland habe ein unvorhergesehenes „Rendezvous mit der Realität der Globalisierung“, meinte Wolfgang Schäuble im November 2015 angesichts der hiesigen „Flüchtlingskrise“ treffend. Zwar hoffen wohl die meisten Deutschen, dass dieses Rendezvous nicht allzu intensiv werden möge. Und der Bundesfinanzminister gehört durchaus zu denjenigen, die noch davon ausgehen, allein die Vorteile der Globalisierung für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft realisieren, die Nachteile aber von ihnen fernhalten zu können. Doch genau diese Vorstellung wird sich als Trugschluss erweisen, als ein klassischer – und im Zweifel tragischer – Fall von wishful thinking.
Letztlich ist ohne Weiteres nachvollziehbar, dass große gesellschaftliche Mehrheiten in den Externalisierungsgesellschaften Verlustängste haben. Deswegen wollen sie, dass alles so bleiben möge wie bisher – und die anderen dort, wo sie sind. Deswegen wird das Wissen um die Voraussetzungen jener ungeheuren sozialen Privilegierung, die uns nun verloren zu gehen droht, unter den Teppich gekehrt – bzw. vor die Haustüre, also ebenfalls externalisiert, und an die Wissenschaft und Expertenzirkel delegiert, auf dass es dort gut aufgehoben sei, ohne gesellschaftliche Konsequenzen zu zeitigen. Deswegen klammert man sich an die Utopie eines durch wirtschaftliches Wachstum erzeugten, globalen „Fahrstuhleffekts“, im Zuge dessen auch die Armen und Ärmsten dieser Welt bessergestellt werden, ohne dass die relative Privilegierung der Wohlstandsgesellschaften und deren eingebürgerte Lebensweise dadurch ernsthaft berührt würde und infrage gestellt werden müsste. Oder an die Illusion eines „grünen“ Kapitalismus, der Wachstum angeblich vom Ressourcenverbrauch entkoppeln könne und die kollektive Lebensweise einer expansiven Moderne mit den stofflichen Belastbarkeitsgrenzen des Planeten Erde zu versöhnen in der Lage sei.
Wie verlockend diese Zukunftsvisionen auch sein mögen: Viel wahrscheinlicher ist, dass es ganz anders kommen wird – und viele Leute in den kapitalistischen Wohlstandszentren spüren das auch. Vielen schwant, dass der globale Kapitalismus auf die Dauer und im Allgemeinen keine Fahrstuhleffekte produziert, sondern eher ein großes Nullsummenspiel ist, in dem die Gewinne der einen die Verluste der anderen sind. Dies gilt zumal und insbesondere dann, wenn man nicht nur ökonomische Größen in die Rechnung einbezieht, sondern die ökologische Bilanz kapitalistischer Globalisierung zieht: Dann zeigt sich nämlich, dass deren Kosten sehr einseitig verteilt sind – und sich seltsamerweise immer dieselben auf der Gewinner- oder aber der Verliererseite wiederfinden. Irgendwie dämmert es daher so manchem, sei es nun auf großer Fahrt durch die Armutsregionen dieser Welt oder in einem stillen Moment nach der Tagesschau, dass es mit dem „guten Leben“ auf Kosten anderer so nicht ewig wird weitergehen können: mit dem märchenhaften Reichtum der wenigen und den existenziellen Lebensnöten der vielen; mit einem hemmungslosen Ressourcenverbrauch in einem Teil der Welt und seinen zerstörerischen, im Zweifel tödlichen Konsequenzen auf dem Rest des Globus; mit der alltäglich zur Schau gestellten Sorglosigkeit in den oberen und der permanenten Sorge ums Überleben in den unteren Etagen der Weltsozialhierarchie.
Diesem einstweilen noch unterschwelligen, aber – so die Vermutung – zunehmend um sich greifenden Unbehagen an der Externalisierungsgesellschaft und ihrem Preis will das vorliegende Buch Ausdruck und Auftrieb geben. Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Es wird hier keine „Totalanalyse“ der Weltverhältnisse behauptet. Mit der Externalisierungsdiagnose kann und soll nicht „alles“ erklärt, nicht der gesamte Verursachungszusammenhang globaler Ungleichheiten aufgeklärt werden. Wohl aber ist damit eine zentrale Dimension zum Verständnis historischer wie gegenwärtiger ökonomischer und ökologischer Ungleichheitsmuster im kapitalistischen Weltsystem benannt.
Und ebenso sei vorab betont, dass die Rede von der Externalisierungsgesellschaft nicht etwa den nächsten, diesmal als schuldbewusste Selbstbezichtigung inszenierten Akt in der langen Geschichte des akademisch-intellektuellen Eurozentrismus markiert: Hier sitzt nicht neuerlich die „euroatlantische Moderne“ am längeren Hebel – weder sozialanalytisch noch verantwortungsethisch oder gar politagitatorisch. Ganz im Gegenteil: Der Verweis auf die soziale Realität der Externalisierungsgesellschaft vollzieht nur das nach, was seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, im globalen Süden gesagt und gedacht, aufgedeckt und offengelegt, problematisiert und skandalisiert worden ist. Diese vielfältigen und vielstimmigen, multilokalen und transnationalen, wissenschaftlichen wie politischen Gegenbewegungen sind bislang nur nicht oder jedenfalls in unseren Breitengraden nicht breitenwirksam zur Kenntnis genommen worden. Wenn dieses Buch einen Beitrag dazu leisten könnte, ebendies zu ändern, hätte es seinen Zweck erfüllt.
A rising tide lifts all boats, die Flut hebt alle Boote: Dieses in den frühen 1960er-Jahren durch den US-amerikanischen Lieblingspräsidenten John F. Kennedy popularisierte Fortschrittsmotto und Beruhigungsmantra für die wohlstandskapitalistische Gesellschaft ist heute unglaubwürdig geworden. Der Wohlstandskapitalismus hat die innergesellschaftlichen Ungleichheiten zuletzt nicht mehr abmildern können, sondern tendenziell verschärft. Und weltgesellschaftlich gesehen hat er den Globus im 20. Jahrhundert tatsächlich überschwemmt – mit Überfluss hier und Überflutungen dort. Diese Fluten kommen nicht etwa nach uns: Die Sintflut ist schon da, gleich neben uns. Wer will, kann das unter anderem in Mariana und am Rio Doce sehen. Oder hier nachlesen.
„Diese Art und Weise macht … den relativen Wohlstand und, im entgegengesetzten Falle, den relativen Uebelstand aus.“
Johann Jakob Hottinger, Theophrast’s Characterschilderungen (1821)
Die „Externalisierungsgesellschaft“ ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Externalisierung wird gesellschaftlich bereits so lange betrieben, wie der globale Kapitalismus existiert – und den wiederum gibt es nicht erst seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Untergang der Sowjetunion. Dem damals ausgerufenen Zeitalter der Globalisierung und der „einen“, nunmehr eben vollständig kapitalistischen Welt setzten die Sozialwissenschaften sogleich die Erkenntnis entgegen, dass es einen globalisierten Kapitalismus schon in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gegeben habe. In den Jahrzehnten zwischen 1870 und 1914 sei die Internationalisierung von Handels- und Kapitalströmen sogar ausgeprägter gewesen als im späten 20. Jahrhundert, nach dem Ende des Kalten Kriegs und des „Wettbewerbs der Systeme“.
Doch auch eine solche zeitliche Perspektive greift zu kurz, wenn es um die Geschichte des globalen Kapitalismus geht. Der Kapitalismus als Wirtschaftssystem war von seinen Anfängen an auf Expansion, auf die Erweiterung seines Geltungsbereichs, auf die Überschreitung von Grenzen angelegt. Und dies nicht allein im Sinne der ihm eigenen abstrakten Systemlogik: Dieser zufolge müssen unablässig Profite erwirtschaftet werden, die wiederum profitabel zu reinvestieren sind, um den Kapitalkreislauf in Gang zu halten – das heißt, um das Spiel der Produktion und Reinvestition von Profiten auch in der nächsten Periode aufrechterhalten, also in dann größerem Maßstab fortführen zu können. Diese Logik einer wirtschaftlichen Reproduktion auf beständig erweiterter und zu erweiternder Basis hat zugleich aber eine ganz konkrete, materiale und nicht zuletzt auch territoriale Dimension: Kapitalismus muss, um auf Dauer bestehen zu können, in seinem Wirkungsbereich immer weiter ausgreifen, auf stets neue gesellschaftliche Bereiche, Felder und Räume. Wirtschaften nach dem Prinzip des rentablen Kapitaleinsatzes hat einen eingebauten Verallgemeinerungsanspruch, ja Vollkommenheitszwang: Tendenziell die „ganze Welt“ wird zu seinem Revier, prinzipiell „alles“ gerät ihm zum Objekt der ökonomischen Verwertung, letztlich „alle“ werden in den Sog der kapitalistischen Warenwelt gezogen.
Die Marktstrategien weltweit operierender Firmen und – als andere Seite der Medaille – die staatlichen Standortpolitiken, wie sie rund um den Globus betrieben werden und tagtäglich dem Wirtschaftsteil der Zeitung zu entnehmen sind, bilden nur die gegenwärtige, wenngleich neuerlich forcierte Variante dieser systemisch angelegten Expansionstendenz: Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen gleichermaßen wird der heimische Absatzmarkt regelmäßig zu klein; Teile der Wertschöpfungskette werden in aller Herren Länder ausgelagert, sobald und solange dort insbesondere Arbeitskraft billiger als am eigenen oder bisherigen Standort zu haben ist. In den jeweils neu „aufkommenden Märkten“ (emerging markets) dieser Welt geben sich die globalen Investitionshandlungsreisenden die Klinke in die Hand – bis sie plötzlich anderswo kurzfristig attraktivere Investitionsräume entdecken. Nach Taiwan war Vietnam an der Reihe, derzeit steht Kuba am Start, und selbst Nordkorea dürfte demnächst – Raketentests hin oder her – feststellen, dass es um (weiter gehende) marktöffnende Interventionen als Eintrittskarte zum kapitalistischen Weltsystem nicht herumkommen wird.
Dieses kapitalistische Weltsystem ist als solches nicht neu – in historisch wechselnder Gestalt existiert es bereits seit etwa fünfhundert Jahren. Nicht von Beginn an hat es die gesamte Welt umfasst, nicht einmal den gesamten jeweils bekannten Teil derselben. Aber seit jeher hat es sich als ein globales Wirtschaftssystem insofern konstituiert, als es unterschiedliche Weltregionen mit verschiedenartigen wirtschaftlichen Funktionen zusammenspannte und zueinander in Beziehung setzte: Produktions- mit Vertriebs- und Konsumregionen, Räume der Rohstoffgewinnung mit solchen ihrer Verarbeitung und Veredelung, industrielle mit agrarischen Gebieten, die Zentren des Kapitaleigentums mit jenen des Arbeitskrafteinsatzes. Oder, einfacher und in der eingängigen Terminologie formuliert, mit der Weltsystemanalyse die funktionale und regionale Aufteilung der „einen“ Welt des modernen Kapitalismus beschreiben: die „Zentren“ mit den „Peripherien“. Der Systemcharakter dieses Arrangements beruht darauf, dass dessen einzelne Elemente in ihrer Gestalt wie in ihrem Wandel wechselseitig aufeinander bezogen sind: Wie sich das kapitalistische Weltsystem an seinen jeweiligen Peripherien darstellt, hängt unmittelbar mit seiner spezifischen Ausprägung in den Zentren zusammen (und umgekehrt), Veränderungen an einer Stelle des Weltsystems ziehen immer auch Veränderungen andernorts nach sich.
Schon Adam Smith, einer der Begründer der klassischen Nationalökonomie, hatte darauf hingewiesen, nach welchem Prinzip sich der „Wohlstand der Nationen“ zuallererst herstellt: nach jenem der strategischen Nutzung relativ günstiger Gegebenheiten nämlich. Warum prosperieren manche Regionen, andere hingegen nicht? Warum schreiten die einen ökonomisch voran, während die anderen zurückbleiben? Smith’ Antwort mit den „relativ“ günstigen Gegebenheiten bezieht sich nicht allein auf den schlichten Sachverhalt, dass die grundlegenden Bedingungen für Wohlstandsentwicklung an dem einen Ort vergleichsweise besser gewesen sein mögen als an dem anderen: milderes Klima, ausbleibende Naturkatastrophen, ein friedlicheres Gemeinwesen – vor allen Dingen aber fleißigere Arbeiter, risikofreudigere Unternehmer, geistreichere Erfinder. So einfach wird die Sache häufig dargestellt, so einfach ist sie aber in aller Regel nicht. Smith’ Verweis auf die Relativität von gesellschaftlichem Reichtum ist vielmehr im Sinne seiner Relationalität zu verstehen: Die der Wohlstandsproduktion zuträgliche Konstellation am einen Ort steht in einer erkennbaren und benennbaren Beziehung zu einer weniger wohlstandsförderlichen Konstellation andernorts, der Aufstieg der einen in einem Zusammenhang damit, dass andere das Nachsehen haben. Oder damit, so wäre an dieser Stelle wohl zu präzisieren, dass ihr Aufstieg überhaupt nur durch das Zurückbleiben der anderen ermöglicht wird.
Smith beschreibt diesen letztlich relationalen Charakter des gesellschaftlichen Wohlstands zunächst allerdings nicht am Beispiel von Nationen, sondern an dem des frühkapitalistischen Zusammenspiels von städtischer und ländlicher Entwicklung. In ihrem wirtschaftlichen Handel mit dem Umland machten sich die Stadtbewohner den Umstand günstiger Austauschbedingungen – die für sie positiven terms of trade, wie man heute sagen würde – systematisch zunutze. Zu diesen die Stadtgesellschaft begünstigenden Handelsbedingungen zählte insbesondere das Produktivitätsgefälle zwischen handwerklicher und landwirtschaftlicher Arbeit: Mit demselben Arbeitseinsatz konnten im städtischen Handwerk deutlich wertvollere Güter hergestellt werden als in der bäuerlichen Agrarwirtschaft, beim direkten Austausch ihrer Waren befanden sich die städtischen Produzenten somit strukturell im Vorteil. Schon Smith’ Analyse zeigt, wie sich aus einem solchen asymmetrischen Verhältnis von preisgünstigen stadtgesellschaftlichen und kostenträchtigen landgesellschaftlichen „Importen“ (bzw. von mehr oder weniger wertvollen „Exporten“) im Lauf der Zeit und aufgrund verschiedener sozialer Mechanismen ungleiche ökonomische Entwicklungspfade ergeben können: Die Städter sind eher in der Lage, sich nach innen zusammen- und nach außen abzuschließen, ihre Produktionstätigkeit untereinander zu koordinieren, zu regulieren und gegen äußere Konkurrenz zu schützen, sich als wirtschaftliche Interessengemeinschaft zu verfassen und den Wettbewerbsdruck auf die Zulieferer in der ländlichen Umgebung auszulagern, etwa indem man möglichst niedrige Preise für den Einkauf produktionsnotwendiger Güter zahlt. Auf die Dauer stabilisieren und potenzieren sich diese Vorteile und lassen eine Konstellation entstehen, die man als ein Gleichgewicht des Ungleichgewichts bezeichnen könnte: Die Dynamik der städtischen Wohlstandssteigerung geht Hand in Hand mit sozioökonomischer Stagnation im ländlichen Raum.
Weltsystemanalysen, wie sie seit den 1970er-Jahren im Umlauf sind, deuten nun diesen lokalen Zusammenhang, also die Strukturen ungleichen Tauschs und die sich daraus ergebenden Ungleichheitsverhältnisse zwischen „Zentrum“ (Stadt) und „Peripherie“ (Land), konsequent global – und verfolgen dieses Ungleichheitsarrangement über lange historische Zeiträume hinweg. Das moderne, kapitalistische Weltsystem entstand demnach aus der wirtschaftlichen wie politischen Krise des europäischen Feudalismus im „langen“ 16. Jahrhundert, welches sich von der Erschütterung des norditalienischen Städtesystems im ausgehenden 15. Jahrhundert bis zur Beilegung des Dreißigjährigen Kriegs im Westfälischen Frieden von 1648 spannt. Der damit verbundene Aufstieg Europas zum politischen und ökonomischen Zentrum der damaligen Welt ist nur vor dem Hintergrund einer räumlichen Hierarchisierung zu verstehen, die sich dem ungleichen Austausch mit den – aus Sicht des Zentrums – globalen Peripherien der Zeit verdankt. Und er lässt sich nur nachvollziehen, wenn man einen Faktor berücksichtigt, der Adam Smith – und mit ihm dem gesamten klassischen wie neoklassischen ökonomischen Liberalismus – allenfalls von nachrangiger Bedeutung zu sein schien: nämlich das Aufkommen des modernen Staates und der Einsatz staatlicher Gewalt.
Im frühen 19. Jahrhundert hatte der liberale britische Nationalökonom David Ricardo die von Smith aufgeworfene Eventualität eines aus dem freien Warentausch sich ergebenden strukturellen Entwicklungsungleichgewichts noch mit seiner Theorie der „komparativen Kostenvorteile“ in allgemeines Wohlgefallen aufzulösen versucht. Die auf den Weltmärkten miteinander in Konkurrenz tretenden Länder bzw. deren Volkswirtschaften, so Ricardo, könnten durch intelligente Spezialisierung auf ihre jeweils wettbewerbsfähigsten Produktionssektoren und damit durch eine geschickte zwischenstaatliche Arbeitsteilung allesamt die für sie optimale Marktposition erreichen – und so in jedem einzelnen Land für Wohlstand sorgen. Was Ricardos theoretische Modellierung der allseits segensreichen Wirkungen des Freihandels allerdings (neben vielen anderen Dingen) nicht in Rechnung stellte, waren die massiven politischen Machtunterschiede im Weltstaatensystem: Hier sind keineswegs alle Staaten, wenn man die Marktanalogie denn überhaupt für plausibel hält, gleichberechtigte Marktakteure, die im freien Spiel wirtschaftlicher Strategien „ihrem“ nationalen Kapital jeweils optimale Verwertungschancen zu eröffnen vermögen. Von wegen: Damals wie heute gab und gibt es mehr und weniger machtvolle (oder auch gänzlich machtlose) Staaten mit mehr oder weniger (oder auch gar keinem) Zugriff auf die Gestaltung der weltwirtschaftlichen Austauschverhältnisse. Schon damals konnten und auch heute können manche Länder dazu gezwungen werden, ihre Nationalökonomie auf ein bestimmtes Produktions- und Wertschöpfungsmodell bzw. auf eine bestimmte Export/Import-Struktur auszurichten – von Ländern, deren Volkswirtschaften von entsprechenden Positionierungen und Orientierungen anderer profitieren. Von den „Korngesetzen“ (Corn Laws) im Großbritannien des 19. Jahrhunderts bis zum TTIP-Regelwerk in unseren Tagen war und ist es den mächtigsten staatlichen Akteuren immer möglich, das Welthandelsregime zu ihren Gunsten auszugestalten – und dies selbstverständlich stets unter programmatischer Beschwörung des Prinzips von „freiem“ Handel und wirtschaftlichen Austauschbeziehungen „unter Gleichen“.
Gegen diese – man muss es so sagen – Ideologie eines globalisierten „gleichen Tauschs“ bietet der Weltsystemansatz eine alternative Deutung kapitalistischer Dynamik im globalen Maßstab an. Das moderne Weltsystem folgt seit jeher einer doppelten, geoökonomischen wie geopolitischen, Expansionslogik. Von der auf permanente Erweiterung angelegten, tendenziell global ausgreifenden Dynamik des Kapitalismus war bereits die Rede – Karl Marx hat sie auf die berühmte Kurzformel G–W–G’ gebracht: Im kapitalistischen Wirtschaftsprozess spielt die Ware (W) im Prinzip nur eine Mittlerrolle für den „eigentlichen“ Systemzweck, der darin liegt, aus Geld (G) mehr Geld (G’) zu machen. Es geht also darum, das für die Warenproduktion eingesetzte Kapital zu mehren und es sodann für die auf erweiterter Stufe fortgesetzte Warenproduktion einzusetzen (um aus dieser – aus W’ gewissermaßen – wiederum erweiterten und neuerlich zu investierenden Kapitalbesitz – G’’ – zu beziehen und immer so weiter). Dieser Prozess der Anhäufung von ökonomischem Kapital, in den im Weltmaßstab Zentren und Peripherien arbeitsteilig eingebunden sind, ist jedoch nur die eine Seite der weltsystemischen Entwicklungsdynamik. Die andere, neben der Kapitalakkumulation nicht minder konstitutive Dimension ist die der politischen Machtakkumulation. Denn schon auf lokaler, mehr noch aber auf globaler Ebene sind weder Smith’ bzw. Ricardos Modell strategischer Vorteilsnutzung noch Marx’ Konzept der Reproduktion von Kapital auf stetig erweiterter Stufe ohne den permanenten Einsatz politischer Macht denkbar.
Ungleiche wirtschaftliche Tauschverhältnisse ergeben sich nämlich nicht von selbst, allein aus der Marktmechanik heraus. Und schon gar nicht erhalten sie sich von selbst. Die Möglichkeit, ungleiche Tauschverhältnisse im Weltmaßstab durchzusetzen und aufrechtzuerhalten, beruhte historisch auf dem Aufstieg des zentralisierten Verwaltungsstaats, dem Ausgriff der europäischen Mächte auf Territorien und Bevölkerungen im Rest der Welt, schließlich auf der Anwendung militärischer Gewalt zur Sicherung der Position der europäischen Staaten – und des Wohlstands ihrer Nationen – im Weltsystem. Dessen Geschichte lässt sich als eine der zyklischen Abfolge verschiedener globaler Hegemone, ihres Aufstiegs und ihres Falls, erzählen: vom genuesischen Stadtstaat im 17. über die „Mittelmächte“ der Niederlande im 18. und des Vereinigten Königreichs im 19. Jahrhundert bis hin zu der Kontinentalmacht der Vereinigten Staaten seit dem Ersten Weltkrieg – und womöglich Chinas im 21. Jahrhundert. Globalhistorisch angemessener sind aber wohl komplexere Geschichten von multipolaren Machtverhältnissen (etwa zwischen den verschiedenen Kolonialstaaten im 19. oder den diversen Atommächten im 20. Jahrhundert), vom Aufkommen „semiperipherer“ Ökonomien (wie der sogenannten Schwellenländer nach dem Zweiten Weltkrieg oder zuletzt der „BRICS“-Staaten), zudem von beständigen Machtverschiebungen im Weltsystem, die sich keineswegs an die künstlichen Epochengrenzen einzelner Jahrhunderte halten.
So oder so aber ist festzuhalten, dass sich das moderne Weltsystem durch eine Logik der politisch gestützten ökonomischen Expansion auszeichnet, deren „Machthaltigkeit“ historisch mal mehr (wie etwa zu Hochzeiten des Imperialismus und der europäischen Kolonialherrschaft) und mal weniger offensichtlichen und handgreiflichen Ausdruck gefunden hat (wie seit Mitte der 1990er-Jahre im Regime der Welthandelsorganisation WTO). Es hat auf diese Weise eine einerseits durchaus variable, andererseits aber äußerst festgefügte Geometrie von Zentrum und Peripherie etabliert, die seit Jahrhunderten und bis in die Gegenwart hinein das geopolitische Korsett für jene Phänomene darstellt, die uns hier im Wesentlichen interessieren: für Strukturen relationaler, also miteinander in Beziehung stehender Ungleichheiten, für Prozesse der Reichtumsproduktion und Wohlstandssteigerung mithilfe, auf Kosten und zulasten Dritter.
Wenn dieses Weltsystem nun aber auf der Basis einer unentwegten und verkoppelten Akkumulation von politischer und ökonomischer Macht operiert, dann stellt sich gleichwohl immer noch die Frage, woher der globale Kapitalismus denn eigentlich seine ungeheure, nie gekannte, scheinbar „unendliche“ Dynamik nimmt. Jene Dynamik, die seine Beobachter und Interpretinnen seit jeher so fasziniert, ganz gleich ob Anhänger und Verteidiger oder Kritiker und Verächter. Es gibt wohl kein eindrücklicheres Dokument einer – wiewohl hin- und hergerissenen – Feier der expansiven und umwälzenden Kraft des Kapitalismus als das Kommunistische Manifest, keine atemlosere und auch ehrfürchtigere Schilderung seines unaufhaltsamen Aufstiegs, seiner immer wieder alte Fesseln sprengenden und neue Grenzen überschreitenden Entwicklung. „Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf“, umschreiben Marx und Engels die kapitalistische Expansion. Da fragt man sich: Wie kann das gehen?
Die Sozialwissenschaften halten auf diese Frage nicht allzu viele gute Antworten bereit. Zumeist behelfen sie sich mit der bloßen Feststellung einer „inneren“ Dynamik des Kapitalismus, deren substanzieller Mechanismus jedoch unergründet bleibt. In der systemtheoretischen Spielart des Verweises auf den „eigenlogischen“ Antrieb kapitalistischen Wirtschaftens führt dies zum Beispiel zu der Analyse, dass sich der Kapitalismus über Zahlungen bzw. über die immer neue, wechselseitig aneinander anschließende gesellschaftliche Kommunikation von Zahlungsbedarf und -notwendigkeit bzw. Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit reproduziert. Aus dieser Perspektive wird das Wirtschaftssystem moderner Gesellschaften von einem sogenannten „autopoietischen“ Impuls getragen: Der Kapitalismus lebt demnach „von sich selbst“, entwickelt sich „aus sich selbst“, steigert sich „an sich selbst“.
So zutreffend aber die Feststellung einer systemischen Eigenlogik des Kapitalismus sein mag, so irreführend ist doch die Annahme, dass dieser sich – in einer Art ökonomischem Münchhausen-Akt – am eigenen Schopf aus dem Sumpf allfälliger Krisen ziehen und gleichsam selbsttätig auf immer neue Höhen wirtschaftlicher Entwicklung schwingen könnte. Der Kapitalismus ist kein Perpetuum mobile, das, einmal in Gang gesetzt, ohne weitere Energiezufuhr ewig in Bewegung bleibt. Wie jeder Motor muss auch jener der kapitalistischen Akkumulation immer wieder neu befeuert werden. Die kapitalistische Verwertungsmaschinerie bedarf der beständigen Zuleitung von Werten aller Art: Arbeit, Land und Geld; Hand-, Kopf- und Care-Arbeit; Biomasse, Bodenschätze und Brennstoffe. Genau dies hatte der nicht eben für seine materialistische Analyse bekannte Max Weber vor Augen, als er Anfang des 20. Jahrhunderts den kulturellen Motor des modernen Kapitalismus – die aus den Mönchszellen ins Berufsleben hinausgetragene asketisch-rationale Lebensführung des Einzelnen – genau so lange am Werke vermutete, „bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist“.
Der Kapitalismus kann sich eben nicht aus sich selbst heraus erhalten. Er lebt von der Existenz eines „Außen“, das er sich einverleiben kann, er zehrt von allen möglichen – materiellen wie immateriellen – Formen des ihm zuzuführenden „Brennstoffs“, ohne den sein angeblich ewiges Feuer ziemlich rasch erlöschen würde. In der Tradition des historischen Materialismus stehende sozialwissenschaftliche Analysen gehen grundsätzlich davon aus, dass der Kapitalismus sich immer wieder – wie es im Kommunistischen Manifest heißt – „ein neues Terrain“ schaffen muss. Genauer wäre wohl zu sagen: dass ihm immer wieder neues Terrain geschaffen werden muss. Im Manifest sind es zunächst im Wortsinne neue Territorien, die der Verwertung zugeführt werden – mit der Entdeckung und Kolonisierung Amerikas, mit der Eroberung des ostindischen und chinesischen Marktes, überhaupt mit dem wachsenden „Austausch mit den Kolonien“. Der beständige Prozess kapitalistischer „Landnahmen“ vollzieht sich jedoch auch im übertragenen Sinne: Immer neue Personenkategorien werden als Arbeitskräfte in marktförmige Zusammenhänge wirtschaftlicher Wertschöpfung eingespannt (weltweit z. B. 170 Millionen Kinder, hierzulande zunehmend auch wieder die Alten); immer weitere Fähigkeiten und Eigenschaften dieser Arbeitskräfte (ihr Wissen, ihr Gewissen, ihre Gefühle) werden ökonomisch nutzbar gemacht; immer neue Formen des Lebens (menschliches, tierisches und pflanzliches Erbgut etwa) werden zum Gegenstand privatwirtschaftlicher Verfügung; alle möglichen – und scheinbar auch unmöglichen – Wertbestände werden kapitalisiert und auf Finanzmärkten gehandelt.
Dies alles vollzieht sich, wie gesagt, bereits seit mehreren Jahrhunderten. Aber auch die kapitalistische Expansionslogik ist offensichtlich noch ausbaufähig, auch sie selbst scheint historisch einem beständigen Steigerungszwang zu unterliegen – man denke nur, mit Blick auf die zuletzt angesprochene Tendenz zur „Finanzialisierung“ des globalen Kapitalismus, an die auch nach der Krise der Jahre 2008/09 immer noch gebräuchlichen, teilweise geradezu ins Absurde gesteigerten derivativen Formen der Kapitalanlage. Der moderne, globalisierte Kapitalismus kennt keine immanenten Grenzen. Er gleicht einem permanenten Winterschlussverkauf der Werte: „Alles muss raus“ lautet seine Devise. Alles muss rausgeholt werden: die Schätze aus dem Boden, die Leistung aus der Arbeit, die Zukunft aus dem Geld. Alles muss raus, um es in den Marktmechanismus einspeisen und der ökonomischen Verwertung zuführen zu können. So gesehen ist der Kapitalismus ein gigantisches Arrangement der Einverleibung und der dadurch ermöglichten wirtschaftlichen Wertschöpfung. Einerseits.
Andererseits operiert der moderne, globalisierte Kapitalismus auf der Grundlage eines nicht minder groß angelegten Arrangements der Auslagerung – und zwar der immensen Kosten ebenjener wirtschaftlichen Wertschöpfung. Diese Kosten werden zu erheblichen Teilen externalisiert. Denn wo ungeheurer Wohlstand geschaffen wird, da entsteht allenthalben auch das, was man mit dem britischen Schriftsteller und Sozialkritiker John Ruskin „Übelstand“ nennen mag. Ruskin hatte den englischen Industriekapitalismus des mittleren 19. Jahrhunderts vor Augen, als er Adam Smith’ wissenschaftlicher Vision des „Wohlstands der Nationen“ die gesellschaftliche Realität des „Übelstands“ weiter Teile der Nation entgegensetzte. Beide Phänomene, das gute Leben hier und das schlechte dort, sah er in einem inneren Zusammenhang zueinander stehen. Und er hatte recht: Kapitalistische Dynamik, von vielen oft und gern so hoch gepriesen, hat im Doppelsinne ihren Preis. Der Preis, den die einen erhalten, ist „wealth“. Der Preis aber, den die anderen zu zahlen haben, ist „illth“: Es brauche einfach, so begründete Ruskin seine ebenso unorthodoxe wie zungenbrecherische Wortschöpfung, einen entsprechenden Gegenbegriff, um der Wohlstandsgesellschaft den Spiegel ihres Gegenbildes vorzuhalten, ihr die Augen für ihr „Anderes“ zu öffnen.
Auch der etwas sperrige Begriff der „Externalisierung“ ist gewissermaßen ein Kunstwort, und allzu leicht von der Zunge geht auch er nicht. Aber er fasst doch zutreffend, was im globalen Maßstab dem Wohlstand der Nationen korrespondiert, was dessen dunkle und daher allzu gern ausgeblendete Seite ausmacht: den Übelstand anderer Nationen.




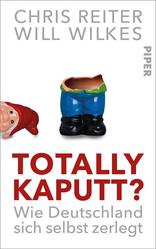
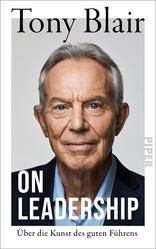






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.