
Palast der Safranblüten — Inhalt
In ihrem ebenso exotisch-farbenprächtigen wie spannenden historischen Roman „Palast der Safranblüten“ verknüpft Lydia Conradi die fesselnde Geschichte zweier Schwestern, die düstere Legende eines unheimlichen Hauses und die bewegende Story einer verbotenen Liebe zu einem packenden Lesevergnügen. Vor der dramatischen Kulisse der glanzvollen Stadt Shimla entfaltet sich eine opulente Frauenemanzipations- und Liebesgeschichte zwischen England und dem indischen Himalaya am Beginn des 20. Jahrhundert.
Kent 1910: Während die rebellische Della nach einem Skandal ins indische Shimla geschickt wird, verlobt sich ihre Schwester Perdita gehorsam mit dem Kandidaten ihres Vaters. Als Della jedoch spurlos verschwindet, bricht auch Perdita aus der erstickenden Enge ihres privilegierten Lebens aus. Auf der Suche nach ihrer Schwester reist sie in die Berge des Himalaya und verfällt nicht nur dem exotischen Zauber von Shimla, sondern ebenso dem faszinierenden Mann, den Della in ihrem letzten Brief die Liebe ihres Lebens genannt hat. Doch der charismatische Fergus ist gefährlich, und seinen „Palast der Safranblüten“ umgibt ein dunkles Geheimnis …
Lydia Conradi steht für „sinnliches Vergnügen“ (Freundin) und für die perfekte Verbindung „historischer Ereignisse mit einer fiktiven, dramatischen Geschichte“ (Von Mainbergs Büchertipp)
Leseprobe zu „Palast der Safranblüten“
1
Miss Dinah Sedgewick
Autumn Hall
Shimla, Punjab, Indien
Lady Hester Linfield
Linfield Castle
Kent, England
Autumn Hall, den 7. April 1827
Liebste Hester!
Bitte nimm nicht an, ich hätte Dir nicht schreiben, Deine lieben Briefe nicht beantworten wollen. Ich habe es dieses endlose halbe Jahr lang immer wieder gewollt. Sooft ich mich aber an mein reizendes, aus Sheesham – indischem Rosenholz – gefertigtes Pult setze, lenkt mich der Blick aus meinem Fenster ab. Er führt mich den hinteren Gartenweg hinunter, der anders ist als jeder Gartenweg in Europa. Eigentlich [...]
1
Miss Dinah Sedgewick
Autumn Hall
Shimla, Punjab, Indien
Lady Hester Linfield
Linfield Castle
Kent, England
Autumn Hall, den 7. April 1827
Liebste Hester!
Bitte nimm nicht an, ich hätte Dir nicht schreiben, Deine lieben Briefe nicht beantworten wollen. Ich habe es dieses endlose halbe Jahr lang immer wieder gewollt. Sooft ich mich aber an mein reizendes, aus Sheesham – indischem Rosenholz – gefertigtes Pult setze, lenkt mich der Blick aus meinem Fenster ab. Er führt mich den hinteren Gartenweg hinunter, der anders ist als jeder Gartenweg in Europa. Eigentlich dürfte er keinen so harmlosen Namen wie Gartenweg tragen, denn er hat nichts Harmloses an sich. Keine in der Sonne schimmernden oder regennass glänzenden Kieselsteine, keine freundlichen Frühlingsblumen wie Himmelsschlüsselchen oder Hasenglöckchen am Rand, keinen Foxterrier, der einem Heimkehrenden fröhlich entgegenspringt. Der Duft des blühenden Safrans hat uns begrüßt, als wir im Herbst nach langer Reise ankamen, und ist jetzt verflogen, als hätten wir davon nur geträumt. Das Mosaik des Säulengangs hat uns der beste aller Menschen geschenkt, um uns das Bild der flüchtigen Schönheit zu bewahren, aber die Blüten aus Steinen sind nur schön und duften nicht.
Götter schlafen auf einem Bett aus Safran Nacht um Nacht. Für Sterbliche hingegen bleibt die Süße nur einen Herzschlag lang, und wer den verpasst, bekommt ihn nicht zurück.
Stattdessen hängen die Zweige von altersgebeugten, dunklen Bäumen – Pinien, Zedern, Zypressen und Wacholder – auf den Weg hinunter und werfen Schatten, in denen nichts Liebliches gedeiht. Was in den Schatten herumspringt, sind weder Hasen noch possierliche Eichhörnchen, sondern graupelzige Affen, Makaken, mit zu Fratzen verzerrten Menschengesichtern, vor deren Anblick einem das Blut gefriert.
Tatsächlich endet der Weg – und damit der Grund und Boden, den Vater für seine Verdienste erhalten hat – an der Kante des Felsens. Vom Gras überwachsen ist dort das seltsame steinerne Symbol in den Boden gehauen, vor dem ich mich am ersten Tag so erschrocken habe, dass ich um ein Haar hinunter ins Nichts gestürzt wäre.
„Wie praktisch“, befand die gute Rhoda, ehe sie uns verließ, „da brauchen Sie nach hinten hinaus keine Gartenmauer.“ Ich aber habe ihrem Tonfall angemerkt, dass sie log und an dem Weg zur Felskante nichts Praktisches fand. Ja, Du hast richtig gelesen. Rhoda, die offenste, ehrlichste Haut von ganz Südengland, das wandelnde Herz auf der Zunge, hatte sich aufs Verschweigen und Lügen verlegt, und am Ende hat sie uns verlassen. Uns, ihre Mädchen, von denen sie doch immer behauptet hat, sie ließe lieber sich selbst als diese zwei mutterlosen Waisen im Stich.
Wie das?, fragst Du. Genau das habe ich mich auch gefragt, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Aber unsere brave, handfeste, durch nichts zu erschütternde Rhoda ist hier oben, weit mehr als tausend Meilen über dem, was wir Menschenwelt nennen, von der Melancholie befallen worden. Und ob Du es glaubst oder nicht: Die Melancholie, die einen in dieser Gegend befällt, führt, wenn sie nicht mit entschiedenen Mitteln bekämpft wird, zum Tod.
Also hat unsere noch immer ein wenig handfeste Rhoda zu diesen entschiedenen Mitteln gegriffen: Als vor zwei Wochen ein Kamerad von Vater, auch er einer von General Ochterlonys glorreichen Offizieren, uns besuchte (der erste englische Besuch seit dem Schnee, der über Wochen kein Heraufkommen möglich machte) und ankündigte, er sei auf dem Weg nach England, um zu heiraten, bot sie ihm kurzerhand ihre Dienste an. Er zahlt ihr weniger als Vater, und da weder Kinder noch junge Damen vorhanden sind, die Verwendung für eine Gesellschafterin hätten, wird sie Hausarbeit verrichten müssen, für die sie sich bei uns zu fein war.
Nichts davon focht sie jedoch an, solange sie nur von hier fortkam, wieder hinunter in die wirkliche Welt und zurück nach England. Das hier oben, Hester, ist nämlich beileibe nicht wirklich. Wärst Du bei uns, so würdest Du nicht lachen, sondern es am eigenen Leib zu spüren bekommen: Die Nebel hier sind wie die kalten Finger von Toten. Hima laya heißt Wohnort des Schnees, nicht Wohnort von Menschen, und kein Ort könnte so nah an Wolken und Sternen liegen und dennoch nichts anderes als irdisch und wirklich sein.
Der Mensch kann nicht Herr sein in einer Handbreit Raum zwischen Himmel und Erde, in den ewigen Schatten, der ewigen Düsternis. Jedenfalls nicht der europäische Mensch mit seinem vernünftigen, aufgeklärten Sinn. Dies hier ist das Zwischenreich. Jener gottverlassene Ort, der sich nun Shimla nennt und Haus um Haus wächst, steht erst seit General Ochterlonys Sieg unter britischem Schutz und gehörte früher den seltsamen Geschöpfen aus Gorkha, die eher Geistern als Menschen gleichen. Auf der Hauptstraße fand sich nicht mehr als ein Fakir, der Wasser austeilte, und der Ort hieß Shyamala. Das ist der Name, den die Gorkha-Wesen ihrer eisblauen Göttin der Zerstörung geben.
Manche sagen, die aus Gorkha werden uns für ihre Vertreibung bestrafen. Ihre Geister können Shimla nicht verlassen, und so streifen sie weiter hier herum und verhindern, dass die Seele eines Weißen auf der geraubten Erde heimisch wird. Andere sagen, es ist Hanuman, der Gott der Affen, der uns vertreiben wird, weil wir auf seinen Safranhängen siedeln. Das ist Unsinn, sagst Du? Es ist Unsinn im Tal, wo uns die Gesetze von Leben und Tod vertraut sind, doch in den Bergen, unter dem Dach der Welt, gelten andere.
In klaren Nächten sieht man hier oben ein Sternbild, das aus blassesten Gestirnen zusammengefügt ist. Haar der Berenike heißt es, und der Mensch, der sich in mein Herz gebrannt hat, hat es mir gezeigt und gesagt: „Es ist wie dein Haar, schöne Tara, Geliebte des Mondgottes Chandra. Blasses Gold.“
Er hat mir auch gesagt, dass das steinerne Symbol, das mich so tief erschreckt hat, die Verkörperung der Liebe zwischen Mann und Frau ist, denn diese Liebe ist nicht zahm wie ein Hündchen in einem englischen Salon, sondern gewaltig wie der Mond und manchmal zerstörerisch wie seine Kräfte.
Den Weg zurück zum Haus bin ich gerannt, und als ich in den Spiegel blickte, packte mich eiskalt die Angst, weil mein Haar aussah, wie er es beschrieben hatte – wie fahle, ferne, blassgoldene Sterne. Es kann doch aber ein Mensch nur zum Sternbild werden, wenn er nicht mehr lebt, und so wie das Haar der Berenice am schwarzen Himmel schlaff herunterhängt, so hängt es doch bei einer Menschenfrau erst im Sarg.
Meine liebste Hester, meine Freundin aus den schönen Tagen, begreifst Du jetzt, warum ich Dir nicht früher geschrieben habe? Die Dinah, die Du kanntest, jenes vergnügte, geschwätzige Geschöpf, gibt es nicht mehr. Jene Dinah ist fort, ich weiß nicht, wo sie hin ist, vielleicht im Schatten der Bäume den Weg hinuntergelaufen und im Zwielicht über die Kante gestürzt. Die, die jetzt hier sitzt, am Pult aus indischer Rose, die wäre Dir fremd, und Du würdest zu Deinem Peter sagen: „Das kann doch die gute alte Dinah Sedgewick nicht sein, die immer so übermütig war und so voller Hoffnungen in ihre Zukunft sah.“
Du hast recht, Hester. Sie kann es nicht sein, und sie ist es nicht. Die, die hier sitzt, ist eine Fremde, die nicht weiß, ob sie alt oder jung ist, die in der schweren, sich nie erwärmenden Luft zittert, und an der Hitze ihrer Sehnsucht verbrennt. Die, die hier sitzt, will nichts als nach Hause, in ihr mildes, maßvolles England, und weiß doch, dass sie diesen verfluchten Ort, der kein Maß kennt, nie wieder verlassen kann. Die, die hier sitzt, ist von der Melancholie befallen, von der schwarzen Krankheit des Gemüts, und sie ist allein, ohne eine Seele. Der einzige Mensch, dem sie nahe sein könnte, ist unerreichbar.
„Aber halt“, höre ich Dich protestieren. „Wie kannst denn ausgerechnet du, Dinah, sagen, du wärst allein, wo du doch deine Schwester hast, deine Prudence und euer wunderbares Band? Ach, Du Ahnungslose!“
Das ist es, was mich zerreißt, was ich nicht ertrage: Das Band ist zerschnitten. Prudence und Dinah, Pru und Di, die Unzertrennlichen, gibt es nicht mehr. Autumn Hall heißt das Haus, in dem unsere Verzweiflung wohnt. Der Vater nannte es so, weil er im Herbst hier heraufkam, durch einen kühlen Zedernwald voller Hyänen und Bären zog und sein Herz an diese Berge verlor, als er den Safran zum ersten Mal blühen sah. In Wahrheit aber heißt das Haus Autumn Hall, weil hier für immer Herbst ist, die Zeit des Sterbens, in der alles zerfällt wie welkes Laub, auch die Liebe zwischen Schwestern, die so strahlend wie der Safran in Blüte stand.
Lass mich über den Grund nichts schreiben. Lass mich jetzt gar nichts mehr schreiben, auch wenn ich weiß, dass Du etwas über „ihn“ lesen willst, über den einen, nach dem sich mein Inneres kranksehnt, dass Du Dich fragst, wer es war, der mir das Haar der Berenike am Himmel gezeigt hat und der mich schöne Tara, Geliebte des Mondgottes Chandra, nennt.
Ich bin so müde, Hester. Und ich will den Brief heute noch dem Menschen mitgeben, der mit seiner Tonga hinunter nach Kalka fährt. Dass ein Brief es von hier oben bis nach England schaffen soll, ist ohnehin unvorstellbar. Ich schreibe ihn zweimal und hebe eine Fassung auf, damit es mir nicht morgen schon vorkommt, als hätte es ihn nie gegeben. Ich denke so viel an Dich, Hester, ich frage mich, ob Du wohl schon mit Deinem Peter verheiratet bist, ob es Dir gut geht, ob ich Dir noch fehle, wie Du mir fehlst. Ich sende Dir Grüße und umarme Dich.
Deine nicht sehr glückliche und doch dem einzig möglichen Glück verfallene Freundin Dinah
2
Kent, Frühling 1910
Was ihre Schwester Della Freiheit nannte und an den unsäglichsten Orten suchte, fand Perdita Lascelles auf dem Rücken ihres im Norden Italiens gezogenen Vollbluts. Das Tier war ein Rappe, auf seiner Stirn eine weiße Raute. Es hieß Ey de Net, was in der Sprache eines dieser eigenartigen Bergvölker, die dort drüben in schluchtartigen Tälern hausten, Auge der Nacht bedeuten sollte.
Der Gedanke an jene Gebirgswelt, deren Gipfel sich so hoch reckten, dass sie in den Wolken verschwanden, jagte Perdita Schauder über den Rücken. Höchstens der Gedanke, sich einmal auf Skier zu stellen, hätte sie gereizt. Sie war nicht weit gereist, war glücklich dort, wo sie lebte, in den grünen Ebenen Kents, durch die sich nach Herzenslust galoppieren ließ. Ey de Net war das schnellste Pferd in ihres Vaters Stall. Er war als stürmisches zweijähriges Fohlen nach Lascelles Manor gekommen, heute vor genau dreizehn Jahren. Ihr Vater hatte ihn Perdita zum zehnten Geburtstag geschenkt, weil sie die Leidenschaft für schnelles, geradezu halsbrecherisches Reiten teilten.
Dann aber hatte Perditas Vater sich zwar nicht den Hals, aber sämtliche Knochen der Beine weit weg von der grünen Freiheit Lascelles Manors gebrochen, im Süden Afrikas, in der Schlacht von Paardeberg, an einem Tag, der als blutiger Sonntag in die Geschichte des britischen Weltreiches eingehen sollte. Gerald Lascelles hatte überlebt, aber er kam als zerstörter Mann zurück, würde seine Beine nicht mehr bewegen und nie wieder reiten können.
Umso mehr hatte er seine älteste Tochter angehalten, das Glück auf dem Pferderücken zu genießen. Die jüngere auch, aber Della hatte zu seinem Leidwesen andere Passionen. Perdita hingegen war kaum je so sehr eins mit sich wie auf Ey de Nets Rücken. In jeden Galoppsprung legte der kraftvolle Rappe sich mit ganzem Gewicht tief hinein, sodass er dicht über den Boden hinwegzujagen schien. Einen Herzschlag lang wünschte sich Perdita, sie hätte im Herrensitz reiten und sich auf seinen Nacken niederbeugen dürfen, die wehende Mähne im Gesicht und zu einer Einheit aus Mensch, Pferd und Erde verschmolzen.
Freiheit aber war wie ein Tonikum. In der richtigen Dosis wirkte sie als Wohltat, doch im Übermaß erwies sie sich als Gift. Das war es, was Della nicht einsehen wollte. Perdita blieb aufrecht in ihrem Dreihornsattel sitzen, der ihr ein sicheres Reiten in hoher Geschwindigkeit erlaubte, und ließ Ey de Net auf der letzten Meile vor dem Abreiteplatz noch einmal alles geben, was er hatte. Dann zügelte sie ihn, zwar sanft, aber äußerst bestimmt. Der Hengst, den selbst Algernon Drury, ihr Bereiter, als starrköpfig und schwer kontrollierbar einstufte, reagierte sofort, fiel in weichen Trab und gleich darauf in Schritt. Pferde liebten es, klare Regeln und ein festes Gefüge zu spüren, innerhalb dessen sie sich orientieren konnten. Sie waren darin den meisten Menschen ähnlich, fand Perdita.
Ohne sich vorzubeugen, klopfte sie ihrem Pferd den schweißnassen Hals. „Danke, mein schwarzer Freund. Schöner kann ein Geburtstag nicht beginnen, und du bist und bleibst mein Bester.“ Sie lachte. „Nun gut, mein Bester neben Caleb, einverstanden?“ Noch einmal lachte sie auf, nicht amüsiert, sondern aus purer Freude. Für gewöhnlich hielt sie sich mit solchen Gefühlsausbrüchen zurück. Es ging schließlich niemanden an, was sie im Innersten bewegte, aber heute konnte sie nicht an sich halten. Das Leben war herrlich. Sie hatte Geburtstag, wurde dreiundzwanzig Jahre alt, und zur Feier des Tages würden ihr Vater und Calebs Vater die höchst willkommene Verlobung des einzigen Sohnes und der erstgeborenen Tochter bekannt geben.
Caleb Custance und Perdita waren Nachbarskinder, entstammten beide Familien der Gentry und liebten einander, solange sie denken konnten. Hatten die übrigen Jungen der Gegend mit Schwert und Spielzeuggewehr die Niederschlagung des Sepoy-Aufstandes oder die Siege in den Burenkriegen nachgespielt, so war Caleb schon als ernster, sanfter Junge von zehn Perditas Bräutigam gewesen. Er hatte ihr Blumenkränze aufgesetzt, die er eigenhändig geflochten hatte, und einen Kinderring an den Finger gesteckt. Jetzt – als stattlicher Mann von vierundzwanzig – würde er es mit dem Segen ihrer Eltern und der Kirche von England noch einmal tun.
Nick, der jüngste der Stallburschen, eilte herbei und griff in Ey de Nets Zügel. „Guten Ritt gehabt, my lady?“
„Sehr gut, Nick. Danke.“
Perdita nahm die zur Hilfe angebotene Hand nicht an, befreite ihr Bein unter dem leaping head des Sattels und ließ sich von Ey de Nets Rücken gleiten. Den Leuten, die in ihres Vaters Haushalt angestellt waren, begegnete sie mit Höflichkeit und Respekt, achtete jedoch darauf, Abstand zu wahren, keine verfänglichen Momente zuzulassen und gezogene Grenzen nicht zu überschreiten. Aus diesem Grund überließ sie ihr Pferd dem Burschen, der ging, um es trocken zu führen, so viel Freude es ihr auch bereitet hätte, diese kurze, intime Zeit noch mit Ey de Net zu verbringen. Es war Nicks Pflicht, nicht die ihre. So gehörte es sich, und so war es gut, für die Dienstboten nicht weniger als für sie.
„Ein Mensch, der weiß, wo sein Platz ist, ist ein zufriedener Mensch“, hatte ihr Vater sie gelehrt, bis es ihr in Fleisch und Blut übergegangen war.
Sie spürte es selbst. Ihr Platz war immer hier auf Lascelles Manor, ihre Stellung die einer Tochter des Hauses, und damit, dass sie den Nachbarssohn, den Erben eines Titels, zum Mann nahm, tat sie, was dieser Stellung entsprach. Dass alles seine Richtigkeit hatte, erfüllte sie mit einer Freude, die in den sonnigen Vorfrühlingstag prächtig passte. Sie würde niemanden enttäuschen und sich selbst nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sie würde wissen, wo ihr Platz war, und zufrieden sein.
Auch Nick, der mit Ey de Net gemächlich über den Abreiteplatz seine Runden drehte, schien mit sich und der Welt zufrieden. Sein Vorgesetzter, Algernon Drury, der als Bereiter und Stallmeister fungierte und die Pferde so perfekt in Form hielt, wie Perditas Vater es wünschte, war ein anderes Kaliber. Er nahm sich Freiheiten heraus, sprach mit den Familienmitgliedern wie mit Bekannten, die er in Faversham im Pub treffen mochte, widersetzte sich Anordnungen und besuchte politische Versammlungen. Er war ein bisschen wie Della – besessen vom Hunger nach Freiheit, ohne zu bedenken, dass diese tödlich sein konnte.
Tödlich war sie für den Jagdhund gewesen, der ihnen davongelaufen war. In den freien Wäldern, deren Ruf er gefolgt war, hatte er sich in einer Fuchsfalle verfangen und ein elendes Ende gefunden. Menschen, die sich wie Algernon Drury herumtrieben, wo sie nicht hingehörten, drohte Ähnliches: Wo man sich nicht auskannte, war man auch nicht in der Lage, Warnzeichen zu deuten.
Auch jetzt sah Perdita Algernon Drury sich davonschleichen wie einen, der nichts Gutes im Sinn hatte. Er war ein kaum mittelgroßer, drahtiger Mann, der grundsätzlich mürrisch, ja, griesgrämig wirkte. Seine Unzufriedenheit rührte daher, dass er den Platz, an den er gestellt war, nicht mit guter Miene hinnahm, dass er zwischen zwei Welten schwankte und in keiner von beiden Halt fand.
Della hatte rein äußerlich mit Drury wenig gemein. Sie war das hübscheste Mädchen rund um Faversham und das liebenswerteste noch dazu. Kein Mensch hätte sie jemals für griesgrämig gehalten, schon gar nicht jetzt, wo sie in ihrem weißen Musselinkleid vor Lebenslust strahlend auf dem Sattelbalken saß und mit den Beinen baumelte. Aber sie hatte ähnliche Anlagen wie Drury – Unrast, Ruhelosigkeit, Sehnsucht und Wünsche nach Dingen, die sie nicht bekommen konnte. Sie musste auf der Hut sein. Für einen Irrwisch, eine Träumerin wie sie war das Leben voller Fallstricke.
„Guten Morgen, Geburtstagskind!“, rief Della vergnügt, während Perdita auf sie zukam.
„Das macht man nicht“, sagte Perdita.
„He, das ist nicht die richtige Antwort!“ Della hängte das Buch, in dem sie gelesen hatte, aufgeschlagen über den Balken und warf ihr Haar, das ihr offen bis in die Taille reichte, über ihren Rücken. Sie hätte nicht unfrisiert hier aufkreuzen dürfen, und sie hatte sich sichtlich auch nicht ordentlich schnüren lassen. Ein kleiner Liederjan war sie, der strenger erzogen gehört hätte. Aber einen Sack Flöhe zu hüten oder eine Koppel voll wilder Pferde zu bändigen schien Perdita machbarer, als streng zu ihrer kleinen Schwester zu sein.
„Ich habe guten Morgen, Geburtstagskind zu dir gesagt, und du musst mir mit Guten Morgen, Geburtstagskind antworten“, forderte die Schwester.
So hatten sie es gemacht, seit Della ihre ersten Worte sprechen konnte. Perdita, fünf Jahre älter, hatte es ihr beigebracht, hatte verzweifelt versucht, so zu tun, als wäre an dem Geburtstag, den sie teilten, etwas zum Freuen, obwohl er zugleich der Todestag ihrer Mutter war. Die zarte Hetty Lascelles war bei der Geburt ihrer zweiten Tochter verblutet. Der Vater – durch und durch ein Mann der Armee – war für die Aufzucht kleiner Kinder nicht geeignet, und so blieben die beiden Mädchen der Obhut eines Kindermädchens überlassen, das für alles Notwendige sorgte, nicht aber für Wärme und Fröhlichkeit.
Sie hatten nur einander gehabt, und aneinander hatten sie sich festgehalten. Am Morgen ihres Geburtstags war Perdita hinaus in den Garten gelaufen und hatte einen Strauß blauer Hasenglöckchen für ihre kleine Schwester gepflückt.
„Guten Morgen, Geburtstagskind.“
„Dir auch Guten Morgen, Geburtstagskind.“
Unter ihrer Bettdecke hatte Della ein zerknittertes Blatt aus ihrem Zeichenblock hervorgezaubert, auf dem kunterbuntes Gekritzel prangte. „Guck, Perdi, die Mama. Hab ich gemalt. Für dich, weil du die doch so vermisst.“
Perdita war acht gewesen und hatte sich unmäßig über die Krakelei der Dreijährigen gefreut. „Du bist die Liebste“, hatte sie gestammelt, „meine Allerallerliebste, und dich würde ich noch viel, viel mehr vermissen als die Mama, so sehr, dass ich’s nicht aushalten könnte.“
Hinterher hatte sie sich geschämt. Schließlich musste sie für Dellas moralische Erziehung sorgen, sie lehren, was richtig und falsch war, denn sonst war ja niemand da. „Die Toten darfst du nicht malen“, hatte sie ihr später erklärt. „Die Toten sind ja in Gottes Hand, und da lassen wir sie ruhen und stören sie nicht. Verstehst du das, Del-Del?“ So hatte die Kleine sich selbst getauft. Perdita benutzte den Namen nur selten. Sie wollte Della zum ordentlichen Sprechen anhalten und ermuntern, ein großes Mädchen zu werden, aber dieses Mal war das Kinderwort ihr herausgerutscht.
Im Grunde ist es dabei geblieben, dachte sie mit einer Spur von Resignation. Ihr Vater – ein Offizier mit Leib und Seele, der mit über fünfzig Jahren noch einmal für sein Land in den Krieg gezogen war – hatte stets mehr mit ihr, seiner Ältesten anfangen können, als mit der verspielten, mädchenhaften Della. Er war froh gewesen, wenn er die Fürsorge für sie Perdita überlassen konnte, und die hatte sich nach Kräften bemüht. Wenn sie ihre Schwester jetzt allerdings betrachtete, zweifelte sie daran, dass diese jemals ein großes Mädchen werden würde. Sie war achtzehn, alt genug, sich zu verloben und zu verheiraten, doch sie baumelte wie ein kleines Kind mit den Beinen, dass ihre Röcke aufflogen.
„Das macht man nicht“, wiederholte Perdita und wies auf Dellas entblößte Strümpfe. „Geburtstag hin oder her.“
„Aber ich bin glücklich“, erwiderte Della.
„Das ist kein Grund, sich schlecht zu benehmen.“
„Bist du auch glücklich, Perdi?“
Jeder andere nannte Perdita bei ihrem vollen Namen oder kürzte ihn zu Dita ab. Einzig Della rief sie noch immer wie damals, als sie mit dem alten, von der Urgroßmutter ererbten Puppenhaus gespielt hatten. Perdita gab keine Antwort. Ja, sie war auch glücklich, wie hätte ein Mädchen in ihrer Lage nicht glücklich sein sollen, aber um derlei Dinge machte man nicht so viel Wind und Worte.
„Und hast du auch Angst?“, fuhr Della schon fort. „Davor, dass es irgendwo finstere, rachsüchtige Götter gibt, die darauf lauern, uns für unser Glück zu bestrafen?“
„Warum sollte ich vor solchem Unsinn Angst haben?“, gab Perdita zurück. „Was Vater Matthew zu deinen finsteren Göttern zu sagen hat, kannst du ihn am Palmsonntag in der Messe fragen. In der Kirche könntest du dich ohnehin öfter blicken lassen.“
„Weil sonst Gott nicht mehr an mich glaubt?“
„Nein, weil dir das deine Verdrehtheit austreiben würde.“ Wider Willen musste sie lachen. Was liest du da überhaupt?« Vor ein paar Wochen hatte sie Della mit Bram Stokers „Dracula“ erwischt, das wahrlich nicht als geeignete Lektüre für eine junge Dame gelten konnte.
Sie griff nach dem Buch, das ihre Schwester auf dem Balken abgelegt hatte. Wilkie Collins. Der Monddiamant. Die Zeichnung auf dem Einband zeigte eine derart abscheuliche Gestalt mit grüner Haut und starrem Blick aus riesigen Augen, dass Perdita das Buch zurück auf den Balken warf. Ihre Schwester hatte denselben Hang zum Melodramatischen, Schauerlichen wie die Dienstmädchen und hatte dem Verbot zum Trotz vermutlich wieder einmal mit einer von ihnen Bücher getauscht.
„Es ist so spannend.“ Schwärmerisch verdrehte Della die Augen. „Stell dir vor, aus einem indischen Tempel wird ein Diamant gestohlen, der einem dieser unheimlichen Götter gehört. Chandra, dem Gott des Mondes. Aber der Gott nimmt Rache, er lässt sich nicht ungestraft von einem dahergelaufenen Menschenwesen bestehlen …“
„Schluss jetzt“, fiel ihr Perdita ins Wort. „Wir stehlen keine Diamanten, und wir sind keine Heiden, sondern glauben an den einen Gott der Kirche von England. Der bestraft uns nicht für Glück, sondern für Sünde und Müßiggang. Also lies keine Schundromane, komm von diesem Balken herunter, und treib dich nicht herum, wo die Stallburschen verkehren. Wenn du dein Leben mit Anstand führst und den Platz, an den du gestellt bist, ausfüllst, ist Glück deine Belohnung dafür.“
„Du bist so vernünftig, Perdi, ich kann nicht glauben, wie vernünftig du bist. Bekommst du nie Lust, mit jemandem zu tauschen und einmal unvernünftig zu sein? Ich nämlich hätte furchtbare Lust, mit dir zu tauschen – nur für einen Tag wäre ich dann die furchtbar vernünftige Perdita Lascelles.“
„Und jetzt bist du die furchtbar unerträgliche Della Lascelles, die mit ihren achtzehn Jahren noch ohne Nachtisch zu Bett geschickt werden muss, wenn sie sich nicht sofort umzieht. Die Custances werden bald hier sein. Ich möchte nicht, dass du mich vor ihnen blamierst.“
„Ach, Perdi!“ Della rutschte von der Stange, und mit einem Ratschen riss der Stoff ihres Kleides. Ohne sich darum zu scheren, warf sie Perdita die Arme um den Hals. „Dein Caleb würde dich doch nicht weniger lieben, nur weil du eine ungezogene Schwester hast, für die du gar nichts kannst.“
„Natürlich würde er mich nicht weniger lieben.“ Perdita versuchte, sich zu befreien, aber Della war schlimmer als jede Klette. „Darum geht es doch gar nicht. Menschen, die sich nicht benehmen können, bringen andere in Schwierigkeiten. Und wenn man einen Menschen liebt, dann will man nicht, dass er in Schwierigkeiten gerät.“
„Aber wenn man diesen Menschen so richtig liebt“, sagte Della, „ich meine, so wie du und Caleb euch liebt – würde man dann nicht alle Schwierigkeiten auf sich nehmen wollen?“
Sie ließ Perdita los und begann sich im Kreis um sich selbst zu drehen, dass die Trompetenlilie ihres Rockes um sie flog. Es war ungehörig und doch eins der Bilder, von dem man sofort wusste, dass man sich später darauf besinnen würde. Dass man, wenn man es sich ins Gedächtnis rief, wieder wissen würde, wie sonnig und unbeschwert dieser erste Frühlingstag gewesen war.
„Ach Perdi, die Liebe ist so wunderbar. Sie macht alles viel größer und schöner, und wenn wir lieben, werden wir auf einmal ganz wichtig.“
„Woher willst du denn das wissen? Und weshalb sollten ausgerechnet wir ganz wichtig sein?“
„Nun, natürlich nicht für die gesamte Welt“, erwiderte Della. „Aber für den einen, der uns liebt, doch wohl.“
„Jetzt geh und zieh dich um“, ermahnte sie Perdita. Insgeheim aber musste sie sich eingestehen, dass ihre Schwester recht zutreffend ausgedrückt hatte, was sie selbst empfand: Sie war nur irgendein Mädchen, das weltvergessen auf dem Land lebte, flüchtig dem König vorgestellt und gleich wieder vergessen. Sie hatte nicht einmal eine Mutter, für die sie etwas Besonderes war, doch für Caleb war sie das wichtigste Geschöpf auf der Welt.
„Du wirst das auch noch erleben“, sagte sie in versöhnlicherem Ton zu Della. „Jetzt bist du achtzehn, im richtigen Alter, und zu der Soiree, die Vater für meine Verlobung gibt, wird Alec Ritchie eingeladen.“
Perdita lauschte auf eine Reaktion, doch es kam keine. Stattdessen sah Della dem Hausmädchen Clarice zu, das mit einem Korb auf der Hüfte aus der Tür des Dienstbotentrakts kam, um harzig duftende Kienzapfen als Anmachholz für den Kamin im Herrenzimmer ihres Vaters zu holen. Der Vater trug Clarice alle erdenklichen Dienste auf, scheuchte sie herum und bestand sogar darauf, von ihr im Rollstuhl gefahren zu werden, obwohl dafür die Pflegerin da war. Ihm zufolge bewegte niemand den Stuhl so sanft wie Clarice.
Die hatte einen schönen Gang, stellte Perdita fest, dazu etwas seltsam Unnahbares, das es ihr manchmal schwer machte, mit der Bediensteten umzugehen.
„Nun sag schon, was du von Alec Ritchie als deinem Tischherrn bei meiner Soiree hältst.“
„Alec“, murmelte Della, ohne den Blick von Clarice zu wenden. „Alec ist nett.“
„Na bitte. Das wollte ich meinen“, sagte Perdita. Die Ritchies waren eine gute Familie, sie gehörten in die Struktur der Gegend wie die Custances und die Lascelles. Alec, der seit Längerem ein Auge auf Della geworfen hatte, war nur ein zweitgeborener Sohn, doch bei der Mitgift, die Gerald Lascelles stellen würde, spielte das keine Rolle. „Wer weiß, vielleicht feiern wir eine Doppelhochzeit.“
„Ach nein, Perdi!“ Della drehte sich nach ihr um. „Du hast so lange darauf gewartet, deinen Caleb heiraten zu können, weil du mich nicht allein lassen wolltest. Ihr heiratet jetzt. Auch wenn es grässlich sein wird, ohne dich hier zu leben. Ganz und gar grässlich.“
Perdita hatte angenommen, ihre Schwester wisse nicht, warum sie ihre Hochzeit aufgeschoben hatte. Sie hatte sich nicht durchringen können, Della, die noch so kindlich war, allein mit ihrem Vater zurückzulassen, hatte jedoch nicht gewollt, dass Della sich deswegen schuldig fühlte. Die Jüngere aber hatte sie durchschaut. Flüchtig legte Perdita ihr die Hand an die Wange. „Du hast recht. Ein wenig ist es mir mit der Hochzeit jetzt eilig, weil ich mit Caleb als Mann und Frau leben will. Und außerdem bekäme ich bei einer Doppelhochzeit ja nicht dich als Brautjungfer.“
„Natürlich werde ich deine Brautjungfer!“, rief Della. „Darauf freue ich mich, seit wir im Obstgarten Hochzeit gespielt haben. Aber vermissen werde ich dich – sehr sogar.“
„Ich dich auch, mein Kaninchen“, sagte Perdita. „Aber allzu lange wirst du ja selbst nicht mehr hierbleiben. So wie ich Alec einschätze, würde er Vater lieber heute als morgen um deine Hand bitten.“
Della hatte sich wieder dem Dienstmädchen zugewandt, das sich niederbeugte, um Kleinholz aufzusammeln. „Hast du dir schon einmal überlegt, wie es sein würde, wenn du Clarice wärst?“, fragte sie unvermittelt. „Stell dir vor, du wärst Clarice und würdest trotzdem Caleb lieben – und er dich. Was solltet ihr dann machen? Davonlaufen? Caleb könnte seine Eltern nicht mehr sehen, er und Clarice hätten kein Geld und wären von allen, die sie lieb haben, fort. Wäre das nicht traurig? Aber tun müssten sie es ja doch. Wenn man liebt, dann tut man so etwas, nicht wahr?“
„Ich habe keine Ahnung, warum du dir dermaßen sinnloses Zeug ausdenkst“, sagte Perdita. „Wenn du so weitermachst, werden deine Geschenke weggeräumt, und nur ich bekomme welche. Willst du das?“
„Nein.“ Della liebte Geschenke und vergaß ihre dummen Fantasien. „Können wir sie gleich jetzt bekommen? Oder müssen wir auf Caleb und seine Eltern warten?“
„Du kannst dich sofort darauf stürzen“, erwiderte Perdita. „Vorausgesetzt, du trägst ein dem Anlass angemessenes Teekleid und hast dir von Annie diesen Vorhang von Haar richten lassen.“
„Gefällt dir mein Haar nicht? Findest du es nicht schön?“
Perdita sah Dellas Haar an, ohne etwas zu sagen. Es war wellig, sehr voll und wie Weißgold. Fast silbern. Dass es jemanden gab, der es nicht schön fand, war unvorstellbar.
3
Lascelles Manor, 20. März 1910
Liebes Tagebuch!
Wie albern sich das las und wie kindisch. Della betrachtete die runden Buchstaben auf dem dicken, weißen Papier. Die Tinte glänzte noch. Sie war fliederblau. Wenigstens das gefiel ihr und hatte etwas von der jungen Frau, die sie gern sein wollte – ein wenig geheimnisvoll, ein wenig anders und ein ganz klein wenig verrucht. Sie hätte gern eine lange Zigarettenspitze gehabt, um daraus zu rauchen, aber vermutlich wäre dann ihre komplette Familie in Ohnmacht gesunken. Außerdem wusste Della überhaupt nicht, ob ihr Zigarettenrauch schmeckte und ob sie es wirklich wollte.
Das war eines ihrer Probleme: Sie wollte alle paar Minuten etwas anderes.
Jetzt jedenfalls wollte sie in das neue, in burgunderroten Samt gebundene Tagebuch schreiben, das sie zum Geburtstag bekommen hatte. Wollte alles festhalten, weil es dadurch noch mehr Bedeutung erlangte. Weil sie es später würde nachlesen können und dann den größeren Sinn begreifen, der hinter den Ereignissen lag. Vielleicht würde sie es ihren Kindern zeigen können und ihnen erklären: „So ist es mit der Liebe – wer weiß schon, was für ein Feuerwerk daraus werden wird, wenn sie als zarter Funke beginnt.“
Aber dazu musste sie erst einmal anfangen. Und eine Zeile durchzustreichen, würde die Schönheit des Buches ruinieren. Also ließ sie liebes Tagebuch stehen und setzte den Federhalter von Neuem auf.
Liebes Tagebuch!
Heute will ich Dir zum ersten Mal schreiben, weil ich glücklich, traurig und durcheinander bin und weil nichts davon verloren gehen soll. Schließlich kann ich ja noch nicht wissen, was einmal wichtig wird oder nicht. Die Leute in dem Buch vom Monddiamanten, das mir Clarice aus der Bücherei mitgebracht hat, schreiben auch Tagebuch. Und Briefe. Aus ihrem Tagebuch und den Briefen entsteht am Ende die ganze Geschichte. Briefe würde ich auch gern schreiben, aber ich weiß nicht, an wen. An Perdi? Die würde das albern finden, wo wir uns doch jeden Tag sehen. Und wenn wir uns bald nicht mehr oft sehen, wird sie sagen: „Ich wohne doch nebenan. Da wäre ein Brief verschwendete Zeit.“
Ich hätte gern eine Freundin. Natürlich könnte keine Freundin mir so lieb wie Perdi sein, aber man könnte der Freundin doch ganz anderes anvertrauen. Clarice zum Beispiel. Die schreibt ständig an alle möglichen Leute, um ihren schriftlichen Ausdruck zu üben, und ich würde ihr auch gern schreiben. Sie versteht so viel mehr vom Leben als ich. Aber weil Clarice unser Hausmädchen ist, steht eben fest, dass sie nicht meine Freundin sein darf. Manchmal möchte ich jemanden fragen: Warum ist das so? Aber wen?
Nicht zuletzt könnte ich wohl auch noch „ihm“ schreiben, und die Vorstellung erscheint mir schrecklich aufregend. Ihm. Meinem Liebsten. So darf ich jetzt ja wohl sagen, wo wir uns geküsst haben und noch so viel mehr, für das es keine Worte gibt. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass Perdi mit ihrem Caleb auch nur halb so viel getan hat wie wir. Wir beide, Perdi und ich, wir haben ja von klein auf unsere Rollen zugeteilt bekommen, und die erfüllen wir: Perdi, die Brave, und ich, der Tunichtgut, der sich mit seiner Unbedachtheit eines Tages noch ins Unglück stürzen wird. Meine Rolle passt mir im Großen und Ganzen wohl recht gut, und die meiste Zeit über habe ich sie ganz gern angenommen, aber manchmal kommt sie mir dennoch vor wie ein Kleid, das da und dort zwickt, weil man herausgewachsen ist. In solchen Momenten frage ich mich: Wenn wir nur immer weiter unsere Rollen spielen und tun, was man von uns erwartet, versäumen wir nicht, was wir sonst noch sind oder sein könnten?
Perdi zum Beispiel. Würde sie nicht gern mit ihrem Caleb, den sie so sehr lieb hat, einmal ein Abenteuer erleben, etwas Verbotenes tun, statt seit Jahr und Tag wie ein hübsches, kleines Paar Zinnsoldaten vor den hochwohlgeborenen Eltern strammzustehen? Heute stand sie wiederum stramm, und sie tat mir leid. Während die wilde Della ihre Geschenke (die ganz sicher Perdi besorgt hatte, denn sie waren wie für mich gemacht) ungestüm aus dem Papier riss und sich ausgelassen über einen Malkasten, Bücher, ein zweiteiliges Kleid aus meerblauer Seide und dieses Tagebuch freute, wickelte Perdita züchtig ein farbloses Stück für die Aussteuer nach dem andern aus, sagte „Danke“ und stapelte alles ordentlich auf. For heaven’s sake (so flucht „er“, mein Liebster, wann immer etwas ihn aufregt), sie ist doch erst dreiundzwanzig, nur fünf Jahre älter als ich, nicht jenseits von Gut und Böse wie Tante Mathilda, die die zwei Geburtstagskinder anschließend in den Teesalon abkommandierte, wo bereits serviert worden war. Lady Maude zupfte sich mit der Silberzange ein hauchdünnes Lachs-Sandwich von der Etagere und hielt in der freien Hand ein Gläschen Sherry, den zuckersüßen Bristol Cream, der schmeckt wie Honigmilch, die man halskranken Kindern gibt.
Lord Roderick, der, ohne zu krümeln, Scones in sich hineinstopfen kann, erhob sich. Wenn er sich erhebt, bekommen die, die sich hinter ihm aufhalten, keine Sonne mehr ab. Aber hinter ihm hielt sich ja niemand auf. Wir sind so wenige auf solchen Feiern „im engsten Kreis“, wir passen alle ordentlich um den kleinen, in Messing gefassten Glastisch: Vater mit der Pflegerin, die nun einmal dabei sein muss, obwohl er lieber Clarice hätte, Tante Mathilda, Onkel Herbert Fitzwater, Cousin Bertram und seine Frau Susan, deren Bauch mit dem Kind fast aus dem Contilkorsett platzt. Mehr Verwandte haben wir nicht, bis auf Vaters Cousin, der weitab von der Zivilisation in irgendeinem indischen Gebirge haust. Mr. Taylor, der Butler, und Diener Cuthbert, der natürlich dabeistand, um bei Bedarf Tee oder in Maßen Alkohol nachzuschenken, zählten nicht, denn die gehören ja nicht zur Familie. Gerade Mr. Taylor benimmt sich auch so, mehr wie ein Möbelstück als wie ein Mensch. Steht reglos wie Großpapa Williams Standuhr, bei der alle erschrecken, wenn sie zur vollen Stunde gongt.
Dazu kamen Caleb, der genauso zackig aufstand wie sein Vater, aber hoffentlich nie genauso in die Breite gehen wird, und die Eltern: Der ehrenwehrte Sir Roderick, Earl of Tedworth und seine Countess, die noch ehrenwertere Lady Maude. Dass diese zwei über uns Lascelles anfangs gehörig die Nase gerümpft haben, ist Perdi ohne Zweifel bekannt. Aufrichtig ausgedrückt, sind ja die Lascelles nichts weiter als zu Geld gekommene Kleinadlige. „Aber nicht ohne Anstand“, beharrt die arme Perdi bei diesem Thema grundsätzlich. „Anstand ist das Wichtigste, so hat Vater es gehalten, und so werden wir es halten, dann brauchen wir uns vor niemandem zu schämen. Und seit Lord Roderick und Lady Maude erkannt haben, dass es bei uns an Anstand nicht fehlt, kommen sie gern zum Bridge, und als Frau für ihren einzigen Sohn bin ich ihnen von Herzen willkommen.“
Vielleicht eher, seit sie erkannt haben, dass es bei uns an Geld nicht fehlt und dass sich ohne den warmen Regen aus Gerald Lascelles’ Portfolio ihr marodes Schloss mit der maroden Wirtschaft drumherum nicht mehr lange wird halten lassen. Aber nicht doch. Das sind so niederträchtige Gedanken, die passen nicht zu meiner Rolle. Ich bin zwar das schwarze Schaf, das ständig Unfug anstellt, aber das ist mein Übermut, keine Bosheit, im Kern bin ich harmlos und darf so etwas Hässliches nicht denken.
Das tue ich ja auch eigentlich nicht. Und den dicken Lord Roderick samt seiner Bohnenstange Maude finde ich nicht einmal unleidlich. Er kann recht amüsant sein, und wie man Scones verputzt, ohne sich von oben bis unten mit Krümeln zu verzieren, muss er mir irgendwann einmal beibringen. Ich frage mich nur und kann damit nicht aufhören: Was wäre, wenn nicht? Was wäre, wenn unser Vater kein Geld hätte? Wenn er nicht kerzengerade in seinem Stuhl einherrollte, als hätte er das Schwert des Empire verschluckt, und eine Fahne mit der Aufschrift „Anstand“ vor sich hertrüge? Wenn es auf seiner weißen Weste einen Flecken gäbe, den fleißige Wäscherinnen mit allem Reiben nicht herausbekämen?
Und wenn Perdi selbst, die so wohlerzogene, fügsame Perdi, einmal etwas täte, was nicht dem Anstand entspricht? Wenn sie sich statt eines halben Gläschens Champagners ein richtiges Glas einschenken ließe und nach dem ersten ein zweites und dann noch eins und noch eins? Wenn sie aus heiterem Himmel die Etageren mit den Sandwich-Fingerchen und Petit Fours vom Tisch fegen würde und den illustren Herrschaften erklären: „Wisst ihr was? Ihr alle hängt mir zum Hals heraus. Ich will mit meinem Caleb allein sein, weit weg von euch und vom Hüfthalter bis auf die Füße nackt.“
Erschrecken sich Tagebücher, weil ihre Besitzerinnen mit fliederblauer Tinte Unaussprechliches in sie hineinschreiben? Sicher nicht. Wozu wären sie sonst da? Sie würden nicht mehr taugen, als Freundinnen, die sich die Ohren zuhalten. Solche Freundinnen könnte man – so man sie hätte – dorthin schicken, wo der Pfeffer wächst.
Weshalb eigentlich Pfeffer, und wo wächst der? Safran, das habe ich aus dem Buch von Clarice gelernt, wächst in Indien und blüht höchstens drei Wochen lang. Ich mag Safran gern, das butterige Goldgelb, das unsere Dottie in den Früchtekuchen knetet, und der Duft, der halb bitter und süß ist, zart und doch alles erfüllend wie die Liebe. Eine Freundin, die sich vor meinen sündigen Gedanken die Ohren zuhält, würde ich nie dorthin schicken, wo man solche Kostbarkeiten pflücken kann. Die wäre beim Pfeffer besser aufgehoben. Aber eine Schwester?
Meine Schwester Perdi?
Eine so liebe Schwester wie Perdi schickt keiner dahin, wo irgendwelche Gewürze wachsen. Die schickt er nicht einmal auf den Besitz des Nachbarn, wo sie unter der gestrengen Aufsicht von Lord Pflaumenpudding und Lady Bohnenstange mit ihrem Caleb in Anstand ihr Leben führen wird.
Und deshalb, liebes Tagebuch, habe ich heute, an Deinem ersten Tag, so viel von den Dingen geschrieben, die mich traurig machen, und nichts von denen, die mich aufgeregt und glücklich machen, so viel von meiner Schwester und fast nichts von meinem Liebsten. Ich kann mir eben einfach nicht vorstellen, dass sie bald nicht mehr hier ist, meine Perdi, die immer bei mir war, und dass sie Mrs. Caleb Custance sein wird, wenn sie uns fortan besuchen kommt. Alle Gäste reisen ab, und ich bleibe allein mit dem Vater, der mich nicht versteht. Perdi versteht mich auch nicht, ich verstehe mich ja an den meisten Tagen selbst nicht, aber Perdi hatte mich an all diesen Tagen lieb. Und ich sie.
Vielleicht wäre ich ja nicht ganz so traurig, wenn ich mir sicher wäre, dass sie und ihr Caleb glücklich sind und dass sie sich um ihr Glück mehr sorgen als um Anstand und Lord Pflaumenpudding nebst Lady Bohnenstange.
Was meinen Liebsten betrifft, so sollte ich wohl nicht ins Buch, sondern an ihn selbst schreiben, wie vorhin schon einmal bedacht. Aber ich weiß nicht einmal, ob er einen Brief gern lesen würde, ja, ob er überhaupt gern liest.
Ich selbst lese immerzu. Geschichten von anderen Leben in anderen Ländern und zu anderen Zeiten, weil ich nur das eine habe, und das kommt mir so furchtbar wenig vor.
Statt zu schreiben, könnte ich mein eines Leben in die Hand nehmen und mit ihm davonlaufen, wie ich es Perdi und Caleb gewünscht habe. Aber könnte ich das wirklich? Fortgehen, um des Abenteuers willen, und meine Perdi nicht mehr sehen?
Der ärmste Liebste würde an einer verborgenen Gabelung des Weges vergeblich auf mich warten, denn ich bekäme nicht einmal einen Fuß über die Schwelle.
4
„Ich liebe dich, Dita. Es macht mich zum stolzesten Mann der Gegend, dass du eingewilligt hast, meine Frau zu werden.“
„Ich liebe dich auch, Caleb. Ich habe schon eingewilligt, deine Frau zu werden, als du mich zum ersten Mal gefragt hast. Da war ich acht.“
„Und ich zehn.“
Sie lachten beide. Der Tag war hell und schön, als müssten von jetzt an alle ihre Tage hell und schön sein.
Sie waren zusammen geritten, Perdita auf Ey de Net und Caleb auf einem fuchsroten Wallach, den er jüngst aus Irland erworben hatte und versuchte, auf Ey de Nets Schnelligkeit hin zu trainieren. Vergebliche Liebesmüh. Es war nicht leicht für Caleb. Von seinen Eltern wurde er knapp gehalten und hatte kaum Geld zur Verfügung, um es für Leidenschaften wie den Reitsport auszugeben.
Liebend gern hätte Perdita ihren Vater gebeten, ihm aus den Mitteln der Mitgift vorab einen Betrag zukommen zu lassen, aber sie wusste, sie hätte Caleb damit gekränkt. Seine Familie hatte Stück um Stück ihr Vermögen verloren, weil sie sich weigerte, an der Art, in der sie seit Generationen ihren Besitz bewirtschaftete, etwas zu ändern. Das Wissen darum verletzte ihn ebenso tief, wie es ihren Vater verletzte, als Offizier seinem Land die Gesundheit geopfert zu haben und dennoch keinen großen Titel zu führen.
Mit der Hochzeit wird all das anders, dachte Perdita. Einen Unterschied zwischen ihnen würde es nicht länger geben, weder in geldlichen noch in gesellschaftlichen Fragen. Was immer sie einbrachte, würde sie in Calebs Hände geben, und er gab ihr und den Kindern, die sie haben würden, seinen Namen und seinen Schutz. Flüchtig legte sie ihren Kopf dorthin, wo in der Halsgrube Calebs Puls schlug. Sie waren Kindheitsfreunde, sie durften sich ein wenig mehr Vertraulichkeit herausnehmen als gewöhnliche Verlobte. „Ossian ist heute ausgezeichnet gelaufen“, sagte sie. „Es ist erstaunlich, was du in der kurzen Zeit aus ihm herausgeholt hast.“
„Meinst du wirklich?“ Wenn er verlegen war, seine Unsicherheit zeigte, liebte sie ihn mehr denn je. „Ich denke schon, es steckt einiges in ihm, und ich gebe mir alle Mühe, ihn zu fördern. Aber seine Möglichkeiten sind begrenzt, sein Vollblut-Anteil ist einfach nicht groß genug.“
„Was hieltest du davon, Drury mit ihm trainieren zu lassen?“ Perdita reckte sich und hielt Ausschau, sah die beiden Stallburschen, die sich aufmachten, ihnen die Pferde abzunehmen, konnte den Bereiter aber nirgends entdecken. Er hatte etwas von einer Kreuzotter, kam und ging, wie es ihm gefiel, verschwand im Gras, um dann unvermittelt daraus hervorzuschießen. Della machte sich wenig aus Reiten und hatte demzufolge kaum mit ihm zu tun, und dennoch missfiel Perdita der Gedanke, dass sie allein und auf ihn angewiesen sein würde, wann immer es um Lucy, ihr Pferd, ging. An manchen Tagen fragte sie sich, ob sie ihren Vater nicht hätte bitten sollen, jemanden anderes einzustellen, der angemessener mit einem so jungen Mädchen umging.
Andererseits hielt der Vater zu Recht große Stücke auf Drurys Talent im Umgang mit Pferden. „Der Kerl macht mir aus einem lahmen Schimmel einen Derby-Sieger“, behauptete Gerald Lascelles, der regelmäßig Dreijährige nach Epsom schickte. Seit er selbst nicht mehr reiten konnte, war der Rennsport ihm Zerstreuung und Trost, und Algernon Drury war der Mann, der ihm die verlorenen Fähigkeiten ersetzte. Aus diesem Grund hatte Perdita Caleb vorgeschlagen, Drury mit seinem Fuchswallach einen Versuch wagen zu lassen. Caleb war ein guter Reiter, aber er war durch und durch zivilisiert, während Drury über einen beinahe animalischen Instinkt verfügte, auf den Pferde reagierten.
Calebs Züge verhärteten sich. „Traust du mir nicht zu, mit meinem eigenen Pferd fertig zu werden?“, fragte er scharf. „Hast du nicht eben noch gesagt, ich hätte einiges aus dem Iren herausgeholt? War das nur leere Schmeichelei?“
Ehe Perdita auch nur ein Wort herausbekam, fuhr er schon fort: „Ich weiß, dein Vater hat dich mit materiellen Gütern überschüttet wie ein indisches Prinzesschen – aber ich dachte doch, gerade du wüsstest andere Werte zu schätzen. Dass du das teurere Pferd besitzt, macht dich übrigens nicht zur besseren Reiterin.“
„Das ist doch absurd, Caleb. Dass ich die bessere Reiterin bin, würde ich nie behaupten.“ Nicht einmal wenn ich es wäre, durchfuhr es sie. „Ich lasse selbst Ey de Net von Drury bewegen, wenn ich nicht genug Zeit habe, und da es ihm gut zu tun scheint, habe ich es dir auch vorgeschlagen. Das ist alles. Kein Grund, mir Finsteres zu unterstellen.“
„Und weshalb solltest du für dein Pferd nicht genug Zeit haben?“, fragte Caleb. „Es ist schließlich nicht so, dass du den lieben langen Tag irgendetwas anderes zu tun hättest.“
Das war rundheraus unfair. Perdita hatte mehr oder weniger die Aufsicht über den Haushalt auf Lascelles Manor geführt, seit sie zwölf Jahre alt gewesen war, und Mrs. Severs, die Haushälterin, hatte mehr als einmal verlautbart, dass sich mit Perdita arbeiten ließ wie mit einer erwachsenen Dame. Vor allem aber hatte sich Perdita um Della gekümmert, hatte versucht, ihr die Mutter zu ersetzen und das moralische Vorbild zu sein, das junge Mädchen so dringend benötigten.
„Da wir einmal dabei sind.“ Caleb war sichtlich noch nicht fertig, obwohl Perdita noch immer nicht klar war, was diesen Sturm aus heiterem Himmel ausgelöst hatte. „Als meine Frau erwarte ich von dir ein deutlich anderes Benehmen. Wie ein Stallbursche herumzugaloppieren gehört sich nicht für die künftige Countess of Tedworth.“
„Aber deine Mutter liebt das Jagdreiten doch auch!“, rief Perdita. Eine Angst ergriff sie, die sie nicht kannte. Was war mit Caleb los, warum ging er so schroff mit ihr um? Sie liebte ihn, es wäre ihr nicht schwergefallen, für ihn auf vieles zu verzichten, aber ihr geliebtes Reiten schien so sehr Teil ihres Wesens, dass in ihr die Frage aufschoss: Wenn ich nicht mehr reite – was ist dann noch übrig von mir?
Natürlich war die Frage müßig. Ihre Liebe zu Caleb war übrig, ihr Wunsch, ihm eine gute Frau zu sein. Und die Liebe zu Della und ihrem Vater, das Bestreben, den Mann glücklich zu sehen, der vom Schicksal so hart geschlagen worden war und doch nie aufgehört hatte zu kämpfen, um seine Töchter zu anständigen Menschen zu erziehen. Und Della sollte einen guten Mann bekommen. Mit einem künftigen Earl zum Schwager erhöhten sich ihre Chancen. Das alles war wichtiger als ihr Vergnügen, war viele Opfer wert.
„Meine Mutter nimmt an Jagden teil, das ist richtig“, sagte Caleb. „Aber sie käme nicht auf die Idee, sich in aller Herrgottsfrühe ein Pferd satteln zu lassen, um ohne Sinn und Zweck durch die Wälder zu sprengen. Mein Vater hätte ihr so etwas auch nie gestattet. Hätte er riskieren sollen, dass die Frau, die er zur Mutter seiner Kinder gewählt hatte, sich bei solchem Leichtsinn den Hals bricht?“
Lady Maude hatte nur ein einziges lebensfähiges Kind geboren, was sie und ihr Mann fast ebenso bedauerten, wie es Gerald Lascelles schmerzte, keinen Sohn zu haben.
Perdita wusste nicht, was sie antworten sollte. Was er sagte, war einleuchtend, und sie verspürte nicht den Wunsch, ihrem künftigen Mann zu widersprechen. Aber Ey de Net nachzusehen, der jetzt von Nick übernommen wurde und an Ossians Seite mit schwingendem Schweif davonschritt, tat dennoch weh.
„Du hast recht“, sagte sie endlich.
„Das meine ich aber auch.“ Er lächelte wieder, beugte sich nieder und küsste sie federzart auf die Stirn. „Ich liebe dich, Perdita. Ich will das Beste für dich.“
„Das weiß ich.“
„Gut. Vergiss es nie.“
Abends, nach dem Dinner, saß sie mit ihrem Vater im Teesalon, den er auch als Rauchzimmer nutzte, wenn kein Besuch da war, weil er auf diese Weise zumindest Perdita beim Rauchen zur Gesellschaft hatte. Diese kurzen, gemeinsam verbrachten Abende bedeuteten Perdita viel. Sie gaben ihr das Gefühl, ihre Sache ordentlich zu machen und ihrem Vater eine gute Tochter zu sein, auch wenn sie ihm keinen Sohn ersetzen konnte. Wenn sie und Caleb erst verheiratet waren, wünschte sie sich zwischen ihnen ebensolche Abende. Sie würde dafür Sticken lernen. Im Sticken war sie nie gut gewesen, aber die Frau, die dabei saß und stickte, während der Mann sich nach einem langen Tag beim Rauchen entspannte, gehörte zur Harmonie des Bildes.
Ihr Vater liebte Zigarren. Zigaretten, die es in ständig neuen Sorten gab, rührte er nicht an.
„Ich bin stolz auf dich“, sagte er, nachdem Cuthbert ihm die gewünschte Zigarre gebracht und er selbst sie sich mit einem kleinen Ritual angeschnitten und in Brand gesteckt hatte. „Ich wünschte, ich hätte Grund, auf deine Schwester genauso stolz zu sein.“
„Aber den hast du doch!“, rief Perdita. „Della ist noch so jung und ja, sie ist ein Wildfang und schwierig zu zügeln, aber das ist jedes gut gezogene Fohlen auch, und mit geduldiger, beharrlicher Arbeit haben wir noch immer ein ordentliches Pferd aus ihm gemacht.“
Sie stockte. Ihre Schwester mit einem Pferd zu vergleichen, gehörte sich nicht. Dennoch konnte sie sich nicht hindern, bisweilen an einen Jährling zu denken, wenn sie Della erlebte: lange Beine, zerzauste Mähne, Tage voller Luftsprünge und nächtelang Lärm in der Box. Es dauerte Jahre, einen solchen Geist voller Widerspenstigkeit an den Zügel zu gewöhnen, ihm Gehorsam und Unterordnung beizubringen, doch mit jedem Schritt voran spürte man die wachsende Zufriedenheit des Pferdes. Es wurde seiner Bestimmung zugeführt, der Aufgabe, die ihm im Leben zufiel, und diese zu erfüllen, schenkte Glück, das war beim Menschen nicht anders als beim Tier.
Ihr Vater blies Rauch aus. Perdita verspürte einen Hustenreiz, und dennoch liebte sie den Geruch, der in seiner samtenen Hausjacke und ein wenig auch in den Chintz-Polstern von Sesseln und Sofas hing. Wo immer er ihr begegnete, würde er sie an ihren Vater erinnern, an die Wärme, an das nach dem Harz von Kiefernholz duftende Feuer und das sanfte Licht jener Abende, die sie zu zweit im Teesalon verbracht und über all die Dinge geredet hatten, die für den Haushalt, das Anwesen, die Familie erledigt werden mussten.
„Du kommst nach deiner Mutter“, sprach ihr Vater gedankenverloren vor sich hin. „Eine Frau, die wusste, wo sie hingehörte, und die Forderungen von Anstand und Pflicht höher stellte als die flatterhafte Stimme des Herzens. Ich habe sie dafür respektiert und bewundert, und meine Liebe zu ihr ist dadurch nur gewachsen.“
In Bruchstücken wusste Perdita, wovon er sprach. Vaters Schwester, Tante Mathilda, hatte etwas erwähnt, und unter gemeinsamen Bekannten wurden hier und da Gerüchte laut: Die junge Lady Hetty Bouvier hatte sich innig in einen jungen Offiziersanwärter aus dem Regiment des Mannes verliebt, mit dem sie sich nach dem Willen ihrer Familie verloben sollte. Der junge Mann war mittellos, dennoch entschlossen, beim Vater seiner Liebsten vorzusprechen und ihn um eine Chance für seine Liebe zu bitten. Er hatte vor, sich zur British Indian Army zu melden, um seine Karriere zu beschleunigen und seiner Frau innerhalb der britischen Gesellschaft in Indien ein angemessenes Leben zu bieten.
Hetty aber hatte sich zu dem harten Schritt durchgerungen und ihrer Mesalliance entsagt. Sie hatte Gerald Lascelles geheiratet, den Mann, den ihre Familie für sie ausgewählt hatte, und ihre Ehe war glücklich geworden, wenn auch ein unbarmherziges Schicksal sie allzu früh beendet hatte.
„Du bist durch und durch ihre Tochter“, fuhr ihr Vater fort und zog von Neuem an seiner Zigarre.
Perdita war fest entschlossen, sich ihre Mutter zum Vorbild zu nehmen und eine so gute Gattin zu werden wie sie. Aber ich brauche nicht dasselbe Opfer zu bringen, dachte sie. Sie hatte Glück – der Mann, den ihr Vater für sie bestimmt hatte, war zugleich der, den sie von ganzem Herzen liebte.
„Della aber – die verstehe, wer will“, sprach ihr Vater weiter. „Da fehlt jetzt die Mutter. Hetty hätte vielleicht gewusst, was in dem Mädchen vorgeht, aber für mich als Mann ist mein eigenes Kind ein Buch mit sieben Siegeln.“
„Ich habe mich immer bemüht, an Della Mutterstelle zu vertreten“, erwiderte Perdita ein wenig verletzt.
„Ja, das hast du, und hast wahrlich dein Bestes gegeben, das könnte kein Mensch bestreiten. Aber was dein Springteufel von Schwester jetzt gerade treibt, was ihr wieder wichtiger war als zum Abendessen mit ihrer Familie zu erscheinen, das weißt du auch nicht, und woher sollst du das auch wissen?“
„Das habe ich dir doch gesagt!“, rief Perdita. „Sie hat sich heute Vormittag beim Spaziergang verkühlt und hatte keinen Appetit. Ich fand es daher sogar vernünftig, dass sie noch ein wenig in ihr Tagebuch schreiben und dann früh zu Bett gehen wollte, um sich auszukurieren.“
Asche von des Vaters Zigarre fiel auf die Glasplatte des Tisches, weil Cuthbert den Aschenbecher – Silber mit dem eingravierten Bild eines Lieblingspferdes – außerhalb seiner Reichweite abgestellt hatte. Der Vater beugte sich vor, unterdrückte einen Schmerzenslaut, als er den Arm so weit wie möglich streckte, um den Behälter zu erreichen. Den Rollstuhl konnte er allein nicht vorwärtsbewegen, und die Pflegerin wollte er in der Privatheit jener Abende nicht um sich haben. Er wollte sie überhaupt höchst selten um sich haben. Seinen Kammerdiener wollte er außerhalb der vier Wände seines Schlafgemachs auch nicht viel häufiger um sich haben, und Clarice, die er leichter duldete, weil sie durch ihre niedrige Stellung nicht recht zählte, hatte in einem Salon nach dem Dinner nichts zu suchen.
Gut zehn Jahre war es her, dass er mit seiner Kavallerieeinheit gegen eine Wagenburg der Buren angestürmt war und mit der Hälfte seiner Männer auch die Beweglichkeit seiner Beine verloren hatte. Sie hätte damit vertraut sein müssen, doch an den Anblick ihres vor Kraft strotzenden Vaters, der hilflos in einem Rollstuhl saß, würde sie sich nie gewöhnen. Er spürte seine Beine noch, aber die Knochen waren vom Leib seines über ihn hinweggerollten Pferdes derart zermalmt worden, dass ärztliche Kunst versagte.
Der Blick ihres Vaters traf sie. Unvermittelt musste Perdita an Della denken. Sie war in vielem ein Ebenbild ihrer Mutter, nur noch hübscher, zarter, fast feenhaft fein, doch die blauen Augen hatte sie vom Vater. Sie waren klar, ließen durch etliche Schichten blicken, und blieben letztlich doch unergründlich, weil sich hinter jeder Schicht eine weitere Tiefe auftat. Sie waren schön, man wollte sich an ihrem Blick festsaugen, doch zugleich lag etwas Kaltes darin.
„Ich bin froh, dass du Custances Sohn heiratest“, sagte ihr Vater. „Dass es dem alten Wolf an Geschäftssinn mangelt – na ja, aber er kann schützend die Hand über dich halten.“
„Bist du der Ansicht, das habe ich nötig? Habe ich mich als so dumm erwiesen?“
Wieder fühlte Perdita einen Stich, eine nicht allzu schwere, aber doch deutlich spürbare Verletzung. Natürlich hatten Frauen den Schutz von Männern nötig, daran hatte sie nicht vor zu rütteln, und zweifellos würde ihr künftiger Schwiegervater in einem Notfall die Hand über jedes Mitglied seiner Familie halten. Sie fand jedoch, dass sie sich in den Jahren, in denen sie häufiger als üblich auf sich allein gestellt gewesen war, nicht übel bewährt hatte. Sie war in zahlreichen Dingen bewandert, die sonst Männern vorbehalten blieben, verstand sich auf den Pferdekauf, auf die finanziellen Aspekte der Haushaltsführung, sogar auf manche bauliche Besonderheit des Hauses. In Ermangelung anderer Gesprächspartner hatte ihr Vater seine Kriegserfahrungen ebenso mit ihr geteilt wie Gedanken zur Bewirtschaftung der Güter. Dass er sie jetzt wie ein geradezu lebensunfähiges Mädchen behandelte, traf ihren Stolz.
„Du bist nicht dumm“, sagte ihr Vater, ohne den Blick von ihr abzuwenden. „Im Gegenteil. Du bist ein patentes Mädchen, eines, das seinen Mann stehen kann und das mir hier an etlichen Ecken und Enden fehlen wird. Wärst du als Sohn zur Welt gekommen, könnte ich mein Lebenswerk in befugte Hände und an mein eigenes Fleisch und Blut übergeben. So fällt alles an diesen Sohn meiner Schwester, den ich – unter uns gesagt – für einen Luftikus halte.“
Das war Cousin Bertram gegenüber nicht gerecht, doch von ihrem Vater in diesem Punkt Fairness zu erwarten, wäre zu viel verlangt gewesen. Über die Enttäuschung, keinen Sohn zu haben, kam ein Mann wie er nie völlig hinweg.
„Nein, du bist wahrlich nicht dumm, meine Gute, dein Mann bekommt eine tüchtige Gefährtin. Aber vertrauensselig bist du, gutgläubig, genau wie deine Mutter es gewesen ist. Wenn jemand, den du gern hast, dir etwas erzählt, dann kaufst du es ihm Wort für Wort ab, und auf die Idee, er könnte ein Rosstäuscher sein, kommst du nicht, denn du hast ihn ja gern. Du hast ja alle und jeden gern.“
„Jeden nicht“, setzte Perdita sich zur Wehr. Algernon Drury kam ihr in den Sinn, den sie ganz und gar nicht gernhatte. „Außerdem frage ich mich, worauf du hinauswillst. Was hat das mit Della zu tun? Dass sie impulsiv ist und über die Konsequenzen ihres Handelns nicht nachdenkt, macht ja keine Lügnerin aus ihr. Im Gegenteil. Manchmal wünschte ich, sie würde ihr Herz nicht so weit vorn auf der Zunge tragen.“
„Perdita“, sagte ihr Vater und straffte den Rücken, wie es Menschen taten, um sich zu erheben. Nur konnte er sich ja nicht mehr erheben. „Ich will, dass du die Griffe von diesem verdammten Stuhl nimmst, mich in den Aufzug stellst und zum Schlafzimmer deiner Schwester schaffst.“
Die Schlafzimmer in den oberen Stockwerken suchte er für gewöhnlich nicht auf. Ein Aufzug war installiert worden, doch seine eigenen Räume hatte Gerald Lascelles in den Südflügel des Erdgeschosses verlegt, um seine Abhängigkeit vom Gesinde gering zu halten und niemandem zur Last zu fallen. Er war ein stolzer Mann, jetzt noch ebenso wie in seinen glorreichen Tagen als Major der Kavallerie.
Perditas Blick flog zum Fenster. Die Nacht war mondlos und schwarz, warf das Licht des Feuers spiegelnd zurück. „Zu Dellas Zimmer? Jetzt? Sie wird schon schlafen.“
„Das eben meine ich“, sagte ihr Vater. „Sie hat dir erzählt, sie geht schlafen, also steht für dich fest, dass sie es tut. Aber so funktioniert die Welt nicht, Dita. Die Welt kann so widerlich sein, dass es einem davor graut, in den Spiegel zu schauen und festzustellen, dass man selbst zum Geschlecht der Menschen gehört. Schieb mich in den Aufzug. Ich habe mir die Sache lange angesehen und versucht, mir einzureden, dass ich mich täusche, aber einmal ist Schluss mit der Augenwischerei. Wir beide werden deiner Schwester jetzt einen Besuch abstatten und nur noch glauben, was wir leibhaftig vor uns sehen.“
Perdita stand auf. Ihre Bewegungen kamen ihr seltsam mechanisch vor. Als wolle etwas sie warnen, ihr raten, zu bleiben, wo sie war. Der Rollstuhl, der sonst leicht über das von den Teppichen ausgesparte Parkett glitt, ließ sich kaum schieben, die Räder sperrten sich wie blockiert.
„Dita?“ Ihr Vater drehte sich erst nach ihr um, als sie im ersten Stockwerk den nach vorn hin offenen Aufzug verließen. Perdita schob seinen Stuhl über den Korridor, der zu den Schlafzimmern führte, ihrem eigenen wie dem von Della. Ein freundliches, luftiges Boudoir, das beiden Schwestern zur Verfügung stand, lag dazwischen. Es war das Zimmer ihrer Mutter gewesen. Hetty Lascelles hatte sich hier gern aufgehalten. Mit ihrem zarten, mädchenhaften Geschmack hatte sie es gestaltet – in Rosenholz, Seide, Elfenbein und dezenter Vergoldung, duftigen Rosa- und Creme-Tönen, blumigen Mustern, frühlingshaft hellem Grün.
Della und Perdita nutzten es wenig. Perdita überfiel darin ein Schmerz, an den sie sich nicht verlieren mochte, und Della betrat den Raum nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ. „Mir läuft’s da eiskalt über den Rücken. Das Licht in den Wandarmen flackert, und bei jedem Geräusch fährt man herum und erwartet, hinter sich jemanden zu sehen.“
Perdita schalt sie dafür. An Geister glaubten ungebildete Massen, die den Kirchenbesuch vernachlässigten und es nicht besser wussten. Die hörten in jedem Pfeifen des Windes im Kaminschacht aus Gräbern auffahrende Tote, sahen in jedem Flimmern des Gaslichts unheimliche Gestalten, weiß gewandete Frauen, bestrebt, Vergeltung für jahrhundertealtes Unrecht zu fordern. Von solchem Humbug durfte sich eine wohlerzogene junge Dame nicht verführen lassen. Della verbrachte zu viel Zeit mit dem Gesinde, stand ständig mit Clarice in Geplauder vertieft und hielt das Mädchen von der Arbeit ab. Eine, die mit Freude lernte, war sie nie gewesen, schon gar nicht in den Naturwissenschaften, die Perdita fasziniert hatten, weil der Kenntnisstand der Menschheit darin ständig voranschritt.
Noch immer konnte sie sich einen verstohlenen Blick auf die wissenschaftlichen Meldungen der Zeitung nicht verkneifen, auch wenn sie als Frau solches Wissen nicht benötigen würde.
Hätte ihre Schwester sich mit physikalischen Gesetzen auseinandergesetzt, so hätte sie sich erklären können, dass solche angeblich übernatürlichen Phänomene nichts Geisterhaftes an sich hatten. Aber still zu sitzen und zu studieren waren nun einmal Dellas Sache nicht. Sie brauchte Beschäftigung. Dringend. Sie brauchte einen Mann.
„Dita.“ Noch immer hielt ihr Vater das Gesicht ihr zugewandt. Im Halbdunkel des Korridors, in dem lediglich ein durch einen Schirm gedämpftes Wandlicht brannte, war sein Ausdruck nicht zu lesen. „Ich muss dich bitten, dein Herz zu wappnen und auf das Schlimmste vorzubereiten.“
Auf das Schlimmste? Flüchtig durchfuhr sie der Gedanke, Della könne gestorben sein wie Tante Mathildas Tochter, die sich im Alter von vierzehn Jahren mit einer leichten Verkühlung zu Bett begeben hatte und am Morgen leblos auf blutig gehusteten Kissen gefunden worden war. Dann atmete sie auf. Woher hätte ihr Vater, der den ganzen Abend in ihrer Gesellschaft verbracht hatte, davon wissen sollen?
An der Tür zu Dellas Zimmer beugte ihr Vater sich im Rollstuhl vor. Perdita erwartete, dass er Dellas Namen rufen und versuchen würde, an die Tür zu klopfen, doch stattdessen hangelte er nach der Klinke. Seine Hand rutschte ab.
„Warte“, sagte Perdita und wollte nach der Klinke greifen. „Della, wir sind es, Vater und Perdi“, rief sie. „Wir wollten uns nur vergewissern, dass es dir gut geht.“
„Mit wem sprichst du?“ Ihr Vater stieß ihre Hand beiseite. „Mit dieser Tür brauchst du dich nicht zu bemühen. Sie ist verschlossen. Fällt dir vielleicht ein Grund ein, warum eine junge Dame in ihrem Heim ihre Tür verschließen sollte?“
„Unsinn, Della verschließt ihre Tür niemals. Ginge es nach ihr, dürfte die halbe Welt in ihr Zimmer stürmen.“ Perdita packte die Klinke, drückte sie nieder und spürte den Widerstand. Ihr Vater hatte recht. Die Tür war verschlossen, Della musste von innen den Riegel vorgeschoben haben.
„Sie wird wirklich müde gewesen sein“, stammelte sie und hörte selbst, wie lahm das klang. „Vermutlich wollte sie sichergehen, dass niemand sie stört.“
„Damit könntest du einen bösen Nagel auf den Kopf treffen.“ Ihr Vater kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. „Aber diesmal hat deine Schwester die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mich hat sie die längste Zeit zum Narren gehalten.“ Aus der Tasche seiner Hausjacke förderte er ein Schlüsselbund zutage, wie es die Haushälterin am Bund ihrer Schürze trug. Es würde ihm nichts nützen. Wenn von innen der Riegel vorlag, waren das uralte, vermutlich verrostete Schloss und sein Schlüssel nutzlos.
Merkwürdig benommen sah Perdita eine Weile lang zu, wie er sich bemühte, jedoch immer wieder abrutschte. Endlich nahm sie ihm den Schlüssel aus der Hand und schob ihn selbst ins Schloss. Ihn herumzudrehen kam ihr sinnlos vor, doch weil ihm daran lag, ließ sie sich darauf ein. Metall knirschte gegen Metall. Als das Schloss mit der nächsten Drehung nachgab, entfuhr ihr vor Verblüffung ein Laut.
Kein Riegel lag vor. Die Tür schwang nach innen auf und gab den Blick auf den im Dunkeln liegenden Raum und die grauen Schemen seiner Möbel frei. Die weiße Tagesdecke, die das mittig stehende Himmelbett bedeckte, war wie eine frisch gefallene Schneeschicht. Unberührt.
Das Zimmer war menschenleer.


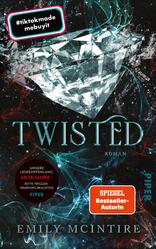
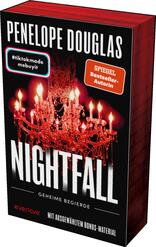










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.