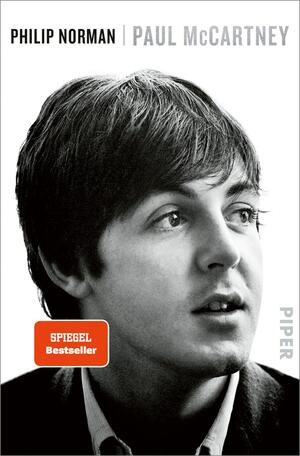
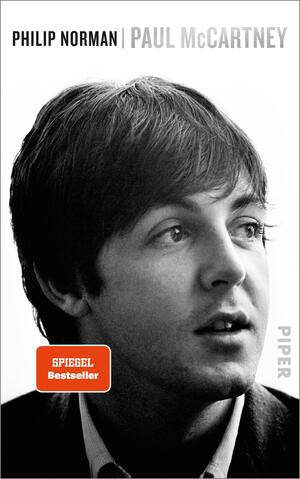
Paul McCartney Paul McCartney - eBook-Ausgabe
„Dem Autor gelingt es dabei, das Image des stets angepassten, niedlichen Beatle zu revidieren und zeigt ihn als komplexen Charakter, der heute noch davon getrieben ist, sich stets beweisen zu wollen.“ - bn Bibliotheksnachrichten
Paul McCartney — Inhalt
Ein halbes Jahrhundert Popgeschichte
Fünf Grammys, elf Mal in den deutschen Album-Top-Ten und Autor von über eintausend Songs – Paul McCartneys Karriere ist von Superlativen geprägt. Der renommierte Rock-Biograf Philip Norman schreibt ein kenntnisreiches Portrait von Pauls schwieriger Beziehung zu John Lennon, der Zeit nach der Auflösung der Beatles und dem Kampf zurück in den Pop-Olymp.
„Gründlicher und kritischer als Philip Norman hat das Leben Paul McCartneys noch niemand erzählt.“ Süddeutsche Zeitung
Er legt mit bisher unveröffentlichten Details und kritischen Erkenntnissen die umfassende Biografie einer der größten musikalischen Legenden unserer Zeit vor – erstmals mit McCartneys Einverständnis und unter Einbezug von Freunden und Familie.
„Normans vielzitierte Biografie porträtiert den ›netten‹ Beatle in all seiner kreativen Komplexität und Bandbreite.“The Guardian
Mit zahlreichen Fotos
Leseprobe zu „Paul McCartney“
Prolog
All Our Yesterdays
Am 4. Dezember 1965 traten die Beatles in der City Hall von Newcastle-on-Tyne auf. Es war, wie sich später herausstellen sollte, ihre letzte Großbritannientournee. Ich war zweiundzwanzig und arbeitete als Reporter für die Redaktion des Northern Echo, einer im Nordosten Englands weitverbreiteten Tageszeitung. Mein Auftrag lautete schlicht: „Geh hin und sieh zu, dass du ein paar Worte mit ihnen wechselst.“
Ohne einen Funken Hoffnung machte ich mich an meine scheinbar aussichtslose Aufgabe. Die Beatles waren seit zwei Jahren das [...]
Prolog
All Our Yesterdays
Am 4. Dezember 1965 traten die Beatles in der City Hall von Newcastle-on-Tyne auf. Es war, wie sich später herausstellen sollte, ihre letzte Großbritannientournee. Ich war zweiundzwanzig und arbeitete als Reporter für die Redaktion des Northern Echo, einer im Nordosten Englands weitverbreiteten Tageszeitung. Mein Auftrag lautete schlicht: „Geh hin und sieh zu, dass du ein paar Worte mit ihnen wechselst.“
Ohne einen Funken Hoffnung machte ich mich an meine scheinbar aussichtslose Aufgabe. Die Beatles waren seit zwei Jahren das Allergrößte in der Popmusik – und sollten zu Giganten werden, wie sie die Welt zuvor nie gekannt hatte. Welche neuen Einsichten sollte ich aus meiner bescheidenen Ausgangslage dazu beisteuern? Und von wegen „Worte wechseln“ – die Tournee folgte direkt auf die Veröffentlichung des Albums Rubber Soul, ihren ungeheuer erfolgreichen zweiten Kinofilm Help!, den geschichtsträchtigen Auftritt vor 55 000 Menschen im New Yorker Shea Stadium und die Verleihung des Ordens Member of the British Empire durch die Königin. Ich würde nicht nur mit den hochkarätigsten Vertretern der Medienlandschaft von ganz Tyneside konkurrieren, sondern auch mit denen sämtlicher nationaler Zeitungen und Sender. Selbst wenn es mir gelingen würde, an die Beatles heranzukommen, warum sollten sie auch nur eine Sekunde mit einem so kleinen Licht vom Northern Echo verschwenden?
Wie fast alle jungen Männer der westlichen Welt damals stellte ich mir vor, wie es wäre, ein Beatle zu sein. Es gab keinen Zweifel daran, mit welchem ich mein Leben hätte tauschen wollen. Paul war ein Jahr älter als ich und sah auf den ersten Blick am besten aus; über John ließ sich das trotz seiner magischen Anziehungskraft nicht behaupten, während George zwar ein hübsches Gesicht hatte, aber unansehnliche Zähne, und Ringo … na ja, Ringo war eben Ringo. Der linkshändige Bassist aber, dessen zarte Gesichtszüge und Rehaugen nur dank eines leichten Bartschattens nicht mädchenhaft wirkten, machte nachvollziehbar, weshalb junge Frauen beim bloßen Anblick der vier schon in Ekstase verfielen.
Paul trug seine Beatle-Kleidung mit der größten Eleganz: die Rollkragenpullover und Button-down-Hemden, die Cordstoffe, die einst Landarbeitern vorbehalten gewesen waren, die schwarzen Lederjacken oder die Stiefel mit dem Gummibandeinsatz an der Seite, die vor langer Zeit bei edwardianischen Lebemännern beliebt gewesen waren. Auch schien er derjenige zu sein, der den (vermeintlich) wachsenden Reichtum der Band am besten zu genießen wusste; ich erinnere mich, wie ich den Klatschspalten des New Musical Expresss neidisch entnahm: „Auf Bestellung von Beatle Paul McCartney – der Aston Martin DB5.“
Dank seines Charmes, seiner guten Laune, seiner tadellosen Manieren und der Gewandtheit, die er ausstrahlte, galt er als der PR-Mann der Band – noch bevor überhaupt jemand wusste, was ein PR-Mann war. Anscheinend war ihm so etwas wie ein sozialer Aufstieg gelungen, was sich auch daran zeigte, dass er mit der eleganten jungen Schauspielerin Jane Asher zusammen war. Trotzdem machten die unbekümmert chaotischen Live-Auftritte der Beatles offensichtlich keinem der drei anderen so viel Spaß wie ihm. Ein Freund von mir, der sie in Portsmouth in der Guildhall gesehen hatte, erzählte mir, gleich in den ersten wilden Minuten des Konzerts habe jemand einen Teddybär auf die Bühne geworfen. Paul habe ihn aufgehoben, am Hals seiner Bassgitarre befestigt und ihn für die gesamte Dauer des Auftritts dort sitzen lassen.
Nun wartete ich also an diesem nasskalten Dezemberabend in Newcastle vor dem Hintereingang der City Hall inmitten einer Gruppe von Reportern, zu denen auch mein Freund David Watts von der Abendausgabe des Northern Echo, dem Northern Despatch, zählte. Fünfundvierzig Minuten vor Auftrittsbeginn fuhr eine schwarze Limousine vor, ein Austin Princess, der durch den dichten Schnee aus Glasgow gekommen war, und heraus sprangen die vier jungen Männer mit den berühmtesten Frisuren der Welt. In diesem Moment nahm uns nur John überhaupt zur Kenntnis, rief uns einen sarkastischen Gruß entgegen. Trotz der Kälte trug er keinen Mantel, nur Jeans und ein weißes T-Shirt, auf dem etwas geschrieben stand – das erste mit einem Schriftzug bedruckte T-Shirt, das ich je sah. Ich konnte den Spruch nicht lesen, war aber davon überzeugt, dass es ebenfalls ein sarkastischer war.
In jener unschuldigen Zeit damals gab es außer einem einzigen, schon etwas älteren Bühnenpförtner keinerlei Sicherheitspersonal. Dave und mir gelang es relativ schnell, ihn zu überreden, uns hereinzulassen, und wenige Minuten später standen wir im Gang vor der – vollkommen unbewachten – Garderobe der Beatles. Ein paar andere Kollegen hatten es ebenfalls bis hierhin geschafft, aber niemand wagte es, an die geschlossene Tür zu klopfen, geschweige denn, einfach hereinzuplatzen. Während wir ein bisschen ratlos herumstanden, signalisierte uns das anwachsende Crescendo der Schreie und stampfenden Füße im angrenzenden Konzertsaal, dass die Zeit für Interviews knapp zu werden drohte.
Plötzlich kam Paul in einem schwarzen Rollkragenpullover, genau wie auf dem Cover von With the Beatles, durch den Gang auf uns zu, wickelte dabei ein Juicy-Fruit-Kaugummi aus. Als er die Tür öffnete, sagte Dave: „Das Gesicht kenne ich doch!“ Und als Paul grinsend innehielt, fragte ich: „Dürfen wir reinkommen und uns mit euch unterhalten?“
„Klar“, erwiderte er mit einem Liverpooler Akzent, der bei ihm auffallend feiner und weicher klang als bei den anderen. Wir konnten unser Glück kaum fassen und folgten ihm.
Eigentlich war es keine Garderobe, sondern ein geräumiger Salon mit grünen Ledersofas, Sesseln und bodentiefen Fenstern, allerdings ohne Aussicht. Die Beatles hatten gerade Steak und Pommes und zum Nachtisch Trifle gegessen, und jetzt räumten flinke Kellnerinnen in schwarzen Kleidern und weißen Schürzen die Teller ab. Andere Frauen waren nicht zu entdecken, ebenso wenig wie Alkohol oder Drogen. Die einzige Ablenkung bot ein Fernseher, auf dem eine Folge The Avengers lief, die aber nur George blass und ungerührt verfolgte.
Ich fing an, mich mit Ringo zu unterhalten, der auf einem der grünen Ledersessel saß, dann schaltete sich John ein, der sich auf die Armlehne hockte. Inzwischen trugen auch sie beide ihre Bühnenkleidung mit schwarzem Rollkragenpullover, und waren erstaunlich freundlich und unkompliziert: Ich hatte das Gefühl, mich mit ebenso gutem Recht dort aufzuhalten wie das hohe Tier vom Melody Maker, das eigens aus London angereist war. Johns Gelassenheit scheint mir jetzt, da ich weiß, unter welchem Druck er zu jener Zeit stand, noch bemerkenswerter. George wendete den Blick nicht vom Fernseher ab, und Paul ging unruhig herum, kaute Kaugummi und suchte jemanden von den Moody Blues, die ebenfalls an diesem Abend auftreten sollten. „Hat jemand die Moodys gesehen?“, fragte er immer wieder. Ich erinnere mich, wie ich seine Jeans anstarrte und mich fragte, ob es sich wirklich, so wie es den Anschein hatte, um eine ganz gewöhnliche handelte oder doch eher um eine Maßanfertigung mit verstärkten Nähten, die sich von ekstatischen Händen nicht so leicht zerreißen lassen würde.
Auf einem Sofa lag der Höfner-Violin-Bass, der mit seinem langen Hals und der an eine Stradivari erinnernden Silhouette zu Pauls Markenzeichen geworden war. Auch ich hatte einst Gitarre gespielt, in einer erfolglosen Band auf der Isle of Wight, und um den Beatles die von mir empfundene Geistesverwandtschaft zu beweisen, fragte ich, ob der Bass auf der Bühne schwer zu tragen sei. „Nein, der ist leicht“, antwortete Paul. „Hier … probier selbst.“ Er nahm ihn und warf ihn mir zu. Ich bin ein sehr schlechter Fänger, aber irgendwie gelang es mir, Griffbrett und Schultergurt zu fassen. Kurz fuhr ich mit den Fingern über dieselben Bundstäbe wie Paul McCartney, schlug dieselben Stahlsaiten an wie er. Dann erkundigte ich mich, ob Violin-Bässe teurer seien als normale. „Hat nur zweiundfünfzig Guineas gekostet“, sagte er. „Ich bin ein Geizhals.“
Auch als ich eine freie Seite in meinem Notizbuch suchte und die drei um ein Autogramm für meine kleine Schwester bat, blieben sie furchtbar nett. „Du bist ihr Lieblings-Beatle“, platzte es aus mir heraus, als Paul seine erstaunlich erwachsen wirkende Unterschrift dazusetzte. „Dann ist ja gut“, murmelte er, „wenn ich ihr Lieblings-Beatle bin.“ Es war die sanfteste Abfuhr überhaupt.
Wie alle Interviewer hatte auch ich das Gefühl, mich besser mit ihnen zu verstehen als alle anderen je zuvor. „Ist es okay, wenn ich noch ein bisschen bleibe?“, fragte ich Paul und sah anschließend John an. „Klar“, nickten beide. Doch in diesem Moment betrat ein hohlwangiger Mann in einem gelben Hemd mit Keulenärmeln den Raum und entdeckte mich. Es war Neil Aspinall, der Roadie der Beatles, dessen Hauptaufgabe unterwegs darin bestand, Journalisten zu sagen, was die liebenswürdigen Fab Four unmöglich selbst sagen konnten. Höchstwahrscheinlich hatten sie ihm per Geheimsignal mitgeteilt, dass ein Besucher allmählich lästig wurde.
„Du“, sagte er und deutete mit dem Daumen über seine Schulter. „Raus!“
„Aber … die haben gesagt, ich darf bleiben“, protestierte ich.
„Und ich sage dir, dass du gehst“, fuhr er mich an, dann entdeckte er eine Zeitung und vergaß, dass ich existierte.
Während ich schmachvoll abzog, tröstete ich mich damit, dass ich eine einzigartige Einsicht gewonnen hatte: Paul McCartney hatte mir seinen Violin-Bass zugeworfen und mir verraten, dass er ein Geizhals war.
Während der gesamten Sechzigerjahre – und während des restlichen Jahrhunderts – kreuzten sich unsere Wege kein einziges Mal mehr. Die Berichterstattung über die Beatles bei der Londoner Sunday Times, für die ich anschließend arbeitete, wurde eifersüchtig von älteren Kollegen überwacht. Daher schrieb ich keine einzige Zeile über das seit dem Ende der Tourneen 1966 immer ambitioniertere Songwriting von Lennon und McCartney, dem schließlich Meisterwerke wie das Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band und überragende „Paul“-Songs wie „Penny Lane“, „Eleanor Rigby“ und „She’s Leaving Home“ entsprangen. Andere – so viele andere – berichteten über die beiden ereignisreichen Jahre nach Brian Epsteins Tod, in denen Paul die Führung der Band übernahm, sie einen Ashram im Himalaya besuchten, der Zeichentrickfilm Yellow Submarine, das „Weiße Album“ und der Film Magical Mystery Tour entstanden und sie ein Unternehmen namens Apple gründeten, das absolut nichts mit Computern zu tun hatte.
Während dieser ganzen Zeit blieb ich einer von unzähligen jungen Männern, die Paul McCartneys Leben für traumhaft hielten und deren Freudinnen bei dessen Anblick demütigenderweise dahinschmolzen (besonders wenn in der Filmsequenz zu „Fool On the Hill“ seine großen braunen Augen in einer extremen Nahaufnahme gezeigt wurden). Es gab bereits Befürchtungen, dass es die Beatles nicht ewig geben würde; auch die Ahnung, dass ihnen ihr gemeinsames Leben vielleicht nicht nur das unglaubliche Glück beschert hatte, das wir ihnen allen unterstellten, und sogar an ihnen Unzufriedenheit und Zweifel nagten. Doch zumindest einer schien für Kontinuität zu stehen. George mochte die indische Religion für sich entdeckt und dabei seinen Sinn für Humor verloren haben; John mochte seine sympathische Frau wegen einer japanischen Performancekünstlerin verlassen und sich mit dieser auf eigenartige Abwege begeben haben. Paul aber blieb bei der wunderbaren Jane Asher, trug seine makellose Beatle-Frisur, die schicksten Anzüge, die es in der Carnaby Street zu kaufen gab, besuchte Theaterpremieren im West End und gab lächelnd Autogramme.
Doch gegen Ende der Sechzigerjahre schien auch sein Pflichtgefühl gegenüber der Öffentlichkeit nachzulassen. Er trennte sich von Asher, die scheinbar in jeder Hinsicht so perfekt zu ihm gepasst hatte, und kam mit einer unbekannten amerikanischen Fotografin namens Linda Eastman zusammen. Als er diese 1969 überraschend heiratete, fühlten sich nicht nur Millionen liebeskranker junger Frauen im Stich gelassen. Auch nicht zu Tränen neigende junge Männer wie ich, die ihn seit 1963 um sein Leben beneidet hatten, fragten sich, was um Himmels willen nur in ihn gefahren war.
Im selben Jahr erhielt ich endlich den Auftrag, einen Beatlesartikel für eine überregionale Zeitschrift zu schreiben, wenn auch keine britische. Die amerikanische Show hatte mich gebeten, einen genaueren Blick auf das Unternehmen Apple zu werfen, das Unsummen an Geld verschlang, und zu prüfen, was an dem Gerücht einer bevorstehenden Trennung der Gruppe dran sein könnte. Ich wandte mich an ihren Pressesprecher Derek Taylor, rechnete aber kaum mit Entgegenkommen, da ich abgesehen von dem Artikel im Northern Echo vor vielen Jahren nichts mehr über die Beatles veröffentlicht hatte. Doch Taylor hatten meine Artikel über andere Themen in der Sunday Times gefallen, besonders der über Charles Atlas, einen Pionier des Bodybuilding, und daher erklärte er sich bereit, mich zu akkreditieren. In jenem Sommer durfte ich mich mehrere Wochen lang in den Londoner Apple-Büros in der Savile Row 3 aufhalten, einem georgianisches Stadthaus und offensichtlich weiterem Beleg für Pauls guten Geschmack.
Außer diesem war damals allerdings kaum noch etwas von ihm spürbar. John und Yoko waren fast täglich dort, leiteten ihre Friedenskampagne von einem Büro im Erdgeschoss aus; George und Ringo schauten ebenfalls regelmäßig vorbei. Von Paul keine Spur. Empört über Johns Entscheidung, Allen Klein als Manager der Beatles zu verpflichten, war er gemeinsam mit Linda auf seiner Farm in Schottland abgetaucht, um an seinem ersten Soloalbum zu arbeiten. Obwohl es mir damals nicht bewusst war, bekam ich Gelegenheit, die Trennung der Beatles von einem Logenplatz aus zu verfolgen.
Wenige Monate nach dem verkaterten Erwachen, das wir später als „die Siebziger“ bezeichneten, erhielt ich einen Anruf von Tony Brainsby, einem freiberuflichen Journalisten, der für seine Überheblichkeit und grellroten Haare bekannt war. Inzwischen vertrat er den Solokünstler Paul McCartney, der gerade dabei war, eine neue Band mit dem Namen Wings zusammenzustellen, und er fragte mich, ob ich Paul für die Sunday Times interviewen wolle. Ohne zweimal darüber nachzudenken, lehnte ich ab. Damals und noch viele Jahre lang hielt man die Beatles für unermesslich größer als ihre einzelnen Mitglieder. Von Interesse wäre einzig und allein ihre Wiedervereinigung gewesen.
Stattdessen interviewte ich zahlreiche andere große Namen des Rock, Country und Blues für das Sunday Times Magazine – Mick Jagger, Bob Dylan, Eric Clapton, die Beach Boys, David Bowie, Bob Marley, Elton John, James Brown, Stevie Wonder, Johnny Cash, Rod Stewart, B. B. King, die Everly Brothers, Diana Ross, Little Richard, Fats Domino, Fleetwood Mac, Aretha Franklin, Bill Haley – ein Gespräch mit Paul wurde mir nie wieder angeboten, und ich bemühte mich auch nie um eines. Wie die meisten Journalisten nahm ich es ihm übel, dass er es gewagt hatte, eine neue Band zu gründen – und zu allem Überfluss John durch Linda zu ersetzen –; ich war fest entschlossen, ihn nicht zu unterstützen. Als erster Rockkritiker der Times (der Tageszeitung, nicht mehr der Sonntagsausgabe) hätte ich jederzeit Gelegenheit gehabt, mich anlässlich der Veröffentlichung eines der frühen Wings-Alben mit ihm zu unterhalten, aber ich tat es nicht. Allerdings musste ich 1973 einräumen, dass ihm mit Band on the Run ein triumphales Album gelungen war, auch wenn einige der Reime („and the county judge / held a grudge …“) aus der Feder des Schöpfers von „Penny Lane“ eher schwach wirkten.
Ansonsten schloss ich mich der allgemein verbreiteten Ansicht an, dass Paul McCartney sich in ein selbstgefälliges Leichtgewicht verwandelt habe, und trauerte seiner verlorenen Beatle-Magie nach. Kurz nach der Veröffentlichung von „Mull of Kintyre“ schrieb ich ein satirisches Gedicht über ihn im Sunday Times Magazine, dessen letzte Strophe heute entsetzlich geschmacklos wirkt:
Oh, deified scouse with unmusical spouse
For the cliches and cloy you unload
To an anodyne tune may they bury you soon
In the middlemost midst of the road
(Oh, vergötterter Liverpooler mit unmusikalischer Ehefrau
möge man dich wegen der Klischees und des Kitsches
die du zu seichten Melodien absonderst,
bald begraben, möglichst mittig in der Straßenmitte)
Hatte jemals jemand unwiderruflicher alle Brücken hinter sich eingerissen?
Aufgrund eines Arbeitskampfs stellte die Sunday Times 1979 ein Jahr lang ihr Erscheinen ein, und ich beschloss, eine Biografie über die Beatles zu verfassen. Kollegen und Freunde drängten mich, meine Zeit nicht mit diesem Thema zu verschwenden; schon damals waren mehrere Milliarden Wörter über sie geschrieben und gesprochen worden; alles, was es zu wissen gab, musste längst bekannt sein.
Ich schrieb die ehemaligen Beatles an und bat um Interviews, bekam aber, vermittelt durch den jeweiligen Pressesprecher, von allen vier dieselbe abschlägige Antwort: Sie hätten kein Interesse daran, in der Vergangenheit zu wühlen, ihre Solokarrieren seien ihnen wichtiger. Tatsächlich – das hatten wir damals noch nicht begriffen – wollten sie immer noch nicht wahrhaben, was sie in den Sechzigerjahren Ungeheuerliches gemeinsam erlebt hatten. Pauls Ablehnung, über Tony Brainsby vermittelt, mochte außerdem durch meine kürzlich im Sunday Times Magazine erschienenen Verse nicht unerheblich beeinflusst worden sein. Meine Telefonate mit Brainsby gestalteten sich zunehmend angespannter, bis er schließlich eines Tages schrie: „Philip … du kannst mich mal!“ Und den Hörer aufknallte.
Ende November 1980 gab ich mein Buch Shout! beim Verlag ab, nur zwei Wochen bevor John in New York ermordet wurde. Nachdem er fünf Jahre lang dem Musikgeschäft den Rücken gekehrt hatte, war mit Double Fantasy ein neues Album erschienen, und er gab ausführliche Interviews. Das Ende von Shout! hatte ich offengelassen, falls er sich doch noch bereiterklären würde, für ein Nachwort mit mir zu sprechen.
Und tatsächlich sollte ich sein Apartment im Dakota Building besuchen – nur nicht so, wie ich gehofft hatte. Als das Buch nach Johns Tod im darauffolgenden Frühjahr in Amerika erschien, reiste ich nach New York, um in der Fernsehsendung Good Morning America darüber zu sprechen. Während des Interviews sagte ich, John sei meiner Meinung nach nicht ein, sondern drei Viertel der Beatles gewesen. Yoko sah die Sendung und rief mich in den ABC-Studios an, um mir zu sagen, dass sie meine Worte „sehr nett“ gefunden habe. „Vielleicht haben Sie Lust, sich anzusehen, wo wir gewohnt haben“, setzte sie hinzu.
Am selben Nachmittag befand ich mich im Dakota Building und ließ mich durch das riesige weiße Apartment im siebten Stock führen, wo John sich um den gemeinsamen Sohn Sean gekümmert hatte, während Yoko sich eher der gemeinsamen Finanzen angenommen hatte. Später saß sie in ihrem Büro im Erdgeschoss auf einem Stuhl, der dem Thron eines ägyptischen Pharaos glich, und sprach ausführlich über Johns Phobien und Unsicherheiten und die Verbitterung gegenüber seinen alten Bandkollegen, besonders demjenigen, mit dem zusammen er das großartigste Songwriterteam der Popgeschichte gebildet hatte.
Wie so häufig an Hinterbliebenen zu beobachten, schien ein Teil des verlorenen Partners in sie übergegangen zu sein; während ich Yoko lauschte, hatte ich das Gefühl, John aus ihr heraus sprechen zu hören. Und bei jeder Erwähnung Pauls wirkte ihr Gesicht unterkühlt und ausdruckslos. „John hat immer gesagt“, erklärte sie mir einmal, „dass ihn nie jemand so sehr verletzt habe wie Paul.“
Ihre Worte ließen auf eine sehr viel tiefere emotionale Verbundenheit der beiden schließen, als die Welt je vermutet hatte – es waren die Worte eines verschmähten Liebenden –, und natürlich zitierte ich sie in meinem Bericht über den Besuch bei ihr, den ich anschließend für die Sunday Times schrieb. Irgendwann nach dessen Erscheinen sagte meine Freundin eines Abends, als ich nach Hause kam: „Paul hat angerufen.“ Sie erklärte, er habe wissen wollen, was Yoko gemeint habe, und sei eher bestürzt als sauer gewesen. Es war wie bei John: Zwar wurde mir schließlich doch Zugang gewährt, aber viel zu spät und auf eine Weise, mit der ich niemals gerechnet hätte. Trotzdem glaubte ich zu jenem Zeitpunkt aufrichtig, ich hätte mein letztes Wort über die Beatles und ihre Epoche geschrieben. Also versuchte ich nicht, eine offizielle Stellungnahme zu Yokos Behauptung zu bekommen, und hörte später auch nichts mehr darüber.
Shout! wurde vor allem wegen seiner übertriebenen Verherrlichung Lennons und seiner Voreingenommenheit gegenüber McCartney kritisiert, unter anderem von Sir Tim Rice, dem Musical- und Filmmusiktexter. Ich erwiderte, ich sei nicht ›anti Paul‹, sondern hätte lediglich versucht, den Menschen hinter der charmanten, stets lächelnden Fassade zu zeigen. Tatsächlich aber hatte ich, wenn ich ehrlich bin, nach all den Jahren, in denen ich mir gewünscht hatte, wie er zu sein, seltsamerweise das Bedürfnis verspürt, es ihm heimzuzahlen. Die Behauptung beispielsweise, John sei drei Viertel der Beatles gewesen, war völlig „irrsinnig“ (wie Tim Rice erläutert hatte). Paul selbst fand das Buch furchtbar, hörte ich, und habe es als „Mist“ bezeichnet.
Aber zum Schluss staunten all seine Kritiker. Die Wings feierten riesige Charterfolge und waren live eine ebenso große Attraktion, wie es die Beatles gewesen waren. Durch kluges Management und Investitionen in Musikrechte (wobei allerdings die Rechte an den bekanntesten seiner eigenen Stücken in den Besitz anderer übergegangen waren) verfügt er heute über ein sehr viel größeres Vermögen als die anderen Beatles, deren Erben oder andere Kollegen aus der Branche – die Schätzungen reichen bis zu einer knappen Milliarde Pfund.
Anhaltende Gerüchte über seinen angeblichen Geiz (hatte er es mir nicht 1965 gestanden?) verstummten, als er immer öfter bei Wohltätigkeitskonzerten zu sehen war, eine Akademie für darstellende Künste ins Leben rief und dort im Gebäude seiner alten Schule in Liverpool Nachwuchsförderung betrieb.
Seine Ehe mit Linda, die Ende der Sechzigerjahre als katastrophaler Fehlgriff galt, sollte schließlich als eine der glücklichsten und stabilsten in die Popgeschichte eingehen. Trotz seines unglaublichen Ruhms und Reichtums gelang es dem Paar, ein relativ normales Privatleben zu führen und ihre Kinder vor dem Schicksal verwöhnter und verkorkster Rockstar-Gören zu bewahren. Auch wenn die Öffentlichkeit nie ein wirklich herzliches Verhältnis zu Linda entwickelte, was hauptsächlich an ihrem militanten Eintreten für eine vegetarische Ernährungsweise und den Tierschutz gelegen haben mag, so akzeptierte man doch endlich, dass sie die Richtige für ihn war, ebenso wie Yoko für John.
Nicht nur in der Popmusik, sondern auch der kreativen Welt insgesamt schien er alles Menschenmögliche erreicht zu haben: Sein klassisches Oratorium wurde in der Liverpool Cathedral aufgeführt und von Symphonieorchestern auf der ganzen Welt ins Repertoire aufgenommen; seine Gemälde wurden in der Royal Academy ausgestellt; seine gesammelten Gedichte als Hardcoverausgabe veröffentlicht, wodurch es prompt zu Spekulationen über seine Ernennung zum Poet Laureate des Vereinigten Königreichs kam. 1997 setzte man sich über die lange Reihe seiner Drogenvergehen (die ihm unter anderem neun Tage Haft in Japan eingebracht hatten) hinweg, und er wurde für seine Verdienste in der Musik zum Ritter geschlagen. Tatsächlich hatte er, wie es im Rolling Stone hieß, „sehr viel weniger Mist gebaut als alle anderen Rockstars“.
Doch mit Ende fünfzig geriet sein Leben aus den Fugen. Nach langem Kampf gegen den Brustkrebs starb Linda 1998. Vier Jahre später heiratete er das ehemalige Fotomodell Heather Mills, eine kämpferische Wohltätigkeitsaktivistin, offensichtlich sehr zum Entsetzen seiner Kinder; sechs Jahre nach der Heirat ließen sich die beiden scheiden und lieferten sich, vermittelt durch die Boulevardpresse, eine Schlammschlacht, die alles selbst in der Popwelt bisher Dagewesene an Abscheulichkeit noch übertraf. Zum ersten Mal war es ein gutes Gefühl, nicht Paul McCartney zu sein.
Seit Yoko mich nach Johns Tod ins Dakota Building eingeladen hatte, durfte ich noch mehrere Exklusivinterviews mit ihr führen. 2003 trafen wir uns in Paris, und sie erklärte sich bereit, mich bei einer ersten umfassenden Lennon-Biografie zu unterstützen. Selbst ohne meine belastende Vorgeschichte mit McCartney hätte ich nicht mit Input von ihm gerechnet. Trotz öffentlicher Solidaritätsbekundungen herrschte zwischen ihm und Johns Witwe noch immer Eiszeit, wenn es um Themen wie die Reihenfolge der Urhebernamen bei den Lennon-McCartney-Songs oder Lennons Tantiemen an Pauls „Yesterday“ ging. Wenn ich Yoko auf meiner Seite hatte, musste dies sicherlich bedeuten, dass er gegen mich war.
Dennoch hielt ich es für zumindest anständig, ihm über seinen damaligen Pressesprecher Geoff Baker eine Nachricht zukommen zu lassen und ihm mitzuteilen, dass ich eine Biografie über John schreiben wolle und sie keinesfalls „anti McCartney“ ausfallen würde. Zwei Wochen später klingelte das Telefon in meinem Büro, und eine bekannte Stimme sagte mit Liverpooler Akzent: „Hallo … hier ist Paul.“ Ich wünschte, ich hätte den Mumm besessen zu fragen: „Welcher Paul?“
Mein erstauntes Schweigen schien ihm ein leises Schmunzeln zu entlocken. „Sie hätten wohl nicht geglaubt, jemals von mir zu hören, oder?“
Er meinte, er rufe aus Neugierde an, wolle wissen, „wie dieser Typ so ist, der mich anscheinend nicht ausstehen kann“. Schließlich unterhielten wir uns ungefähr fünfzehn Minuten lang, aber es war kein Gespräch zwischen einem Journalisten und dem größten Popstar der Welt. Ich hoffte nicht, dass er mir bei meiner Lennon-Biografie helfen würde, wandte also nichts von der Hinterlist an, mit der Journalisten Prominenten Zitate entlocken. Ich redete auf Augenhöhe mit ihm, ohne Ehrerbietung, aber mit wachsendem Respekt. Megastars müssen Unangenehmes oder Schwieriges nicht selbst erledigen, wenn sie nicht wollen, und trotzdem hatte er höchstpersönlich zum Hörer gegriffen.
Als ich sagte, ich würde nicht davon ausgehen, dass er mir ein Interview für mein Lennon-Buch geben würde, widersprach er nicht. „Am Ende sieht es so aus, als wollte ich dich dafür belohnen, dass du schlecht über mich schreibst.“ Allerdings gebe es bestimmte Fragen, die nur er beantworten könne, sagte ich, ob er dies zumindest per E-Mail tun wolle?
„Okay“, antwortete er.
Wie ich seit 1965 in der Garderobe der Newcastle City Hall wusste, bedeutete das „Ja“ eines Beatle nicht immer ein Ja. In diesem Fall aber doch. Ich mailte Pauls Assistentin Holly Dearden meine Fragen, und prompt kamen die diktierten Antworten zurück, von der Länge her variierend zwischen einem halben Dutzend Wörtern bis zu mehreren Hundert.
Mit einigen klärte er ganz entscheidende Fragen bezüglich der Anfangsjahre der Beatles. So wurde behauptet, er sei in Hamburg der einzige Augenzeuge gewesen, als der betrunkene John im Pillenrausch dem Bassisten Stu Sutcliffe einen Tritt an den Kopf verpasst habe, was als möglicher Auslöser seiner späteren tödlichen Hirnblutungen galt. Nein, an einen solchen Vorfall könne er sich nicht erinnern. Andere, weniger aufsehenerregende Fragen waren nicht weniger aufschlussreich. Ob es stimme, fragte ich, dass der Linkshänder Paul, als sie anfingen, gemeinsam Songs zu schreiben, Johns Rechtshändergitarre spielen konnte und umgekehrt? Wenn das zutraf, dann war dies das perfekte Sinnbild für die kreative Symbiose der beiden ansonsten vollkommen unterschiedlichen Charaktere, die auf diese Weise in der Lage waren, einen Song zu Ende zu schreiben, den der andere begonnen hatte.
Das stimme, erwiderte er.
Im Juni 2012 sah ich den Auftritt des inzwischen siebzigjährigen Sir Paul als Headliner im Buckingham Palace anlässlich des diamantenen Thronjubiläums der Königin neben anderen in den Adelsstand erhobenen Popmusikern wie Sir Elton John, Sir Cliff Richard und Sir Tom Jones. Er trug eine dunkelblaue Militärjacke, eine sachlich-schlichte Version des Sergeant-Pepper-Kostüms, und spielte immer noch seinen „geizig“ erstandenen Höfner-Violin-Bass. Johns „Imagine“ mochte der inzwischen weltweit beliebteste nichtreligiöse Choral sein, aber Pauls „Hey Jude“ war inzwischen so etwas wie eine alternative Nationalhymne geworden. Zwei Monate später, erneut in Anwesenheit der Königin, bestritt er mit „Hey Jude“ das Finale der 27 Millionen Pfund teuren Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London. Abgesehen von der funkelnden kleinen Frau in der königlichen Loge gab es kein anderes Nationalheiligtum, das die Briten der Welt lieber präsentiert hätten.
In einem solchen Ausmaß verehrt und geliebt zu werden bringt allerdings auch etwas mit sich, das man als Fluch der Vergangenheit bezeichnen könnte. Die Trennung der Beatles liegt jetzt mehr Jahre zurück, als John Lennon überhaupt lebte, ihre aktive Zeit entspricht gerade mal einem Fünftel von McCartneys Biografie. Doch all seine Soloerfolge haben nichts an der allgemeinen Ansicht geändert, dass er sich künstlerisch mit Anfang zwanzig, als John ihm noch über die Schulter schaute, auf dem Höhepunkt befand; und dass es niemals wieder einen Paul-McCartney-Song geben würde, der an „Yesterday“, „Penny Lane“ oder auch nur „When I’m Sixty-Four“ herankommen würde.
Viele Geringere, die in dem von Lennon und McCartney ausgelösten Songwriting-Boom zu Ruhm und Ehren kamen, sind damit zufrieden, sich im Glanz vergangener Hits zu sonnen – nicht aber McCartney. Obwohl die Liste seiner Songs ungefähr den Werken Shakespeares in der Popmusik entspricht, verspürt er, wie ein blutiger Anfänger, noch immer den Drang, sich stets aufs Neue zu beweisen. Bewunderung zu erfahren hat auf ihn – ähnlich wie auf so viele Größen des Rock wie Mick Jagger oder Elton John – eine Wirkung wie chinesisches Essen: Hinterher hat man immer Appetit auf mehr. An dem Tag, an dem er mich anrief, erwähnte er, dass er „wieder in der Abbey Road“ aufnehme. Bis heute ist kein Ende der Welttournee in Sicht, auf der er sich seit mehr als fünfzehn Jahren befindet.
Die Dutzende von Büchern, die über ihn verfasst wurden, konzentrieren sich fast alle auf seine Rolle in der Geschichte der Beatles – die deren Pressesprecher Derek Taylor völlig zu Recht als eine der „größten Romanzen des zwanzigsten Jahrhunderts“ bezeichnet hat – und behandeln die darauffolgenden Jahrzehnte lediglich als Nachsatz. Auch McCartneys offizielle Biografie, Many Years from Now, verfasst von Barry Miles, folgt demselben Muster, widmet nur etwa zwanzig von insgesamt sechshundert Seiten der Zeit nach den Beatles und endet 1997, ein Jahr vor Lindas Tod.
Bislang gab es keine umfassende Biografie des größten lebenden Repräsentanten und gleichzeitig größten Nonkonformisten der Popmusik. Trotz der vielen Millionen Wörter, die über ihn geschrieben wurden, vor, während und nach den Beatles, bleiben seltsam viele Fragen offen. Der scheinbar zugänglichste aller Mega-Prominenten ist tatsächlich nur schwer zu fassen. Mithilfe seiner scheinbaren „Normalität“ und „Alltäglichkeit“ hat er ein Bollwerk der Privatheit um sich herum erschaffen wie sonst nur Bob Dylan. Hin und wieder gelingt es uns, hinter dem ewigen Mr Nice Guy jemanden zu entdecken, der trotz aller Preise und Auszeichnungen noch in der Lage ist, so etwas wie Frustration zu empfinden, ja sogar Unsicherheit – jemanden, der innerlich, wie wir auch, mit Zweifeln zu kämpfen hat. Größtenteils aber bleibt diese Seite an ihm hinter dem Lächeln und den fröhlich erhobenen Daumen verborgen.
Ende 2012 schrieb ich McCartney einen Brief zu Händen seines Pressesprechers Stuart Bell, in dem ich ihm mitteilte, dass ich ergänzend zu dem Band John Lennon: The Life nun auch seine Biografie zu schreiben plane. Ich ging nicht davon aus, dass er direkt mit mir sprechen wollte, denn warum sollte er die ganze Beatles-Geschichte noch einmal durchkauen? Doch vielleicht würde er mir sein Einverständnis signalisieren, damit ich ihm Nahestehende interviewen konnte, an die ich sonst niemals herankommen würde. Ich räumte ein, dass ich vielleicht der Letzte sei, den er sich als seinen Biografen wünsche, fügte aber auch hinzu, das Lennon-Buch habe hoffentlich meine alles andere als faire Darstellung seiner Person in Shout! wieder geradegerückt. Bell erklärte sich bereit, meine Bitte weiterzuleiten, warnte mich aber, dass die Antwort auf sich warten lassen könne, da McCartney sich auf Tournee in Amerika befinde. Aha, dachte ich, er will mir ausweichen …
Wenige Wochen später erhielt ich eine Antwort:
Lieber Philip,
danke für die Nachricht. Ich gebe gerne mein Einverständnis,
und vielleicht wird Stuart Bell helfen können.
Mit schönen Grüßen,
Paul
Es war die größte Überraschung meiner gesamten beruflichen Laufbahn.
Teil Eins
Stairway to Paradise
1
„Hey Mister, für ’n Pfund zeig ich Ihnen das Haus von Paul McCartney“
Der hellblaue Minibus, der am Liverpooler Albert Dock startet, verspricht „die einzige Führung durch die Häuser, in denen Lennon und McCartney aufwuchsen“. Auf der Tür sind zwei gezeichnete Gesichter zu sehen, kaum mehr als Umrisse, und trotzdem sind sie, ebenso wie Mickey Mouse, in aller Welt auf Anhieb zu erkennen.
Viele Jahre lang scheute man sich in Liverpool davor, Kapital aus den berühmtesten Söhnen der Stadt zu schlagen. Inzwischen ist das anders. Das Museum The Beatles Story am Albert Dock arbeitet die gesamte Saga so realistisch auf, dass man fast glauben könnte, dabei gewesen zu sein. Die Mathew Street, jetzt umbenannt in „The Cavern Quarter“, ist ein lebendiger Boulevard aus Souvenirshops, thematisch passend eingerichteten Bars und einem nachgebauten Cavern nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der sich das Original befand. Das luxuriöse Hard Day’s Night Hotel in der North John Street verfügt sowohl über eine John-Lennon- als auch eine Paul-McCartney-Suite, eine Übernachtung dort kostet um die 800 Pfund pro Nacht, und beide sind auf Monate im Voraus ausgebucht.
Außerdem gibt es ein breites Angebot an „Magical Mystery Tours“ zu den wichtigsten Beatles-relevanten Wahrzeichen der Stadt – den Pier Head, die St George’s Hall, Lime Street Station, das Empire Theatre –, anschließend geht es raus in die Vororte, wo sich die bedeutendsten Heiligtümer finden.
Die Tour im hellblauen Minibus unterscheidet sich insofern von den anderen, als sie vom National Trust angeboten wird, einer Organisation, die sich normalerweise dem Erhalt und der Restaurierung alter hochherrschaftlicher Anwesen in Großbritannien verschrieben hat. Die beiden Häuser, die wir jetzt ansteuern, sind weder wirklich alt noch hochherrschaftlich, ziehen aber auf die Quadratmeterzahl umgerechnet ebenso viele zahlende Besucher an wie die Tudorpaläste und palladianischen Herrenhäuser des achtzehnten Jahrhunderts, die sich sonst in der Obhut des Trust befinden.
Ausnahmsweise war hier die gängige Reihenfolge einmal umgekehrt. Der National Trust erstand zuerst Pauls Haus in der Forthlin Road 20 in Allerton, wo Lennon und McCartney anfingen, gemeinsam Songs zu schreiben, und machte es 1996 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Einige Jahre lang war man daraufhin noch der Ansicht, dass die Menlove Avenue 251 in Woolton, wo John aufwuchs, nicht als nationales Monument gelten könne, weil sich nicht beweisen ließ, dass ein bestimmtes Beatles-Stück dort komponiert worden war (obwohl Paul und John häufig im Windfang vor der Eingangstür geprobt hatten). 2002 kaufte Johns Witwe Yoko Ono schließlich das Haus, schenkte es dem National Trust und stiftete eine Geldsumme für die Instandsetzung und den Unterhalt.
An diesem Sonntagvormittag sitzen, wie zu erwarten, Vertreter aller Nationalitäten und Altersstufen in dem hellblauen Minibus. Eine Gruppe von vier Personen stammt aus dem französisch-kanadischen Montreal und wird angeführt von dem Rundfunkredakteur Pierre Roy, eine „Paul“-Person bis in die manikürten Fingerspitzen hinein: „Ich bin Zwilling wie er, Linkshänder, und meine erste Freundin hieß Linda.“
Zwei junge Frauen Mitte zwanzig kommen jeweils aus Dublin und Teesside (wobei Letztere eher beschämt gesteht, George lieber zu mögen). Bernard und Margaret Sciambarella, ein Ehepaar Mitte vierzig, sind von der anderen Seite des Mersey, aus Wirral in Cheshire herübergekommen und haben ihre einundzwanzigjährige Tochter dabei, eine Studentin. Obwohl sie eingefleischte Beatles-Fans sind, haben sie die Tour bislang erst einmal mitgemacht. „Ist doch immer so, wenn man was direkt vor der Tür hat, oder?“, sagt Margaret.
Wir fahren durch das neu mit Leben erfüllte Hafengebiet, vorbei am alten, von Espressobars und Boutiquen gesäumten Hafenbecken; auf der anderen Seite werden viktorianische Industriegebäude in begehrte Wohnhäuser mit Flussblick verwandelt. An der Ecke zur James Street befindet sich die Zentrale der White Star Reederei, wo 1912 ein Mitarbeiter der fassungslosen Menge unten die Namen der auf der Titanic Ertrunkenen bekannt gab – über ein Megafon.
Wie sich herausstellt, ist die moderne Technologie nicht gerade zuverlässiger. „Liebe Leute, es tut mir leid …“, meldet sich unser Fahrer gleich zu Beginn zu Wort. „Der Bus ist gerade erst aus der Werkstatt gekommen und der CD-Player noch nicht angeschlossen. Das heißt, wir können leider auf unserer Rundfahrt nicht die passende Musik hören.“
Wir treten unsere Reise also in Stille an: Sie führt uns durch das als kriminell verschriene Toxteth, vorbei an dem prächtigen schmiedeeisernen Tor von Sefton Park, die Smithdown Road hinunter, wo Pauls Mutter zur Krankenschwester ausgebildet wurde. Wir biegen links ab in den Queen’s Drive, vorbei am früheren Wohnhaus der Familie Epstein, bei dem schändlicherweise bis heute noch niemand auf die Idee gekommen ist, es für die Nation erhalten zu wollen.
„Achtung, Leute“, sagt unser Fahrer, „wir kommen jetzt an einen Ort, den ihr alle kennt. Tut mir leid, dass wir euch ›Penny Lane‹ nicht vorspielen können.“
Aber das stört niemanden. In der kollektiven Erinnerung ertönt der Song ohnehin lauter und deutlicher als mithilfe der besten Stereoanlage. „Penny Lane is in our ears and in our eyes“, auch wenn die „blue suburban skies“ an diesem Vormittag eher wischmoppgrau sind.
Pauls Meisterwerk wurde zusammen mit Johns nicht weniger genialem Song „Strawberry Fields Forever“ veröffentlicht, was die bis heute wahrscheinlich großartigste Popsingle aller Zeiten ergab. Tatsächlich konkurriert die Penny Lane auch mit dem alten Heim der Heilsarmee, „Strawberry Field“, um den Rang der meistbesuchten Beatles-Stätte. Die Straßenschilder hier wurden im Laufe der Jahre so häufig gestohlen, dass die Behörden schließlich dazu übergingen, den Namen einfach auf die Gebäudewände zu schreiben. Erst kürzlich entpuppte sich ein neues, angeblich diebstahlsicheres Schild als nicht viel widerstandsfähiger als seine Vorgänger.
Als Songtitel hatte der Name einen wunderbar süßen Klang, ließ an das unschuldige England der fünfziger Jahre denken, als noch große Kupfermünzen kursierten, die häufig bis in die Amtszeit von Queen Victoria zurückreichten, Süßwarenhändler Schokoriegel oder „Happen“ für einen Penny feilboten und Frauen nicht pinkeln gingen, sondern „einen Penny ausgaben“, denn so viel kostete die Benutzung einer öffentlichen Toilette. In Wirklichkeit wurde die Straße aber zu Ehren von James Penny so benannt, einem Liverpooler Sklavenhändler aus dem achtzehnten Jahrhundert. Auch handelt der Song eigentlich nicht von der Penny Lane (mit der John eigentlich mehr zu tun hatte als Paul), sondern von Smithdown Place, auf den sie mündet und wo sich eine Reihe von Geschäften sowie die Haltestellen mehrerer Buslinien befinden.
Jedes einzelne im Text aufgeführte Wahrzeichen ist noch da, löst bei uns allen unvermeidlich einen mentalen Soundtrack mit nostalgischem Klavier und den trippelnden Tönen einer Bachtrompete aus. Da ist noch immer der Friseur, „showing photographs of every head he’s had the pleasure to know“, auch wenn dort kaum noch ein „Tony Curtis“ oder ein „Duck’s Arse“ verlangt wird und der Laden nicht mehr wie in Pauls Jugend Bioletti heißt, sondern Tony Slavin. An diesem Platz befindet sich eine Filiale von Lloyds TSB, wobei der dort zuständige „Banker“ möglicherweise gar keinen „Mac“ (damals noch ein Regenmantel, kein Laptop) besitzt und heute durchaus hinter seinem Rücken über ihn gelacht wird.
Hier befindet sich auch das Wartehäuschen auf der Verkehrsinsel, in dem vielleicht wirklich eine hübsche Krankenschwester Mohnblumen von einem Tablett verkauft – „poppies from a tray“ (und wir alle wissen, wer sie ist). Links an der Mather Avenue ist auch noch immer die Feuerwehrstation, wo auch jetzt noch ein behelmter Feuerwehrmann zusieht, wie die Zeit verstreicht und den Wagen poliert … „in his pocket … a portrait of the Queen“.
Die Häuser, in denen Paul und John aufgewachsen sind, liegen weniger als eine Meile voneinander entfernt, aber in verschiedenen Vororten, deren soziale Unterschiede noch immer sehr deutlich zu erkennen sind. Allerton besteht zumindest auf dieser Seite vorrangig aus Arbeitersiedlungen, während Woolton eine wohlhabende Enklave von Unternehmern und Akademikern der Liverpool University ist. Als John und Paul sich 1957 zum ersten Mal begegneten, war dies noch tausendmal stärker spürbar.
Nach dem McCartney-Prolog kehren wir im hellblauen Minibus schnell wieder zur gewohnten Rangfolge zurück. „Mendips“, die Doppelhaushälfte, in der John, der vermeintliche „working-class hero“, unter der Aufsicht seiner strengen Tante Mimi eine eher behütete, für die Mittelschicht typische Kindheit verlebte, ist die erste Station.
Erst knapp eine Stunde später verlassen wir die breiten grünen Straßen von Woolton, fahren die Mather Avenue entlang und halten schließlich vor der Forthlin Road 20. Ein weiterer, identischer Minibus wartet bereits, um die Gruppe vor uns abzuholen, die uns gerade durch den winzigen Vorgarten entgegenkommt. Aus dem angeregten Stimmengewirr lassen sich französische, spanische und russische, vielleicht auch polnische Satzfetzen heraushören. „Well, she was just seventeen …“, singt ein Mann mit niederländischem Akzent. „You know what I mean …“, erwidert ein internationaler Chor.
Für moderne britische Ohren klingt die Bezeichnung „council house“ nach den unteren Gesellschaftsschichten, doch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichten diese von den Behörden erbauten und bezuschussten Unterkünfte Familien einen wunderbaren Aufstieg aus den überfüllten und unhygienischen Slums.
Die Forthlin Road 20 ist ein klassisches Beispiel für ein solches „council house“: Ein zweistöckiges Reihenhaus, die Fassade schlicht und schmucklos (was in den Fünfzigerjahren als ultramodern galt), dazu ein großes Fenster im Erdgeschoss, zwei kleine Fenster oben und eine Eingangstür mit Glaseinsatz unter dem flachen Vordach. Obwohl es sich um ein nationales Denkmal handelt, ist an der Hauswand keine blaue Gedenktafel angebracht, wie sie der English Heritage Trust normalerweise an einst von historisch bedeutenden Figuren bewohnten Häusern anbringen lässt, denn die Voraussetzung dafür ist, dass der Betreffende entweder hundert Jahre alt oder mindestens zehn Jahre tot ist.
Wie auch in „Mendips“ wohnt hier jemand, der auf das Haus achtgibt und gleichzeitig als Fremdenführer fungiert. Meist handelt es sich dabei um engagierte Fans, die es paradiesisch finden, in Johns oder Pauls altem Zuhause leben zu dürfen, das jeweils möglichst originalgetreu in den Zustand gebracht wurde, in dem es sich in den Fünfzigerjahren befunden hatte. Einige Jahre lang wohnte in der Forthlin Road 20 ein Mann, der Paul von seinen Gesichtszügen her tatsächlich beinahe unheimlich ähnlich sah, verwirrenderweise aber John hieß.
Heute führt uns eine mütterlich wirkende Frau mit hellem lockigem Haar herum, die sich selbst als Sally vorstellt und uns anschließend taktvoll Taschen und Kameras abnimmt, wobei sie verspricht, diese sicher aufzubewahren: „Genau dort, wo auch die McCartneys ihre Hüte und Mäntel aufgehängt haben.“
Als der National Trust das Haus gekauft hatte, bat Paul nur darum, es nicht ausschließlich als Kultstätte der Beatles wiederherzurichten, sondern auch in Erinnerung an eine Familie. „Und anfangs“, erinnert uns Sally, „war dies ja ein sehr trauriger Ort für ihn.“ Über der Eingangstür in dem kleinen Flur hängt eine schlichte Holztafel:
In loving memory of
Mum and Dad
Mary and Jim
Links davon befindet sich das Wohnzimmer, in dem Paul die ersten gemeinsamen Songs mit John schrieb (vorher hatte er bereits alleine versucht, welche zu schreiben). Der Raum ist klein, fast jeder freie Zentimeter wird von einer klobigen „Sitzgruppe“ ausgefüllt, ein Sofa und zwei dazu passende Sessel, außerdem gibt es eine Stehlampe mit Fransen und einen winzigen Fernseher mit Holzverkleidung. Auf einem Beistelltischchen steht das schwere schwarze Wählscheibentelefon (Garston 6922), das lange Zeit das einzige in der gesamten Straße war. Die Mitarbeiter des National Trust wählten die gelbe Tapete mit Chinamuster, weil sie typisch für einen solchen Raum Anfang der Fünfzigerjahre war und während der Restaurierungsarbeiten kam die ursprüngliche, silberblaue China-Tapete der McCartneys teilweise wieder zum Vorschein. Ein kleiner Abschnitt wurde auf Pappe gezogen, und bei jeder Führung wird ein privilegiertes Mitglied der Reisegruppe gebeten, diese hochzuhalten, damit die anderen sie bewundern können.
An einer Wand steht ein Klavier von der Art, wie sie sich einst in unzähligen britischen Wohnzimmern fanden. „Hier hat der sechzehnjährige Paul am Klavier gesessen und ›When I’m Sixty-four‹ geschrieben“, sagt Sally. „Und wie Sie sich wahrscheinlich denken können, kam das Instrument aus den North End Road Music Stores oder auch NEMS, dem Geschäft der Familie Epstein. Nein, das ist nicht dasselbe Klavier“, setzt sie noch hinzu, bevor jemand fragen kann. „Das echte hat Paul.“
Über dem Fernseher hängt ein von Pauls Bruder Michael aufgenommenes Foto von Paul und John, die in Sesseln einander gegenübersitzen, über ihren rechts- beziehungsweise linkshändig aufgezogenen Gitarren brüten und angeblich „I Saw Her Standing There“ komponieren (daher der singende Niederländer draußen). „Die beiden hatten eine Regel, wenn sich am nächsten Tag keiner mehr an den Song erinnern konnte, war er’s nicht wert, aufgehoben zu werden“, fährt Sally fort. „Wenn aber doch, dann schrieb Paul ihn in sein Schulheft. Und dieses Schulheft hat er immer noch.“
Eine Falttür führt in ein winziges Speisezimmer und in eine Küche dahinter, die mit Produkten der Fünfzigerjahre wie Rinso-Spülmittel, Robin-Stärke und Lux-Seife bestückt wurde. Nachdem die McCartneys 1964 ausgezogen waren, wohnte dreißig Jahre lang eine Familie namens Smith in dem Haus und ließ eine moderne Küche mitsamt Edelstahlspüle einbauen. Als der National Trust das Gebäude übernahm, entdeckte man die ursprünglichen hölzernen Abtropfgitter auf dem Dachboden. Dann tauchte auch noch das dazugehörige Keramikspülbecken im Garten hinten auf, wo es als Blumenkübel gedient hatte.
Der Garten ist eine bescheidene, rechteckige Rasenfläche, von der aus man damals wie heute auf das Trainingsgelände der Polizeifachhochschule in der Mather Avenue blickt. „Natürlich wurden dort, als Paul klein war, auch Polizeipferde gehalten“, sagt Sally. „Das gab jede Menge schönen Pferdedung für die Rosen seines Vaters.“ Im Holzschuppen war eine Waschküche untergebracht – wo die Wäsche noch von Hand gewaschen und durch Walzen gedreht und gemangelt wurde –, außerdem ein Außenklo. Jetzt befindet sich dort eine „Besuchertoilette“ („ist ja auch eine lange Tour“, sagt Sally) und ein Kämmerchen, in dem die Fremdenführerin schon ihr Mittagessen bereitgelegt hat, ein Focaccia mit sonnengetrockneten Tomaten.
Sie zeigt uns das Abflussrohr, an dem Paul spätnachts heraufkletterte, um durch das Fenster der Innentoilette zu steigen und John hereinzulassen, ohne dass sein Vater wach wurde. Wahrscheinlich ist dies das einzige Gebäude im Besitz des National Trust, in dem Besucher auf die historische Bedeutung eines Abflussrohrs hingewiesen werden.
Wir gehen nach oben in das große Schlafzimmer hinten, das Paul seinem jüngeren Bruder Michael überlassen hatte, wobei aber beide ihre Klamotten dort aufbewahrten. Über dem Kopfteil des Betts hängt ein schwarzer Kopfhörer, genau wie diejenigen, über die sich die britische Jugend damals mit dem Rock-’n’-Roll-Fieber infizierte. Pauls altes Zimmer zur Straße hin ist kaum breiter als das schmale Einzelbett, das darin steht. Auf der Überdecke liegt eine Reihe von Gegenständen, unter anderem auch eine Taschenbuchausgabe von Dylan Thomas’ Under Milk Wood (das heißt, er war ein guter Englisch-Schüler) und eine Nachbildung seiner allerersten Gitarre, der rötlichen Sunburst F-hole Zenith. „Paul hat noch die alte“, muss Sally kaum noch dazusagen.
Hier bekommt jede Gruppe ein paar Minuten zur – wie man in der Kirche sagen würde – „stillen Andacht“. Und meist wird in diesen Minuten auch nicht gesprochen. „Manche Leute lachen, andere weinen“, sagt Sally. „Die meisten sind aber vor allem einfach sehr gerührt.“
In all den Jahren, in denen die Forthlin Road 20 jetzt schon der Öffentlichkeit zugänglich ist, hat Paul sich das Haus nie in restauriertem Zustand angesehen, obwohl er mehrfach inkognito vorbeifuhr. Einmal, als er in Begleitung seines Sohns James vorbeikam, wurde er von einem kleinen Jungen aus einem der Nachbarhäuser angesprochen. Der Junge, der nicht begriff, wen er vor sich hatte, versuchte mit derselben Liverpooler Dreistigkeit, die auch die Beatles in ihrer Blütezeit auszeichnete, ein bisschen Geld abzustauben:
„Hey Mister, für ’n Pfund zeig ich Ihnen das Haus von Paul McCartney.“
2
Apfel-Sandwiches mit Zucker
Obwohl Nachnamen mit der Vorsilbe Mac oder Mc, was so viel heißt wie „Kind von“, in der Regel auf eine schottische Herkunft schließen lassen, hat Paul sowohl väterlicher- wie mütterlicherseits irische Vorfahren. Im Lauf der Geschichte gab es allerdings immer wieder starke Überschneidungen zwischen Iren und Schotten, nicht zuletzt auch durch die gemeinsame Verachtung gegenüber den Engländern. Die Ähnlichkeiten sind vielfältig, angefangen von der gälischen Sprache bis hin zur Vorliebe für Whisky und der Leidenschaft für traditionelle Musik, in beiden Fällen unter anderem mit Dudelsack. Überall in Irland leben Familien schottischer Herkunft und umgekehrt.
Einer der umstrittensten Songs, die Paul geschrieben hat, war „Give Ireland Back to the Irish“ – wobei seine eigenen Ahnen sich ihr Land durchaus bereitwillig aberkennen ließen.
Sein Urgroßvater väterlicherseits, James McCartney, verließ seine Heimat im Zuge der Massenabwanderung Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als Tausende vor der entsetzlichen Armut in Irland und in der Hoffnung auf ein besseres Leben außer Landes flohen. James war einer von vielen, die über die Irische See nach Liverpool übersetzten, das seinen Anspruch, „die zweite Hauptstadt des British Empire“ zu sein, mit seinem geschäftigen Hafen und den vielen Fabriken begründete. Anfang der Achtzigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts traf er dort ein, ließ sich in dem eher ärmlichen Bezirk Everton nieder und arbeitete als Anstreicher. James’ Sohn Joseph arbeitete in der Tabakfabrik Cope Bros & Co und heiratete 1896 Florence Clegg, die Tochter eines Fischhändlers. Sie brachte neun Kinder zur Welt, von denen zwei, Ann und Joseph junior, noch im Kleinkindalter starben (ihre Namen wurden später jeweils einem anderen Jungen und Mädchen gegeben). Joseph und Florries zweiter überlebender Sohn, ihr fünftes Kind, wurde 1902 geboren und war Pauls Vater James, der von Anfang an Jim gerufen wurde.
Jim und seine sechs Geschwister Jack, Joe junior, Edith, Ann, Millie und Jane – die den Spitznamen „Gin“ bekam – lebten in einem winzigen Reihenhaus in der Solva Street, dem ärmsten Teil von Everton. Später in seinem Leben erinnerte Jim sich daran, dass die McCartney-Kinder insgesamt nur zwei Paar Schuhe besaßen, die Jungs ein Paar, die Mädchen ein anderes. Da es in der Schule verboten war, den Unterricht barfuß zu besuchen, wechselten sie sich mit dem kostbaren Schuhwerk ab, kamen abends nach Hause und wiederholten den Lehrstoff laut für die anderen.
Trotz der extremen Armut und der zweifelhaften Einflüsse in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wuchs Jim zu einem ehrlichen, bescheidenen und stets zuvorkommenden Erwachsenen heran, der sogar von seinen Geschwistern „Gentleman Jim“ genannt wurde. Als er mit vierzehn Jahren die Schule verließ, hatte der Direktor in seinem Zeugnis „kein schlechtes Wort über ihn zu sagen“. In seiner Kindheit allerdings widerfuhr ihm ein Missgeschick: Als Zehnjähriger fiel er von einer Mauer und verletzte sich das rechte Trommelfell, weshalb er Zeit seines Lebens auf diesem Ohr taub blieb.
Seit dem achtzehnten Jahrhundert beruhte der Wohlstand Liverpools hauptsächlich auf Baumwolle, die mit Schiffen aus Amerika und Asien herübergebracht und an die Textilfabriken und Kleidermanufakturen im ganzen Norden Großbritanniens verkauft wurde. Jim heuerte bei Hannay & Son, einem der alteingesessensten Baumwollhändler der Stadt, als „sample boy“ an, das heißt, er brachte potenziellen Käufern Proben der frisch eingetroffenen Ware. Um seinen Lohn von sechs Schilling (dreißig Pence) die Woche aufzubessern, verkaufte er außerdem Programmhefte im Theatre Royal in Everton und bediente dort gelegentlich auch den Scheinwerfer, richtete in besonderen Augenblicken den grellen Lichtstrahl auf die angesehensten Künstler.
Der Sohn, den er eines Tages haben würde, sollte im Scheinwerferlicht der Welt stehen. Aber ein kleines bisschen davon fiel auch auf Jim. Sein Vater Joseph war ein begeisterter Hobbymusiker gewesen, hatte bei Cope in der Werkskappelle Es-Tuba gespielt sowie Konzerte und Liedernachmittage für die Nachbarn organisiert. Auch wenn Jim halb taub war, hatte er ein angeborenes musikalisches Gehör, das ihm erlaubte, sich sowohl Trompete wie auch Klavier selbst beizubringen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, für den er zu jung war, gründete er eine halbprofessionelle Tanzkapelle, in der sein älterer Bruder Jack Posaune spielte.
Am Anfang malten sie sich schwarze Zorromasken auf die Gesichter und nannten sich The Masked Music Makers, aber weil es auf der Bühne so heiß war, verlief die Farbe, und so änderten sie schon bald ihren Namen in Jim Mac Jazz Band. Sie spielten bei Tanzveranstaltungen in der Nachbarschaft und begleiteten gelegentlich Stummfilmvorführungen, improvisierten Melodien, die zum Geschehen auf der Leinwand passten. Jims Vater und sein Bruder Jack hatten schöne Singstimmen, aber er versuchte sich nicht als Sänger, sondern blieb lieber bei seiner „Tröte“. Ein Foto zeigt die Jim Mac Jazz Band in den Zwanzigerjahren im Smoking und mit Stehkragen, einige weibliche Anhängerinnen scharen sich um die Bassdrum – nicht unähnlich der späteren Sgt. Pepper’s Band. Das zarte Gesicht des Bandleaders und seine großen wachen Augen sind ebenfalls Vorboten dessen, was kommen sollte.
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war Jim siebenunddreißig Jahre alt und trotz der Bemühungen seiner Mutter und fünf Schwestern, ihn davon abzubringen, mit seinem Leben als „eingefleischter Junggeselle“ offenbar zufrieden. Inzwischen war er bei Hannay & Son zum Baumwollhändler aufgestiegen, arbeitete teilweise in der Baumwollbörse in der Old Street an den Docks, wo die Ware entladen wurde, oder besuchte Kunden im knapp sechzig Kilometer weiter östlich gelegenen Manchester. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Länge der Baumwollfasern zu überprüfen, denn je länger die Faser, desto besser ließ sie sich spinnen. Trotz seiner Schwerhörigkeit war er schon bald in der Lage, diese nach Gehör einzuschätzen. „Er rieb ein Stückchen Baumwolle an seinem guten Ohr und konnte die Qualität bestimmen“, erinnert sich Ruth McCartney, seine Adoptivtochter.
Als wichtigster Hafen für Lebensmittellieferungen aus Übersee und eines der bedeutenden Zentren der Waffenproduktion gehörte Liverpool zu den Hauptangriffszielen von Hitlers Luftwaffe und wurde beinahe ebenso stark bombardiert wie London. Jim war nun zu alt für den aktiven Militärdienst und aufgrund seiner Schwerhörigkeit ohnehin freigestellt. Als Hannay & Son vorübergehend geschlossen wurde, arbeitete er an einer Drehmaschine in einer Munitionsfabrik und nachts außerdem freiwillig als Feuerwehrmann.
Eines Tages, bei einem Besuch seiner verwitweten Mutter in Norris Green, begegnete er einer Krankenschwester irischer Herkunft, die bei seiner Schwester Gin logierte und Mary Patricia Mohin hieß. Obwohl Liverpool die schlimmsten Bombardierungen inzwischen hinter sich hatte, kam es doch immer wieder zu Luftangriffen. Als Jim und Mary sich kennenlernten, begannen die Sirenen zu heulen, sodass sie gezwungen waren, ihre Unterhaltung im Anderson-Shelter im Garten fortzusetzen. Während sie sich unter dem dünnen Wellblechdach zusammenkauerten, war es schließlich doch um „Gentleman Jim“ geschehen.
Marys Vater Owen Mohan, ein Kohlelieferant, war um die Jahrhundertwende aus County Monaghan nach England gezogen und hatte seinen Namen in Mohin geändert, damit er weniger irisch klang. Marys Mutter war gestorben, als Mary zehn Jahre alt war, und sie und ihre beiden Brüder Wilfred und Bill (zwei Schwestern hatten nicht überlebt) zurückgelassen. Ihr Vater hatte erneut geheiratet und eine zweite Familie gegründet, aber ihre Stiefmutter hatte nicht viel für Mary übrig gehabt und sie schließlich ganz und gar aus dem gemeinsamen Zuhause ausgeschlossen.
Danach war es vielleicht nicht erstaunlich, dass sie sich zur Pflege anderer berufen fühlte. Im Alter von vierzehn Jahren wurde sie Schwesternschülerin im Smithdown Road Hospital und begann anschließend eine dreijährige Ausbildung im Walton General Hospital in der Rice Lane, machte dort ihren Abschluss als staatlich anerkannte Krankenschwester und wurde mit nur vierundzwanzig Jahren bereits Stationsschwester.
Als Mary Jim McCartney kennenlernte, war sie einunddreißig und damit in einem Alter, in dem sich die meisten unverheirateten Frauen damals bereits mit einem ehelosen Dasein als „alte Jungfern“ abgefunden hatten. Aber mit ihrem guten irischen Aussehen – das auf spanische oder italienische Vorfahren schließen ließ – und ihrem schüchternen, sanften Auftreten war sie für Jim, der immerhin knapp vierzig war, ein toller Fang. Trotzdem war es Mary, die die Initiative ergriff. „Mein Dad hat gesagt, er habe meine Mum wirklich toll gefunden und häufig ausgeführt“, erinnerte sich Paul. „Aber dann plötzlich kapierte er, dass sie ihn dazu gebracht hatte … Sie besuchte alle möglichen Tanzschuppen, dabei war sie gar nicht so ein Mädchen. Wie sich herausstellte, war sie nur hingegangen, weil mein Vater dort gespielt hatte. Sie ist ihm als Fan gefolgt. Später dachte ich: ›Du liebe Zeit, daher hab ich das alles!‹“
Die Romanze hätte ebenso schnell enden können, wie sie begonnen hatte, denn Mary war katholisch aufgewachsen, während die McCartneys Protestanten waren. Bei der irischen Bevölkerung Liverpools galten die konfessionellen Schranken als ebenso unüberwindlich wie in der Heimat: Katholiken und „Oranier“ veranstalteten Siegesparaden und Demonstrationen, die meist mit Gewalt endeten, und beide missbilligten Eheschließungen über die Glaubensschranken hinweg. Doch Mary hatte keine nahen Verwandten mehr, die ihr Schwierigkeiten hätten machen können, und Jim begriff sich ohnehin als Agnostiker: Sie heirateten im April 1941 in der römisch-katholischen Kapelle St Swithin’s.
Ihr erstes Kind, ein Junge, wurde am 18. Juni des darauffolgenden Jahres im Walton General Hospital geboren. Mary hatte als Krankenschwester einst die Entbindungsstation dort geleitet und kam daher in den Genuss eines Einzelzimmers. Das Baby kam „scheintot“ zur Welt, verursacht offensichtlich durch eine Sauerstoffunterversorgung im Gehirn, und offensichtlich atmete es nicht. Die Geburtshelferin wollte es für tot erklären, aber die Hebamme, die Mary gut kannte und ebenfalls Katholikin war, betete inbrünstig zu Gott, und nach wenigen Augenblicken erwachte es zum Leben.
Jim hielt Brandwache und erreichte das Krankenhaus erst einige Stunden später, als das Baby definitiv atmete und auch gar nicht mehr totenbleich war. „Der Junge hatte ein Auge geöffnet und plärrte ununterbrochen“, erinnerte sich sein Vater mit wahrer Liverpooler Freimütigkeit. „Sie hielten ihn hoch, und er sah aus wie ein fürchterlich rohes Stück Fleisch.“
Als Jim erfuhr, welches Wunder sich ereignet hatte, erhob er keinerlei Einwände, als Mary bat, den Jungen katholisch taufen zu lassen. Er bekam den Namen seines Vaters und seines Urgroßvaters James und den frommen Zweitnamen Paul, der sein Rufname wurde.
Sein erstes Zuhause waren zwei möblierte Zimmer in der Sunbury Road 10 in Anfield, nicht weit von dem Friedhof entfernt, auf dem die Hunderte von Liverpoolern begraben lagen, die den Luftangriffen zum Opfer gefallen waren. Wenig später verließ Jim die Munitionsfabrik und wurde Inspektor der Stadtreinigung, musste überprüfen, ob die Müllmänner gewissenhaft ihre Runden gefahren waren. In einer Stadt mit über 20 000 ausgebombten Haushalten war Unterbringung ein ständiges Problem. Die McCartneys wohnten unter vier weiteren vorübergehenden Adressen auf beiden Seiten des River Mersey, blieben aber nirgendwo länger als ein paar Monate. Als Mary im Januar 1944 in das Walton General zurückkehrte und einen zweiten Sohn zur Welt brachte, der Peter Michael genannt und seither Mike gerufen wurde, nahm der Druck zu.
Nach dem Krieg wurde Hannay & Son wiedereröffnet, und Jim kehrte in seinen alten Beruf als Baumwollhändler zurück. Doch fünf Jahre Weltkrieg hatten den Baumwollhandel in die Knie gezwungen, und wenn er Glück hatte, brachte er jetzt sechs Pfund die Woche nach Hause. Um ihr Einkommen aufzustocken, nutzte Mary ihre Erfahrung in der Krankenpflege und arbeitete als von den Behörden angestellte Schwester, die Menschen mit weniger schlimmen Beschwerden zu Hause behandelte.
1947, als Paul noch keine fünf Jahre alt war, wurde sie in der neuen Wohnsiedlung Speke, etwa acht Meilen südöstlich der Liverpooler Innenstadt, Hebamme und machte Hausbesuche. Das Beste an dieser Anstellung war, dass der Familie dadurch eine mietfreie Sozialwohnung zustand. Als die McCartneys in ihr neues Zuhause in der Western Avenue 72 zogen, war die Siedlung noch nicht viel mehr als ein Gewirr aus matschigen Straßen und ungedeckten Rohbauten. Paul kam sich mit seiner damals bereits lebendigen Fantasie vor „wie das Mitglied einer Familie von Pionieren im Planwagen“.
Zu seinen frühesten Erinnerungen gehört es zu frieren – der eisige Winterwind, der vom Mersey herüberwehte, brennende aufgerissene Lippen, nackte Ohren und Knie, unbedeckt von den kurzen Hosen, die damals alle Jungen tragen mussten.
1947 war das für Großbritannien härteste Nachkriegsjahr. Die kampfesmüde, bankrotte Nation schien nirgendwo Wärme, Lebensmittel oder Vergnügungen zu finden, im Kino liefen nur die körnigen Wochenschauen in Schwarz-Weiß. In Hinblick auf Entbehrungen schien es Liverpool am schlimmsten getroffen zu haben, über viele Hektar zogen sich die zerstörten Gebäude und Ruinen. Die Spielplätze der Kinder in der Stadt, und damit auch die von Paul und Mike, waren vor allem Bombenkrater, die im Liverpooler Slang – in dem nie etwas wirklich ernst genommen wird – „Bombies“ hießen.
In der Western Avenue 72 aber war es nie kalt, denn Mary McCartney schenkte ihren beiden Söhnen ein liebevolles, sicheres Heim, wie sie selbst nie eins gekannt hatte. Paul erinnerte sich an „viele Umarmungen und Küsschen“ von seiner Mutter, dazu an ihre praktische Veranlagung als Krankenschwester, immer wusste sie genau, was zu tun war, wenn er oder sein Bruder hingefallen waren, sich wehgetan oder Fieber bekommen hatten. Tröstlicher noch als ihre Umarmungen war die professionelle Geschicklichkeit, mit der sie Verbände oder Pflaster anlegte und das Fieberthermometer schüttelte, bevor sie es ihm unter die Zunge schob.
Mary kümmerte sich unermüdlich um ihre Patientinnen, eine Aufgabe, die immer anspruchsvoller wurde, je mehr Bewohner in die neue Siedlung zogen. Paul behielt das Bild von ihr im Kopf, wie sie in einer verschneiten Winternacht mit dem Fahrrad davonradelte, eine Tasche mit ihren Hebammenutensilien auf dem Gepäckträger, und einem Baby auf die Welt verhalf. Für ihn hatte sie fast so etwas wie die Aura einer Heiligen, zumal dankbare Patienten stets Blumen oder nur schwer zu ergatternde Süßigkeiten auf den Stufen der Hausnummer 72 ablegten, wie Opfergaben auf einem Altar.
Zu den Eigenheiten des britischen Klassensystems der Vierziger und Fünfzigerjahre gehörte, dass Krankenschwestern, egal welcher Herkunft, ehrenhalber in die Mittelschicht aufstiegen und ein vornehmer Akzent praktisch zur Ausbildung dazugehörte. Obwohl sie also eine so wichtige Aufgabe in Speke übernommen hatte, stand Mary gleichzeitig auch irgendwie abseits der Gemeinschaft dort, und dieses Gefühl übertrug sich auf Paul und Mike. Ihre Mutter achtete sehr darauf, dass sie sich nie denselben breiten Liverpooler Akzent angewöhnten, den die anderen Kinder im Viertel sprachen, und sie wurden angehalten, stets höflicher und zuvorkommender zu sein, als es am Mersey allgemein üblich war. Nach einigen Jahren in der Western Avenue wurde die Familie in einen anderen Sozialbau verlegt, in die Ardwick Road 12, nur wenige Straßen weiter. Das Haus war kaum größer als das alte, und auch hier gab es nur eine Außentoilette, aber Mary hielt die Gegend für besser.
Obwohl er relativ spät erst Kinder bekommen hatte, entpuppte Jim sich als pflichtbewusster und liebevoller Vater. Insgesamt wirkte er eher ernst, so, wie es von jemandem erwartet wurde, der jeden Tag im Anzug zur Arbeit in „die Stadt“ fuhr, aber laut Mike McCartney „sprudelte tief in seinem Inneren ein feiner Sinn für Humor, der sich jeden Augenblick Bahn brechen konnte“. Die Jungs entdeckten zum Beispiel schon sehr früh, dass es keinen Sinn hatte, ihrem Dad die Zunge zu zeigen, da er selbst die mit Abstand größte hatte und sie, wenn es drauf ankam, auch sehr viel weiter rausstreckte.
Jim hatte das Trompetespielen aufgeben müssen, als er seine Zähne verlor, doch die Leidenschaft fürs Klavierspielen war ihm geblieben. Im Wohnzimmer nahm ein stabiles Modell, das er im NEMS-Musikgeschäft in Walton erstanden hatte, einen Ehrenplatz ein. Pauls erste Ahnung von einer Melodie waren die von seinem Vater ausgelassen über Kreuz gespielten Versionen alter Gassenhauer wie „Stairway to Paradise“, ein Hit von George Gershwin aus dem Jahr 1922.
Zwar lernten die Jungen ihre Großeltern väterlicherseits nicht mehr kennen, doch waren sie durch Jims Brüder Jack und Joe sowie seine vier Schwestern Edie, Annie, Millie und Ginny bestens mit Tanten und Onkeln versorgt. Der große und äußerst gut aussehende Onkel Jack, einst Posaunist bei der Jim Mac Jazz Band, jetzt Mieteneintreiber bei der Liverpool Corporation, war im Ersten Weltkrieg in einen Gasangriff geraten und seither nicht mehr in der Lage, lauter als im Flüsterton zu sprechen. Tante Millie hatte Albert Kendal, einen von Jims Kollegen bei der Baumwollbörse, geheiratet, weshalb Paul also tatsächlich den „Uncle Albert“ hatte, über den er später einen Song schrieb. Das schwarze Schaf der Familie war Tante Edies Mann Will Stapleton, ein Schiffssteward, der – wie die meisten Vertreter seines Berufsstands – ausgiebig auf den Schiffen klaute, auf denen er diente, und schließlich drei Jahre Gefängnis absitzen musste, weil er 500 Pfund in Scheinen hatte mitgehen lassen, die eigentlich per Schiff nach Westafrika hatten verschickt werden sollen. Danach verging ein halbes Jahrhundert, bis noch einmal ein Mitglied der Familie hinter Gitter kam.
Die temperamentvollste der Tanten war Ginny oder Gin, Pauls Lieblingstante von Anfang an – auch sie sollte er später in einem seiner Songs erwähnen. Sie war die Matriarchin der Familie, diejenige, an die sich alle anderen ratsuchend wandten. „Mum war eine sehr kluge Frau“, erinnert sich ihr Sohn Ian Harris, „sie wusste immer, wie sie bekam, was sie wollte. Einmal überredete sie die Liverpool Corporation sogar eine Busstrecke so zu verlegen, dass der Bus durch unsere Straße fuhr.“
Die Kinder der Familie, erinnert Harris sich, waren „wie Nomaden, weil wir immer irgendwo bei jemand anderem übernachteten. Ich war oft bei Paul und Mike. Ihre Mum, Tante Mary, war sehr streng – aber eine wunderbare, freundliche Frau.“ Immer wieder gab es Zusammenkünfte nach Liverpooler Art, bei denen ausgiebig bis in die frühen Morgenstunden getrunken, gesungen, getanzt und gelacht wurde. Onkel Jack erzählte Witze im Flüsterton, und Jim griff in die Tasten. Wenn bei Onkel Joe in Aintree Silvester gefeiert wurde, spielte um Mitternacht ein schottischer Dudelsackbläser draußen vor der Tür auf. Gin rief immer am lautesten im Chor mit den anderen: ›Let ’im in!‹«
Da Mary Katholikin war, hätten ihre Söhne eigentlich „im Glauben“ erzogen und unterrichtet werden müssen. Doch auch hier fügte sie sich, wie in fast allem, ihrem nominell agnostischen, im Grunde aber doch protestantischen Ehemann. Obwohl sie katholisch getauft worden waren und einige wenige Male in frühester Kindheit die katholische Sonntagsschule besucht hatten, blieben Paul und Mike der katholischen Kirche fern. Stattdessen besuchten sie die Grundschule in der Stockton Road, einen kurzen Fußweg von zu Hause entfernt, wo der Religionsunterricht ausschließlich anglikanisch geprägt war. Schon bald wurden so viele Kinder aus den Neubausiedlungen dort eingeschrieben, dass sie mit 1500 Schülern die überfüllteste Grundschule ganz Großbritanniens war. Paul und Mike gehörten zu einer Gruppe von Schülern, die daraufhin in die Joseph Williams Primary School in Gateacre versetzt wurden, wohin sie jeweils eine halbe Stunde lang im Bus fahren mussten.
Wie sich herausstellte, war Paul Linkshänder, was ihm in seiner frühen Entwicklung an der Schule damals leicht zum Hindernis hätte werden können. Linkshändigkeit hielt man für widernatürlich, bisweilen sogar für einen Ausdruck von Bösartigkeit (das lateinische Wort für links ist „sinistra“), und Linkshänder wurden häufig ausgelacht und gezwungen, die rechte Hand zu benutzen. Aber in der Joseph Williams durfte er mit links weitermachen. Das Ergebnis war eine tadellos saubere Handschrift – wie die seiner Mutter –, und auch im Zeichnen und Malen bewies er ein ausgeprägtes Talent.
Das Lernen fiel ihm von Anfang an leicht, und dank seines lausbubenhaften Aussehens und der Höflichkeit, die Mary ihm eingeimpft hatte, war er bei den Lehrern sehr beliebt. Die einzige Kritik damals war eine, die er auch später immer wieder zu hören bekam – dass er sich zu sehr auf seine Begabung und seinen Charme verlasse und deshalb nie ganz die Ergebnisse erreiche, derer er eigentlich fähig sei. In einem seiner Zeugnisse wird er beschrieben als „sehr intelligenter Junge, der mit ein wenig mehr Sorgfalt und Einsatz leicht Klassenbester werden könnte“.
Zu seinen Klassenkameraden in der Joseph Williams Primary gehörte ein großes, flachsblondes Mädchen namens Bernice Stenson, deren Mutter Mary McCartney kannte und ihr manchmal bei der Arbeit als Hebamme half. Einmal war sie bei der Niederkunft einer taubstummen Mutter dabei. Mary blieb wie immer ruhig und geduldig, übertrug Mrs Stenson die Aufgabe, den Papierkram zu erledigen, während sie sich „um untenrum kümmerte“.
Bernice erinnert sich, dass Paul bereits im Alter von sechs oder sieben Jahren für seine „kräftige, klare“ Singstimme bekannt war und bei Schulaufführungen und dem Weihnachtssingen immer die Hauptrolle bekam. Er hatte die Musikleidenschaft seines Vaters geerbt und sang die Harmoniestimmen im Radio instinktiv mit. Als er elf wurde, hoffte Jim, er würde vielleicht in den Chor der Liverpool Cathedral, dem prächtigen Sandsteingebäude, das sich über der Stadt erhebt und irgendwie von Hitlers Bomben verschont geblieben war, aufgenommen werden. Neben neunzig anderen Jungen sollte er Ronald Woan, dem musikalischen Leiter der Kathedrale, das Weihnachtslied „Once in Royal David’s City“ vorsingen. Als er an der Reihe war, bewog ihn irgendetwas dazu, absichtlich einen hohen Ton zu verpatzen, den er ohne Weiteres hinbekommen hätte, und er wurde abgelehnt. Fast vierzig Jahre sollte es dauern, bis ihm die Kathedrale erneut ihre Tore öffnete.
Einstweilen musste er sich mit dem Chor der St Barnabas Church, auch bekannt als „Barney’s“, unweit der Penny Lane in Mossley Hill begnügen. Durch die Gottesdienste erwachte in ihm eine tiefe Liebe für die anglikanischen Hymnen mit ihren volltönenden Orgelakkorden und oft äußerst poetischen Texten. Jahre später, als er weltberühmte Songs schrieb, wurde häufig behauptet, die getrageneren darunter erinnerten an Kirchenlieder. Damals aber war das Beste an Barney’s für ihn noch, dass die Chorsänger für ihre Aufritte bei Hochzeiten und Beerdigungen bezahlt wurden. „Wenn man bei einer Hochzeit sang, bekam man zehn Shilling (fünfzig Pence)“, erinnerte er sich. „Ich hab Wochen gewartet – Monate –, aber nie eine Hochzeit abbekommen.“
Jim McCartney war verständlicherweise erpicht darauf, dass er Klavier spielen lernte – es ›richtig‹ lernte und es sich nicht einfach nach Gehör aneignete, so, wie Jim dies selbst getan hatte. Da es an der Joseph Williams Primary keinen Musikunterricht gab, bekam Paul privat Klavierunterricht bei einer älteren Dame. Schon bald gab er es auf, beklagte sich, dass er dadurch nur noch mehr Hausaufgaben habe und es bei seiner Lehrerin zu Hause „nach alten Leuten riecht“.
Zum Schluss kam das wenige, was er an formaler Musikausbildung je bekommen sollte, von seinem Vater und dem Klavier im Wohnzimmer. Während Paul „Stairway to Paradise“ oder ein anderes altes Lieblingslied spielte, schrie Jim die Namen der Akkorde laut heraus, zeigte ihm auf den schwarz-weißen Tasten, wie sie gegriffen wurden, und erklärte ihre Abfolge. Sein Vater liebte außerdem Blaskapellen und nahm Paul mit zu den Konzerten in den weitläufigen Parks von Liverpool, womit er eine weitere traditionelle musikalische Vorliebe an ihn weitergab.
Aber Jim beharrte stets darauf, kein „echter“ Musiker zu sein, da er keine professionelle Ausbildung genossen hatte. Gelegentlich wich er ab von seinem geliebten Standardrepertoire aus Titeln von Gershwin und Irving Berlin und spielte etwas, das er früher zu Zeiten der Jim Mac Jazz Band selbst geschrieben hatte, eine nachdenkliche kleine Melodie namens „Eloise“. Er weigerte sich allerdings zu behaupten, er habe sie „komponiert“ – Komponisten waren für ihn, ebenso wie für die Allgemeinheit, eine geheimnisvolle Freimaurerloge, bestehend aus ausschließlich in London oder New York anzutreffenden „Profis“. Wie er mit der Bescheidenheit eines anderen Zeitalters stets erklärte, habe er nicht mehr getan, als „sich was auszudenken“.
Die McCartneys waren alles andere als wohlhabend. Die sechs Pfund, die Jim jede Woche von Hannay & Son nach Hause brachte, wurden durch keinerlei Provisionen oder Sonderzulagen ergänzt. Mary verdiente als Hebamme sechs Schilling (dreißig Pence) mehr – was beiden durchaus peinlich war –, angesichts ihrer langen Arbeitszeiten aber immer noch wenig genug.
Im Nordwesten Englands konnte eine vierköpfige Familie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg von zwei Löhnen einigermaßen gut über die Runden kommen. Fleisch war nicht teuer und bildete die Grundlage von Marys Küche: Lamm, Schwein, Steaks, Leber und am Sonntag einen Rinderbraten mit Yorkshire Pudding, den sie so servierte, wie es im Norden üblich ist, nämlich als Dessert mit Tate & Lyle’s Golden Syrup übergossen. Mit großem Genuss aß Paul jede Sorte Fleisch abgesehen von Zunge, da sie seiner eigenen viel zu ähnlich war. Obst kam hauptsächlich aus der Dose, Pfirsiche, Birnen und Mandarinenstücke, ertränkt in Vanillesauce oder Kondensmilch, mochte er am liebsten. Jahrelang kannte er keinen anderen Orangensaft als ein Konzentrat, das die Regierung während des Kriegs an Kinder ausgegeben hatte, und das auch jetzt noch überall erhältlich war. „Eigentlich sollte man das verdünnen“, erinnerte er sich, „aber wir haben es lieber direkt aus der Flasche getrunken.“
Die Brüder waren immer tadellos gekleidet, und auch im Vergleich mit ihren Schulkameraden fehlte es ihnen an nichts. Jeden Sommer fuhren Mary und Jim mit ihnen in den Urlaub, entweder in den nahegelegenen Norden von Wales oder ans Meer in eines der Butlin’s-Ferienlager. Noch kannte man in Großbritannien keine Freizeitkleidung, und die Jungs spielten in ihren Schulhemden und kurzen Hosen am Strand, während Jim in seinem Büroanzug im Liegestuhl saß.
Beide traten den Pfadfindern bei, der 19th City Scout Troop, weshalb sie zusätzlich zur Schuluniform noch eine weitere erhielten und regelmäßig Ausflüge unternahmen. Paul erwies sich als sehr geschickt in Pfadfindertätigkeiten wie Knoten und Feuermachen und hatte großen Spaß daran, als Beleg seiner vielfältigen Talente möglichst viele Abzeichen zu sammeln.
Ein Schnappschuss zeigt eine typische Familie der Fünfzigerjahre – Jim im Hemd mit offenem Kragen und Tweedjackett erinnert an einen Pfeife rauchenden Fred Astaire; Mary in dem recht förmlichen Kleid, das sie immer trug, wenn sie ihren gestärkten Kittel ablegte. Der neunjährige Paul stemmt die Fäuste in die Seiten, wirkt schon damals völlig unbefangen vor der Kamera. Mike hatte in genau dem Augenblick, in dem sich die Blende öffnete, gelacht und ist leicht unscharf.
Obwohl die Mutter das gemeinsame Leben organisierte, war Jim der Herr im Haus und sein Wort Gesetz. Er bestand darauf, dass seine Söhne altmodische Regeln der Höflichkeit beachteten, auch wenn diese sogar damals schon allmählich im Aussterben begriffen waren. Zum Beispiel mussten sie vor „Damen“ die Schulkappen abnehmen, sogar vor vollkommen fremden, die an der Bushaltestelle warteten. „Wir haben gesagt: ›Oh, Dad, wieso müssen wir? Das macht keiner von den anderen Jungs‹“, erinnerte sich Paul. „Aber wir haben es trotzdem gemacht.“ Absolute Ehrlichkeit auch in den kleinsten Dingen war eine weitere von Jims unabänderlichen Regeln. „Einmal fand ich einen Einpfundschein auf der Straße, und er hat mich gezwungen, ihn bei der Polizei abzugeben.“
Selbst in den besten britischen Haushalten dieser Zeit wurden Kinder körperlich gezüchtigt, ohne dass Außenstehende sich einmischen durften. Der unbescholtene Jim hatte in seiner Kindheit selbst häufig „eine Tracht Prügel“ bezogen und keinerlei Skrupel, seinen Söhnen was auf den Hintern oder die nackten Beine zu geben, wenn sie sich ernsthaft schlecht benommen hatten – auch wenn Mary sie niemals schlug. Im Allgemeinen bekam eher Mike, der Hemmungslosere und Impulsivere der beiden, die flache Hand seines Vaters zu spüren, während Paul es meist gelang, sich irgendwie herauszureden.
Dank dieser Fähigkeit schaffte er es auch, sich von Raufereien meist fernzuhalten. Mike geriet ständig irgendwo hinein, aber Paul hatte etwas an sich, das selbst die schlimmsten Schulhoftyrannen davor zurückschrecken ließ, sich mit ihm anzulegen. Immer funktionierte es allerdings auch nicht. Nicht weit von zu Hause führte ein schmaler Weg namens Dungeon Lane an einen Abschnitt des Mersey, der Cast Iron Shore genannt wurde, da er mit Blechteilen vom Hof des nahe gelegenen Schiffsverwerters übersät war. Als er eines Tages alleine dort war, lauerten ihm zwei größere Jungen auf und stahlen ihm seine mit großem Stolz getragene Armbanduhr. Beide wohnten in der Nähe der McCartneys; es kam zur Anzeige, und Paul musste sie vor Gericht identifizieren. Auch wenn er kein Rabauke war, so fehlte es ihm doch nicht an Mut.
Mary McCartney widmete sich derart selbstlos ihrer Tätigkeit als Hebamme, dass Jim sich Sorgen machte, ihre eigene Gesundheit könne darunter leiden. Schließlich übernahm sie, sehr zu Jims Erleichterung, eine andere Aufgabe bei der Gesundheitsbehörde, sie begleitete fortan die Schulärzte auf ihren Runden durch die Bezirke Walton und Allerton. Dadurch hatte auch sie endlich einen normalen Arbeitstag von neun bis fünf und musste sich nicht mehr rund um die Uhr bei jedem Wetter aufs Fahrrad setzen.
In der Klinik, in der sie jetzt stationiert war, freundete Mary sich mit Bella Johnson an, einer noch jugendlichen Witwe, deren Teenagertochter Olive Sekretärin bei der Law Society in der Innenstadt war und um die Ecke von Jims Baumwollbörse arbeitete. Sie war eine gebildete junge Frau, die ein eigenes Auto besaß und mit – in Marys Ohren – beeindruckend vornehmem Akzent sprach. Sie wurde inoffiziell Paul und Mikes große Schwester, spielte mit ihnen, nahm sie in ihrem Wagen mit und ging mit ihnen auf dem See in Wilmslow rudern.
Bella kam häufig zum Tee in die Ardwick Road 12, und Mary servierte dann zur Feier des Tages Sandwiches mit gezuckerten Apfelscheiben. Beide Jungs liebten ihre Mutter offensichtlich über alles, wobei Olive aber immer den Eindruck hatte, dass Michael sie am meisten brauchte. „Ich weiß noch, wie Mike zu Marys Füßen saß. Er war einer, den man ständig lieben und beschützen wollte. Paul dagegen war auch sehr liebenswert, aber es war klar, dass er nicht beschützt werden musste.“
1952 stand Paul vor den Eleven-plus-Prüfungen, die über sein weiteres schulisches Schicksal entscheiden würden. Die Elfjährigen kamen danach entweder aufs Gymnasium, auf die „secondary modern“ oder eine Berufsfachschule, wo sie ein Handwerk erlernten, zu Schreinern oder Klempnern ausgebildet wurden.
Während der letzten Zeit an der Joseph Williams Primary hatte Paul einen sehr engagierten Lehrer namens F. G. Wollard, der bis auf einen alle seine vierzig Schüler durch die Prüfung brachte. Paul war einer von nur vier der insgesamt neunzig Bewerber von der Joseph Williams, die einen Platz am Liverpool Institute High School for Boys bekamen – das war die angesehenste Schule der Stadt, auch wenn sie mit der typischen Liverpooler Flapsigkeit meist einfach nur „Inny“ genannt wurde. Später sollte auch Mike dort landen.
Im Juni 1953 wurde die sechsundzwanzigjährige Queen Elizabeth II. gekrönt, und endlich war in Großbritannien die Zeit der Entbehrungen vorbei. Wie Tausende anderer kauften Jim und Mary ihr erstes Fernsehgerät, um auf dessen winzigem Schwarz-Weiß-Bildschirm die Krönungsprozession im verregneten London und die Krönung in der Westminster Abbey zu verfolgen. Bella und Olive Johnson gehörten zu den Freunden und Verwandten, die sie eingeladen hatten, in einem kinoartig bestuhlten Wohnzimmer, in dem jedes Licht gelöscht und die Vorhänge zugezogen worden waren, „mitzuschauen“.
Einen Platz am Inny zu ergattern blieb nicht Pauls einziger Triumph in dieser Zeit. Er war außerdem eines von sechzig Liverpooler Kindern, die bei einem Aufsatzwettbewerb anlässlich der Krönung einen Preis gewannen, den sie in feierlichem Rahmen in der Picton Hall überreicht bekamen. Er erinnerte sich später, wie er vor Angst zu schlottern begann, als er auf die Bühne gerufen wurde – dies sollte ihm später in ähnlichen Situationen nicht mehr häufig passieren.
Schon der kaum mehr als eine Seite lange Aufsatz „von Paul McCartney, zehn Jahre, zehn Monate“ lässt auf ein gewisses Talent schließen, eine Geschichte relativ kurz gefasst zu erzählen. In Hinblick auf Rechtschreibung und Zeichensetzung ist er praktisch perfekt.
Am Tag der Krönung Wilhelm des Eroberers versammelten sich begeisterte Sachsen vor der Westminster Abbey, um ihren Normannenkönig zu bejubeln, während dieser durch die Kirchenreihen nach vorne schritt. Die Normannen, die dies für eine Schmähung hielten, stürzten sich auf die Sachsen und töteten fast alle. Am Tag der Krönung unserer liebreizenden jungen Königin Elizabeth II. wird es keine Unruhen und kein Töten geben, denn der moderne Adel herrscht mit Zuneigung, nicht mit Gewalt. Die Massen draußen vor dem Buckingham Palace und am Rande der Prozession zur Abbey werden zahlreicher erscheinen als bei jeder anderen Krönung. Weltweit haben die Vorbereitungen begonnen, sogar in Australien bereiten sich Menschen auf die lange Reise nach England vor. In London bekommen die Kinder einen kostenlosen Sitzplatz am Straßenrand. Aber nicht nur die Londoner Kinder haben Glück, denn auch andere junge Menschen in anderen Teilen Großbritanniens erhalten Becher mit einem Porträt der Königin auf Porzellan. Für die Touristen, die kommen, um sich das herrliche Spektakel anzusehen, stehen Andenken bereit, darunter auch die Coronation Loving Cup, auf der Queen Elizabeth II. und hinten Queen Elizabeth I. zu sehen sind. Ein Kelch wurde in Edinburgh hergestellt und hat eine Luftblase im Stiel, die fein geschwungenen Buchstaben ER sind in das Glas eingraviert. Die Diamanten, Rubine, Smaragde und Saphire wurden aus der Krone genommen, poliert und von Juwelenexperten wieder eingesetzt. Doch auch nach all den Mühen werden viele Menschen mit mir der Ansicht sein, dass sie es allesamt wert waren.
Das „Porträt der Königin“ sollte vierzehn Jahre später in einer ebenfalls hochgelobten Komposition noch einmal auftauchen, denn eigentlich ließe sich der Aufsatz mit anderen Worten auch so zusammenfassen: „Her Majesty’s a pretty nice girl.“
„Differenziert, verständnisvoll.“
„Ein Buch, das man lesen muss, wenn man Beatles-Fan ist! Eine fundierte, feinfühlige Sicht auf einen der kreativsten Köpfe der Pop-Musik-Geschichte mit all seinen Höhen und Tiefen.“
„Mehr McCartney geht nicht. Auf fast 1000 Seiten liefert der Autor alles Wissenswerte über den Ex-Beatle. (...) Ein äußerst kenntnisreiches, sorgfältig recherchiertes Buch, das einem Sir James Paul McCartney in all seinen Facetten auf beinahe plastische Weise näher bringt. Man hat bisweilen das Gefühl, selbst dabei gewesen zu sein, und einem der begnadetsten Popmusiker über die Schulter zu blicken.“
„Das Werk ›McCartney‹ reiht sich nahtlos ein in die herausragenden Bücher von Philip Norman, dessen klarer und detailreicher Schreibstil mich schon bei ›Shout‹ und ›John Lennon‹ begeistert hat. (...) Obwohl das Buch mit fast 1000 Seiten (einschl. 57 Abbildungen!) schon ein ›schweres Pfund‹ ist, kam bei mir beim Lesen keine Langeweile auf. (...) Ein großartiges Buch – einfach empfehlenswert!“
„Der Meister, der sich entgegen der berüchtigten ›Paul is dead‹-Theorie auch mit 75 Jahren quicklebendig und voller Tatendrang präsentiert, hat Normans Werk übrigens persönlich abgesegnet, was einer Autobiografie somit am nächsten kommt und einen weiteren Qualitätsbeweis darstellt.“
„Es wurden dutzende von Büchern über Sir Pop verfasst, aber keines liest sich wie dieses. Jede Seite ist ihr Geld wert. Das Buch ist Musik zum Lesen, mit Geschichten, in denen man lange spazieren möchte.“
„Dem Autor gelingt es dabei, das Image des stets angepassten, niedlichen Beatle zu revidieren und zeigt ihn als komplexen Charakter, der heute noch davon getrieben ist, sich stets beweisen zu wollen.“
»Faktenreich und detailliert beleuchtet der Musikjournalist Philip Norman in seiner Biographie über den gebürtigen Liverpooler, wie dieser seit mehr als 50 Jahren seine Spuren in der Popgeschichte hinterlässt. (...) Nach der lohnenswerten Lektüre dürfte es schwerfallen, allein seinen einstigen Bandkollegen John Lennon als die experimentierfreudige Kraft der „Fab Four“ einzuschätzen.«
„Neben den wasserdichten Fakten gefällt auch Normans flüssiger Erzählstil.“
„Gründlicher und kritischer als Philip Norman hat das Leben Paul McCartneys noch niemand erzählt.“
„Dies ist ein Buch für Kenner der McCartney-Materie und für welche, die es werden wollen, und nach seiner Lektüre mag man Yoko Ono immer noch nicht so wirklich.“
„Philip Norman legt in ›Paul McCartney‹ mit bisher unveröffentlichten Details und kritischen Erkenntnissen die umfassende Biografie einer der größten musikalischen Legenden unserer Zeit vor. Norman gelingt aber nicht nur ein Buch über McCartneys Leben, sondern darüber hinaus über ein halbes Jahrhundert Popgeschichte. Für die vorliegende Biografie bedarf es eigentlich nur drei Worte: wow, wow, wow!“
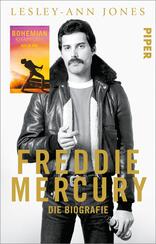



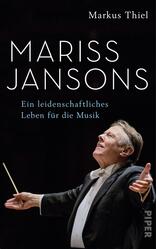
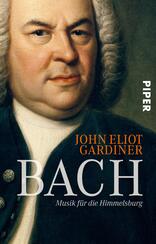



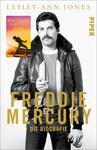


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.