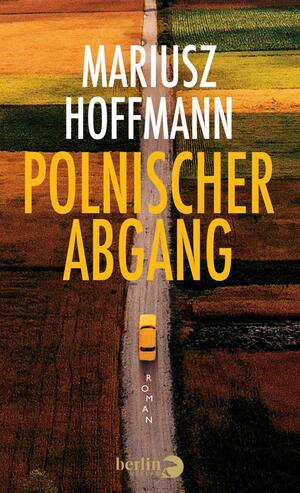
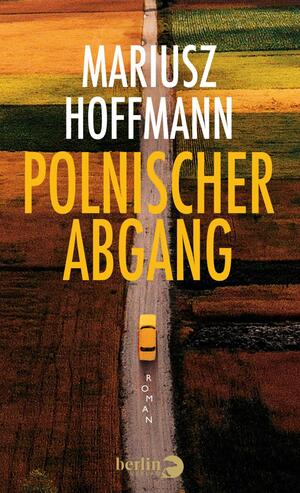
Polnischer Abgang Polnischer Abgang - eBook-Ausgabe
Roman
— Nominiert für den Literaturpreis Ruhr 2023„Mariusz Hoffmann gehört zu den interessanten jungen Stimmen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.“ - DFL "Büchermarkt"
Polnischer Abgang — Inhalt
Ein tragikomischer Familien-Roadtrip auf den Spuren der verschollenen Großmutter
Salesche, ein Dorf in Polen 1990: Jarek und seine Eltern packen ihre Sachen. Sie wollen nach Deutschland aussiedeln, so wie Oma Agnieszka, die acht Jahre zuvor die Flucht angetreten hatte. Doch wovor war sie wirklich geflohen? Niemand will es dem 14-Jährigen sagen. Als Jarek ins Schlepperauto steigt, das sie von Schlesien über die Grenze bringen soll, weiß er nur eins genau: Er wird nicht zurückkehren. Im sich wiedervereinigenden Deutschland, sagt man ihm, warte ein besseres Leben. Doch statt zu Agnieszka nach Hannover zu fahren, geht es für die Sobotas schnurstracks in die Aussiedlerlandestelle Hamm, um dort ihre Anträge zu stellen. Und auch nachdem sie die Aufnahmebestätigung in Deutschland erhalten, rückt das Wiedersehen mit der Großmutter in immer weitere Ferne. Jarek beginnt, dem Schweigen seiner Eltern zu misstrauen, bis sich am ersten Weihnachtsabend im „gelobten Land“ die Teile des Familienpuzzles plötzlich folgenreich ineinanderfügen.
„Eine warmherzige, humorvolle Geschichte, die in einem Roadtrip von Oberschlesien bis nach Deutschland führt und die – frei von Kitsch und in einer poetischen Sprache – mit liebenswerten Figuren vom Suchen und Ankommen erzählt.“ Pierre Jarawan
Leseprobe zu „Polnischer Abgang“
I
KAPITEL 1
In den letzten Tagen hatten ungewöhnlich viele Autos in Salesche gehalten. Ganze drei. Zugegeben, das klingt nach wenig, es ist aber weiß Gott nicht so, als hätte es bei uns keinen Verkehr gegeben. Es rollten sogar eine Menge Autos durch unser Dorf, nur hielt kaum eins an.
Andrzej und ich saßen unter einem Ahornbaum an der Landstraße. Hinter uns die vier Wohnblocks der kleinen Landarbeitersiedlung und vor jedem Haus ein Stück Wiese und dazwischen Schotterwege, auf denen die Wagen von außerhalb parken würden. Weinbrandfarbenes Morgenlicht [...]
I
KAPITEL 1
In den letzten Tagen hatten ungewöhnlich viele Autos in Salesche gehalten. Ganze drei. Zugegeben, das klingt nach wenig, es ist aber weiß Gott nicht so, als hätte es bei uns keinen Verkehr gegeben. Es rollten sogar eine Menge Autos durch unser Dorf, nur hielt kaum eins an.
Andrzej und ich saßen unter einem Ahornbaum an der Landstraße. Hinter uns die vier Wohnblocks der kleinen Landarbeitersiedlung und vor jedem Haus ein Stück Wiese und dazwischen Schotterwege, auf denen die Wagen von außerhalb parken würden. Weinbrandfarbenes Morgenlicht strahlte, während eine breit gezogene Parade aus Mähdreschern über die Luzernenfelder dröhnte. Wir verbrachten den Vormittag damit, dem Bataillon aus grünen, gelben und roten Maschinen zuzusehen, wie es in wenigen Stunden unsere Umgebung niedermähte. Normalerweise hätten wir in den kommenden Tagen den PGR-Landarbeitern geholfen, das Heu einzuholen, um es mit Kartoffelresten zu durchmischen und an die Schweine und Kühe zu verfüttern.
Als Erstes tauchte ein weißer Punkt am Horizont auf. Er schwebte über die Landstraße, wurde größer, dann langsamer und bog schließlich ein auf den Platz vor den Blocks. Hier war der weiße Punkt zu einem VW Jetta geworden. Schwarze Buchstaben auf weißem Blech – ein deutsches Auto. Und als ob das nicht schon erstaunlich genug wäre, wurde die Fahrertür geöffnet, und ein Kerl postierte sich neben den Wagen. Nagelneue Turnschuhe, eng sitzende Jeanshose und eine Jeansjacke, die nicht mal halb um seinen Bauch reichte, an der zur Ablenkung aber Fransen von den Unterarmen hingen. Stolz wie ein Pfau stemmte der Kerl die Fäuste in die Hüften.
Stachu Ogonek war zurückgekehrt.
„Unglaublich“, sagte Andrzej.
Dann wurde die Beifahrertür aufgestoßen. Irenka mit dunkelblau schimmernder Dauerwelle stieg aus. Uns hielt nichts mehr, wir sprinteten über die Landstraße und den Hügel hinunter. Irenka schlang beide Arme um uns, knutschte unsere Wangen ab und drückte dabei die Rüschen ihres Oberteils in unsere Gesichter. „Oh, wie schön, euch wiederzusehen!“
Stachu bewegte zur Begrüßung nur kurz das Kinn auf und ab.
Als Nächstes kamen die Ogonek-Schwestern auf den Platz gelaufen. Daria Ogonek trug ein langes Kleid, in dem sie aussah wie eine Heiligenfigur. Ola Ogonek erschien dagegen mit über den Knien abgeschnittenen Leggings und einem LZS-Sokół-Salesche-Trikot, das die alte Rückennummer ihres Bruders trug. Olas lange, dunkelblonde Haare kräuselten sich an den Schläfen, und sie versuchte, sie mit den Kopfhörern ihres Walkmans platt zu drücken. Was sie nur noch hübscher machte.
Andrzej hatte für keine der Ogonek-Schwestern etwas übrig. Er stand am Heck des Autos, schaute nachdenklich drein und schnüffelte den Abgasen nach. „Ganz klar, höhere Oktanzahl.“
Auf der Rückbank des Jetta hätten es sich drei Leute gemütlich machen können, aber dass wir einstiegen, hätte weder der alte noch der neue Stachu zugelassen. Also hielten wir die Hände schirmartig vor die Stirn und glotzten durchs Seitenfenster. Andrzej erklärte mir aufgeregt, was es womit auf sich hatte. Da gab es das Radio mit Kassettendeck, die Tachoanzeige bis 220 km/h, den zweiten Seitenspiegel … Um ehrlich zu sein, interessierten mich Autos nicht sonderlich. Welches Fabrikat oder wie schnell so eine Kiste fuhr und ob du darin Kassetten oder nur den Fahrtwind hören konntest, war mir egal. Es hätte auch ein Fuhrwerk vor uns stehen können. Viel wichtiger war mir, wo das Gefährt herkam.
„Unglaublich“, fasste Andrzej kopfschüttelnd zusammen. „In Deutschland kann sich sogar ein Debiler so ein Auto leisten.“
Und dann stakste auch noch Ogonek senior – Stachus, Olas und Darias Vater – gemächlich auf uns zu. Mit Daumen und Zeigefinger strich er sich die dickste Oberlippenbürste von Salesche glatt. Der alte Ogon, wie wir ihn heimlich nannten, hatte kantige Arme und einen breiten Brustkorb, den Teint eines durchgesessenen Ledersofas und ansonsten nur zwei, drei Gesichtsausdrücke zu bieten, die unter den dicken, schwarzen Schnurrbartborsten allerdings schwer voneinander zu unterscheiden waren. Er hortete ein üppiges Weinfass im Keller und unzählige leere Flaschen in seiner Werkstatt. Vor allem aber besaß er die Autorität, kleine Dorfköter wie Andrzej und mich mühelos zu verscheuchen.
Nach der Mittagszeit war Stachus Jetta schon wieder verschwunden, dafür lenkte Herr Paweł seinen Wagen auf die Wiese vor unseren Block. Alle paar Wochen klapperte Herr Paweł die Dörfer der Region ab. Sobald das typische Gedudel aus seinem Lautsprecher ertönte, strömten die Bewohner heran und formten eine Schlange bis zur Müllkippe. Auf seiner Motorhaube breitete er ein Tischtuch aus und drapierte darauf auswärtiges Waschmittel, Kaffeebüchsen und Unmengen an Schokolade, Weingummis, sauren Drops und diesen bunten Kaugummikugeln, die in lange, goldene Streifen eingeschweißt waren. Wie jedes Mal kaufte ich die Kugeln. Dann half ich Andrzej, einen großen Karton Waschpulver ins oberste Stockwerk zu schleppen.
Zurück an der frischen Luft, verschwanden wir auf der Rückseite der Häuser und duckten uns unter den Balkonen entlang. Am PGR-Gelände, das direkt an die Siedlung anschloss, bogen wir ab. Wir zogen das dicke Brett aus den Sträuchern, keilten es zwischen Fabrikmauer und Lehmboden und konnten so aufs Vordach der stillgelegten Schnapsfabrik klettern und von dort über eine Leiter auf das richtige Dach. In Kommune-Zeiten hatte Opa Edmund in der Schnapsfabrik gebrannt. Wegen des alten Gauners hatte meine Familie immer etwas Spiritus im Haus gehabt. Mittlerweile aber war alles Nützliche aus der Fabrikhalle entfernt worden. Außer Klebstoffschnüfflern verirrte sich niemand mehr dorthin.
Auf dem Fabrikdach hatten wir einen Topf mit Aroniabeeren deponiert. Einige Tage zuvor hatten wir sie zerstampft und mit Zucker eingedeckt, um daraus köstlichen Sirup zu gewinnen. Jetzt rührten wir Selbstgebrannten in den Sirup, wie ich es mir von Opa Edmund abgeschaut hatte.
„B-R-D?“ Andrzej ließ ein Backsteinbröckchen auf der Handfläche hüpfen. „Oder D-D-R? Wie heißt das Reich jetzt eigentlich?“
„Deutschland“, sagte ich.
Er schaute mich an.
„Einfach Deutschland, denke ich.“
„Und dann wohnst du in Hannover?“
Meine Eltern hatten die klare Absicht, Polen für immer den Rücken zu kehren. Offiziell behaupteten wir aber nur, meine seit Jahren in Deutschland lebende Oma Agnieszka zu besuchen. Meine Eltern hatten mir eingebläut, unser wahres Ziel keinesfalls preiszugeben. Aber Andrzej war mein bester Freund, und neben all den Dingen, die er besser konnte als ich, konnte er vor allem eins: die Klappe halten, wenn’s darauf ankam.
„So steht es in Omas Einladung“, sagte ich. „Aber wir fahren direkt ins Lager Friedland.“
„Die will wohl was wiedergutmachen“, sagte Andrzej.
„Wie kommst du denn darauf?“
„Na, sie hat ihren Sohn verraten. Deinen Vater. So was verjährt nicht.“
„Sie hat –“, sagte ich, aber Andrzej war schneller.
„Die meisten holt irgendwann das schlechte Gewissen ein. Schuldgefühle, uralte christliche Tradition. Du weißt schon.“
„Ich glaube ihr. Nach wie vor“, sagte ich. „Oma hat ihre Arbeit immer sehr ernst genommen.“
„Hast du den Brief mit ihrer Einladung denn selbst gelesen?“
„Wieso?“
„Vielleicht hat deine Oma ja eine Beichte mitgeschickt!“
„Sie hat Vater damals nicht in die Scheiße geritten, das stimmt einfach nicht.“
Andrzej schleuderte den abgebrochenen Backstein in den Teich hinter der Fabrik. Das Geschoss flog so weit, dass ich erst wieder das Aufkommen auf der Wasseroberfläche sehen konnte. Er senkte den Blick, seine Augenringe traten noch stärker hervor.
„Kennst du das Märchen von der Schlange?“, fragte er.
Mir war kein Märchen mit Schlange geläufig. Nur das von Adam und Eva, aber es wäre zu dumm, danach zu fragen, dachte ich, denn das kannte nun wirklich jedes Kind auswendig.
Während ich überlegte, verflog Andrzejs düsterer Blick, er trank aus dem Topf, grinste wieder und boxte gegen meinen Oberarm. „Sieh dich doch mal um. Den Siff hier musst du nie wieder ertragen. Freu dich gefälligst, Sobota!“
Andrzej war der Einzige, der mich mit meinem Nachnamen ansprach. Ansonsten wurde ich Jarek genannt. Nur Mutter rutschte manchmal Jareczek raus, und die Klassenlehrerin nahm es ganz genau und blieb konsequent bei meinem Taufnamen Jarosław.
„Und du musst auch nie wieder diesen Kleister trinken“, sagte Andrzej, als mir die matschigen Beeren vom Boden des Topfes ins Gesicht klatschten. Er schnalzte mit der Zunge, als wollte er den süßlich-fauligen Geschmack zwischen den Zähnen wegsaugen.
Er hatte recht. Es gab genügend Gründe, mich zu freuen. „Nie wieder polnisches Bier“, jubelte ich, obwohl ich gar nicht wusste, wie das deutsche schmeckte, und selbst polnisches Bier hatte ich erst einmal, auf Stachus und Irenkas Hochzeit, heimlich probiert. Das hatte so lala geschmeckt. Andrzej grinste grotesk. Unser Aufgesetzter hatte ihm knallrote Clownslippen gemalt.
Der Topf ging weiter hin und her, und wir zählten auf: Nie wieder Feldarbeit! Nie wieder in roter Sporthose und weißem Turnhemd das Land bejubeln! Nie wieder den PGR-Direktor abwimmeln! Jeden Monat, wenn seine Frau ihre Periode hatte, soff der Direktor tagelang durch und klingelte irgendwann verzweifelt bei uns, um sich eine Halba zu borgen, die ich erst rausrückte, wenn er drohte, andernfalls in mein Bett zu hüpfen.
Irgendwann beschlossen wir, Andrzejs Mutter in Strzelce zu besuchen. Auf den Bus wollten wir nicht warten. Die paar Kilometer, so glaubten wir, würden wir auch ohne Weiteres zu Fuß schaffen. Schwer zu sagen, ob wir den Topf verloren hatten, weil wir unbedingt Wiesenblumen für Andrzejs Mutter sammeln wollten, oder ob wir ihn leer getrunken hatten. Ich weiß aber noch, dass meine Augenhöhlen zu brennen begannen, als wir über die Landstraße torkelten. Übelkeit pumpte in mir auf und ab, und ich hielt mir den Bauch. Die alten Beeren, der viele Zucker. Und vielleicht war auch das Mischverhältnis etwas zu krass ausgefallen. Ich schaute zu Andrzej. Der ließ sich überhaupt nichts anmerken.
„Nie wieder auf den Müllberg kacken, weil der alte Herr den Schlüssel von innen hat stecken lassen, nie wieder Kohlenschleppen, nie wieder …“ Je weiter Andrzej sich in seine Aufzählung hineinsteigerte, desto mehr revoltierte mein Magen. „Nie wieder Sonntagsmesse, nie wieder Beten vorm Schlafen, nie wieder mit dem Rohrstock auf die Finger, wenn wir im Unterricht Schlesisch reden …“
Die rechteckigen, abgemähten Felder sahen aus wie Wellen, die Wrackteile vor sich hertrugen. Ich musste mich hinknien. Mich auf dem Asphalt abstützen. Andrzej dagegen hatte die Arme von sich gestreckt, in den Fäusten Mohnblumen, und drehte sich so schnell im Kreis, dass ihn ein Schein umgab. Vom Zusehen wurde mir immer schwindeliger. Die von Kastanien gesäumte Allee fing an zu schwanken, und auch die Straße schlug jetzt Wellen, in denen die Leitpfosten ertranken.
Dann ließ ein grässliches Quietschen uns zusammenfahren und die Ohren zuhalten. Stachus Jetta stand quer auf der Fahrbahn.
„Was ist denn in euch gefahren?“, schrie Stachu uns aus dem offenen Seitenfenster an. Er sprang aus dem Wagen und baute sich vor uns auf. „Ihr habt verdammtes Schwein gehabt, dass ich euch nicht über den Haufen gefahren habe. Ja pierdolȩ!“, fluchte und gestikulierte er wild mit den Armen, und in seiner Jeans-Fransen-Kluft hatte er plötzlich eine unverschämte Ähnlichkeit mit dem polnischen Adler.
„Hoho, Herr Stachu“, höhnte Andrzej von der Rückbank, nachdem der uns unter permanentem Fluchen schließlich doch in sein Heiligtum gelassen hatte. „Wie ich sehe, haben Sie großzügig eingekauft.“ Andrzej hatte die mit Kabanosy, Frankfurterki und saftigen Leberwürsten gefüllten Tüten geöffnet. „Etwa für den lieben Herrn Papa?“, fragte er und kippte eine Tüte zwischen uns auf die Sitzbank aus.
„Das sind Lebensmittel, du gottverdammter Nichtsnutz“, schrie Stachu von vorne.
Andrzej grüßte militärisch.
„Ihr besoffenen …“ – Stachu Ogonek mochte zwar mit deutschem Auto und deutschem Pass zurückgekommen sein, auf dieser kurzen Strecke aber spielte er einwandfrei die Klaviatur polnischer Fluch-Kunst rauf und runter.
Andrzej jedoch ließ das völlig kalt. Der Reihe nach beschnüffelte er die Würste und fuhr mit der Zunge darüber. „Mmmmmhh“, machte er bei jeder einzelnen, und wie der alte Ogon zog er dabei mit Daumen und Zeigefinger seine Oberlippe straff.
Als wir die Wohnblocks erreichten, ging Stachu voll in die Eisen, der Wagen machte eine halbe Drehung auf dem Schotter. Andrzej kippte zu mir herüber und verteilte dabei einen Schwall dunkelroter Kotze über die Metzgerware. Es roch bestialisch. Stachu hechtete ums Auto herum, riss in einer fließenden Bewegung die Hintertür auf, musste sich einen Jeansflügel unter die Nase halten und zerrte mit dem anderen Arm Andrzej heraus.
„Mein schönes Auto!“, brüllte er.
Andrzej knallte mit dem Gesicht voran auf die Wiese. Und als wolle er einen Freistoß schießen, trat Stachu ihm in den Bauch. Andrzej schnappte nach Luft, verschluckte sich und rollte zusammengekrümmt zur Seite.
Ich kauerte noch immer auf der Rückbank. Zitternd vor Angst, Stachu würde auch mich so verdreschen. Durch die Autoscheibe beobachtete ich, wie er sich zu Andrzej hinunterbeugte und wie ihm dabei die Sehnen im Nacken hervortraten.
„Wenn du so weitermachst, Dombrowski, können wir dich bald neben deine Mutter in die Erde legen“, hörte ich ihn zischen.
Schließlich holte er mit angewiderter Miene die Monatsration an Würsten aus dem Auto und trug die versaute Ware laut fluchend zum Müllberg.
Erst als Stachu im Hauseingang verschwunden war, wagte ich es, aus dem stinkenden Jetta hervorzukommen.
Andrzej atmete laut. Ich beugte mich zu ihm, fasste nach seiner Schulter. Er knurrte. Ich hielt ihm den Streifen bunter Kaugummikugeln hin. Er schnappte danach und schleuderte ihn weg. Vorsichtig legte ich mich neben ihn auf die Wiese. Ich verschränkte die Hände hinterm Kopf und blinzelte in den leicht bewölkten Himmel. Die Gardinen in den Fenstern bewegten sich. Wir hörten die Autos über die Landstraße nach Lichynia und nach Strzelce fahren, aber keines hielt mehr bei uns an. Es wurde laut, als die Mähdrescher über die Hügel auf die Landstraße zumarschierten. Hummeln und Luzernenhalme schwebten durch die Sommerluft.
„Nie wieder Mähdrescher schauen“, sagte ich, denn das war es doch, wovon wir wirklich wegwollten. „Nie wieder …“, spielte ich weiter und dachte, das würde Andrzej freuen, ihn irgendwie trösten.
Mein Freund hob den Kopf, gerade so hoch, dass mich seine verquollenen Augen anvisieren konnten. Er spuckte einen Grashalm aus. Blut lief ihm aus der Nase.
„Kennst du also das Märchen von der Schlange?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Verpisssssss dich!“
Das dritte Auto von außerhalb hielt einige Tage später für uns. Ich hockte mich zu Mutter auf die Rückbank, während Vater vorne einstieg und Herrn Hübner, unserem Fahrer, große Scheine in die Hand zählte. Hupend und aus den Fenstern winkend, bogen wir auf die Landstraße ein und machten uns davon. Meine weinende Tante, mein winkender Onkel, meine Cousins und Cousinen, Ola Ogonek, mein bester Freund Andrzej, die Wohnblocks, die Schnapsfabrik, die Wiesen und Felder und alles Vertraute blieben zurück. Ich schaute noch lange durch die Heckscheibe, und als kein Geruch von Brennholz, frischem Heu oder gepanschtem Aroniabeeren-Sirup mehr durch meinen Kopf schwirrte, sagte ich zu mir selbst: „Nie wieder Salesche.“
KAPITEL 2
Wir kamen im oberschlesischen Teil Polens zur Welt. Wir wurden katholisch getauft. Wir beteten zu Gott. Wir besuchten sonntags seine Kirche, und nach der heiligen Messe aßen wir gemeinsam zu Mittag. Meine Eltern und ich. Oma und Opa. Hin und wieder kamen Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen dazu. Jeden Sonntagmittag wurde in unserem Wohnzimmer der Tisch erweitert, wurden Stühle dazugeholt, so saßen wir dann zusammen als große Familie Sobota.
In weißem Porzellan servierten wir als ersten Gang Nudelsuppe. Dann Kartoffelklöße und Rotkohl und gebratenes Fleisch von den Tieren aus unserem Stall. Wir hielten Hühner, Enten und Gänse, und mit unseren Nachbarn teilten wir uns ein Schwein. Nach dem traditionellen Sonntagsessen blieben wir am Tisch sitzen. Schnaps und Anekdoten wurden ausgepackt, und wir lachten viel und erinnerten uns an die, die nicht mehr bei uns sein konnten. Das hatte Tradition in unserer Familie.
Doch dann war es zum Zerwürfnis mit Oma Agnieszka gekommen. Seitdem hatten wir auch an den Sonntagen nur noch zu dritt am Tisch gesessen.
Der Proviant drohte nach vorne zu hoppeln. Mutter und ich mussten mit je einer Hand die randvolle Tasche festhalten, mit der anderen krallten wir uns in die Sitzpolsterung. Brötchen, mit Butter beschmiert und mit hart gekochten, in Scheibchen geschnittenen Eiern belegt, eine Thermoskanne Kaffee, Wasserflaschen, Salzstangen, nicht zu vergessen die Einmachgläser mit Gewürzgurken und eingekochtem Sellerie, und ich weiß nicht, was sonst noch alles, waren in der Provianttasche verstaut.
Unserem Fahrer schien es egal zu sein, dass der Combi über die auseinanderklaffenden Betonplatten hämmerte und dass davon die Stoßdämpfer kaputtgehen konnten. Jedes Mal, wenn er auf die Uhr blickte, war das der Auftakt für sein nächstes Überholmanöver. Dabei zog Hübner sich mit gefletschten Zähnen ans Lenkrad, wich auf die Gegenspur aus und beschleunigte weiter. Weil das Lenkrad nicht herauszureißen war, klebte er mit der Stirn an der Windschutzscheibe. Der Motor jaulte wie ein sterbendes Schwein, die Tachonadel zitterte nach rechts, wir wurden von ungekannten physikalischen Kräften in die Sitze gedrückt. Auf der Höhe des zu überholenden Fahrzeugs drehte Hübner den Kopf nach rechts und schaute so grimmig hinüber, dass nur jemand, der noch wahnsinniger war als er, auf die Idee hätte kommen können, uns auf dieser Strecke wieder zu überholen. Stachus Kamikazefahrt mit Vollbremsung war vertrauenerweckend gewesen gegen Hübners Versuchen, die Schallmauer zu durchbrechen. Allein beim Gedanken an den Proviant drehte sich mir fast der Magen um.
Freu dich gefälligst, Sobota.
Als Kiefernwälder an uns vorbeirauschten, hatten wir das Grenzgebiet erreicht. Die Bäume waren hoch gewachsen wie Plattenbauten. Größtenteils war das Astwerk von den Stämmen geschlagen, nur oben trugen sie ihre Krönchen. Vater sagte, das sei so, damit sich keiner im Wald verstecken könne.
Hübner hielt erneut die funkelnde Armbanduhr hoch. Doch diesmal bremste er ab. Kurz vor der Grenze verließ sein Kombi die Fahrbahn und hielt auf eine abgelegene Raststätte zu. Statt an die Zapfsäulen zu fahren, umkurvte er die Station und kam auf einem Parkplatz dahinter zum Stehen.
Hübner holte ein Stofftaschentuch hervor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Bitte. Geht alle ein letztes Mal in eurer geliebten Heimat pissen“, sagte er und schritt mit einem Stück Schlauch in der Hand auf die fast schon im Wald stehenden Taxis zu.
Neben den Parkplätzen erstreckte sich eine Reihe kleiner, schäbiger Marktstände. Dreckige Glühbirnen und Ventilatoren hingen von provisorisch zusammengezimmerten Holzdächern.
„Macht ihr zuerst.“ Vater schüttelte sich die Beine aus. „Ich bleibe beim Auto.“
An einem Marktstand waren Zigarettenstangen aufgetürmt. Daneben baumelte über Pendeltüren ein Schild – BAR. Der Laden daneben verkaufte Zeitschriften, Getränke, Video- und Musikkassetten. Besonders gut schien das Geschäft allerdings nicht zu laufen, die Cover waren staubig und ausgeblichen.
„Prosze bardzo.“ Ein Verkäufer knackte Sonnenblumenkerne zwischen den Zähnen auf und spuckte die Schalen neben sich auf den Boden. „Was darf’s sein?“
„Nur zur Toilette“, sagte Mutter und zog mich weiter. Frühmorgens hatte sie sich Lockenwickler ins Haar gedreht, geschminkt, Parfüm aufgelegt. Sie hatte sich rausgeputzt, als würde sie zu einer großen Familienfeier aufbrechen.
Ich beeilte mich, so schnell wie möglich aus der Klokabine herauszukommen. Wieder draußen, musste ich auf Mutter warten. Ich lehnte an einer Brüstung, so wie ich es bei Sylvester Stallone in Over the Top gesehen hatte. Genau so. Jedenfalls, bis mir die jungen Frauen am Straßenrand ins Auge fielen. Eine hübscher als die andere. Die Schönheit mit den langen, kohlrabenschwarzen Locken trug ein hellgrünes, sehr eng anliegendes Kleid und um die Hüfte eine Bauchtasche. Die noch größere Blondine zupfte an ihrem Paillettenoberteil herum, als ein Auto heranfuhr. Sie winkten, als wollten sie per Anhalter mitfahren, doch das Auto sauste an ihnen vorbei. So schöne Frauen an einer so gottverlassenen Raststätte? Die Bedeutung des Wortes Kurwa kannte ich schon lange, aber ich hatte bis dahin noch nie eine gesehen. Und ich fragte mich, wie diese schönen Frauen hier hingekommen waren und wohin sie gingen, wenn sie nach Hause gingen.
Da hakte mich Mutter plötzlich mit dem Arm unter. „Nicht trödeln, Jareczek.“
Natürlich befreite ich mich sofort aus ihrem Griff.
„Komm schon“, ließ sie jedoch nicht locker. „Papa macht sich sonst in die Hose.“
Vater hatte sich allerdings einige Meter von Hübners Kombi wegbewegt und war umringt von kitschigen Gipsfiguren. Ein Zwerg mit geschulterter Spitzhacke und Laterne schien ihm besonders zu gefallen. Er hob ihn hoch, inspizierte ihn von allen Seiten.
Ein dubioser Verkäufer schwang sich aus seinem Schaukelstuhl. „Der Bergmann. Ist auch mein Liebling.“
Vater lächelte.
„Ich mache Ihnen einen guten Preis.“
„Was meinst du, Jagódka?“ Vater reckte den Zwerg in die Höhe.
„Arek …“ Mutter ging die restlichen Schritte wortlos auf ihn zu, vermutlich, um nicht schreien zu müssen. „Wo soll der hin?“, flüsterte sie gepresst.
„Sobald wir einen Garten haben …“
„Garten?“
„Du hast ihn dir gar nicht richtig angesehen.“
„Wozu? Wir haben keinen Platz für so einen Quatsch.“
„Ich weiß, ich weiß. Ich dachte, später könnten wir den doch in unseren Garten stellen. So ein Zwerg macht sich bestimmt prächtig.“
„Allerdings“, pflichtete der Verkäufer bei. „Ist sehr modern zurzeit.“
„Da hörst du’s.“
„Und wo im Auto willst du den noch hinpacken?“ Mutters Stimme wurde jetzt doch lauter. „Der Kofferraum ist voll, und hinten will ich das Ding nicht haben.“
„Ich genauso wenig“, ergänzte ich schnell.
„Halt du dich da raus“, sagte Vater zu mir, und zu seiner Frau: „Der kommt auf meinen Schoß.“
„Auf deinen Schoß?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Hast du vergessen, was wir abgemacht haben?“
„Ich weiß, ich weiß, Kochanie. Aber schau mal.“ Vater drehte ihr den Gartenzwerg von allen Seiten hin.
„Wir haben die schönen Porzellanvasen verkauft und das Weihnachtsgeschirr und … Ich mag mich gar nicht dran erinnern. Und jetzt willst du diesen … was soll das sein? Diesen … Dödel mit Zipfelmütze mitschleppen?“
Ich drückte Vater mittlerweile uneingeschränkt die Daumen. Die Vorstellung, er würde mit diesem hässlichen Zwerg auf dem Schoß durch halb Deutschland fahren, war zu köstlich.
Und auch der Verkäufer witterte seine Chance. „Halten Sie ihn mal, gute Frau. So ein Exemplar werden Sie in Deutschland lange suchen. Und erst recht zu dem Preis.“
Missbilligend drehte Mutter sich von ihm weg und zu ihrem Mann hin. „Wenn die an der Grenze den Kofferraum aufmachen und dann diesen –“
„Der kommt doch mit zu mir nach vorn.“
„Oh, Verzeihung. Dein neuer Kumpel aus Gips wird trotzdem die Aufmerksamkeit der Grenzbeamten auf sich ziehen. Auf deinem Schoß sogar noch stärker. Und jetzt stell dir vor, die kapieren, dass das gar keine Urlaubsreise ist. Dann haben wir ein Problem …“
„Im Gegenteil“, sagte Vater freudestrahlend. „Wir besuchen doch meine Mutter.“ Er hob die Augenbrauen. „Und als anständiger Sohn bringe ich ihr ein Geschenk mit.“
„Ich bitte dich, so was niemandem zu schenken. Nicht mal deiner Mutter.“
„Natürlich schenke ich ihr nichts. Die wird genug haben. Aber …“
Egal, was er auch einwandte, Mutter schüttelte gnadenlos den Kopf.
„Kochanie, du hast selbst gesagt … Wir haben etwas abgemacht.“
Jetzt schlug Mutter die Hände über dem Kopf zusammen, ließ wegen der frischen Locken aber sofort wieder davon ab. „Gut“, sagte sie. „Was soll der denn kosten?“
„Zahlen die Herrschaften in Mark oder Złoty?“
„Ihr zahlt am besten gar nix.“ Hübner stand neben seinem Auto. Benzinkanister in der einen, eine pralle Plastiktüte in der anderen Hand und einen Taxifahrer im Schlepptau. „Denn wenn ihr Pech habt, zahlt ihr für diesen Wicht noch Zoll obendrauf.“
Der Verkäufer widersprach ihm vehement. Doch als Hübner die Sonnenbrille abnahm, gab der Mann sich freiwillig geschlagen.
Vater stellte den Gartenzwerg wieder zu den anderen Figuren, schob die Hände in die Hosentaschen und kickte ein Steinchen über den Parkplatz. Dann verzog er sich in Richtung der Toiletten.
Inzwischen kippte Hübner staatlich subventionierten Kraftstoff in den Tank seines Autos. Er schraubte den Verschluss auf den leer gelaufenen Kanister und reichte ihn dem Taxifahrer. Dann platzierte Hübner noch die pralle Tüte sehr präsent im Kofferraum und schmiss mit einem Knall die Klappe zu.
Als wir alle wieder beisammen waren, setzte sich unser Fahrer hinter das Lenkrad, riss die Folie von einer Kassettenhülle ab, schob die Kassette ins Deck und drehte den Regler auf.
„Auf der Straße nach San Fernando …“
Die hübschen Frauen standen weiter am Wegesrand. Als wir an ihnen vorbeifuhren, winkten sie auch uns zu, und ich winkte kurz zurück. Da fühlte ich mich tatsächlich für einen Moment so cool wie Sylvester Stallone. Und mit diesem Gefühl würden wir den Grenzübergang Olszyna passieren, zum ersten Mal durch Ost- und Westdeutschland düsen, und in den kommenden Tagen würden wir endlich Oma Agnieszka wiedersehen. Glaubte ich zumindest.
KAPITEL 3
Aber kaum befanden wir uns wieder auf der Autobahn, steckten wir im Stau fest, eingekeilt zwischen unzähligen Autos, Bussen und Kleintransportern, die anscheinend alle mit uns über die Grenze wollten. Hübner stellte den Motor und damit auch die Belüftungsanlage ab. Der Sprit sollte bis Friedland reichen. Wie ich fand, war das eine sehr optimistische Rechnung bei seinem Fahrstil. Es wurde augenblicklich so heiß im Wagen, dass wir alle Fenster runterkurbelten, um wenigstens einen Hauch von Abkühlung zu haben. Und dann überbrachte Hübner uns die sämtliche Pläne über den Haufen werfende Nachricht: Von den Taxifahrern hatte er erfahren, dass die zentrale Meldestelle in Friedland überlastet sei. Seit Tagen schon würde man dort alle neu Ankommenden abweisen.
„Und jetzt?“, fuhr Vater hoch. „War’s das also für uns?“
„Beruhig dich, Arek. Ich bringe euch schon nach Deutschland.“
„Und dann? Sollen wir auf der Straße leben?“
„Keine Sorge.“
„Was ist mit Hannover?“, fragte Mutter. „Können wir nicht dort in ein Lager?“
„Ja!“ Ich freute mich. Direkt nach Hannover! Das war eine großartige Lösung. Friedland klang zwar idyllisch, aber Hannover, das war die Großstadt. Das war … das war … keine Ahnung, aber Oma lebte dort. Wieso sollten wir es umständlicher machen als nötig? Ich klatschte mit Mutter ab.
Vater verzog das Gesicht, als hätte er sich an Selbstgebranntem verschluckt.
„Keine Chance.“ Hübners Sonnenbrillengläser füllten den Rückspiegel aus. „Erstens weiß ich nicht, wo sich in Hannover ein Lager befindet. Zweitens liegt die Stadt im selben Bundesland wie Friedland und wird deshalb auch über dieselbe Verwaltung abgewickelt. Und wie gesagt, die schicken alle weiter.“
„Und wenn wir tatsächlich zuerst zu Oma fahren, so wie es in der Einladung steht, ihre Adresse haben wir ja, und von da aus …“
„Auf gar keinen Fall“, unterbrach mich Vater. „Sie hat die Einladung geschickt und damit genug.“
Nachdem Omas Einladung eingetroffen war, hatten meine Eltern etwa ein halbes Jahr gebraucht, um Reisepässe und Visa zu organisieren. Sie hatten den Maluch verkauft, den Schrebergarten abgetreten, unsere Habseligkeiten verteilt, bis wir nur noch so viel besaßen, wie in einen Kofferraum passte. In den letzten Tagen vor der Abfahrt hatten die Zimmer gespenstisch gewirkt. Die Gardinen hatten sie hängen lassen, und auch unser Name war an der Tür geblieben. Falls es schiefgehen sollte.
Ohne Einladung ging so was jedenfalls nicht. Die polnischen Behörden verlangten es. Ein Schriftstück, in dem jemand mit Wohnsitz in Deutschland – und dazu zählten weder Notwohnungen noch Lageradressen – garantierte, uns für die Zeit unserer Visa bei sich aufzunehmen. Außerdem mussten wir den Behörden das Bargeld für die Reise vorzeigen. Mindestens 50 D-Mark pro Tag.
Wie gesagt, war die Einladung für uns nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck war, Polen für immer zu verlassen. Wenn wir aber in Deutschland bleiben wollten, mussten wir in einer zentralen Aussiedlerlandesstelle unsere Anträge einreichen, solange unsere Visa gültig waren.
„Die nächste mir bekannte Aufnahmestelle liegt im Ruhrgebiet“, erklärte uns Hübner. „Gut zweihundert Kilometer weiter.“
„Ruhrgebiet?“, fragte Mutter.
„Nordrhein-Westfalen.“
„Nordrhein-Westfalen klingt doch prima“, sagte Vater auffallend schnell und als wüsste er irgendetwas über den Landstrich. Er kannte zwar Schalke, den BVB und eventuell den VfL Bochum, aber das war’s dann auch schon. Was ihn wirklich freute, war offensichtlich: Nordrhein-Westfalen lag weiter weg von Oma Agnieszka.
Ich war fassungslos. Wir vertrauten Gerüchten, die Benzin verhökernde Taxifahrer an der Grenze von Durchreisenden aufgeschnappt hatten. Bei uns im Dorf ging so was klar, aber doch nicht in dieser heiklen Situation.
„Nordrhein-Westfalen klingt doch prima“, äffte ich Vater nach.
An seiner Schläfe zeichnete sich die Anspannungsader ab wie ein Fluss auf der Landkarte.
Ich dachte an Andrzejs Worte, Oma habe sicher etwas wiedergutzumachen. „Sie hat die Einladung doch nicht ohne Grund geschickt“, sagte ich. „Ich bin sicher, sie will auch, dass die Familie endlich wieder zusammenkommt.“
Vater fuhr herum und blaffte mich an, mir diesen Quatsch schleunigst aus dem Kopf zu schlagen.
Hübner atmete laut aus. „Klärt das untereinander, Leute. Ich würde euch aber raten, keine Zeit zu verschwenden und direkt ins Ruhrgebiet zu fahren.“ Er schnallte sich ab und stieg aus. Die Fahrertür ließ er wie ein Scheunentor offen stehen. „Arek, falls der Konvoi in Bewegung geraten sollte“, sagte er, „rutschst du auf meinen Platz und fährst vor, hörst du? Schlüssel steckt. Ich geh mir mal die Beine vertreten.“
Vaters Gesicht hellte sich auf. Er rutschte sofort auf den Fahrersitz rüber.
„Glaubst du Hübner?“, fragte Mutter nach einer Weile.
Vater knetete mit beiden Händen das genoppte Leder des Lenkrads. „Was?“
„Ob du Hübner die Geschichte von den Taxifahrern glaubst?“
„Wieso nicht? Denkst du, er hält uns zum Narren?“
„Ist doch seltsam.“
„Stachu Ogoneks Karre ist reinster Schrott im Vergleich hierzu“, sagte Vater und rutschte mit dem Hintern auf dem Sitzbezug aus Holzperlen hin und her.
„Er wohnt doch in der Nähe von Dortmund“, sagte Mutter. „In Nordrhein-Westfalen.“
„Ja, und?“
„Er müsste also keinen Umweg fahren und könnte auch noch die längere Strecke berechnen. Vielleicht linkt er uns.“
„Aber ich habe ihn doch schon im Voraus bezahlt.“
„Da dachte Hübner auch noch, er muss uns nur nach Friedland bringen. Hinterher wird er dir die gesamte Strecke berechnen.“
„Das ist sein Pauschalpreis“, erwiderte Vater, an den Holzperlen zwischen seinen Beinen zupfend. „Er hätte dasselbe verlangt, wenn er uns nur bis nach Berlin hätte kutschieren sollen. Für Hübner wäre es sogar lukrativer, uns früher loszuwerden. Durch unseren Ballast frisst der Motor Sprit wie ein Traktor.“
Mutter hatte den Kopf in den Nacken gelegt und musterte die Innenverkleidung des Wagens.
„Wie viele Menschen passen denn ins Lager Friedland?“, fragte ich.
„Voll ist voll“, seufzte Mutter.
„Mariusz Hoffmann gehört zu den interessanten jungen Stimmen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.“
„Mariusz Hoffmann erzählt geradlinig und empathisch von Ankunft und Bleiben, Abschied und Wiederfinden. ... Eine unterhaltsame Lektüre, die zugleich Verständnis fördert für eine Erfahrung, die viele Einwanderer aus Osteuropa Anfang der Neunziger gemacht haben.“
„›Polnischer Abgang‹ ist ein Buch, das sehr gut in unsere von Migration geprägte Gegenwart passt.“
















Eine sehr warmherzige und humorvolle Auswanderungsgeschichte.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.