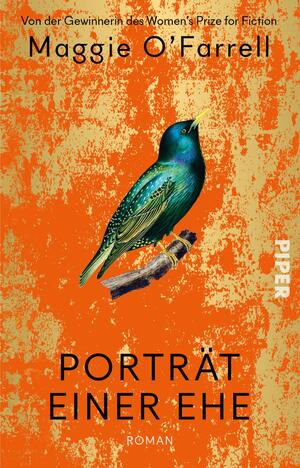
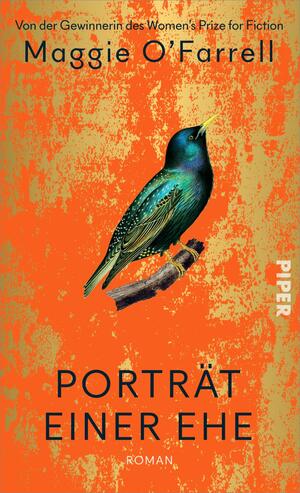
Porträt einer Ehe Porträt einer Ehe - eBook-Ausgabe
Roman
— Sunday-Times-Bestseller | Women’s Prize for Fiction 2023 LonglistPorträt einer Ehe — Inhalt
„Er blickt dich an und sieht, was du um jeden Preis verbergen willst.“
Ein Mal hat Lucrezia den Mann gesehen, mit dem sie als Zwölfjährige verheiratet werden soll. Am Hof von Florenz wächst die Tochter aus dem Hause Medici auf wie in einem goldenen Käfig. Niemand versteht das künstlerisch begabte, feinsinnige Mädchen, das lieber mit Tieren spricht als mit den Geschwistern – außer ihrem Zukünftigen, Alfonso, der ihr tief in die Seele zu schauen scheint. Bringt das Leben mit dem Herzog von Ferrara ihr die ersehnte Freiheit? Oder doch den Tod?
„O’Farrell ist eine Meisterin der Gegenwärtigkeit. Sie schafft es, vergangene Zeiten so unmittelbar zu beschreiben, als atme man deren Sein.“ Brigitte Woman
„Ein fein ziselierter, modern anmutender psychologischer Roman. Die Sätze fließen unangestrengt, doch anspielungsreich, die Figuren kommen uns nahe.“ Neue Zürcher Zeitung
„Ganz große Kunst!“ emotion
Leseprobe zu „Porträt einer Ehe“
Ein schauriger, einsamer Ort
Fortezza bei Bondeno, 1561
Lucrezia nimmt Platz am langen Esstisch, der zu fahlem Glanz poliert und vollgestellt ist mit Geschirr, auf dem Kopf stehenden Kelchen und einem Kranz aus Tannenzweigen. Ihr Mann setzt sich neben sie, nicht an seinen gewohnten Platz am anderen Ende des Tisches, sondern so dicht neben sie, dass sie ihren Kopf auf seine Schulter legen könnte, wenn sie wollte. Er entfaltet seine Serviette, richtet das Messer aus und zieht die Kerze zu ihnen hin, als Lucrezia mit seltsamer Klarheit – als blickte sie [...]
Ein schauriger, einsamer Ort
Fortezza bei Bondeno, 1561
Lucrezia nimmt Platz am langen Esstisch, der zu fahlem Glanz poliert und vollgestellt ist mit Geschirr, auf dem Kopf stehenden Kelchen und einem Kranz aus Tannenzweigen. Ihr Mann setzt sich neben sie, nicht an seinen gewohnten Platz am anderen Ende des Tisches, sondern so dicht neben sie, dass sie ihren Kopf auf seine Schulter legen könnte, wenn sie wollte. Er entfaltet seine Serviette, richtet das Messer aus und zieht die Kerze zu ihnen hin, als Lucrezia mit seltsamer Klarheit – als blickte sie durch gefärbtes Glas oder vielmehr als täte sie dies mit einem Mal nicht mehr – begreift, dass er beabsichtigt, sie zu töten.
Sie ist sechzehn Jahre alt, seit einem knappen Jahr verheiratet. Ihr Mann und sie sind den größten Teil des Tages unterwegs gewesen, sind, um das bisschen Tageslicht in dieser Jahreszeit zu nutzen, im Morgengrauen aus Ferrara losgeritten zu einer Jagdhütte, wie er sagte, draußen im Nordwesten des Herzogtums.
Das sei doch keine Jagdhütte, hatte Lucrezia sagen wollen, als sie ihr Ziel erreichten: ein Gebäude mit hohen Mauern aus dunklem Stein, auf der einen Seite flankiert von dichtem Wald und auf der anderen von einer Flusswindung des Po. Am liebsten hätte sie sich im Sattel umgewandt und gefragt: „Wozu hast du mich hierhergebracht?“
Doch sie sagte nichts, ließ ihre Stute folgen auf dem Weg durch triefende Bäume, über die gebogene Brücke hinein in den Hof des seltsamen, befestigten, sternförmigen Gebäudes, das ihr schon da merkwürdig menschenleer vorkam.
Die Pferde sind mittlerweile weggeführt worden, sie hat den durchnässten Umhang und Hut abgelegt, während Alfonso sie beobachtete, mit dem Rücken zum Kamin stehend, wo ein Feuer lodert; nun bedeutet er den bäuerlichen Bediensteten im Schatten des Saals vorzutreten, die Teller mit Essen zu füllen, Brot zu schneiden, Wein in die Kelche zu gießen, und Lucrezia erinnert sich plötzlich an die heiser geflüsterten Worte ihrer Schwägerin: „Dir wird die Schuld zugeschoben werden.“
Lucrezias Finger umklammern den Rand ihres Tellers. Dass ihr Mann ihren Tod will, steht ihr so klar vor Augen, als hätte sich ein dunkel gefiederter Raubvogel auf der Armlehne ihres Sessels niedergelassen.
Das ist der Grund für ihre hastige Reise an einen so schaurigen, einsamen Ort. Er hat sie hierhergebracht, in diese steinerne Festung, um sie zu ermorden.
Verblüffung reißt sie aus ihrem Körper, und beinahe lacht sie: Sie schwebt unter der gewölbten Decke und blickt hinab auf sich und ihn, wie sie am Tisch sitzen, Brühe schlürfen und sich gesalzenes Brot in den Mund schieben. Sie sieht, wie er sich zu ihr herüberlehnt, wie seine Finger leicht auf der nackten Haut ihres Handgelenks ruhen, während er ihr etwas sagt; sie sieht sich ihm zunicken, das Essen herunterschlucken, Worte sagen über die Reise und die interessante Landschaft, die sie durchquert haben, als stünde alles zum Besten, als wäre dies ein normales Abendessen, nach dem sie zu Bett gehen würden.
In Wirklichkeit, denkt sie, noch immer oben unter dem schwitzenden Mauerwerk der Saaldecke, war die Reise von der Stadt hierher langweilig, durch öde und gefrorene Felder, der Himmel so schwer, dass er schlaff auf die Wipfel der kahlen Bäume herabzuhängen schien. Ihr Mann hatte die Pferde im Trab gehen lassen, Meile um Meile war sie im Sattel auf und ab geruckelt, mit schmerzendem Rücken, die Beine wund gerieben von den nassen Strümpfen. Trotz der mit Eichhörnchenfell gefütterten Handschuhe waren ihre Finger starr vor Kälte gewesen, während sie die Zügel umklammerten, und die Mähne ihrer Stute war schon bald von Eis überzogen. Ihr Mann war vorangeritten, mit zwei Wächtern hinter sich. Als die Stadt dem Land gewichen war, hatte Lucrezia ihr Pferd anspornen, ihm die Fersen in die Flanken drücken, seine Hufe über Stock und Stein fliegen lassen, durch das flache Tal galoppieren wollen – doch sie wusste, dass sich dies nicht ziemte, dass ihr Platz hinter ihrem Mann war oder, falls sie dazu aufgefordert wurde, neben ihm, nie aber vor ihm, und so trabten sie weiter und weiter.
Nun, da sie am Tisch den Mann anblickt, von dem sie vermutet, dass er sie ermorden will, wünscht sie, sie hätte es getan und ihre Stute zum Galopp angespornt. Sie wünscht, sie wäre an ihm vorbeigejagt, kichernd vor Lust am Verbotenen, mit flatterndem Umhang und flatterndem Haar, während der eisige Schlamm von den Hufen aufspritzte. Sie wünscht, sie wäre den fernen Hügeln entgegengeprescht, um sich in den felsigen Klüften und Höhen zu verlieren, wo er sie nie gefunden hätte.
Die Ellbogen zu beiden Seiten seines Tellers aufstützend, erzählt Alfonso, wie er als Kind schon in diese Hütte – er beharrt auf dem Wort – gekommen sei, wo sein Vater ihm das Jagen beigebracht habe. Sie hört, er habe Pfeil um Pfeil auf eine Zielscheibe an einem Baum schießen müssen, bis seine Finger bluteten. Sie nickt und gibt in den richtigen Momenten mitleidiges Gemurmel von sich, doch viel lieber würde sie ihm in die Augen blicken und sagen: „Ich weiß, was du im Schilde führst.“
Würde er sich davon überrumpelt, ertappt fühlen? Hält er seine Frau für naiv, weltfremd, kaum dem Kinderzimmer entwachsen? Sie sieht es alles. Sie sieht, wie sorgfältig und umsichtig er sein Vorhaben geplant hat, wie er sie von den anderen getrennt und sichergestellt hat, dass ihr Gefolge in Ferrara zurückbleibt, dass sie allein ist, dass niemand aus dem castello hier ist, nur sie und er, zwei Wachen draußen und drinnen eine Handvoll Leute vom Land, die sie bedienen.
Wie will er es anstellen? Ein Teil von ihr würde ihn gern fragen. Mit einem Messer in einem dunklen Gang? Mit seinen Händen um ihren Hals? Mit einem Sturz vom Pferd, der wie ein Unfall wirken soll? Zweifelsohne hat er all diese Möglichkeiten im Repertoire. Aber es müsste schon gut gemacht werden, wäre ihr Rat, denn ihr Vater ist keiner, der die Ermordung seiner Tochter einfach so hinnehmen würde.
Sie setzt den Kelch ab, hebt das Kinn, wendet den Blick ihrem Mann, Alfonso II., Herzog von Ferrara, zu und fragt sich, was als Nächstes geschehen wird.
Die unglücklichen Umstände
von Lucrezias Zeugung
Palazzo, Florenz, 1544
In den folgenden Jahren sollte Eleonora die Art, wie ihr fünftes Kind gezeugt wurde, bitter bereuen.
Stellen Sie sich Eleonora im Herbst 1544 vor: Sie befindet sich im Kartenraum des Florentiner Palazzos und hält sich eine Landkarte dicht vors Gesicht (sie ist ein wenig kurzsichtig, würde das aber niemals zugeben). Ihre Hofdamen stehen etwas abseits, so nah beim Fenster wie möglich: Es ist zwar schon September, doch in der Stadt ist es drückend heiß. Als würde unten im Hof die Luft gebacken; Schwall um Schwall schwappt aus dem steinernen Rechteck zu ihnen hoch. Der Himmel hängt tief und reglos; kein Hauch bewegt die Seidentücher vor den Fenstern, und die Flaggen auf dem Schutzwall des Palazzos hängen schlaff herab. Die Hofdamen fächeln sich Luft zu und tupfen sich die Stirn lautlos seufzend mit einem Taschentuch ab. Sie alle fragen sich, wie lange sie noch hier in diesem getäfelten Raum ausharren müssen, wie viel Zeit Eleonora noch mit dem Betrachten dieser Karte verbringen will und was sie daran bloß so interessant finden mag.
Eleonoras Augen durchstreifen die Silberstiftdarstellung der Toskana: die Gipfel von Hügeln, das aalartige Geschlängel von Flüssen und die nordwärts aufsteigende, zerklüftete Küstenlinie. Ihr Blick schweift über die Landstraßen, die sich verknoten für die Städte Siena, Livorno und Pisa. Eleonora ist sich ihrer eigenen Seltenheit und ihres Wertes wohl bewusst: Sie hat nicht nur einen Körper, der eine ganze Reihe von Erben hervorzubringen vermag, sondern auch ein schönes Gesicht mit einer Stirn wie geschnitztes Elfenbein, weit auseinanderliegenden tiefbraunen Augen und einem Mund, der schön ist, ob sie nun lächelt oder schmollt. Darüber hinaus verfügt sie über einen raschen, unsteten Verstand. Sie kann im Gegensatz zu den meisten Frauen aus dem Gekritzel auf dieser Karte Kornfelder, Weinberge, Ernten, Bauernhöfe, Klöster und Zehnten zahlende Bauern herauslesen.
Sie legt die Karte hin, und gerade als ihre Hofdamen die Röcke raffen, um in besser belüftete Räumlichkeiten aufzubrechen, nimmt Eleonora eine andere Karte. Sie studiert das Gebiet nahe der Küste; dort scheint nichts verzeichnet zu sein außer ein paar vagen, unregelmäßigen Wasserflächen.
Wenn Eleonora eines nicht ertragen kann, dann ist das Nutzlosigkeit. Unter ihrer Ägide ist jeder Raum, jeder Gang, jedes Vorzimmer dieses Palazzos renoviert und mit einem Zweck versehen worden. Jede nackte Wand ist geschmückt und verschönert worden. Keinem ihrer Kinder, keiner ihrer Bediensteten oder Hofdamen ist auch nur eine Minute der Untätigkeit gestattet. Von morgens bis abends werden sie auf Trab gehalten durch einen Stundenplan, den Eleonora aufgesetzt hat. Wenn sie nicht schläft, erfüllt sie eine Aufgabe: schreibt Briefe, lernt Sprachen, erstellt Pläne und Listen oder überwacht die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder.
In Eleonoras Kopf regen sich Ideen, was mit dem Marschland zu tun wäre. Man muss es trockenlegen. Nein, man muss es bewässern. Man könnte Feldfrüchte anpflanzen. Man könnte eine Stadt bauen. Man könnte Seen anlegen, um Fische zu züchten. Oder ein Aquädukt oder ein –
Ihre Gedanken werden unterbrochen durch das Geräusch einer aufspringenden Tür, gefolgt von Stiefeln auf dem Boden: ein selbstbewusster, zielstrebiger Schritt. Sie dreht sich nicht um, sondern lächelt vor sich hin, während sie die Karte gegen das Licht hält und sieht, wie die Sonne Berge, Städte und Felder aufleuchten lässt.
Eine Hand legt sich auf ihre Hüfte, eine andere auf ihre Schulter. Sie spürt das gesprenkelte Stechen eines Bartes an ihrem Hals, den feuchten Druck von Lippen.
„Was treibst du, mein fleißiges Bienchen?“, flüstert ihr Mann ihr zu.
„Ich mache mir Gedanken über dieses Gebiet hier“, sagt sie und hält weiter die Karte hoch, „hier an der Küste, siehst du?“
„Mmm“, sagt er, lässt einen Arm um sie gleiten, vergräbt sein Gesicht in ihrem hochgesteckten Haar und drückt ihren Leib mit seinem gegen die harte Tischkante.
„Wenn wir es trockenlegten, könnte man es nutzen, für Landwirtschaft oder Häuser und …“ Sie bricht ab, denn er macht sich an ihren Röcken zu schaffen, hebt sie hoch, damit seine Hand ungehindert von ihrem Knie über ihren Oberschenkel hoch und immer höher wandern kann. „Cosimo“, tadelt sie ihn flüsternd, doch es ist gar nicht nötig, denn ihre Hofdamen sind dabei, sich mit raschelnden Röcken aus dem Zimmer zurückzuziehen, auch Cosimos Berater gehen, drängeln an der Tür, begierig wegzukommen.
Die Tür fällt hinter ihnen ins Schloss.
„Die Luft dort ist schlecht“, fährt Eleonora fort, mit den blassen, schmalen Fingern auf die Karte weisend, als wäre nichts, als stünde kein Mann hinter ihr und versuchte, sich durch die verschiedenen Schichten ihrer Unterkleider einen Weg zu bahnen, „übel riechend und ungesund, und wenn wir …“
Cosimo dreht sie herum und nimmt ihr die Karte aus der Hand. „Ja, mein Schatz“, murmelt er, während er sie erneut gegen den Tisch drückt, „alles, was du sagst, alles, was du willst.“
„Aber Cosimo, du musst nur mal …“
„Später.“ Nachdem er die Karte auf den Tisch geworfen hat, hebt er Eleonora hoch und setzt sie, in der Masse ihrer Röcke wühlend, darauf. „Später.“
Eleonora seufzt resigniert, und ihre Katzenaugen verengen sich zu Schlitzen. Sie sieht ein, dass er von seiner Absicht nicht abzubringen ist. Dennoch packt sie seine Hand.
„Versprichst du es mir?“, fragt sie. „Versprichst du mir, dass ich dieses Land nutzen darf?“
Seine Hand kämpft mit ihrer. Sie tun nur so, das ist ein Spiel, wie beide wissen. Cosimos Arm ist doppelt so dick wie ihrer. Er könnte ihr das Kleid binnen Sekunden vom Leib reißen, mit oder ohne ihre Zustimmung, wäre er eine andere Sorte Mann.
„Ich verspreche es“, sagt er, küsst sie, und sie lässt seine Hand los.
Noch nie, überlegt sie, während er in Gang kommt, hat sie sich ihm verweigert. Und wird es auch nie tun. Es gibt in ihrer Ehe viele Bereiche, in denen sie das Sagen hat, mehr als andere Frauen in ähnlichen Positionen. Ihm ungehinderten Zugang zu ihrem Körper zu gewähren, findet sie, ist ein kleiner Preis für all die Freiheiten und Möglichkeiten, die ihr gewährt werden.
Sie hat bereits vier Kinder und beabsichtigt, mehr zu bekommen, so viele, wie ihr Mann in sie hineinzupflanzen gewillt ist. Eine Herrscherfamilie muss groß sein, um dem Herzogtum Stabilität und Langlebigkeit zu verleihen. Vor ihrer Heirat mit Cosimo drohte diese Dynastie abzusterben, Geschichte zu werden. Und jetzt? Sind Cosimos Herrschaft und die Macht der Region gefestigt. Dank Eleonora gibt es im Kinderzimmer oben bereits zwei männliche Erben, die man dazu ausbilden wird, in Cosimos Fußstapfen zu treten, und zwei Mädchen, durch deren Verheiratung man sich mit anderen Fürstenhäusern verbinden kann.
Sie versucht, sich auf diesen Gedanken zu konzentrieren, denn sie möchte wieder schwanger werden, möchte nicht mehr an die ungetaufte Seele denken müssen, die sie letztes Jahr verloren hat. Sie spricht nie darüber, sagt niemandem, nicht einmal ihrem Beichtvater, dass das perlgraue Gesicht und die gekrümmten Finger dieses Kindes sie noch immer in ihre Träume verfolgen, dass sie sich nach ihm sehnt und sein Verlust in ihr ein großes Loch hinterlassen hat. Das beste Heilmittel gegen diese verschwiegene Schwermut ist, sagt sie sich, so rasch wie möglich wieder ein Kind zu bekommen. Sobald sie wieder schwanger ist, wird alles gut sein. Ihr Körper ist stark und fruchtbar. Das toskanische Volk nennt sie „la fecundissima“, die Fruchtbarste, und das trifft die Sache. Beim Gebären hat sie auch nie so höllische Qualen gelitten, wie man ihr hatte weismachen wollen. Als sie das Haus ihres Vaters verließ, nahm sie Sofia, ihr eigenes Kindermädchen, mit, und diese kümmert sich jetzt um die Sprösslinge. Eleonora ist jung, schön, ihr Mann liebt sie, ist ihr treu und ihr zuliebe zu allem bereit. Sie wird das Kinderzimmer oben unter dem Dach füllen; sie wird es mit Erben vollstopfen, Kind um Kind um Kind gebären. Warum nicht? Nie mehr wird ihr ein Kind vorzeitig entgleiten; das wird sie nicht zulassen.
Während sich Cosimo in der Hitze der Sala delle Carte Geografiche abrackert, seine Berater und Eleonoras Hofdamen im Zimmer draußen lustlos warten, gähnen und einander resignierte Blicke zuwerfen, wendet sich Eleonoras Geist von dem verlorenen Kleinen ab und wieder dem Marschland zu, gleitet dahin über das Schilf, die gelben Schwertlilien, die Büschel struppigen Grases. Er windet sich durch Nebel und Dünste. Er stellt sich Ingenieure vor, die mit Röhren und anderem Gerät anrücken und alles, was klamm, nass und unerwünscht ist, austrocknen. Er schafft üppige Ernten, fette Nutztiere und Dörfer, bevölkert von willigen, dankbaren Untertanen.
Sie legt ihre Arme auf die Schultern ihres Mannes und richtet, während er den Höhepunkt der Lust erreicht, ihren Blick auf die Karten an der gegenüberliegenden Wand: das alte Griechenland, Byzanz, das Römische Reich in seiner ganzen Größe, Sternbilder, unerforschte Ozeane, wirkliche und erfundene Inseln, Berge, deren Gipfel in Gewittern verschwinden.
Unmöglich hätte sie voraussehen können, dass sich dies als Fehler erweisen würde, dass sie ihre Augen schließen und ihren Geist zurück in diesen Raum hätte bringen müssen, zu ihren ehelichen Pflichten, ihrem starken, gut aussehenden Mann, der sie nach all diesen Jahren immer noch begehrt. Wie hätte sie wissen sollen, dass das Kind, das aus diesem Akt hervorgehen würde, so anders als alle anderen sein würde, deren Wesen so freundlich und deren Temperament so ausgeglichen ist? So leicht vergisst man das Prinzip der mütterlichen Prägung. Sie wird sich später Vorwürfe machen dafür, dass sie so abgeschweift, so unaufmerksam gewesen war. Ärzte wie Priester hatten ihr eingeschärft, dass der Charakter eines Kinds durch die Gedanken der Mutter im Augenblick der Empfängnis bestimmt wird.
Doch es ist zu spät. Hier im Kartenraum ist Eleonoras Geist unruhig, ungezähmt, er schweift, wohin er will. Sie schaut sich Karten an, Landschaften, Wildnisse.
Cosimo, Großherzog der Toskana, stößt zum Schluss sein gewohntes knurrendes Keuchen aus und zieht seine Frau sanft an sich; sie wiederum, gerührt, aber auch etwas erleichtert – es ist wirklich heiß –, lässt sich vom Tisch herabhelfen. Sie ruft nach den Frauen, auf dass sie sie in ihre Gemächer geleiten. Ihr sei nach einer Pfefferminz-tisana, sagt sie, einem Nickerchen und einem frischen Unterhemd.
Als ihr neun Monate später ein Kind gezeigt wird, das brüllt und sich windet und sein Wickelzeug von sich wirft, ein Säugling, der weder ruht noch schläft und sich nur durch ständige Bewegung trösten lässt, ein Kind, das die Brust der von Sofia sorgfältig ausgewählten Amme wohl ein paar Minuten lang akzeptiert, sich aber sonst nicht weiter stillen lässt, ein Kind, dessen Augen immer offen sind, als hielten sie nach fernen Horizonten Ausschau, da überkommt Eleonora beinahe so etwas wie Schuld. Ist sie verantwortlich für die Wildheit dieses Kindes? Liegt es an ihr? Sie sagt es niemandem, schon gar nicht Cosimo. Die Existenz dieses Kindes macht ihr Angst, nagt an ihrer Überzeugung, eine gute Mutter zu sein und Nachkommen gebären zu können, die an Körper und Geist gesund sind. Dass eines ihrer Kinder so schwierig ist, so widerspenstig, bringt ihr Bild von sich und ihrer Rolle hier in Florenz bedrohlich ins Wanken.
Bei einem Besuch im Kinderzimmer, wo sie einen ganzen Morgen lang die kreischende Lucrezia im Arm zu halten versucht, bemerkt sie, wie der Lärm sich auf die vier älteren Geschwister auswirkt, die sich die Ohren zuhalten und in ein anderes Zimmer laufen. Furcht ergreift Eleonora, das Verhalten des Säuglings könnte die anderen beeinflussen. Werden auch sie plötzlich nicht mehr fügsam sein und sich nicht mehr trösten lassen? So beschließt sie, ohne langes Federlesen, Lucrezia aus dem Kinderzimmer zu nehmen und in einem anderen Teil des Palazzos unterzubringen. Nur eine Zeit lang, sagt sie sich, bis das Kind sich beruhigt hat. Sie zieht Erkundigungen ein und stellt danach eine andere Amme an, eine der Köchinnen. Eine breithüftige, fröhliche Frau, die mit Freuden bereit ist, sich um Lucrezia zu kümmern, denn ihre eigene, knapp zwei Jahre alte Tochter tapst schon über die Fliesen und kann abgestillt werden. Jeden Tag schickt Eleonora eine ihrer Hofdamen hinunter in die Küchen, um sich nach dem Befinden des Säuglings zu erkundigen; sie ist sich sicher, ihre Pflicht dem Kind gegenüber zu erfüllen. Unglücklich dabei ist nur, dass Sofia, Eleonoras ehemaliges Kindermädchen, Lucrezias „Verbannung“ lauthals missbilligt und auch nicht einsieht, was an der von ihr ausgewählten Amme nicht gut gewesen sein soll. Doch Eleonora ist ungewöhnlich hartnäckig: Das Kind wird fern von der übrigen Familie in der Kellerküche untergebracht, bei den Dienern und Dienstmädchen, im Lärm von Kochtöpfen und in der Hitze der riesigen Feuer. Ihre ersten Monate verbringt Lucrezia in einem Waschkessel, überwacht von der kleinen Tochter der Amme: Die tätschelt die winzige geballte Faust des Säuglings und ruft die Mutter, wenn dessen Gesicht sich zu einem Heulen verzerrt.
Als Lucrezia laufen lernt, entgeht sie knapp einer Katastrophe mit einem umgekippten Topf siedenden Wassers, weshalb sie wieder nach oben geschickt wird. Fern vom vertrauten Lärm und Dampf der Küchen und konfrontiert mit vier Kindern, an die sie sich nicht erinnern kann, schreit sie zwei Tage lang. Sie schreit nach ihrer Amme, nach den Holzlöffeln, an denen sie gegen die Schmerzen des Zahnens lutschen durfte, nach den Kräutersträußen, die an den Fenstern hingen, nach der Hand, die ihr ein warmes Stück Brot oder ein Stück Käse entgegenstreckte. Sie will nichts zu tun haben mit diesem Zimmer unter dem Dach, wo sich Bett an Bett reiht, wo lauter gleich aussehende Kinder sie mit schwarzen Augen ungerührt anstarren, einander etwas zuflüstern, dann unvermittelt aufstehen und davongehen. Die Erinnerung an einen riesigen schwarzen Topf, der neben ihr umkippt, und an einen Schwall zischend heißer Flüssigkeit beunruhigt sie. Sie verweigert sich den Armen und Schößen der Kinderzimmerfrauen, erlaubt ihnen nicht, sie anzukleiden oder ihr etwas zu essen zu geben. Sie will die Köchin von drunten, ihre Milchmutter; sie will beim Dösen, geborgen in ihrem breiten Schoß, eine Strähne ihres glatten Haars zwischen Daumen und Finger halten. Sie will das liebe Gesicht ihrer Milchschwester, die für sie singt und sie mit einem Stock in der Asche des Feuers zeichnen lässt. Sofia schüttelt den Kopf und murmelt, sie habe es Eleonora immer schon gesagt, dass es nicht gut ausgehen werde, wenn man das Kind in den Keller schicke. Lucrezia isst nur, wenn man Nahrung neben ihr auf den Boden legt. Wie bei einem wilden Tier, bemerkt Sofia.
Als Eleonora all dies von Sofia hört, die darauf beharrt hat, in die Gemächer ihres ehemaligen Schützlings zu gehen und, die Fäuste in die Hüften gestemmt, neben dessen Bett Aufstellung zu nehmen, seufzt die Herzogin und steckt sich eine frisch geknackte Mandel in den Mund. In wenigen Tagen wird sie erneut gebären, ihr Bauch ragt unter den Laken auf wie ein Berg; sie hofft auf einen Jungen. Diesmal hat sie nichts dem Zufall überlassen und ihr Schlafgemach mit Gemälden von gesunden jungen Männern ausstatten lassen, die männlichen Beschäftigungen nachgehen: Speere werfen oder Zweikämpfe austragen. Die ehelichen Pflichten durften nur hier vollzogen werden, zur großen Enttäuschung von Cosimo, der immer eine Vorliebe gehabt hat für hastige Akte in einem Korridor oder einem Zwischengeschoss. Doch Eleonora wollte auf keinen Fall den gleichen Fehler wie beim letzten Mal begehen.
Als Vierjährige will Lucrezia im Gegensatz zu ihren Schwestern keine Puppen bemuttern, sich zum Essen nicht an den Tisch setzen oder mit ihren Geschwistern spielen; sie bleibt lieber allein, rast wie eine Wilde von einem Ende des Laufgangs zum andern oder kniet sich vors Fenster, um stundenlang hinauszuschauen auf die Stadt und die fernen Hügel dahinter. Als sie sechs ist, zappelt sie so herum, statt einem Maler brav Modell zu sitzen, dass Eleonora die Geduld verliert und sagt, dann gebe es eben kein Porträt, Lucrezia könne zurück ins Kinderzimmer gehen. Mit acht oder neun weigert sie sich, Schuhe zu tragen, sogar als Sofia ihr für ihre Widerspenstigkeit eine Ohrfeige verpasst. Als sie mit fünfzehn schließlich verheiratet werden soll, macht sie ein Riesentheater wegen des Brautkleids, das Eleonora persönlich in Auftrag gegeben hat, eine traumhaft schöne Kombination von blauer Seide und Goldbrokat. Lucrezia platzt unangekündigt in die Gemächer ihrer Mutter und ruft, sie werde es nicht tragen, auf keinen Fall, es sei ihr zu groß. Eleonora, die an ihrem scrittoio sitzt und gerade einer ihrer liebsten Äbtissinnen schreibt, versucht, Ruhe zu bewahren, und sagt Lucrezia klar und deutlich, das Kleid werde, wie sie wisse, eigens für sie geändert. Doch natürlich geht Lucrezia zu weit. Warum, fragt sie wutentbrannt, müsse sie ein Kleid tragen, das für ihre verstorbene Schwester Maria entworfen worden sei? Sei es nicht schon schlimm genug, dass sie Marias Bräutigam heiraten müsse? Müsse sie wirklich auch noch Marias Kleid tragen? Als Eleonora ihren Stift beiseitelegt, löst sich ihr Geist vom Schreibtisch, geht auf ihre Tochter zu und weiter zurück zu deren Zeugung, erinnert sich daran, wie ihre, Eleonoras, Augen über die Karten früherer Länder geschweift waren, über fremde, wilde Meere voller Drachen und anderer Ungeheuer, gepeitscht von Winden, die Schiffe weit von ihrem Kurs abbringen konnten. Was für einen Fehler hatte sie damals gemacht! Wie oft ist sie davon heimgesucht und wie schwer bestraft worden!
Am anderen Ende des Zimmers sieht Eleonora das tränenüberströmte, kantige Gesicht ihrer Tochter, das sich voll Hoffnung und Erwartung öffnet wie eine Blume. Hier ist meine Mutter, denkt Lucrezia, wie Eleonora weiß, die kann mich vielleicht retten vor dem Kleid, vor der Hochzeit. Vielleicht wird alles gut.






















Endlich kommt es zum Ende des Falls, werden die Maddox es schaffen, ihn zu lösen ohne dass die Familie zerbricht ? Das ist der letzte Band der Reihe, es ist ratsam und zur Logik erforderlich die vorherigen Bände zu lesen. Das Cover ist passend zu Reihe, wunderschön verspielt und die Farbwahl ist toll gewählt. Der Klapptext macht neugierig auf mehr. Die Hauptprotagonisten bestehen aus allen Maddox, die uns wieder in Gedächtnis gerufen werden. Alles sind so herzlich und leben Ihr Leben, der Leser wird wieder involviert und steckt mitten im Gefühlschaos und hofft mit den Hauptprotagonisten das am Ende alles gut ist. Der Schreibstil von Jamie ist sehr bildlich, flüssig und fesselnd. Die Autorin schafft eine wundervolle Welt, besonders aber eine emotionale und spannende. Die Erzählweise ist emotionell und gefühlvoll. Diese reißt einen mit und belebt den Lesefluss, dass man nicht aufhören kann zu lesen. Man bekommt durch die wechselnden Perspektiven jede mögliche Einsicht in die Protagonisten und fühlt mit Ihnen. Der familiäre liebevolle Umgang in der Familie ist wundervoll, man wünscht sich diesen Zusammenhang und die Loyalität. Außerdem schafft die Autorin innerhalb der ganzen Bände ein perfekten roten Faden und ergänzt in diesem Band alle Lücken zwischen den Situationen. Erstaunlich ist auch die Beschreibung der Liebe eines Maddox, sowie die erotische Spannung, die den Leser fesselt und spürbar sowie gut beschrieben ist. Die Autorin bietet dem Leser eine emotionale, spannende und amüsante Geschichte. Das Buch zeichnet sich durch die Familienbande der Maddox sowie der Auflösung des Falls aus. Es hat mir sehr viel Freude bereitet das Buch zu lesen. Das Buch hat mich berührt, geschockt, amüsiert, überrascht, emotional mitgerissen und sehr gut unterhalten. Fazit: Emotion geladene Geschichte mit Lösung eines Fall, spannender & aktionistischem Verlauf und hilfreiche Ergänzung der Lücken der Szenen. Ich war sehr erstaunt und emotional total involviert. Sehr über den Plan begeistert & mitgerissen, sowie aber auch geschockt. Ich war über die Verluste emotional total am Ende und habe sehr bedauert dass nicht alles wie erhofft Gut ging. Ich bin durch das Buch nur so geflogen, war durch den Maddox Charme berauscht und über Ihre Familienbande begeistert. Jedoch gab es auch Fehler und Probleme, das normal Leben, dass man innerhalb der Leben der Maddox zu lesen bekam, dies macht die Familie noch authentischer und herzlicher. Die Lösung der Probleme war sehr originell. Der letzte Band war der Emotionell stärkste Band. Jamie hat es geschafft die Reihe wundervoll zum Ende zu bringen. Der rote Faden von Beginn der Reihe an wurde sehr gut durch gezogen & logisch abgeschlossen. Emotionelle Lektüre umhüllt mit Spannung, Aktion und Liebe. Vielen Dank für das Lesevergnügen. ! Empfehlung ! <3 Danke für das Rezi Exemplar an den Verlag Piper.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.