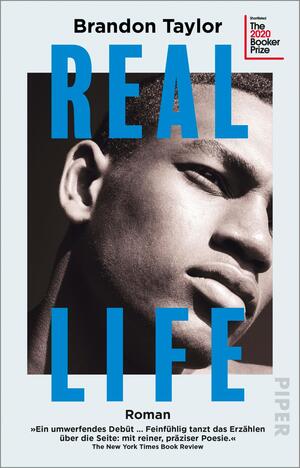
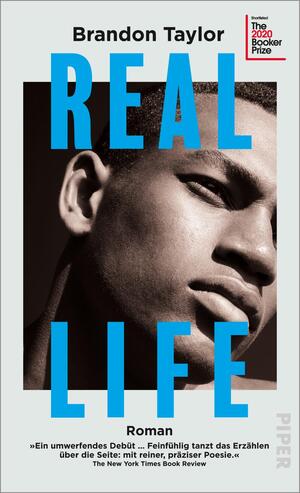
Real Life Real Life - eBook-Ausgabe
Roman
— Shortlist des Booker Prize 2020„Ein vielschichtiger Roman.“ - Berliner Zeitung
Real Life — Inhalt
Über die Sprengkraft subtiler Diskriminierung: Brandon Taylors aufwühlender Debütroman
Ein Spätsommerabend bei Freunden, man plaudert und sagt: Wallace könne froh sein, es als einziger Schwarzer an der Uni zum Biochemie-Doktoranden gebracht zu haben. Selbst die, die ihm angeblich nahestehen, sehen oft nicht mehr als die Farbe seiner Haut. Als sein Vater stirbt, brechen die Erinnerungen über Wallace herein: an eine Kindheit in Alabama, die ihrem Elend nicht gewachsene, trinkende Mutter und den kühlen, seltsam unbeteiligten Vater. All das hat Wallace hinter sich gelassen. Doch noch immer spürt er die Kluft der Scham, die ihn von seinen Freunden trennt. Und nicht zuletzt von Miller, mit dem er eine heimliche Affäre beginnt.
Brandon Taylors gefeiertes Romandebüt schaffte es bis auf die Shortlist des Booker Prize 2020. In Real Life bricht ein Mann mit seiner schmerzhaften Vergangenheit. Er wagt sich hinaus ins echte Leben, zeigt sich als der, der er ist. Und riskiert so, alles zu verlieren – oder alles zu gewinnen.
„Es ist, als würden sie sagen, du sollst mit all deinen Erfahrungen kommen und ganz du selbst sein. Aber wenn du dann an ihrem Tisch sitzt, als queere schwarze Person aus dem Arbeitermilieu der Südstaaten, wollen sie auf einmal nicht mehr, dass du über bestimmte Dinge sprichst, weil du damit alle Regeln ihrer Welt brechen würdest.“ Brandon Taylor im Interview mit Maddie Sofia, NPR
„Das Wechselspiel aus Begehren und Widerwillen macht die psychologisch-erzählerische Tiefe von Real Life aus.“ Berliner Zeitung
„Beeindruckend ist die Sprachgewalt, mit der Taylor den Süden der USA heraufbeschwört. Real Life funktioniert als Anti-Bildungsroman, der wie ein Prequel wirkt zum echten Leben. Dass sein Autor, anders als Wallace, den endgültigen Absprung aus dem Labor wagte, ist für die Literatur ein Glück.“ Die Zeit
„Real Life verdeutlicht auf ergreifende Weise, welcher Widerspruch aufklafft, sobald man sich in einer Institution nicht akzeptiert und verstanden fühlt, die aggressiv ihre eigene unbefleckte Progressivität bewirbt.“ The Guardian
„Mal bitter, mal zart schreibt sich dieser fein gewirkte Roman in die schwule Literatur ein. Aber damit nicht genug, Wallace’ Stimme trägt mit ihrer erfrischenden Nuanciertheit und ihrem Sinn fürs Mikroskopische auch zur Debatte um Black Lives Matter bei.“ Financial Times
Leseprobe zu „Real Life“
So erbte ich Monde der Enttäuschung, und Nächte voller Mühsal wurden mir zuteil.
Hiob 7,3
1
Einige Wochen nach dem Tod seines Vaters beschloss Wallace an einem kühlen Abend im Spätsommer, sich doch noch mit seinen Freunden am Pier zu treffen. Weiße Wellen dellten die Oberfläche des Sees wie kleine Grübchen. Die letzten böigen Sommertage galt es voll auszukosten, denn schon bald würde das Wetter kippen und ungemütlich werden. Weiße Menschen hatten sich überall auf den zum See hin abfallenden Terrassen verteilt, rissen den Mund auf und warfen einander ihr [...]
So erbte ich Monde der Enttäuschung, und Nächte voller Mühsal wurden mir zuteil.
Hiob 7,3
1
Einige Wochen nach dem Tod seines Vaters beschloss Wallace an einem kühlen Abend im Spätsommer, sich doch noch mit seinen Freunden am Pier zu treffen. Weiße Wellen dellten die Oberfläche des Sees wie kleine Grübchen. Die letzten böigen Sommertage galt es voll auszukosten, denn schon bald würde das Wetter kippen und ungemütlich werden. Weiße Menschen hatten sich überall auf den zum See hin abfallenden Terrassen verteilt, rissen den Mund auf und warfen einander ihr Lachen ins Gesicht. Oben am Himmel glitten die Möwen mühelos dahin.
Wallace stand auf einer der höher gelegenen Terrassen, blickte ins Gedränge hinunter und versuchte, inmitten all der weißen Grüppchen das richtige zu finden. Noch konnte er einfach gehen und den Abend zu Hause verbringen. Dass er sich zuletzt mit seinen Freunden am See getroffen hatte, war Jahre her, ein Umstand, der ihn in Verlegenheit brachte, weil er nach einer Erklärung verlangte, die Wallace nicht hatte. Möglicherweise hing es mit seiner Angst vor Menschenmengen zusammen, mit der unmittelbaren Nähe fremder Körper, oder mit den Vögeln, die am Himmel kreisten und auf der Suche nach Futter auf die Tische hinunterschossen. Manche hüpften zwischen den Füßen der Leute herum, als feierten sie dort unten ihre eigene Party. Die Bedrohungen lauerten an allen Ecken. Hinzu kam der Lärm – das Gebrüll, mit dem die Leute einander vergeblich zu übertönen versuchten, die schlechte Musik, die Kinder und die Hunde, die Ghettoblaster der Studenten unten am Seeufer, die Autoradios auf der Straße, die ganze kreischende Masse Hunderter kollidierender Leben.
Der Lärm schien Wallace etwas Befremdliches, noch nicht näher Bestimmtes abzuverlangen. Plötzlich entdeckte er die vier an einem der weinroten Holztische direkt unten am Wasser, genauer gesagt entdeckte er Miller, der ungewöhnlich groß und nicht zu übersehen war. Dann erkannte er Yngve und Cole, die einfach nur groß waren, und zuletzt Vincent, der knapp unter dem Durchschnitt hängen geblieben war. Miller, Yngve und Cole sahen aus wie drei helle, stolze Hirsche, wie Vertreter einer ganz eigenen Spezies, und wäre man in Eile, hätte man sie glatt für Brüder halten können. Wie Wallace und der Rest der Clique waren auch sie in diese Stadt im Mittleren Westen gekommen, um in Biochemie zu promovieren. Ihr Jahrgang war so klein wie schon seit Langem nicht mehr, und der erste mit einem schwarzen Doktoranden seit über drei Jahrzehnten. In weniger gelassenen Momenten redete Wallace sich ein, dass diese beiden Dinge zusammenhingen; dass erst das nachlassende Interesse und die geringe Bewerberzahl seine Zulassung ermöglicht hatten.
Er war kurz davor, einfach kehrtzumachen – unschlüssig, ob er die Gesellschaft der anderen, die ihm eben noch so notwendig erschienen war, wirklich ertragen könnte –, als Cole den Kopf hob und ihn bemerkte. Obwohl Wallace in seine Richtung schaute, fuchtelte er mit den Armen und machte sich noch größer, um bloß nicht übersehen zu werden. Es gab kein Zurück mehr. Wallace hob die Hand und winkte.
Es war Freitag.
Wallace stieg die bröckelnden Betonstufen hinunter, und es stank immer heftiger nach Seewasser und Algen. Er folgte der Krümmung der Stützmauer und kam an den aufgebockten Booten und der Stelle vorbei, wo dunkle Steine aus dem Wasser ragen, und am langen Pier, der sich über den Wellen erstreckt und voller lachender Menschen war. Im Gehen betrachtete er den riesigen grünlichen See und die darauf kreuzenden Boote, deren vom Wind geblähte Segel sich weiß und selbstbewusst vom weiten, bewölkten Himmel abhoben.
Es war perfekt.
Es war wunderschön.
Es war ein ganz normaler Abend im Spätsommer.
Eine Stunde zuvor war Wallace noch im Labor gewesen. Den ganzen Sommer lang hatte er Nematoden gezüchtet, eine ebenso langweilige wie anspruchsvolle Arbeit. Nematoden sind mikroskopisch kleine Würmer, die im Erdreich vorkommen und etwa einen Millimeter groß werden. Wallace’ Aufgabe war es, vier unterschiedliche Nematodenstämme zu kultivieren und in einem zweiten Arbeitsschritt untereinander zu kreuzen. Die gezielte Beschädigung des Erbguts und die anschließende Reparatur – Regulation und Steuerung der Genexpression, Markierung eines Proteins, Entfernen oder Hinzugeben bestimmter Abschnitte des genetischen Materials – führten zu erwünschten Mutationen, die wiederum von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden, wie eine Zahnlücke oder Sommersprossen oder Linkshändigkeit. Nach simplen, aber sorgfältig durchzuführenden Berechnungen wurden die Modifikationen mit denen anderer Stämme kombiniert. Manchmal brauchte es dazu einen Marker oder einen Balancer. Nach einer Manipulation des Nervensystems bewegten die Tiere sich plötzlich rollend statt schlängelnd fort, eine Mutation in der Cuticula erzeugte Nematoden so dick wie kleine Keksröllchen. Und immer bestand die heikle Aussicht, dass die Männchen zu empfindlich sein könnten oder kein bisschen an Fortpflanzung interessiert. Im letzten Schritt wurden die Würmer aufgelöst und das genetische Material extrahiert. Nicht selten stellte sich nach wochenlanger sorgfältiger Zucht und Beobachtung mehrerer Generationen heraus, dass die Mutation verloren gegangen war. Es folgte eine fiebrige Suche, und Wallace verbrachte Tage oder Wochen damit, die alten Petrischalen zu überprüfen und die Abweichung unter Tausenden von wimmelnden Nachkommen erneut zu finden. Die auflodernde, fast wahnhafte Erleichterung, wenn er im letzten Moment doch noch den goldenen Nematoden aus der Masse der zappelnden Tiere fischte; und dann begann der langsame, stetige Zuchtprozess von vorn, das Hüten der erwünschten Chromosomen und das Ausschalten der unerwünschten, bis endlich die ersehnte Variante herauskam.
Wallace hatte viele schöne Sommertage durchgearbeitet, und doch war es ihm nicht gelungen, den entscheidenden Stamm zu kultivieren. Eine Stunde zuvor hatte er im Labor seine Tabletts mit den Agarplatten aus dem Brutschrank geholt. Seit drei Tagen wartete er darauf, dass eine Generation in die nächste überging, so angespannt, wie er seit Monaten auf das Endergebnis wartete. Er würde die Babys einsammeln und die feinen, fast unsichtbaren Würmchen voneinander trennen, bis er schließlich seine Dreifachmutation gefunden hätte. Aber als er nach seinen Nematoden sah, wirkte die glatte blaugrüne Oberfläche des Agar, das in seiner weichen Festigkeit der menschlichen Haut auf unheimliche Weise ähnelte, gar nicht mehr so glatt.
Ganz im Gegenteil, dachte er, sie war aufgewühlt.
Nein, nicht aufgewühlt. Wallace kannte das korrekte Wort.
Verunreinigt.
Schimmel und Staub türmten sich wie bei der grausigen Nachstellung eines Vulkanausbruchs – ganze Zivilisationen von Asche und Ruß bedeckt und zu porösem weißem Stein erstarrt. Ein weicher Pelz aus grünen Sporen überzog die Nährflüssigkeit, darunter verbarg sich der schleimige Bakterienfilm. Die Oberfläche des Agars sah aus, als hätte sie jemand mit einem groben Pinsel zerkratzt. Wallace überprüfte alle Schalen auf allen Plastiktabletts, und ausnahmslos jede wies Spuren des Grauens auf. Die bakterielle Verunreinigung war so weit fortgeschritten, dass sie durch die Deckel austrat wie Eiter aus einer Wunde und ihm über die Finger lief. Nicht zum ersten Mal fand er seine Petrischalen verunreinigt und verschimmelt vor. Im ersten Laborjahr war ihm das regelmäßig passiert, später dann waren seine Technik besser und seine Sorgfalt größer geworden. Später hatte er gelernt, aufmerksam und vorsichtig zu sein. Er hatte an sich gearbeitet. Er wusste, wie man einen Stamm am Leben hält.
Nein, dieses Gemetzel hatte mit bloßer Nachlässigkeit nichts zu tun. Außerdem wirkte es alles andere als zufällig, eher wie die Rache eines kleinlichen Gottes. Wallace stand da, schüttelte den Kopf und lachte leise in sich hinein.
Er lachte, weil das Ganze auf eine schwer zu fassende Art lustig war. Ein unerwarteter Witz, der sich aus einer völlig willkürlichen Verkettung von Umständen ergab. Nach vier Jahren Laborarbeit hatte er in den vergangenen Monaten zum ersten Mal das Gefühl gehabt, kurz vor einem großen Durchbruch zu stehen. Er hatte sich der Ahnung einer Erkenntnis angenähert, die Konturen der ihr innewohnenden Fragestellung erspürt, das Ausmaß ihrer Tragweite. Er war mit dieser sich stetig entwickelnden Erkenntnis aufgewacht, und sie hatte ihn durch die vielen eintönigen Stunden begleitet, durch das Zähneknirschen und den dumpfen Schmerz, wenn er um neun aufstand und wieder zur Arbeit ging, obwohl er erst um fünf eingeschlafen war. Er hatte sie so deutlich vor Augen gehabt wie ein schwebendes Staubkorn im gleißenden Licht der hohen Laborfenster – die Hoffnung, einen kurzen Moment absoluter Klarheit zu erleben.
Und was war ihm davon geblieben? Ein Haufen absterbender Nematoden. Als er vor drei Tagen nach ihnen gesehen hatte, waren sie noch schön und perfekt gewesen. Er hatte sie in die laue Dunkelheit des Brutschranks zurückgestellt und in Ruhe gelassen. Hätte er sie vielleicht einen Tag früher überprüfen sollen? Nein, selbst das wäre zu spät gewesen.
Er hatte in diesem Sommer so große Hoffnungen gehegt. Er hatte geglaubt, endlich etwas Sinnvolles zu tun.
In seinem Posteingang dann die gleiche Mail wie an jedem Freitag: Los, treffen wir uns am Pier, wir sichern einen Tisch.
An dem Abend hatte er nichts Besseres vorgehabt. Im Labor gab es nichts mehr zu tun. Die kontaminierten Schalen waren nicht zu retten. Ihm würde nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal von vorn anzufangen, aber in jenem Augenblick hatte er nicht die Kraft, frische Schalen aus dem Regal zu holen und vor sich auszubreiten wie Spielkarten. Er hatte nicht die Kraft, das Mikroskop einzuschalten und sich an die komplizierte Rettung des Stammes zu machen, falls die Zersetzung nicht ohnehin schon zu weit fortgeschritten war. Er war nicht bereit zu erfahren, ob er zu spät kam.
Er hatte nicht die Kraft.
Stattdessen war er zum See gegangen.
Die fünf saßen in angespanntem, betretenem Schweigen beisammen. Wallace fühlte sich, als hätte sein überraschendes Erscheinen für eine Unterbrechung gesorgt, als lenkte seine Anwesenheit den ursprünglichen Lauf der Dinge in eine neue Richtung. Er saß gegenüber von Miller, direkt an der Mauer. Hinter Miller bedeckte ein Schleier aus zarten Ranken den Beton, in dessen dunklen Ritzen die Insekten wimmelten. Der Tisch verlor seine rostrote Farbe wie ein räudiger Hund sein Fell. Yngve zupfte graue Holzsplitter aus den kahlen Stellen und schnippte sie hinüber zu Miller, der es entweder nicht bemerkte oder sich nicht darum kümmerte. Miller wirkte immer ein bisschen verärgert; leicht hochgezogene Oberlippe, leerer Blick, verengte Augen. Wallace fand das abschreckend, aber irgendwie auch liebenswert. An diesem Abend wirkte Miller jedoch einfach nur gelangweilt und müde, wie er dasaß und das Kinn in die Hand stützte. Er und Yngve kamen vom Segeln, beide trugen sie die beige Rettungsweste offen über dem Hemd. Die Gurte von Millers Weste hingen so schlaff herab, als gelte es, den Kopf einzuziehen, seine zerzausten Locken waren noch feucht. Yngve, der kräftiger und sportlicher war als Miller, hatte ein herzförmiges Gesicht und kleine, spitze Zähne. Er ging immer leicht nach vorn gebeugt. Wallace beobachtete, wie die Muskeln in Yngves Unterarmen sich verspannten, während er einzelne Fasern aus dem verwitterten Holz zupfte, zu Kügelchen zusammenrollte und mit dem Daumen wegschnippte. Eines nach dem anderen landete auf Millers Weste oder in seinen Haaren, aber Miller zuckte nicht einmal. Yngve bemerkte, wie Wallace ihn ansah, und zwinkerte, als gäbe es hier einen Insiderwitz zu verstehen.
Cole und Vincent saßen neben Wallace, dicht zusammengerückt wie Betende auf einem sinkenden Schiff. Cole streichelte Vincents Fingerknöchel. Vincent hatte sich die Sonnenbrille auf die Stirn geschoben, was sein Gesicht kleiner und ihn wie ein hilfloses Haustier wirken ließ. Wallace hatte ihn seit Wochen nicht mehr gesehen, nicht seit der Grillparty, die Vincent und Cole am 4. Juli ausgerichtet hatten. Das war jetzt, wie Wallace erschreckt feststellte, schon über einen Monat her. Vincent arbeitete im Finanzwesen und wachte über geheimnisvolle Reichtümer wie ein Klimaforscher über die Bewegung der Gletscher. In diesem Teil des Landes stand Reichtum entweder für Rinder und Mais oder für Biotech; nachdem der Mittlere Westen Amerika über Generationen hinweg mit Weizen, Milch und Geflügel versorgt hatte, brachte er nun eine neue Industrie hervor, die Geräte und Apparate produzierte, um mit ihnen Organe, Seren und Pflaster aus genetischem Brei zu züchten. Es handelte sich um eine neue Art von Landwirtschaft, wie auch Wallace’ Arbeit eine neue Art von Viehzucht war. Am Ende aber taten sie, was die Menschen schon immer getan hatten, und alle Unterschiede zu früheren Zeiten waren nur bedeutungslose Details.
„Ich habe Hunger“, sagte Miller und legte unvermittelt die Arme auf den Tisch, Handflächen nach oben. Fast streifte er Wallace’ Ellbogen, Wallace zuckte zusammen.
„Miller, du hast da auf deinem Platz gesessen, als ich das Bier bestellt habe“, sagte Yngve. „Du hättest den Mund aufmachen können. Eben meintest du noch, du hättest keinen Hunger.“
„Hatte ich auch nicht. Schon gar nicht auf Eis. Ich brauche was Richtiges. Vor allem, wenn wir jetzt weitertrinken. Außerdem waren wir den ganzen Tag in der Sonne.“
„Was Richtiges“, wiederholte Yngve und schüttelte den Kopf. „Na so was. Was möchtest du denn, Miller, Spargel? Ein paar Sprossen? Was Richtiges. Was soll das überhaupt sein?“
„Du weißt, wie ich das meine.“
Vincent und Cole husteten verstohlen und stützten die Ellbogen auf. Die Tischplatte neigte sich unter ihrem Gewicht. Würde sie die beiden halten? Wallace drückte sich gegen die Latten und beobachtete, wie das Holz sich unter dem Druck der dunklen, dünnen Nägel verbog.
„Ach ja, weiß ich das?“, gluckste Yngve. Miller verdrehte stöhnend die Augen. Ihre lässig hingeworfenen Sticheleien machten Wallace ein bisschen traurig; es war die Art von Traurigkeit, die man vor sich selbst verleugnen kann, bis man eines Tages aufwacht und merkt, sie war immer da und hat gelauert.
„Ich will nur was zu essen, das ist alles. Kein Grund, gleich gemein zu werden“, sagte Miller lachend, aber da war eine Härte in seiner Stimme. Was Richtiges. Wallace hatte richtiges Essen zu Hause, und er wohnte ganz in der Nähe. Er könnte, dachte er plötzlich, Miller zu sich einladen und ihn füttern wie ein streunendes Tier. Hey, ich habe noch ein Schweinekotelett von gestern Abend übrig. Er könnte Zwiebeln anbraten, das Kotelett aufwärmen. Er könnte etwas von dem Brot mit der knusprigen Kruste abschneiden, das er in der Bäckerei an der Ecke gekauft hat, er könnte es in Eier und Milch tunken und in der Pfanne frittieren. Wallace sah alles genau vor sich: eine Mahlzeit aus Resten, die er im Handumdrehen in einen herzhaften heißen Snack verwandeln würde. Es war einer dieser Momente, in denen alles möglich schien. Aber dann war der Moment vorbei – wie ein Schatten, der über den Tisch huschte.
„Ich kann schnell heimgehen und was holen, wenn du willst. Oder dir irgendwas kaufen“, sagte Wallace.
„Nein, ist schon in Ordnung. Ich brauche nichts.“
„Sicher?“, fragte Wallace.
Miller zog die Augenbrauen hoch. Seine Skepsis fühlte sich wie eine Ohrfeige an.
Obwohl sie sich fast täglich sahen, waren sie nicht auf eine Weise befreundet, die solche Nettigkeiten zugelassen hätte. Sie hockten ständig aufeinander – an der Eiswürfelmaschine, in der Teeküche, wo sie in traurigen, kurzen Mittagspausen verwaiste Teller und Schüsseln aus dem Regal holten, oder im Kühlraum, wo die empfindlichen Reagenzien lagerten, auf der Herrentoilette mit den scheußlichen lila Kacheln – sie waren wie schlecht gelaunte Cousins und bekämpften einander wie Feinde, die zu höflich oder zu faul sind, um echte Gewalt anzuwenden und wirklichen Schaden anzurichten. Auf der Weihnachtsfeier hatte Wallace einen unbedachten Kommentar zu Millers Outfit abgegeben, er hatte vom „Trailerparkschick des Mittleren Westens“ gesprochen. Alle hatten gelacht, auch Miller, aber in den folgenden Monaten war er bei jeder Gelegenheit darauf zurückgekommen: „Oh, da bist du ja, Wallace. Sicher hat unser Modezar auch was dazu zu sagen?“ Dieses Blitzen in seinen Augen, das kühle, schiefe Lächeln.
Im April hatte Miller es ihm dann heimgezahlt. Wallace war zu spät zu einem Seminar erschienen und musste ganz hinten stehen. Sie kamen beide von einer Veranstaltung, in der sie als Tutoren aushalfen; der Dozent hatte überzogen, und Miller war früher gegangen, während Wallace dageblieben war, um die Fragen der Studierenden zu beantworten. Nun standen sie mit dem Rücken an der holzvertäfelten Wand und verfolgten einen PowerPoint-Vortrag. Der Gastdozent galt als Koryphäe auf dem Gebiet der Proteomik, der Hörsaal war überfüllt. Insgeheim freute Wallace sich, dass auch Miller keinen Sitzplatz mehr bekommen hatte, aber da beugte Miller sich zu ihm herunter, sodass Wallace seinen Atem feucht und warm am Ohr spüren konnte, und flüsterte: „Ich dachte, ihr dürft jetzt immer ganz vorn sitzen, du und deine Leute?“ Eigentlich hatte Wallace, als er so dicht neben Miller stand, wider Willen ein Kribbeln gespürt, aber plötzlich schlug das Gefühl in etwas vollkommen anderes um. Die rechte Hälfte seines Körpers wurde taub und heiß zugleich. Miller blickte zu ihm hinunter und musste es ihm vom Gesicht abgelesen haben: Auch so etwas ließ ihre Freundschaft nicht zu. Wallace’ Hautfarbe gehörte ganz bestimmt nicht zu den Dingen, über die sie Witze machen konnten. Später, im Gedrängel um Gratiskaffee und trockene Kekse, hatte Miller noch versucht, sich zu entschuldigen, aber Wallace hatte auf Durchzug geschaltet. Wochenlang war er Miller aus dem Weg gegangen. Zwischen ihnen machte sich ein unterkühltes Schweigen breit, wie es nur zwischen Menschen vorkommt, die einander nahe sein sollten, es aufgrund eines frühen, entscheidenden Fehltritts aber nicht sein können. Später bereute Wallace es sehr, sie in diese Sackgasse hineinmanövriert zu haben, denn inzwischen tauschten sie sich nicht einmal mehr über die gewohnten Themen aus. Sie waren jeweils die Ersten in ihrer Familie gewesen, die aufs College gingen; nach dem Umzug in den Mittleren Westen hatten sich beide von der neuen Großstadt einschüchtern lassen; sie gehörten derselben Clique an, waren aber immer Außenseiter geblieben, die dem Leben nichts Leichtes abgewinnen konnten. Und da saßen sie nun.
Millers verdutztes Schweigen und das dunkle Misstrauen in seinem Gesicht waren Antwort genug.
„Dann eben nicht“, sagte Wallace leise. Miller ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken und stöhnte übertrieben.
Cole, der netter war als sie alle und sich derlei Gesten erlauben konnte, streckte die Hand aus und fuhr Miller durchs Haar. „Komm, auf geht’s.“ Miller grunzte, schwang die langen Beine unter dem Tisch hervor und erhob sich. Cole küsste Vincent auf Wange und Schulter, und Wallace lief ein kalter Schauder der Eifersucht über den Rücken.
Am Nachbartisch, hinter Yngve, saß eine Fußballmannschaft in billigen Polyestershorts und weißen T-Shirts mit selbst aufgemalten Nummern. Anscheinend stritten sie über Frauentennis. Alle waren sportlich und gebräunt, ihre Trikots mit Dreck und Gras beschmiert. Ein Spieler mit Regenbogenstirnband zeigte aufgebracht auf einen anderen und brüllte ihn auf Spanisch oder vielleicht Portugiesisch an. Wallace fragte sich, worum es ging, aber für diese fremden Doppelvokale und fragmentierten Konsonanten reichten seine sieben Jahre Schulfranzösisch nicht aus.
Yngve saß über sein Handy gebeugt, das Gesicht vom Display erleuchtet. Sein Profil zeichnete sich in der Dämmerung deutlich ab. Die Dunkelheit kroch über den Himmel wie ein sich langsam ausbreitender Fleck, der See schimmerte metallisch und unheilvoll. Es war der Moment kurz nach der blauen Stunde, wenn der Sommerabend sich langsam abkühlt und beruhigt. Der Wind roch ein wenig salzig, fast so, als wäre die Luft elektrisch aufgeladen.
„Wir haben dich in diesem Sommer nicht oft gesehen“, begann Vincent. „Wo hast du dich versteckt?“
„Zu Hause, schätze ich. Aber ich wusste nicht, dass ich mich verstecke.“
„Neulich hatten wir Roman und Klaus zu Besuch. Hat Cole dir davon erzählt?“
„Ehrlich gesagt habe ich die Jungs in dieser Woche gar nicht gesehen. Habe gerade höllisch viel zu tun.“
„Na ja, es war auch nichts Besonderes. Nur ein Abendessen. Du hast nicht viel verpasst.“
Warum davon anfangen, dachte Wallace, wenn es nichts Besonderes war? Zu ihrer Grillparty hatte er sich schließlich auch aufgerafft, oder? Auf einmal fiel ihm ein, dass Vincent schon beim letzten Mal betont hatte, wie schön es doch sei, Wallace zu sehen. Er mache sich in letzter Zeit wirklich zu rar, gehe viel zu selten mit ihnen aus, interessiere sich zu wenig für seine Freunde. „Es ist, als gäbe es dich gar nicht mehr“, hatte Vincent gesagt. Die Ader an seiner Stirn war unter seinem Lachen angeschwollen, und Wallace hatte sich in seelenruhiger Grausamkeit gewünscht, sie möge platzen. Cole, Yngve, Miller und Emma lief er im Gebäude der Biowissenschaften fast jeden Tag über den Weg. Dann grüßten sie sich mit einem knappen Nicken oder einem Winken, nahmen einander auf alle möglichen Arten zur Kenntnis. Doch es stimmte, er ging nicht mehr so oft mit den anderen aus und mied ihre Lieblingsbars. Anders als früher zwängten sie sich auch nicht mehr in zwei Autos, um Äpfel zu pflücken oder am Devil’s Lake Wandern zu gehen. Wallace hielt sich zurück, weil er das Gefühl hatte, eigentlich nicht erwünscht zu sein. Nie stand er im Mittelpunkt, und er redete eigentlich nur, wenn jemand Mitleid bekam und ihm ein paar Brocken Small Talk vor die Füße warf. Und doch stellte Vincent sich hin und tat so, als würde Wallace aus freien Stücken auf die gemeinsame Freizeit verzichten. Als trügen sie alle keine Schuld daran.
Wallace lächelte gequält. „Klingt so, als wäre es ein lustiger Abend gewesen.“
„Und letzte Woche waren Emma und Thom da. Wir haben ein kleines Mittagessen am Pool veranstaltet und sind dann rüber in den Hundepark gegangen. Scout ist wirklich riesig geworden!“ Die Ader an Vincents Stirn schwoll erneut an, und plötzlich stellte Wallace sich vor, einen Daumen daraufzulegen und mit aller Kraft zuzudrücken. Er stieß ein kehliges, zustimmendes Grunzen aus, als wollte er sagen: Wer hätte das gedacht?
„Wo bleiben eigentlich Emma und Thom? Ich dachte, die beiden wollten heute auch kommen?“, fragte Yngve.
„Sie lassen Scout waschen.“
„Wie lange dauert es denn bitte, seinen Hund waschen zu lassen?“, fragte Yngve mit gespielter Empörung.
„Kommt drauf an“, antwortete Vincent mit einem Lachen und sah Wallace an, der sich für kaum etwas zu schade war, wohl aber für Witze über Hundescheiße, und sich deshalb einfach nur räusperte. Vincent trommelte mit den Fingern auf den Tisch. „Okay, im Ernst, wo hast du gesteckt, Wallace? Hast du es nicht mehr nötig, mit deinen Freunden abzuhängen?“
Was für eine blöde Frage. Sogar Yngve machte große Augen. Wallace brummte vor sich hin, als müsste er überlegen. Er wartete darauf, dass sein Ärger und das Gefühl der Demütigung nachließen. Vincent sah ihn geduldig und erwartungsvoll an. In seiner Sonnenbrille spiegelte sich das Treiben am Nachbartisch: Die Fußballer hatten begonnen, einander anzurempeln, ihre weißen Trikots leuchteten wie helle, sich übereinander schiebende Rechtecke in einem kubistischen Gemälde.
„Ich war im Labor“, erklärte Wallace. „Eigentlich habe ich nichts anderes gemacht.“
„Du Märtyrer“, sagte Vincent. „Das wird dann wohl das Thema für den Rest des Abends? Die Heilige Jungfrau vom ewigen Labor.“
„Wir reden nicht immer über das Labor“, widersprach Yngve, aber Wallace musste lachen, auch wenn der Witz natürlich auf seine Kosten ging. Vincent hatte recht: Sie redeten praktisch nur über das Labor. Egal, welches Thema sie anschnitten, irgendwie nahm das Gespräch immer wieder denselben Verlauf: Ihr werdet es nicht glauben, aber neulich habe ich eine Säule laufen lassen und schon vor der letzten Spülung eluiert. Jemand hat die Pipettenspitzen nicht aufgefüllt, und ratet mal, wer deswegen stundenlang am Autoklaven stehen musste? Ist es wirklich zu viel verlangt, dass die meine Pipette wieder dahin zurücklegen, wo sie sie gefunden haben? Die kommen einfach rein, nehmen sich, was sie brauchen, und bringen nichts zurück. Wallace konnte Vincents Frust verstehen. Vincent war in ihrem zweiten Jahr in die Stadt gezogen, um in Coles Nähe zu sein. Und hatte seine Einweihungsparty ausgerechnet in der Woche geschmissen, in der sie auf ihre Prüfungsergebnisse warten mussten. Statt billiges Bier zu trinken und die elegante Sitzecke aus Chrom und Leder zu bewundern, hatten sie die Köpfe zusammengesteckt und über den Prüfungsbogen 610 getuschelt, an dessen Schluss eine unerwartete Helixfrage aufgetaucht war, und über den 508er: Änderung der freien Energie unter unterschiedlichen osmotischen Bedingungen. Für die Lösung hatte Wallace fünf Bögen Papier vollschreiben und Gleichungen hervorkramen müssen, die er seit dem Grundstudium nicht mehr gebraucht hatte. Am Ende hatte Vincent allein den Weihnachtsbaum geschmückt, während sie einander ihr Leid klagten. Wallace hatte Mitleid mit ihm gehabt. Aber dieser Reflex, ständig auf das Labor zurückzukommen, trat immer wieder auf. Denn solange sie über die Wissenschaft sprachen, mussten sie sich mit keinem anderen Problem auseinandersetzen. Es war, als hätte das Promotionsstudium ihre alten Persönlichkeiten ausgelöscht.
Zumindest für Wallace war das Sinn und Zweck der Sache gewesen. Trotzdem hatte er gerade in diesem Sommer etwas Neues gefühlt: Auf einmal wollte er mehr. Ja, er war immer noch unglücklich, aber zum ersten Mal in seinem Leben schien dieses Unglück nicht naturgegeben zu sein. Manchmal sehnte er sich danach, dem Drang nachzugeben, ihm einfach blind zu vertrauen. Dieses Leben hinter sich zu lassen und in die weite, unberechenbare Welt hinauszugehen.
„Ich arbeite auch viel, aber ich rede nicht ständig darüber. Weil ich weiß, dass es euch langweilen würde“, sagte Vincent.
„Weil du einfach nur einen Job hast. Das ist … Was wir machen, ist etwas völlig anderes“, sagte Yngve.
„Ihr kennt doch nur dieses eine Thema, weil ihr nichts habt, worauf ihr stolz sein könnt“, antwortete Vincent. Wallace stieß einen leisen Pfiff aus. Die Stimmen am Nachbartisch schwollen weiter an, wurden schriller und lauter. Gelegentlich schrie jemand vor Freude, vielleicht auch vor Wut. Die Fußballer beugten sich über ein Handy, so viel konnte Wallace erkennen, anscheinend verfolgten sie ein Spiel. Hin und wieder tat sich zwischen den Körpern eine Schneise auf, und er konnte das helle Display sehen, nur einen Augenblick lang, bevor die Lücke sich wieder schloss.
„Es gibt mehr im Leben als Stipendien und Jobs“, sagte Vincent. Auch auf dem See wurde gelärmt und gejohlt. Wallace schaute aufs Wasser hinaus, wo die dunklen Felsen sich über ihr noch dunkleres Spiegelbild beugten. Von den Booten, die aufs Ufer zusteuerten, schallte Musik herüber, doch die Lieder vermengten sich zu einem Rauschen, wie das undefinierbare Knistern und Knacken zwischen zwei Funksprüchen.
„Ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast, Vincent“, sagte Wallace. Yngve grunzte zustimmend, aber Wallace bezweifelte, dass sie wirklich dasselbe meinten. Wie auch? Yngves Vater war Chirurg, seine Mutter unterrichtete Geschichte an einer Hochschule. Yngve war in dieser Welt der Stipendien und Jobs groß geworden. Zu behaupten, dass es jenseits von ihr nichts gab, hieß für Wallace, dass sein Leben auf dem Spiel stünde, sollte er eines Tages seinen Platz darin verlieren. Plötzlich fragte er sich, ob er zu schnippisch geklungen hatte, doch gerade, als er sich bei Vincent entschuldigen wollte, kamen Cole und Miller zurück. Die blassen Innenseiten von Millers Schenkeln leuchteten im Dunkeln. Im Vergleich zum Rest seines Körpers wirkte die Haut dort glatt und unschuldig. Seine Shorts waren zu kurz, die Gurte der Rettungsweste schlugen ihm gegen die nackten Beine. Cole hatte einen watschelnden, ungelenken Gang, wie ein Welpe in Spiellaune. Sie trugen weiße Popcorntüten auf dem Arm und eine große Plastikschale voller Nachos, die von schleimigem, gummiartigem Käse überzogen und großzügig mit Jalapeños bestreut waren. Beim Hinsetzen stieß Miller ein „Uff“ aus. Sie hatten auch Tacos gekauft, von denen sich Yngve sofort einen schnappte.
„O ja“, rief er und bebte vor Freude. „Ja, ja, ja! Das ist es, Jungs!“
„Ich dachte, du hast keinen Hunger“, sagte Miller.
„Habe ich nie behauptet.“
Cole stellte einen kleinen Becher Vanilleeis vor Vincent hin. Sie küssten sich. Wallace schaute schnell weg. Irgendwie fühlte es sich übergriffig an, sie dabei zu beobachten.
„Möchtest du auch?“, fragte Cole und bot ihm Nachos und Popcorn an. Er bot Wallace Essen an, wie Wallace es Miller hatte anbieten wollen.
Wallace schüttelte langsam den Kopf, spürte die Wärme in seinen Wangen aufsteigen. „Nein, danke.“
„Greif zu“, sagte Miller, und Wallace bildete sich ein, das Gewicht zu spüren, das von Millers Blick ausging. Die Hitze. Er merkte es, wenn er beobachtet wurde, wenn ein Raubtier ihn fixierte.
„Bleibt es bei morgen?“, fragte Cole und strich eine weiße Serviette auf dem Tisch glatt.
„Ja“, antwortete Wallace.
Das Fett des Tacos durchtränkte die Serviette, bis das Holz des Tisches durch die hauchdünnen Lagen sichtbar wurde. Cole runzelte die Stirn, legte eine zweite Serviette unter und dann noch eine. Das Aroma ihres Essens mischte sich mit der fauligen Süße des Sees. Es roch nach verrottenden Pflanzen.
„Was ist denn morgen?“, fragte Vincent.
„Tennis“, sagten Cole und Wallace wie aus einem Mund.
Vincent schnaubte. „Warum frage ich überhaupt?“
Cole küsste Vincent auf die Nasenspitze. Miller zog die Plastikfolie von den Nachos. Wallace knetete seine Hände unter dem Tisch so fest, dass die Gelenke laut knackten.
„Ich komme vielleicht ein wenig später“, sagte Cole.
„Das macht nichts. Ich habe noch ein bisschen was zu tun.“ Dabei war es mehr als nur ein bisschen. Ihm wurde schon bei dem Gedanken schlecht. All die Mühe war umsonst gewesen. Es würde ihn sehr viel Zeit kosten, den Schaden zu beheben, und am Ende würde es ihm vielleicht nicht einmal gelingen. Er hatte gut daran getan, das Ganze vorerst beiseitezuschieben und nicht mehr daran zu denken. Eine Welle der Übelkeit überkam ihn. Er schloss die Augen, alles um ihn herum schien sich in langsamen, dunklen Bahnen zu drehen. Was bist du doch dumm, dachte er. So unfassbar dumm. Er hatte tatsächlich gehofft, dass die Dinge sich zum Guten wenden würden, dass er endlich an der Reihe wäre und auch einmal Glück haben würde. Jetzt hasste er sich selbst für so viel Naivität.
„Ja, genau deswegen komme ich später“, sagte Cole und lachte. Wallace öffnete die Augen. Da war ein metallischer Geschmack in seinem Mund, nicht nach Kupfer oder Blut, sondern anders, irgendwie silbrig.
„Du willst morgen arbeiten?“, fragte Vincent. „Wir machen Pläne, und du arbeitest?“
„Nur ein bisschen.“
„Morgen ist Samstag.“
„Und heute ist Freitag, und gestern war Donnerstag. Es ist bloß ein Tag. Ich habe zu tun.“
„Ich arbeite nie am Wochenende.“
„Toll, möchtest du eine Medaille dafür?“, fragte Cole mit einem Hauch von Bosheit in der Stimme.
„Nein, ich brauche keine Medaille. Aber ich würde gern einmal ein freies Wochenende zusammen mit meinem Freund verbringen, noch diesen Sommer. Entschuldige!“
„Wir sind hier, oder? Nicht wahr? Ich bin hier. Du bist hier. Wir sind hier. Zusammen.“
„Du hast wirklich eine verdammt gute Beobachtungsgabe.“
„Können wir nicht einfach den letzten schönen Sommerabend genießen?“
„Wow, klar, der Sommer ist ja fast schon wieder um. Wie wundervoll.“
„Bald fängt das neue Semester an“, warf Yngve zögerlich ein. „Ihr wisst, was das bedeutet.“
„Neues Semester, neue Daten“, sagten Cole und Yngve gleichzeitig, und ein verzweifelter Optimismus brachte ihre Augen zum Glänzen. Wallace musste lächeln. Für einen Moment vergaß er sich, ließ sich von ihrer Wärme und ihrem Glauben an neue Chancen tragen. Neues Semester, neue Daten. Für sich persönlich hatte er keine Hoffnung, es war nur ein Spruch, den die Leute sagen, um sich Mut zu machen. Er pochte auf die Tischplatte.
„Toi, toi, toi.“
„Meine Güte“, sagte Vincent.
„Hey.“ Cole legte den Arm um ihn, aber Vincent schüttelte ihn ab. Er ließ den Becher auf den Tisch fallen, das Eis schwappte über den Rand und verteilte sich auf dem Holz. Ein weißer Tropfen, lauwarm wie Spucke, landete auf Wallace’ Handgelenk.
„Was würdet ihr ohne die Uni bloß machen? Wenn ihr allein zurechtkommen müsstet?“, fragte Vincent. Er sah jeden von ihnen einzeln an. Miller hatte die Augenbrauen hochgezogen, Yngve wurde rot. Wallace nahm eine von Coles Servietten und wischte sich das Handgelenk ab.
„Wenn wir allein zurechtkommen müssten? Entschuldige mal, aber du bist im Finanzsektor. Nicht gerade Schwerstarbeit“, sagte Cole.
„Ich habe nie behauptet, dass ich Schwerstarbeit leiste, ich frage einfach nur, was wäre, wenn ihr allein zurechtkommen müsstet. Wenn ihr selbstständig denken und euer verdammtes Leben allein planen müsstet. Ihr wärt aufgeschmissen.“
„Ich plane mein Leben nicht? Mein Forschungsprojekt? Meine Experimente? Willst du mir sagen, dass wir unser Leben nicht zusammen geplant haben? Wir besitzen Möbel, Vincent.“
„Weil ich Möbel angeschafft habe. Als ich in die Stadt kam, hast du mit den beiden in einer Männer-WG gelebt“, sagte Vincent und zeigte auf Yngve und Miller, die keine Miene verzogen. „Euer Couchtisch war ein Sperrholzbrett auf Eimern! Mein Gott. Du hast keine Ahnung von Möbeln, geschweige denn davon, wie es ist, einen richtigen Job und eine Krankenversicherung zu haben und Steuern zu zahlen. Wir können uns nicht mal einen richtigen Urlaub leisten. Fünf Tage in Indiana – tolle Idee. Wunderbar.“
„Den letzten Sommer haben wir bei deinen Eltern in Mississippi verbracht, oder?“
„Ja, weil deine Familie Schwule hasst, Cole. Das ist der Unterschied.“
Wallace lachte auf und biss sich in der nächsten Sekunde auf die Zunge. Er schämte sich furchtbar, weil hier etwas Privates ans Licht gezerrt wurde, und doch konnte er nicht wegschauen. Cole und Vincent hatten den Streit im Spaß begonnen, als harmlose Rauferei, aber jetzt fletschten sie ganz im Ernst die Zähne. Cole war von Vincent abgerückt und Vincent von Cole. Die lange Holzbank schwankte bedrohlich, das Essen rutschte über die plötzlich schräge Tischplatte. Miller fing die Nachos auf, bevor sie hinunterfielen.
Cole warf Wallace ein Lächeln zu. „Los, Kumpel, hilf mir. Es geht um Mississippi.“
„Ich bin aus Alabama“, sagte Wallace, und Cole schloss die Augen.
„Du weißt, wie ich das meine. Ist doch ein und dasselbe.“
„Also, ich komme ja aus Indiana, und selbst ich finde es ziemlich schrecklich da“, erklärte Miller. „Vincent hat recht.“
„Genau genommen bist du aus Chicago“, sagte Cole. „Das ist nicht … Vincent kann meine Familie einfach nicht leiden.“
„Das stimmt nicht. Deine Familie ist wunderbar! Leider nur zutiefst rassistisch und absolut homophob.“
„Meine Tante ist eine Rassistin“, sagte Cole zu Wallace.
„Seine Mutter behauptet, ihre Kirchengemeinde kämpfe ums Überleben. Sag ihnen, warum, Cole.“
„Weil eine schwarze Familie eingetreten ist. Oder es versucht hat. Oder immer noch versucht?“ Cole schlug sich die Hände vors Gesicht. Sein Hals war dunkelrot.
„Dann erzähl mir nicht, die wären …“
„Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Schwarzen in der Kirche“, schaltete Miller sich ein. „Jedenfalls nicht, als ich noch hingegangen bin. Indiana halt.“
„Also, meine Familie ist eigentlich nie in die Kirche gegangen“, sagte Yngve. „Es gab auch keine Schwarzen in meiner Stadt. Aber meine Großeltern lieben schwarze Menschen. Man sagt, die Schweden seien die Schwarzen Skandinaviens.“
Wallace verschluckte sich kurz an seinem eigenen Speichel. Yngve zuckte zusammen und wandte sich schnell wieder seinem Taco zu.
„Jedenfalls gibt es mehr im Leben als Pipetten und Reagenzgläser“, sagte Vincent leise. „Alles nur Spielzeug, das ihr braucht, um euch erwachsen zu fühlen.“
Cole wollte gerade etwas antworten, als Wallace zu seiner eigenen Überraschung den Mund aufmachte. „Ist doch aber wirklich albern, oder? Immer noch in der Ausbildung zu sein, meine ich. Manchmal frage ich mich, was ich hier eigentlich mache. Anscheinend ist es nicht albern, zumindest denken das viele Leute. Aber manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, von hier wegzugehen und was anderes zu machen. Im echten Leben, wie du es nennst, Vincent.“ Er sagte das mit einem Lachen in der Stimme und sah an seinen Freunden vorbei zu den Fußballspielern hinüber, die sich beruhigt hatten und näher zusammengerückt waren. Jetzt verfolgten sie gespannt das Geschehen auf dem Handy, niemand redete mehr dazwischen, das Bier wurde ignoriert. Wallace bohrte sich die Daumen in die Kniekehlen, bis es wehtat. „Ich glaube, irgendwie hasse ich es, hier zu sein. Manchmal hasse ich es wirklich.“
Die Worte quollen aus ihm heraus wie Dampf aus einer heißen, engen Kammer in seinem Inneren, und als er fertig war, sah er sich um in der Annahme, dass keiner ihm richtig zugehört hatte. So war das immer – er erzählte etwas, und die anderen hörten höchstens mit einem Ohr zu. Aber als Wallace jetzt den Kopf hob, sah er in ihren Gesichtern eine Art zärtliche Entgeisterung.
„Oh“, sagte er leicht erschrocken. Miller aß weiter seine Nachos, Cole und Yngve kniffen die Augen zusammen. Ihre Schatten fielen über den Tisch, sie waren so nah.
„Du kannst jederzeit von hier weg, weißt du“, sagte Vincent. Wallace meinte, seine Stimme als warmen Hauch im Nacken zu spüren. „Wenn du unglücklich bist, kannst du jederzeit abhauen. Niemand zwingt dich zu bleiben.“
„Moment mal, stopp, warte, sag ihm doch so was nicht“, ging Cole dazwischen. „Wenn er geht, kann er das nicht einfach wieder rückgängig machen.“
„Das echte Leben besteht daraus, Dinge zu tun, die man nicht wieder rückgängig machen kann, Babe.“
„Na hör mal einer an. Bist du jetzt plötzlich sein Coach? Im Ernst, dein Job ist doch nur besseres Telefonmarketing.“
„Du bist so überheblich manchmal“, zischte Vincent. „Das ist wirklich erschreckend.“
Cole beugte sich vor, um Wallace direkt in die Augen zu sehen. „Wenn du von hier weggehst, wirst du dich nicht besser fühlen. Dann hättest du nämlich aufgegeben.“
„Du kannst nicht entscheiden, womit ein anderer sich besser fühlt“, sagte Vincent aufgebracht. Wallace streckte den Arm aus und legte ihm eine Hand an den Rücken. Sein T-Shirt war durchgeschwitzt, die Muskelstränge darunter zitterten wie gezupfte Saiten.
„Hey, ist schon gut“, raunte Wallace, aber Vincent nahm es kaum wahr. „Setz ihn nicht so unter Druck“, sagte er zu Cole. „Wo sind wir denn hier, in einer Sekte?“
„Wo ist eigentlich Lukas?“, fragte Yngve so laut dazwischen, dass selbst die Fußballmannschaft es mitbekam. „Weißt du irgendwas, Cole?“
„Bei Nate, glaube ich“, sagte Cole, ohne Vincent aus den Augen zu lassen. Yngve zuckte abermals zusammen. Lukas und Yngve waren seit dem ersten Jahr an der Uni mehr oder weniger ineinander verliebt, aber Yngve war hetero, weswegen Lukas irgendwann die Geduld verloren hatte; er hatte sich einen Freund gesucht, der Tiermedizin studierte. Eine ebenso seltsame wie passende Wahl, fand Wallace. Wenn Yngve auf einer Party sehr betrunken war, sagte er Sachen wie: „Mit einem Tierarzt zu schlafen, das ist praktisch Sodomie. Tiermedizin ist doch gar kein richtiges Fach.“ Lukas zuckte dann einfach nur die Achseln und schwieg. Abgesehen davon hatte Yngve eine Freundin. Wallace bemitleidete alle beide. Er fand, dass sie sich unglücklicher machten als nötig.
„Kommen sie noch?“
„Nicht, wenn sie schlau sind“, sagte Vincent.
Das Eis war inzwischen zu einem weißen Brei zerlaufen. Die Mücken hatten sich aus ihrem Versteck in den Ranken an der Mauer gewagt und sich in der Dämmerung auf Nahrungssuche begeben. Wallace wedelte sie fort.
„Du hättest nicht mitkommen müssen. Du hättest zu Hause bleiben können“, sagte Cole zu Vincent.
„Das hier sind auch meine Freunde.“
„Jetzt. Jetzt sind sie deine Freunde.“
„Was hast du eben zu mir gesagt?“
Wallace sah zu Yngve hinüber, der erschrocken die Augen aufriss, und zu Miller, der so teilnahmslos wirkte, als säße er an einem anderen Tisch. Wallace nickte Cole und Vincent zu, Miller zuckte nur mit den Achseln. Kein Wunder. Eigentlich wusste Wallace, dass auch er sich besser raushalten sollte, aber er hatte ein schlechtes Gewissen. Als wäre das alles seine Schuld. Yngve stieß Miller an, durchdrang dessen Apathie jedoch nicht. Vincent atmete schwer und schnell. Die Wellen schwappten gegen den Rumpf der in Ufernähe festgemachten Boote.
„Niemand gibt auf. Niemand geht von hier weg. Wir haben jede Menge Spaß zusammen“, sagte Wallace.
„Ja, genau“, gab Vincent schnippisch zurück und schaute zu Cole. „Sei nicht so eine Heulsuse.“
„Bin ich nicht. Niemand heult“, sagte Cole und wischte sich mit den Handballen über die Augen.
„Du Armer“, meinte Yngve, streckte die Hand aus und fuhr Cole durchs Haar. „Kommst du klar?“
„Lass das“, sagte Cole, doch er klang alles andere als entschlossen. Er lachte und weinte gleichzeitig. Alle bemühten sich nach Kräften, die Tränen in seinen Augen zu ignorieren. Armer Cole, dachte Wallace, so nah am Wasser gebaut. Als er sah, wie Cole sich über die Augen wischte, spürte er ein Brennen in der Kehle.
„Ja, ich glaube, er kommt klar“, sagte Wallace. Dies waren seine Freunde, die Menschen, die ihn am besten kannten, denen er am meisten bedeutete. Erneut breitete sich die schreckliche, übervolle Stille zwischen ihnen aus, nur dass sich Wallace diesmal sicher war: Er und nur er allein war dafür verantwortlich. Er hatte den Streit angezettelt, er mit seiner großen Klappe. Das Komischste daran war – und er verstand es erst jetzt –, dass er nur einen Teil der Wahrheit ausgesprochen hatte. Ja, er spielte tatsächlich mit dem Gedanken, von hier abzuhauen, und ja, manchmal hasste er es. Aber das Szenario ganz zu Ende zu denken, so gründlich, wie man einen harten Knochen durchkaut, war etwas vollkommen anderes. Eigentlich wollte er nicht die Universität verlassen, sondern sein Leben. Diese Wahrheit schmiegte sich an ihn, drang unter seine Haut wie ein zweites, schlecht sitzendes Selbst, und jetzt, da er ihrer gewahr geworden war, würde er sie nicht mehr loswerden. Was blieb, war nur das ewige, öde Warten, diese Angst, etwas zu entscheiden und nicht mehr rückgängig machen zu können.
„Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, Wallace“, sagte Yngve. Wallace versuchte zu lächeln. Die Erkenntnis ließ seinen Atem stocken. Yngve erwiderte sein Lächeln nicht. Cole beugte sich abermals vor, um ihn anzusehen, Vincent ebenfalls. Sogar Miller schien ihn jetzt zu beobachten, verstohlen und hinter seinem Essen hervor, das er sich mit beiden Händen in den Mund stopfte.
„Mir geht es gut“, beteuerte er. „Wirklich.“ Seine Kehle war wie zugeschnürt. Er bekam nicht mehr genug Luft. Er spürte, wie er den Halt verlor.
„Brauchst du einen Schluck Wasser?“, fragte Vincent.
„Nein, nein. Doch. Ich gehe schon“, krächzte Wallace und stand auf. Er ruderte mit dem Arm, weil die Welt um ihn herum mit einem Mal schwankte. Er schloss die Augen und spürte eine Hand auf seinem Unterarm. Cole wollte ihn stützen, aber Wallace machte sich los. „Hey, ist schon gut. Alles okay.“
„Ich begleite dich“, sagte Cole.
„Nein, bleib sitzen. Entspann dich.“ Wallace grinste, so gut es ging, sein Zahnfleisch brannte. Plötzlich hatte er Zahnschmerzen. Er wandte sich vom Tisch ab und spürte die Blicke der anderen in seinem Rücken. Dann folgte er der Krümmung der Mauer und nahm die Treppen hinunter zum See. Er würde sich zusammenreißen und erst wieder zurückgehen, wenn er seinen Freunden einen überzeugenden Anschein von Glück präsentieren konnte.
Vom Ufer führte eine Treppe auf den trüben Grund des Sees hinunter. Sie bestand aus schroffem, unbehandeltem Stein, glatt poliert von Wellen und Fußtritten. Nur wenige Armlängen von Wallace entfernt saßen andere Menschen und beobachteten, wie der Mond aufging. Am gegenüberliegenden Ufer, noch hinter der Halbinsel, die mit Kiefern und Fichten bewachsen war und wie ein Daumen in den See ragte, standen Häuser auf hohen Stelzen. Ihre erleuchteten Fenster erinnerten an die Augen riesiger Vögel. Wenn Wallace abends am Ufer spazieren ging und durch die Büsche aufs Wasser schaute, fand er, dass die Häuser wie ein Schwarm riesiger Vögel aussahen, die sich auf der anderen Seite niedergelassen hatten. Er selbst war nie dort drüben gewesen, hatte nie einen Grund gehabt, den See zu überqueren und diesen exklusiven und abgelegenen Teil der Stadt zu besuchen.
Die letzten Boote waren hereingekommen, auf die Böcke gezogen und für die Nacht mit Planen abgedeckt worden. Die größeren wurden weiter unten aus dem Wasser geholt, am Bootshaus. Manchmal spazierte Wallace daran vorbei und in die andere Richtung, wo das Gras nicht gemäht wurde, die Baumstämme dichter standen und dicker waren. Dort gab es eine gedeckte Brücke, unter der eine Gänsefamilie wohnte. Ab und an schaute er nach unten und sah sie mit grauen, weit ausgebreiteten Flügeln über das Wasser gleiten. An anderen Tagen watschelten sie träge und selbstgewiss durch den Schatten vor den Fußballfeldern und Picknickplätzen, wie strenge Wildhüter.
Aber um diese Tageszeit waren die Gänse längst weg, die Möwen in ihre Nester zurückgekehrt, und Wallace hatte das Ufer praktisch für sich allein, abgesehen von den anderen Leuten auf der Treppe. Er schaute verstohlen zu ihnen hinüber und fragte sich, was für ein Leben sie führten, ob sie zufrieden waren oder wütend oder enttäuscht. Sie sahen aus, wie Menschen überall aussahen, weiß und in hässlicher, weit geschnittener Kleidung, mit sonnenverbrannter, trockener Haut und breiten, elastischen Mündern. Die Jüngeren, hochgewachsen und gebräunt, rempelten einander feixend an. Weiter hinten verteilte sich die Menschenmasse auf dem Pier wie Moos. Das Wasser zu Wallace’ Füßen spritzte in die Höhe und benetzte den Saum seiner Shorts. Die Steintreppe war glitschig und kühl. In seinem Rücken fing eine Band zu spielen an, die Instrumente erwachten leiernd und schrammelnd zum Leben.
Wallace schlang die Arme um die Knie und stützte das Kinn auf. Er zog die Füße aus den Leinenturnschuhen und tauchte sie bis zu den Knöcheln in den See. Das Wasser war kalt, aber nicht so kalt, wie er es erwartet oder erhofft hatte. Er spürte etwas Glattes an der Oberfläche, anders als das Wasser selbst, eher wie eine lose zweite Haut, die darauf herumrutschte. An manchen Tagen wurde ein Badeverbot verhängt, wegen der Algen, deren Neurotoxine tödlich wirken konnten. Außerdem gab es parasitäre Organismen, sie saugten sich an den Schwimmern fest und übertrugen Krankheiten, die den Körper von innen zerfraßen. Das Wasser schien harmlos, dabei konnte es ziemlich gefährlich sein. Trotzdem waren weit und breit keine Warnschilder zu sehen, denn was immer dort im See lebte, wurde den Menschen anscheinend nicht gefährlich genug. Jetzt, da Wallace direkt am Ufer saß, fand er, dass das Wasser stank wie Alkohol, beißend und irgendwie chemisch.
Plötzlich musste er an das schwarze Wasser denken, das ihn vor so vielen Jahren aus dem Abfluss des elterlichen Waschbeckens angestarrt hatte. Ein schwarzer Kreis, eine glänzende Pupille, die zu ihm emporblickte, während der säuerlich verdorbene Gestank ihm in die Nase stieg. Sein Vater hatte das Wasser eimerweise gehortet. „Das brauche ich noch“, sagte er, wenn Wallace es ausschütten wollte. Er hortete Wasser, wie andere Leute Kleidung oder Flaschen oder kaputte Kulis und Bleistifte horten. Man kann nie wissen, was noch kommt und welcher Müll es wert ist, aufbewahrt zu werden. Das Wasser in den Eimern war schwarz wie Teer, weil Blätter vom Dach hineinfielen und sich zersetzten. Manchmal waren auch nur die zarten braunen Blattadern geblieben, von denen alles Grün abgefressen worden war. Wenn man in einem bestimmten Winkel ins Wasser schaute, konnte man unter der Oberfläche zappelnde Mückenlarven erkennen. Einmal hatte sein Vater ihm erzählt, es wären Kaulquappen. Wallace hatte ihm geglaubt, hatte das schleimige Wasser mit beiden Händen abgeschöpft und die Augen zusammengekniffen, um die Quappen zu sehen. Aber natürlich waren es nur Mückenlarven gewesen.
Dunkles Wasser.
Die Anspannung saß oben in seiner Brust wie eine aufgedrehte Spule. Sie fühlte sich an wie ein schwarzer Knoten zwischen den Lungenflügeln. Sein Magen schmerzte, er hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Die Oberfläche seines Hungers war rau wie eine Katzenzunge. Er spürte, wie der Druck hinter seinen Augäpfeln anstieg.
Oh, dachte er, als er merkte, was es war: Tränen.
Im selben Moment spürte er jemanden neben sich. Wallace drehte den Kopf und erwartete ganz kurz, das Gesicht seines Vaters zu sehen, heraufbeschworen aus der Erinnerung. Aber dann war es nur Emma, die doch noch gekommen war, zusammen mit ihrem Verlobten Thom und ihrer Hündin Scout, einem zotteligen, fröhlichen Tier.
Sie lachte und legte Wallace einen Arm um die Schultern. „Was machst du hier unten?“
„Die Aussicht genießen“, sagte er und versuchte, ebenfalls zu lachen. Er hatte Emma seit mindestens einer Woche nicht gesehen. Sie arbeitete zwei Stockwerke tiefer in einem Labor am Ende eines langen, dunklen Korridors. Jedes Mal, wenn Wallace sie zum Mittagessen abholte oder ihr etwas vorbeibrachte, hatte er das Gefühl, das Gebäude der Biowissenschaften verlassen zu haben und an einen verbotenen Ort vorzudringen, gerade so, als hätte er sich verlaufen oder wäre in ein seltsames Paralleluniversum hineingesaugt worden. Die Wände waren leer bis auf ein paar Schwarze Bretter, an denen vergilbte Flugblätter und Poster aus den Achtzigern hingen, deren Verheißungen immer noch gültig schienen. Emma und Wallace hatten sich aus einem einfachen Grund angefreundet: Beide waren sie in ihrer jeweiligen Laborgruppe die Einzigen, die nicht weiß und männlich waren. Vier Jahre lang hatten sie neben großen jungen Männern mit aufrechter Haltung, unverwüstlichem Selbstbewusstsein, lauter Stimme und vorwitzigen Wortmeldungen gesessen und heimliche Blicke ausgetauscht, vier Jahre lang hatten sie in diesem langen, dunklen Korridor leise Gespräche geführt und einander versichert, dass sie es irgendwann leichter haben würden.
Emma strich sich eine dunkle Locke aus dem Gesicht und sah ihn an. Auf einmal fürchtete Wallace, er könnte so dünn und durchsichtig werden wie Coles Serviette.
„Wallace, was ist los?“, fragte sie. Ihre Finger berührten sanft sein Handgelenk. Wallace räusperte sich.
„Nichts“, sagte er. Seine Augen brannten.
„Wallace, was ist passiert?“ Emma hatte ein schmales, markantes Gesicht und einen olivfarbenen Teint; bei bestimmten Lichtverhältnissen hielten die Leute sie nicht für eine Weiße. Aber sie war eine, wenn auch mit weitverzweigten Wurzeln. Das eine Großelternpaar war böhmisch – oder tschechisch, wie es jetzt hieß –, das andere stammte aus Sizilien. Ihr Kinn war spitz wie das von Yngve, nur ohne Grübchen. Ihre Finger umschlossen Wallace’ Handgelenk nicht ganz, aber sie klammerte sich fest.
„Es ist nichts“, murmelte er und versuchte, möglichst überzeugend zu klingen. Er wusste ja selbst nicht genau, was eigentlich mit ihm los war. Was sollte er ihr sagen?
„Sieht nicht so aus, Mister.“
„Mein Vater ist gestorben“, sagte er, weil es immerhin nicht gelogen war, fühlte sich danach aber kein bisschen erleichtert. Vielmehr rüttelte es ihn auf, wie ein plötzlicher Schrei in einem stillen Raum.
„Scheiße“, sagte sie. „Scheiße.“ Und dann, als sie sich wieder gefangen hatte, schüttelte sie den Kopf und fügte hinzu: „Das tut mir sehr leid, Wallace. Mein herzliches Beileid.“
Er lächelte schüchtern, weil er nicht so recht wusste, wie er mit ihrem Mitgefühl umgehen sollte. Wenn Menschen mit anderen trauerten, hatte er immer den Eindruck, sie würden um ihrer selbst willen trauern; als wäre das fremde Unglück nur ein Anlass zu fühlen, was man fühlen will. Mitgefühl – das kam ihm vor wie Bauchrednerei. Sein Vater war mehrere Hundert Meilen von hier gestorben, ohne dass Wallace irgendjemandem davon erzählt hätte. Sein Bruder hatte ihn angerufen. Später hatten sich ein paar Verwandte über Facebook bei ihm gemeldet, manche machten sich Sorgen, andere waren einfach nur neugierig. Diese öffentlich bekundete Trauer war nichts als hässliche Schaumschlägerei. Es war seltsam, dachte Wallace und lächelte Emma an, doch er empfand keinen quälenden Verlust. Nein, wenn er an den Tod seines Vaters dachte, fühlte er sich wie am frühen Morgen im Labor, wenn er pünktlich erschienen war und andere die Arbeit schwänzten. Aber vielleicht war das nicht die ganze Wahrheit. Er wusste nicht, was er fühlen sollte, und deswegen versuchte er, gar nichts zu fühlen. Das erschien ihm aufrichtiger. Das war ein echtes Gefühl.
„Danke“, sagte er, denn was soll man sagen, wenn man ins Mitleid eines anderen verstrickt wird?
„Warte mal“, sagte sie und drehte sich zum Tisch um, wo die Jungs sich gerade über Scout beugten. Der Hund ließ sich zu gerne kraulen. „Sie wissen es noch nicht?“
„Nein.“
„Scheiße“, sagte sie. „Warum nicht?“
„Es war wohl einfacher für mich. Kannst du das verstehen?“
„Nein, Wallace. Nein, das kann ich nicht verstehen. Wann ist die Beerdigung?“
„Die war schon. Vor ein paar Wochen“, sagte er, und Emma erschrak.
„Wie bitte? Warst du dort?“, fragte sie.
„Nein. Ich hatte zu viel Arbeit“, sagte er.
„Du liebe Güte. Hat die Dämonin es dir verboten?“
Wallace lachte, seine Stimme hüpfte über das Wasser. Die Vorstellung, seine Doktormutter könnte ihm die Reise zur Beerdigung seines Vaters verboten haben, war zu absurd. Gleichzeitig war es jedoch ziemlich verlockend, Emma in dem Glauben zu lassen, schließlich wäre Simone so etwas durchaus zuzutrauen. Doch wahrscheinlich würde es sich bis zu ihr herumsprechen, und dann würde er Ärger bekommen.
„Nein“, antwortete er. „Sie ist gar nicht so übel, weißt du. Und außerdem war sie nicht einmal in der Stadt.“ Simone war groß und attraktiv und von einschüchternder Intelligenz. Eigentlich hatte sie nichts Dämonisches an sich, sie glich eher einem heißen Wind, der einen nach und nach zermürbt.
„Nimm sie nicht in Schutz“, sagte Emma und schloss die Augen. „Im Ernst, hat sie dir verboten, zur Beerdigung deines Vaters zu gehen? Das ist doch krank.“
„Nein“, sagte Wallace und musste plötzlich wieder lachen, er krümmte sich und hielt sich den Bauch. „So war es nicht. Ich hatte einfach keine Zeit.“
„Er war dein Vater“, sagte Emma. Wallace’ Lachen erstarb. Ihre Worte klangen wie ein Tadel. Ja, sein Vater. Er wusste das. Aber das Problem mit seinen Freunden und überhaupt mit der Welt war doch, dass alle glaubten, in einer Familie müsse alles auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen. Offenbar musste man bestimmte Gefühle empfinden, sollte das Gleiche fühlen wie alle anderen, und wenn nicht, machte man irgendetwas falsch. Wie konnte er bei dem Gedanken, dass er die Beerdigung seines Vaters verpasst hatte, einen Lachanfall bekommen? War das nicht eigenartig? Nein, befand Wallace. Zu lachen war weder falsch noch schlecht; trotzdem zwang er sich dazu, eine Maske stiller Traurigkeit aufzusetzen.
„Verdammte Scheiße“, sagte Emma. Anscheinend wurde sie an seiner Stelle wütend. Sie trat ins Wasser, silbrige Tropfen spritzten auf und verschwanden im Dunkel der Nacht. Emma umarmte Wallace und drückte ihn. Er schloss die Augen und seufzte. Sie weinte leise, er löste sich und legte ihr einen Arm auf den Rücken, wie um sie zu stützen.
„Es ist okay, alles ist okay“, sagte er, aber sie schüttelte nur den Kopf und weinte noch lauter. Sie küsste ihn auf die Wange und klammerte sich an ihn.
„Es tut mir so leid, Wallace. O mein Gott. Ich wünschte, ich könnte irgendwas für dich tun“, sagte sie.
Das Ausmaß und die Tiefe ihres Kummers verstörten ihn. Es erschien ihm unmöglich, dass Emmas zur Schau gestellte Trauer ganz aufrichtig war, dass sie zitternd in seinen Armen hing, weil sie einen Verlust fühlte, den auch er gefühlt haben musste. Er wollte weinen, und sei es nur ihr zuliebe, aber er konnte nicht. Die Leute an den Tischen direkt hinter ihnen begannen zu johlen, sie applaudierten und warfen ihnen Küsse zu.
Emma knurrte leise, aber sie hörten es nicht. Nur Thom richtete sich kerzengerade auf, als hätte er gespürt, dass irgendetwas nicht stimmte. Wallace drehte sich um und fing Thoms finsteren Blick auf. Thom wusste, dass Wallace schwul war, er wusste, dass zwischen ihm und Emma nichts lief. Warum starrte er ihn dann so an? Es war, als hätte ihm jemand einen Witz erzählt und er hätte die Pointe nicht verstanden. Manchmal nahm Thom sich selbst so ernst, dass es fast schon wehtat. Er weigerte sich, seine Haare zu kämmen, und trug das ganze Jahr über Wanderschuhe, obwohl sie in einer ziemlich flachen Gegend lebten und er zudem aus Oklahoma stammte. Auf der anderen Seite machte Thom um alles und jeden ein Gewese. Er promovierte in Literaturwissenschaften und hatte sich einer akademischen Karriere verschrieben, die ihn nun langsam in die Tiefe zog. Dennoch mochte Wallace Thom mehr, als dass er ihn nicht mochte. Thom versorgte ihn mit Buchtipps, und sie unterhielten sich über Literatur wie die anderen über College-Football und Hockey. Seltsamerweise kam es trotzdem immer wieder zu Momenten wie diesem, in denen Thom ihn und Emma anstarrte, als wollte er ihnen am liebsten den Kopf abreißen.
„Genug jetzt, das ist ja peinlich“, sagte Wallace.
„Nein, noch nicht“, flüsterte Emma und küsste ihn auf den Mund. Ihr warmer Atem roch süßlich, als hätte sie ein Bonbon gelutscht. Ihre Lippen fühlten sich weich und klebrig an. Der Kuss war nur flüchtig gewesen, aber der Lärm, den er an den Tischen auslöste, war ohrenbetäubend. Jemand richtete eine Taschenlampe auf sie, und da saßen sie am Wasser, wie in einem Liebesfilm. Emma, die geborene Schauspielerin, riss die Arme hoch und ließ sich in Wallace’ Schoß sinken.
Wallace war noch nie geküsst worden, nicht so richtig. Jetzt fühlte er sich auf eine unbestimmte Weise betrogen. Emma hing lachend über seinen Knien. Thom kam ans Ufer, Scouts Leine in der geballten Faust.
„Was zum Teufel sollte das?“, fuhr er Wallace an. „Machst du das immer so? Einfach die Freundinnen anderer Leute küssen?“
„Sie hat mich geküsst!“, rief Wallace.
„Ich habe ihn geküsst“, sagte Emma, als würde das irgendetwas erklären. Wallace seufzte.
„Emma, wir haben doch darüber geredet.“
„Er ist schwul“, sagte sie und setzte sich auf. „Das zählt nicht. Das ist so, als hätte ich eine Frau geküsst.“
„Danke, ich weiß das zu schätzen“, sagte Wallace.
„Siehst du?“
„Nein, Emma. Es ist nicht in Ordnung. Mir doch egal, ob er schwul ist … Nichts für ungut, Wallace.“
„Na ja. Ich bin schwul.“
„Aber das ist kein Grund“, fuhr Thom fort, „einfach so jemanden zu küssen.“
„Sei nicht so ein Puritaner“, maulte Emma. „Bist du jetzt plötzlich Baptist, oder was?“
„Mach dich nicht über mich lustig.“
„Sein Vater ist gestorben. Ich wollte nur eine gute Freundin sein!“ Sie war jetzt aufgestanden, der Saum ihres Rocks – ein geblümtes Ding, das sie wahrscheinlich aus irgendeinem Kleidersack gerettet oder für ein paar Cent auf dem Flohmarkt gekauft hatte – war nass. Wallace atmete tief durch, während Thom ihn fragend ansah.
„Dein Vater ist gestorben?“
„Ja“, sagte Wallace mit einem leichten Zittern in der Stimme.
„O Mann, das tut mir leid.“ Thom zog Wallace an sich und drückte ihn. Seine Haut war warm und gerötet, sein dunkler Bart kratzte an Wallace’ Hals. Thom hatte haselnussbraune Augen, die im Abendlicht dunkel schimmerten. „Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist wirklich schlimm. Tut mir leid.“
„Ist schon okay“, sagte Wallace.
„Nein, ist es nicht. Aber das ist okay“, erwiderte Thom und klopfte Wallace selbstzufrieden auf den Rücken. Scout leckte Wallace’ Hand, ließ ihre Zunge über Handfläche und Knöchel schnellen. Wallace ging in die Hocke, um ihr die Ohren zu kraulen, sie sprang hoch und legte ihm die Vorderpfoten auf die Schultern. Ihr Fell roch holzig, nach Linde vielleicht. Emma und Thom versöhnten sich mit einem Kuss, während Scout Wallace’ Ohren ableckte.
Sie gingen gemeinsam zurück zum Tisch, der sich mit Müll und Alkohol gefüllt hatte. Die Bierkrüge waren gebracht worden, dazu ein Cider für Wallace.
„Für dich“, sagte Miller.
„Wie aufmerksam von dir“, entgegnete Wallace und klang dabei unfreiwillig gestelzt, aber Miller nickte nur.
Über dem Tisch zogen fette Hornissen ihre trägen Kreise. Gelegentlich begab sich eine brummend zu ihnen herab, angelockt vom Bier und von dem süßlichen Cider. Yngve, der Tierfreund, fing sie in einem Becher und trug sie zum Pier, um sie wieder freizulassen. Als er zurückkam, schwirrten neue Hornissen über den Gläsern.
„Ich hasse Bienen“, sagte Wallace.
„Genau genommen sind das keine Bienen“, fing Yngve zaghaft an.
„Ich bin allergisch gegen Wespen“, erklärte Wallace.
„Bienen und Wespen sind nicht …“
„Ich auch“, sagte Miller. Er gähnte und streckte sich. Mit einer Hand rieb er sich über die Augen. Sie war salzig und verklebt von Popcorn und Nachos. Innerhalb von Sekundenbruchteilen sprang er auf und stieß beinahe den Tisch um. Wallace sah die leere Nacho-Schale und verstand sofort, was passiert war.
„Mist“, rief Miller.
„Oh, nein!“
„Geht es dir gut?“
„Nein, Yngve. Mir geht es nicht gut“, sagte Miller, drehte sich um und lief los.
„Ich mach das“, sagte Wallace, bevor Cole sich anbieten konnte.
Im Getümmel der weißen Menschen sah Wallace einen dicken Mann mit geröteter Haut, dessen Körperbehaarung im Flutlicht der Getränkebuden golden schimmerte. Zwei kleine Jungen ließen ihre Spielzeugautos über die glatte Tischplatte und über die Arme ihrer erschöpften Eltern fahren, die den verkniffenen Ausdruck durchtrainierter Menschen im Gesicht trugen. Unter den Bäumen sah er mehrere Tische mit Verbindungsstudenten in Muskelshirts, deren Teint im milchigen Schein der Lichterketten vor Gesundheit zu strahlen schien; hier und dort auch Gruppen von älteren Leuten mit erschlafftem Körper und erschlafftem Leben. Vielleicht wollten sie ein Stück ihrer Vergangenheit zurückerobern wie ein Glühwürmchen, das man in ein Marmeladenglas lockt. Die Band auf der kleinen Bühne hatte den See im Rücken und spielte eine Art karibischen Swing, schleppend und wie aus der Zeit gefallen. Die Musiker trugen Hawaiihemden und waren ungefähr in Wallace’ Alter. Alle hatten strähniges blondes Haar und eine schmale Nase, fast als wären sie Geschwister. Zwischen den Tischen standen Lampen in Fackelform, vor den Getränkebuden sammelte sich das Flutlicht in breiten Pfützen. Wenn man hineintrat, um überteuertes Bier, weiche Brezeln oder Bratwurst zu bestellen, war es, als käme man von der Nacht in den Tag. Wallace reihte sich gleich hinter dem Mann mit den goldenen Schulterhaaren ein. Als er an der Reihe war, fragte er nach Milch. Eine kleine Flasche kostete dreieinhalb Dollar. Der Verkäufer, ein junger Mann mit schütterem Bart und platter Nase, kramte in der Kühlbox unter dem Tresen und warf Wallace immer wieder skeptische Blicke zu.
Wallace sah sich um, er suchte Miller. Auf der Treppe, die vom Uferweg auf die höher liegende Terrasse führte, war er noch dicht hinter ihm gewesen. Die verglasten, gelblich ausgeleuchteten Korridore des Memorial Union waren von außen gut einsehbar und die Böden aus einem Marmor, wie Wallace ihn sonst nur aus Bankgebäuden kannte. Unter dem weiten, dunklen Geäst der Eiche in der Platzmitte hatten sich ein paar Leute versammelt, um zu tanzen. Wallace schaute ihnen eine Weile dabei zu, wie sie ruckartig und steif die Hüften bewegten. Zwei ältere Männer versuchten, ihre Begleiterinnen zum Tanzen zu animieren, aber die schüttelten nur den Kopf und lächelten verlegen. Am Nebentisch saßen ein paar junge Studentinnen. Alle hatten sie den kantigen Körperbau einer Sportlerin und ein großes, breites Gesicht. Ihr Lachen schallte über den Platz, tief und ausgelassen. Zwei von ihnen standen auf, um mit den alten Männern zu tanzen, die Freundinnen applaudierten begeistert und lösten damit eine Welle aus; plötzlich drehten sich alle um und klatschten mit, die Band spielte umso beherzter, und die Musik rasselte durch die Luft wie eine Schaufel durch Kies. Es klang nicht schön. Eigentlich war das gar keine richtige Musik, dachte Wallace, aber die Leute tanzten unbeirrt weiter, und bald kamen noch mehr hinzu. Zwei Verbindungsstudenten sprangen auf und parodierten die tanzenden Paare, aber dann wurden sie plötzlich schüchtern, wendeten sich ab und ließen die muskelbepackten Arme sinken. Mit einem Ruck fand Wallace zu sich selbst zurück. Ein Schatten fiel durch die Fenster auf ihn, er sah Miller durch den Flur in Richtung der Waschräume eilen. Sie liefen ein paar Schritte nebeneinander her, zu beiden Seiten der Glasfront, er draußen und Miller drinnen, aber Miller sah ihn nicht oder gab vor, ihn nicht zu sehen; es war wie in einem Traum.
Wallace betrat die Herrentoilette. Miller stand bereits am Waschbecken und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Sein Hemd und sein Kinn waren tropfnass, er zappelte und fluchte leise vor sich hin. Sie waren allein.
„Hey, lass mich dir helfen“, sagte Wallace.
„Ich bin so blöd“, schimpfte Miller. „Ich habe völlig vergessen, dass meine Hände dreckig sind.“
„So was kommt vor“, sagte Wallace und stellte die Milchflasche ab. Sie war eiskalt. Er wusch sich die Hände. In der Herrentoilette roch es nach Bier und Desinfektionsmittel. Überhaupt nicht nach Pisse. Die Beleuchtung war gedimmt, und für eine öffentliche Toilette wirkte der Raum viel zu sauber, was Wallace unheimlich vorkam. Die Platte zwischen den Waschbecken war aus billigem schwarzem Stein. An der Milchflasche bildeten sich Kondenstropfen, Miller betrachtete sie durch zusammengekniffene Lider. Der Spiegel war hoch und leicht konkav. Wallace musste den Blick von ihrem Spiegelbild abwenden. „Kannst du dich vorbeugen?“
Miller rührte sich nicht. Zunächst fürchtete Wallace, er hätte sich schon wieder eine Blöße gegeben, aber da begann Miller, sich zu regen, ganz langsam, als hätte er eine Entscheidung getroffen. Er beugte die Knie und drehte sich ein klein wenig zur Seite, bis sein Gesicht über dem Waschbecken schwebte. Er wirkte ganz wehrlos. Wallace öffnete die Milchflasche und hielt sie über Millers Augen. Seine Hände zitterten. Ein Milchtropfen traf Millers Wange knapp unterhalb der Wimpern. Wallace schluckte. Er sah, wie Miller atmete. Sah, wie er sich die Mundwinkel leckte. Vom Wasserhahn löste sich ein Tropfen.
„Los geht’s“, sagte Wallace. Er kippte etwas Milch auf Millers Lider und sah zu, wie das weiße Rinnsal über Millers Nasenrücken ins Waschbecken lief. Miller schloss die Augen. „So klappt das nicht. Du musst sie offen lassen.“ Miller grunzte und öffnete die Augen wieder. Die Milch klatschte ins Becken. Wallace goss die halbe Flasche aus, nahm zwei Papiertücher und hielt sie unters Wasser. Er drückte die Tücher über Millers Augen aus – braune Iris mit einem schmalen blauen Rand, das Weiß begann schon, sich rot zu färben. Das Wasser lief Miller in die Augen, er schloss sie instinktiv, öffnete sie dann aber wieder. Wallace tupfte Millers lange Wimpern mit den nassen Papiertüchern ab, hielt sie erneut unters Wasser, tupfte wieder.
„Okay“, sagte Wallace. „Siehst du, alles wird gut.“
„Ach komm. Mach dich nicht über mich lustig.“
„Tue ich nicht“, sagte Wallace. Er gab sich Mühe und berührte Miller nur sanft, durchnässte das Tuch, tupfte vorsichtig weiter. „Mir ist das auch schon mal passiert. Ich habe mit meinen Großeltern Chilischoten geerntet und mir dann, als ich müde wurde, die Augen gerieben“, erzählte Wallace und musste dabei über sich selbst lachen. Darüber, wie elend er sich gefühlt hatte. Augen wie Grapefruits hatte er gehabt, geschwollen und wund. Er schaute auf Miller hinunter, auf sein sonnengebleichtes Haar und die langen Wimpern. Auf einmal war es, als hätte man ihm in den Bauch getreten. Ja, Miller erwiderte seinen Blick, aber was hätte er sonst tun sollen? Wohin sollte er schauen außer nach oben, und was gab es da zu sehen, wenn nicht Wallace?
„Fertig“, sagte Wallace und ließ die Milchflasche in den Papierkorb unter dem Waschbecken fallen.
„Danke“, antwortete Miller. „Es war gar nicht so schlimm. Hat bloß höllisch wehgetan.“
„Ja. Es tut furchtbar weh, selbst wenn man nicht ernsthaft verletzt ist.“
Sie standen am Becken, der Wasserhahn tropfte. Wallace’ Hände waren feucht und kalt, Millers Augen so geschwollen und rot, als hätte er geweint. Miller lehnte sich an die Wand, was ihn ein bisschen kleiner erscheinen ließ. Die Musik, die jetzt von draußen hereinwehte, klang so sanft und harmlos wie das Rascheln des Windes in den Bäumen. Nervös verdrehte Wallace die feuchten Papiertücher. Miller streckte den Arm aus und umschloss Wallace’ Finger mit seiner großen Hand.
„Willst du wirklich von hier weg?“, fragte er.
„Ach“, sagte Wallace und lachte peinlich berührt, weil ihm klar wurde, wie albern und lächerlich er geklungen haben musste. „Wer weiß? Ich glaube, ich bin einfach nur gestresst.“
„Sind wir doch alle“, sagte Miller nach einer Weile und drückte Wallace’ Finger. „Ich glaube, wir alle stehen unter Strom und verschließen uns, bis wir bekommen, was wir wirklich wollen, und manchmal hört es sogar dann nicht auf. Wer weiß?“
„Wer weiß“, wiederholte Wallace.
Miller zog ihn an sich, Wallace ließ sich ziehen. Sie küssten sich nicht, nein, Miller hielt ihn einfach nur im Arm, bis draußen ein neues Lied anfing. Es war höchste Zeit zurückzugehen. Hand in Hand traten sie vor die Schiebetüren, die sich öffneten und sie in den Abend entließen, wo sie sich zaghaft und widerwillig voneinander lösten und wieder zu getrennten Menschen wurden.
„Bis gleich“, sagte Miller und zog eine Augenbraue hoch.
„Bis gleich.“ Wallace bahnte sich einen Weg zurück durch die Menge. Er fühlte sich federleicht, aber auch entblößt, wie innerlich aufgescheuert. Als er sich wieder hinsetzte und die anderen wissen wollten, wo Miller blieb, konnte er nur mit den Achseln zucken. „Er hat gesagt, er kommt gleich.“
„Wie geht es ihm?“, fragte Cole.
„Besser. Er war zu groß, um den Kopf unter den Wasserhahn zu halten. Da hat es sich endlich mal gelohnt, klein zu sein.“
„Der Ärmste“, sagte Emma.
„Es geht ihm gut“, sagte Wallace und griff zu seinem Cider, der schal und lauwarm geworden war. Der bittere, chemische Geschmack des Plastikbechers. Alle sahen ihn an. Emmas Augen waren feucht. Cole warf ihm verstohlene Blicke zu, Vincent schluckte immer wieder angestrengt. Yngve musterte ihn über den Rand seines Bierglases hinweg. Scout hatte sich zwischen Thoms Füßen eingerollt, und die Marken an ihrem Halsband klimperten leise wie Glöckchen.
„Was?“, fragte er. „Habe ich was im Gesicht?“
„Nein“, sagte Cole. „Aber wir … Emma hat uns von deinem Dad erzählt. Es tut mir so leid.“
Wallace hatte geahnt, was passieren würde. Trotzdem spürte er so etwas wie Wut auf Emma. So war es nun einmal mit ihm und seinen Freunden, die Informationen flossen dahin wie in einem unsichtbaren Kreislauf, wurden durch Textnachrichten, E-Mails und Partygetuschel weitergetragen. Er leckte sich über die Lippen und schmeckte Emma. Seine Wut verebbte nicht, eher wurde sie von Resignation verdrängt.
„Danke“, sagte er tonlos. „Vielen Dank.“
„Das muss sehr schwer für dich sein“, sagte Yngve kopfschüttelnd. Sein dunkelblondes Haar schimmerte im künstlichen Licht, das seine kantigen Züge plötzlich weich wirken ließ. Nur sein Kinn war so spitz und jungenhaft wie immer. Den Sommer vor seiner Promotion hatte Yngve mit Bergsteigen verbracht; sein Großvater, ein wohlhabender Schwede, war zu jener Zeit verstorben.
„Ja“, sagte Wallace. „Aber das Leben geht weiter.“
„Wohl wahr“, sagte Thom vom anderen Ende des Tisches aus. „Das Leben geht weiter. Was mich an eines meiner Lieblingsbücher erinnert.“
„O Gott“, stöhnte Vincent. „Nicht schon wieder.“
„Und alles Leben, das verrann, und alles, das die Zukunft bringt, ist baumumkränzt und blattumglänzt.“
„Das ist hübsch“, sagte Wallace.
„Ermutige ihn nicht auch noch“, sagte Emma. „Sonst hört er den ganzen Abend nicht mehr auf.“
„Zum Leuchtturm. Eigentlich handelt es sich um eine falsch zitierte Gedichtzeile“, dozierte Thom stolz. „Eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es hat mein Leben verändert, damals in der Mittelstufe.“
Vincent, Emma und Cole tauschten vielsagende Blicke. Yngve wendete sich wieder der Holzmaserung des Tisches zu und studierte sie durch das blasse Gelb seines Biers.
„Danke für den Tipp“, sagte Wallace. Er hob den Kopf und sah Miller zu ihnen zurückkommen, einen Krug Bier in der Hand.
„Da wären wir“, sagte Miller. Er setzte sich Wallace gegenüber, sah ihn jedoch nicht an. Wallace war gekränkt, aber nur ein bisschen. Er verstand schon. Mit Unsicherheit kannte er sich aus.
„Ich muss los“, sagte er. „War schön mit euch.“
„Nein, geh nicht“, sagte Emma. „Wir sind doch gerade erst gekommen.“
„Ich weiß, meine Liebe, aber ich habe schon einen ganzen Abend mit diesen Idioten hier hinter mir.“
„Du liebst uns also nicht mehr?“, sagte Cole. „Verstehe.“
„Alles okay?“, fragte Yngve. „Soll ich dich nach Hause bringen?“
„Ich wohne praktisch auf der anderen Straßenseite, es ist wirklich nicht weit. Aber danke.“
„Ich glaube, ich gehe auch“, sagte Miller, und schlagartig verstummten alle.
„Was?“
„Warum?“
„Weil ich müde bin, Yngve. Ich war den ganzen Tag in der Sonne. Ich bin betrunken. Ich möchte nach Hause.“
„Dann lasst uns alle zusammen gehen.“
„Nein, ihr bleibt“, sagte Miller. Wallace war schon vom Tisch aufgestanden und umarmte Emma, Cole und Vincent. Alle rochen nach Bier und Salz, nach Schweiß und Spaß. Thom schüttelte ihm die Hand und sah ihm lange in die Augen, was Wallace als Friedensangebot auffasste. „Warte auf mich“, sagte Miller.
„Du musst in die andere Richtung“, meinte Wallace und zeigte hinter sich.
„Aber wir müssen zum selben Ausgang.“
„Okay.“
Miller verabschiedete sich, und zusammen liefen sie zur Straße. Hoch oben am Himmel waren ein paar helle Sterne zu sehen. Die Musik waberte über den Campus und kollabierte zu einem verschwommenen Medley ihrer selbst. An der Straße stiegen Leute aus ihren Autos, es war noch immer genug los. Wallace und Miller blieben im Halbschatten eines Vordachs stehen.
„Warum bist du gegangen?“, fragte Miller. „Ist es meine Schuld?“
„Nein“, sagte Wallace. „Ich bin einfach nur müde.“
Miller sah ihn forschend an und biss sich auf die Unterlippe. „Tut mir leid, was im Waschraum passiert ist.“
„Wieso? Ist schon gut.“
„Nein, ist es nicht. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich habe dich ausgenutzt.“
„Oh“, sagte Wallace.
„Ich stehe nicht auf Männer“, erklärte Miller. „Aber manchmal siehst du mich so komisch an, und dann frage ich mich, ob du mich nicht leiden kannst. Oder ob ich dir gefalle. Die Vorstellung, du könntest mich nicht leiden, ist wirklich unerträglich.“
Wallace schwieg. Von hier aus konnte er noch immer das Wasser erkennen, in der Ferne hell und in Ufernähe dunkler.
„Okay.“
„Ich weiß nicht, was ich tun soll“, sagte Miller und ballte eine Hand zur Faust. Er sah aus, als wollte er weinen, aber seine Augen waren einfach nur gereizt.
„Da gibt es nichts zu tun.“
„Wirklich nicht?“
„Nein“, sagte Wallace und meinte es ernst, wünschte es sich zumindest. „Wir haben Händchen gehalten. Wie Kinder in der Junior High.“
„Ich weiß nicht. O Gott“, sagte Miller. Er machte einen Schritt auf Wallace zu, wich dann aber wieder zurück.
Wallace seufzte. „Kommst du mit zu mir?“
Miller sah ihn argwöhnisch an. „Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.“
„Ich bin müde und muss jetzt nach Hause.“
„Ich begleite dich.“
„Alles klar“, sagte Wallace. Der Wunsch, daheim im Bett zu liegen, war überwältigend. Sie gingen die Straße hinunter, vorbei an einem großen halbrunden Wohnhaus und einer kleinen Eckbar, aus der wummernde Musik drang. Ein paar Weiße standen rauchend davor. Wallace fühlte, wie ihre Blicke ihnen folgten. Miller ging dicht an dem Grüppchen vorbei, streifte Wallace flüchtig an Ellbogen und Fingern und sah dann auf ihn herab. Wallace blieb standhaft und erwiderte Millers Blick nicht. Was war das für ein Leben? Was hatte ihn an diesen Ort verschlagen? Er bereute den Spaziergang zum See. Er bereute es, seine Freunde getroffen zu haben. Nicht, weil Emma alles ausgeplaudert hatte, sondern weil ihm etwas, das eben noch einfach gewesen war, plötzlich chaotisch, heikel und kompliziert erschien.
Er führte Miller die Treppe zu seinem kleinen Zweizimmerapartment hinauf. Das Fenster stand offen, auch die Wohnung roch nach See und Sommerabend. Es war kühl, weil im Schlafzimmer der Ventilator lief. Miller setzte sich an den Küchentresen und schaute zu, wie Wallace in einer French Press, für Miller eine kleine Sensation, den Kaffee zubereitete.
Als das Thema nicht länger zu vermeiden war, setzte sich Wallace im Schneidersitz auf den Tresen und nahm die warme Kaffeetasse in die Hände. Miller zupfte an einem losen Zettel herum.
„Also? Was soll das alles, Miller?“
„Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wegen eben, und wegen der Sache, die ich im April zu dir gesagt habe. Wegen allem. Ich bin ein beschissener Freund. Ein schlechter Mensch.“
„Nein, bist du nicht.“
„Ich möchte das ein für alle Mal klarstellen, ich stehe nicht auf Typen. Ich bin nicht schwul oder bi oder so. Ich … ich weiß auch nicht.“
„Ist schon okay. Du wolltest nur ein guter Freund sein.“
„Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mich danebenbenommen. Ich habe gesehen, wie du Emma geküsst hast, und da dachte ich … na ja, du weißt schon.“
„Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst“, sagte Wallace. Er trank einen Schluck Kaffee. In der Spüle stapelte sich dreckiges Geschirr, am Nachmittag hatte Wallace eine Suppe gekocht. „Du hast gesehen, wie Emma mich geküsst hat, und du dachtest … was? Wenn wir jetzt alle Leute küssen, auf die wir nicht stehen, dann könntest du es ja auch mal ausprobieren?“
„Nein … ja. Vielleicht. Und dann bist du aufgestanden und gegangen, und ich dachte: O Scheiße, jetzt habe ich’s geschafft.“
„Wie nett von dir.“
„Dabei würde ich wirklich gern.“
„Was?“
„Dich küssen“, sagte Miller.
„Oh.“
„Ist das schlimm?“
„Nein. Ist es nicht. Aber weißt du, eben hast du noch gemeint, du wolltest nicht.“
„Aber ich will. Wirklich. Ich sollte es nicht wollen. Aber ich will.“
„Okay“, sagte Wallace.
Miller kniff die Augen zusammen. Die Wohnung war nur schwach beleuchtet, in der Küche brannte eine Lampe, und von draußen fiel etwas Licht durch das breite Wohnzimmerfenster, das auf eine Seitengasse hinausging.
„So einfach ist das?“
„Was soll ich sagen. Ich bin eben einfach gestrickt.“
„Deine Witze sind so schlecht“, sagte Miller, kletterte vom Hocker und trat auf Wallace zu. Er schob sich vor die Lichtquelle, bis Wallace in seinem Schatten saß. Wallace spürte Millers warmen Atem auf den Wangen, Miller hob die Hand und legte ihm seine Fingerspitzen an die Lippen, schob ihm langsam seinen Daumen in den Mund. Und sah ihn währenddessen die ganze Zeit aufmerksam an. Miller wirkte weder nervös noch schüchtern, im Gegenteil, er wusste genau, was er tat, und ganz offensichtlich übte er nicht zum ersten Mal Macht über einen anderen Menschen aus, kontrollierte ihn. Dennoch spürte Wallace einen Hauch von Zurückhaltung. Wie Miller ihm langsam und etwas ruckartig über den Mund strich, verriet eine gewisse Unbeholfenheit. Wallace schloss die Lippen um Millers Daumen und lutschte langsam und zärtlich daran. „Warum bist du nur so?“, fragte Miller.
Wallace antwortete nicht. Er setzte sich aufrecht hin und zerrte an Millers Hemd, bis sie einander der Länge nach berührten. Miller stand zwischen seinen Beinen und beugte sich leicht vor, ihre Lippen berührten einander – Reibung, Hitze, Feuchtigkeit. Es war Wallace’ zweiter Kuss, und er fragte sich, warum er so lange gebraucht hatte, um sich auf diese Art von Intimität einzulassen. Das Gefühl war so gut, dass er noch im selben Moment fürchtete, es könnte direkt wieder aufhören.
Miller küsste ihn noch einmal, und Wallace gab aus Versehen ein leises Wimmern von sich, was Miller aber nur weiter anspornte. Wallace fühlte sich, als würde sein Körper abgetastet, als wäre jeder Kuss, der Mund, Kiefer und Wange berührte, die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hatte. Er spürte, wie Millers Hände aufwärts wanderten, von seiner Hüfte zur Taille und immer höher, bis sie am Kinn innehielten. Millers Finger waren rau vom Segeln, das leichte Kratzen fühlte sich aufregend an. Seine Küsse schmeckten nach Bier und Eiscreme, würzig und kalt. Er biss Wallace sanft auf die Unterlippe.
„Das gefällt mir“, sagte Miller. „Mehr, als ich dachte.“
„Schön“, sagte Wallace, aber anscheinend war das falsch, denn Miller runzelte die Stirn und zog sich zurück. Wallace schlang ihm die Beine um die Taille und hielt ihn fest. „Hey, wo willst du hin?“
„Offenbar bist du nicht so begeistert wie ich“, sagte Miller. „Ich will dich zu nichts zwingen.“
„Mir gefällt es auch, auf jeden Fall“, erwiderte Wallace und führte sich Millers Hand zwischen die Beine. Er war hart geworden. Miller keuchte leise und erschauderte vor Überraschung, als wäre ihm jetzt erst wieder eingefallen, dass Wallace ein Mann war. Doch das hielt ihn nicht zurück – er zog Wallace an sich, vielleicht sogar ein bisschen zu fest, und presste ihm seine Lippen auf den Hals.
„Ich … ich weiß nicht, wie so was geht.“
„Ist schon okay“, sagte Wallace. „Es ist ganz leicht.“
Miller lachte. „Ich bin keine Jungfrau mehr. Aber ich … ich habe nur … na ja, du weißt schon.“ Er machte eine unbestimmte Handbewegung.
In Wallace’ Schlafzimmer war es dunkel, nur das geöffnete Fenster zeichnete sich als blauschwarzes Rechteck ab, erhellt von der Straßenlaterne darunter.
Wallace schloss die Jalousien, und im Raum wurde es noch dunkler. Grautöne schichteten sich übereinander, aber dies war sein Zimmer, er kannte die Abstände genau und wusste, wo Miller stand. Er trat von hinten an ihn heran, überraschte ihn und schubste ihn aufs Bett. Millers Körper widersetzte sich zunächst, ein kurzes Zaudern, aber dann landete er mit einem verträumten Seufzer auf der Matratze. Wallace streckte sich neben ihm aus, und so lagen sie lange Zeit da, oder wenigstens kam es ihnen lange vor, fast ohne einander zu berühren.
Wallace konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so neben jemandem gelegen hatte, in dieser beinahe unschuldigen Stellung, die vor dem Sex kommt, wenn beide vorgeben, alles zu wollen außer das eine. Wenn sich eine unerträgliche körperliche Spannung aufbaut. Wallace rührte sich zuerst, er legte eine Hand auf Millers Brust und spürte seinen Herzschlag als schnelles, hartes Klopfen.
Sie küssten sich abermals, ein langsames Versinken in der Lust. Und schälten sich dann aus ihren Kleidern, warfen sie ab wie eine alte Haut, und als sie einander wieder berührten, zitterten sie wie kleine, nackte, neugeborene Wesen.
„Komm unter die Decke“, sagte er, und Miller gehorchte. Jede Berührung war so unfassbar zärtlich und vorsichtig, dass Wallace um den Jungen hätte weinen können, der er mit sieben oder acht Jahren gewesen war, damals, als er zum ersten Mal berührt wurde, grob und ohne Rücksicht darauf, dass diese Berührung ihm schaden würde. Wallace war entschlossen, Miller zu geben, was ihm selbst niemand gegeben hatte, und was immer es war, danach würde Miller keine Angst vor dem eigenen Körper haben oder vor dem, wozu dieser Körper in der Lage war. Sein Kopf wippte zwischen Millers Schenkeln auf und ab, Millers Finger krallten sich in sein Haar. Er nahm ihn immer tiefer in seine Kehle auf, bis zum letzten, erstickten Keuchen.
Sie schliefen mit ineinander verschlungenen Gliedmaßen ein, wund gescheuert und übersät von kleinen Kratzern und blauen Flecken. Sie schliefen, und Wallace träumte nichts. Er glitt dicht unter der Oberfläche des Bewusstseins dahin, unter einem riesigen silbrigen Lichtermeer, das er von unten zu betrachten schien, und die Welt zog an ihm vorbei und über ihn hinweg.
Millers Körper fühlte sich warm und schwer an. An manchen Stellen war seine Haut fremd und hart. Während er schlief, zog Wallace die Finger über Millers Hüftknochen und durch die spärlichen Schamhaare über seinem Schwanz. Der Segelsport hatte Millers Körper in der Tat verändert. Nicht, dass Wallace ihn vorher nackt gesehen hätte, aber da war eine Festigkeit unter der weichen Haut von Bauch und Oberschenkeln. Ein Körper im Wandel. Millers Brusthaar war weich und gelockt, und im Schlaf sah er lieb und sanft aus, wie ein kleiner Junge im Körper eines erwachsenen Mannes. In der Art, wie seine Hand auf dem Gesicht ruhte, lag eine Verwundbarkeit, und sein tiefer, friedlicher Schlaf verriet Wallace, wie sicher und unschuldig sich Miller bei ihm fühlte.
Wie lange war es her, dass er selbst so tief und fest geschlafen hatte? Wann hatte er sich zuletzt der Welt entzogen? Miller stieß ein kleines Geräusch aus und drehte sich um, als suchte er Wallace’ Körperwärme. Wallace schmiegte sich an und ließ sich umarmen. Das Brummen des Ventilators schob sich in seine Wahrnehmung und wieder hinaus. Würden die anderen sich fragen, wo Miller steckte, wenn sie nach Hause kamen und er nicht in seinem Zimmer war? Miller teilte sich ein Haus mit Yngve. Dass er über Nacht wegblieb, war sicher ungewöhnlich. Es passte nicht zu ihm. Und selbst wenn er und Wallace enger befreundet gewesen wären, würden die anderen es seltsam finden. Aber gut, morgen blieb ihnen immer noch genug Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.
Wallace stieg aus dem Bett, ging in die Küche und goss sich ein großes Glas Wasser ein. Er trank langsam und wartete, bis Zunge und Kehle von der Kälte betäubt waren, bis das Schlucken ihm schwerfiel und sein Durst gestillt war. Sein Magen wehrte sich, fast musste er würgen, aber er trank weiter. Weiter, immer weiter, bis das Wasser seinen Bauch aufblähte. Er füllte das Glas erneut bis zum Rand und trank. Seine Lippen waren rot. Er trank immer weiter. Er trank vier Gläser hintereinander, und dann ging er ins Bad und übergab sich. Heraus kam Wasser, dann Sperma, Popcorn, der säuerliche Cider und die Suppe vom Mittag. In der Kloschüssel lief alles zu einem orangefarbenen Strudel zusammen. Wallace’ Kehle war wund und brannte vor Säure. Zitternd stemmte er sich gegen die Kloschüssel. Der Gestank ließ ihn abermals erbrechen, ein heftiges, krampfhaftes Würgen.
Danach fühlte er sich leer. Er wischte sich den letzten Rest Erbrochenes von den Lippen, putzte sich die Zähne und ging zurück ins Wohnzimmer. Dort setzte er sich aufs Sofa und zog die Knie an. Der Mond draußen war ein makellos runder, weißer Kreis. Die Welt lag still und ruhig da. Wallace konnte in das Gebäude auf der anderen Straßenseite hineinsehen, in das Leben der Menschen, die dort wohnten. In einer Wohnung brannte noch Licht, ein Mann stand in der Küche und bügelte.
Die Geräusche aus den Nachbarwohnungen verliehen der Stille in seinem Apartment eine Struktur. Irgendwo sang jemand furchtbar schief den Hit des Sommers. Aus weiter Ferne ertönte ein Klingeln, nicht wie von einem Telefon, eher wie von Wasser, das durch ein Rohr schoss.
Als ihm der Gedanke kam, seine Freunde könnten die Wahrheit über ihn und Miller herausfinden, wurde Wallace unruhig. Nicht weil er sich schämte, sondern weil er Angst hatte, dass Miller sich schämen und die Sache für beendet erklären könnte.
Ein Blowjob im Dunkeln. Mehr war nicht passiert.
„Wo bist du?“, rief es von nebenan.
„Hier drüben“, sagte Wallace. Seine Kehle brannte immer noch.
Miller hatte sich in die Bettdecke eingewickelt und schleppte sich aus dem Schlafzimmer, um neben Wallace aufs Sofa zu sinken. Er roch säuerlich, nach Schweiß, aber immer noch gut, irgendwie angenehm.
„Was machst du hier?“
„Ich wollte dich nicht wecken.“
„Kannst du nicht einschlafen?“
„Nein“, sagte Wallace und lächelte knapp. „Aber das ist nicht ungewöhnlich.“
„Warum?“
„Warum was?“
„Warum kannst du nicht einschlafen?“
„Keine Ahnung. Es fällt mir schwer, seit mein Vater gestorben ist.“
„Das tut mir leid“, sagte Miller. Er nickte, dann küsste er Wallace auf die nackte Schulter.
„Danke.“
„Standet ihr euch nahe?“
„Nein, eigentlich nicht. Das ist ja das Verrückte. Wir kannten uns nicht mal richtig.“
„Vor zwei Jahren ist meine Mutter gestorben“, erzählte Miller. „Zuerst hatte sie lange Brustkrebs, bis der auch irgendwann ihre Leber befallen hat und dann den Rest des Körpers. Sie ist zu Hause gestorben.“
Wallace legte den Kopf an Millers Schulter. „Das tut mir leid“, sagte er.
„Weißt du, es spielt keine Rolle, wie nah man sich stand und ob man einander gut kannte. Meine Mutter zum Beispiel konnte ein richtiges Miststück sein. Sie war böse und gemein, eine Lügnerin, die mich mein ganzes Leben lang immer nur runtergemacht hat. Aber als sie starb, habe ich … Ich weiß auch nicht. Irgendwie werden die eigenen Eltern erst zu Menschen, wenn sie leiden. Wenn sie plötzlich nicht mehr da sind.“
„Ja“, sagte Wallace. „So ist es. Oder so ähnlich.“
„Meine Mom ist gestorben, und ich dachte: O Scheiße. So lange hatte ich sie abgelehnt und gehasst, aber als sie dann plötzlich diese Krankheit bekam, der sie nichts entgegenzusetzen hatte, tat sie mir einfach nur leid.“
„Hast du dich von ihr verabschieden können?“
„Ich war jeden Tag bei ihr. Wir haben Karten gespielt und uns über das Fernsehprogramm gestritten, sie hat sich sogar über meine Musik lustig gemacht. Ich habe für sie gekocht, und sie hat mir gesagt, dass sie mich liebt.“ Millers Augen wurden dunkel und feucht, aber keine Träne löste sich. „Und dann war sie weg.“
„Das tut mir leid“, sagte Wallace wieder, weil ihm nichts Besseres einfiel.
„Ich kann dir wegen deines Vaters nichts raten. Ich kann dir nicht sagen, was du fühlen sollst, Wallace. Aber ich bin hier, wenn du mich brauchst. Ich bin dein Freund, und ich möchte für dich da sein. Okay?“ Er nahm Wallace’ Hand, und Wallace ließ es geschehen. Sie küssten sich noch einmal, zärtlich und flüchtig. Plötzlich kamen sie sich dumm vor und lachten verlegen, aber dann drückte Miller sich an ihn und zog die Decke über sie beide. Und zum ersten Mal seit langer Zeit ließ Wallace jemanden in sich eindringen. Anfangs tat es so weh wie immer, aber der Schmerz und die leidenschaftliche Erinnerung seines Körpers reichten aus, um ihn abermals hart werden zu lassen. Miller war nicht grob, aber er wusste, was er wollte, und er nahm es sich. Als es vorbei war, atmeten sie beide schwer.
Sie standen unter der Badezimmerleuchte und wischten sich sauber. Wallace fühlte sich wie ein verquirltes Ei, zerschlagen und aufgewühlt. Er spürte ein heißes Pochen, eine kleine, geheime Sonne, die in seinem Inneren glühte. Miller sah ihm nüchtern ins Gesicht.
„Ich will dir nichts vormachen“, sagte er. „Ich bin selbst sehr verwirrt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“
„Kein Problem“, sagte Wallace und ignorierte den Schmerz. „In Ordnung.“
„Nein, lass mich bitte ausreden. Ich weiß ja selbst nicht, was ich von dir will. Am Ende ist das alles vielleicht ein Riesenfehler. Aber ich mochte es. Es war gut. Mach dir keine Vorwürfe.“
„Ich werde versuchen, es nicht persönlich zu nehmen.“
„Wallace …“
„Danke für deine Offenheit.“
„Okay, vergiss es.“
„Nein, warte, lass es mich noch mal versuchen.“
Aber Miller war schon auf dem Weg hinaus. Er ging in die Küche, Wallace folgte ihm.
„Hey, wo willst du hin? Komm zurück. Es tut mir leid.“
„Kann ich einen Schluck Wasser haben?“
„Klar“, sagte Wallace. Seine Wangen und sein Hals glühten bei der Erinnerung an das Wasser, das er getrunken und erbrochen hatte. Er schenkte Miller ein Glas ein, dasselbe, das er zuvor benutzt hatte. Er beobachtete die Muskeln an Millers Hals, die sich bei jedem Schluck zusammenzogen. Er dachte an seine eigenen Lippen und wie sie den Rand des Glases berührt hatten, an die Übertragung seines Aromas. Konnte Miller ihn schmecken?
„Hör auf, mich zu beobachten. Das macht mich nervös“, murmelte Miller ins Glas.
„Sorry“, sagte Wallace und schaute demonstrativ weg, hinüber zu dem Haus auf der anderen Straßenseite, wo der Mann immer noch in der Küche stand und bügelte. Hatte er sie beim Sex auf dem Sofa beobachtet?
„Mehr, bitte“, sagte Miller. Wallace hob die Karaffe und goss den kalten, klaren Rest in Millers Glas. Miller schaute zu, und Wallace schaute Miller beim Zuschauen zu. Der Pegel stieg und stieg, bis das Wasser fast überlief und Miller über die Finger rann. Aber nur fast. Wallace hielt inne, kurz bevor es sich zitternd über den Gefäßrand wölbte – der Moment, wenn etwas bis zur Unerträglichkeit angeschwollen ist und entweder zurückweichen oder überfließen muss.
„Bitte sehr“, sagte Wallace. „Prost.“
„Danke“, sagte Miller und leerte das Glas in einem einzigen Zug und mit geschlossenen Augen, wie in Ekstase.
2
Die anderen Labore im zweiten Stock der Biowissenschaften sind so verlassen wie nach dem Jüngsten Gericht. Seltsamerweise fühlt es sich an, als erhasche man einen Blick auf einen Menschen, der sich unbeobachtet glaubt und auszieht – der doppelte Nervenkitzel des Voyeurs, Beschämung und Entzücken. Der salzige Geruch von Hefekulturen hängt in der Luft, Wallace läuft das Wasser im Mund zusammen. Das Atrium steht in watteweichem Licht, um die Geländer winden sich vertrocknete gelbe Ranken, der abgenutzte Boden glänzt. Wenn er jetzt springt, denkt er, fällt er senkrecht in die Tiefe, ein langsamer Sturz durch die Leere. Was für eine schreckliche Art zu sterben. Ganz kurz bildet er sich ein, die Wucht des Aufpralls zu fühlen, das gespenstische Nass des geborstenen Schädels. Die Illusion der Schwerelosigkeit verfliegt, die Aufzugtüren schließen sich mit metallischem Hall.
Samstagmorgen, kurz nach zehn.
Simones Labor am Ende des Korridors ist hell erleuchtet. Katie steht an der Tischzentrifuge. Die riesige graue Apparatur stößt ein Sirren aus, das immer höher wird und sich dann im mechanischen Lärm des Labors verliert. Das Scheppern der Käfige, das Klirren der Glasbecher in den Rührwerken, die sirrenden Spulen an der Rückseite der Brutschränke, und über allem hängt das gedämpfte Brummen der Klimaanlage. Wallace fühlt sich wie im Darm eines großen Tieres, allseitig bedrängt von den Geräuschen eines verdauenden Organismus. Katie beachtet ihn nicht. Sie ist blond und ihr Gesicht so fein, als hätte jemand die ursprünglichen Züge weggewischt und an ihrer Stelle eine filigrane Miniatur aufgemalt. Sie hält einen grünen Eiskübel in der Armbeuge und schlägt sich mit einem Paar hellblauer Schutzhandschuhe auf den Oberschenkel. Ungeduld. Langeweile.
Wallace geht schnell an ihr vorbei und hofft, sie würde ihn nicht bemerken, aber da sagt sie: „Bringen wir den Mist hinter uns.“
„Bringen wir es hinter uns“, bestätigt er zögerlich und weiß, er wurde ertappt. Aus dem ganzen Labor – eigentlich drei angrenzende Räume, fünf Arbeitsnischen pro Raum und zwei Labortische pro Nische – schallt ihm ein kollektives Bringen wir es hinter uns entgegen. Die anderen tauchen kurz in seinem Augenwinkel auf und verschwinden wieder, während er zu seinem Platz geht. Heute bilden sie das helle Zentrum des kühlen, dämmrigen Gebäudes, den flüchtig pulsierenden Kern. Ein schwacher Trost.
Im Labor arbeiten sonst nur Frauen: Katie, Brigit, Fay, Soo-Yin und Dana.
Katie brennt darauf, endlich ihren Abschluss zu machen, sie verströmt eine knisternde, ungefilterte Energie. Alle meiden ihren Blick. Sie ist die Älteste, dann kommen Brigit und Fay. Brigit ist ein Naturtalent, neugierig, tatkräftig und mit einem übernatürlich guten Gedächtnis ausgestattet, das ganze Bibliografien zur Entwicklungsbiologie verschlingt. Fay hingegen ist schüchtern und nachtaktiv, klein und so blass, dass man, wenn sie mit der Pipette hantiert, den Schatten ihres Bluts über die Unterarme huschen sieht, den Muskeln entgegen. Ihre Versuche sind korrekt und doch wenig aussagekräftig angelegt und ihre Fehlerbalken ausnahmslos winzig, was in Wallace eine an Neid grenzende Bewunderung erzeugt. Einmal hat Simone in einer Laborbesprechung behauptet, die von Fay ermittelten Abweichungen seien zu klein, um relevant zu sein. Soo-Yin bewohnt die Labornische zwischen den chemischen Reagenzien und dem Schrank mit den Gewebekulturen. Dort legt sie Tausende von winzigen Zellproben an, gräuliche Klumpen, die in Tümpeln aus leuchtend roter Nährflüssigkeit schwimmen, sich munter teilen oder auch sterben. Einmal ist sie Wallace begegnet wie ein Geist, sie wischte sich die Tränen mit dem bloßen Unterarm ab und pipettierte einfach weiter, in ein und derselben fließenden Bewegung. An jenem Tag roch sie anders als sonst, nach Salzwasser. Dana, die Jüngste, hat ein Jahr nach Wallace im Labor angefangen. Seither hat ihr Doktorvater keine weiteren Studenten mehr angenommen. Alle paar Monate machen Gerüchte von einer Pensionierung, einer Abwanderung in die Ivy League, einer Beraterstelle bei der Regierung oder einem Lehrauftrag die Runde, aber diese Gerüchte sind so zahlreich und kurzlebig, dass sie wohl unbegründet sein müssen.
Meistens geht es im Labor ruhig zu. Knappe Fragen fliegen durch den kühlen, hellen Raum: Hast du noch Puffer mit pH 6,8? Hast du einen neuen TBE-Puffer angesetzt? Wo ist das DAPI? Warum haben wir keine Skalpelle mehr? Wer hat vergessen, dNTPs zu bestellen?
Cole arbeitet zwei Stockwerke über ihnen. Er und seine Kollegen treffen sich auch außerhalb des Labors, und an den Wochenenden spielen sie manchmal Frisbee, wenigstens hat Wallace das gehört. Die meisten von ihnen waren zu der Grillparty bei Cole und Vincent eingeladen. Als Wallace eine Bemerkung darüber machte, hatte Cole ihn nur verwirrt angesehen: „Natürlich habe ich sie eingeladen. Wir sind in einem Labor!“ Als Katie mit Caroline, die erst seit ein paar Wochen ihren Abschluss hatte, beim Grillen auftauchte, hatte Wallace sich zu ihnen gesellt. Er fühlte sich verpflichtet, obwohl der Raum voller Menschen war, die er besser kannte und lieber mochte. Trotzdem unterhielten Caroline und Katie sich nur miteinander, nicht mit ihm. „Jetzt stehen wir wieder hier rum“, seufzte Caroline, und Katie klammerte sich an ihrem Weinglas fest und schaute durch die Terrassentür nach draußen, wo sich die anderen um den Grill scharten und einer der älteren Doktoranden im Pool träge Bahnen zog. Sie standen stundenlang in der Ecke und wechselten kaum ein Dutzend Worte, aber statt sich aus der Affäre zu ziehen und einen Freund suchen zu gehen, blieb Wallace den ganzen Abend an ihrer Seite. Selbst als Caroline – womöglich hatte sie ein paar Bier zu viel – nur noch finster vor sich hin starrte und Katie Vincent barsch zurechtwies, das Fleisch sei nicht durch und sie könne nichts davon essen. Wallace blieb neben ihnen stehen, denn es zog ihn nirgendwo anders hin.
Der zweite Labortisch in Wallace’ Nische steht leer. Das wäre anders, denkt Wallace, wenn Henrik noch da wäre. Henrik würde jetzt zwischen Schreibtisch und Labor hin- und herstiefeln und ein halbes Dutzend Aufgaben in Angriff nehmen, um sich irgendwann doch noch auf eine festzulegen. Henrik, ein stiernackiger Ex-Footballer mit Tight-End-Qualitäten, hatte an einem kleinen College im tiefsten Minnesota Chemie studiert. Henrik war derjenige gewesen, der Wallace beigebracht hatte, wie man seziert – in der Schale statt auf dem Objektträger, weil man auf diese Weise Zeit gewinnt und seinen Bewegungsspielraum vergrößert; dass man warten muss, bis die Würmer stillhalten; dass man mit einem einzigen geschickt gesetzten Schnitt viele Nematoden auf einmal zerteilen und mit einem Schlag fünfzig Köpfe abtrennen kann. Er zeigte Wallace den idealen Winkel, um die dünne Nadel in die Keimbahn zu schieben wie durch zarten Rogen. Das und noch viel mehr brachte er Wallace bei, nicht zuletzt, wie man eine Präsentation vorbereitet und sich vor einem Vortrag beruhigt, indem man die Hände abwechselnd unter kaltes und warmes Wasser hält. („Heißer, Wally, los, dreh den Hahn voll auf!“)
Wenn Wallace die Augen schließt, sieht er manchmal noch Henriks Gesicht vor sich oder hört seine Stimme, freundlich wie die eines Muppets – die verspielte Stimme eines Mannes, der vielleicht immer ein Kind bleiben würde. Henrik hatte etwas Ungestümes, Ungehobeltes an sich, als könnte er Wallace jeden Augenblick in den Schwitzkasten nehmen und ihm mit seinen Knöcheln die Kopfhaut massieren. Wenn er sich vor einem aufbaute, sich zu seiner vollen Größe aufrichtete, wurde man sich plötzlich seiner Kraft bewusst. Einmal hatte Wallace gesehen, wie Henrik im Zorn eine Zwanzig-Liter-Flasche zu Boden warf, bloß weil der Deckel nicht richtig zugeschraubt war. Ein anderes Mal war Wallace gerade dabei gewesen, Kolonien zu impfen, als Henrik ihn zur Seite schubste, ruppig das Gas abdrehte und rief: „So geht das nicht, deine Methode ist nicht keimfrei!“ Er schlug Wallace die Holzspindel aus der Hand, die mit einem erbärmlichen kleinen Klappern auf dem Arbeitstisch landete. Während der Laborpräsentationen hatte jeder im Dunkeln Henriks physische Präsenz spüren können, und ein bisschen war es, als behielten die anderen ihn immer im Auge, sicherheitshalber. Wenn er laut wurde, klang er merkwürdigerweise immer noch wie ein Muppet. Mit der Stimme eines aufgebrachten Kermit machte er Ergebnisse herunter, die ihm nicht passten: „Was ist das hier, ein Kaffeeklatsch? Deine Daten geben das nicht her! Tun sie nicht! Auf keinen Fall!“
Wallace zuckte dann meistens zusammen und schämte sich sofort dafür. Es erinnerte ihn an die Zeit, als er noch ein Kind gewesen war und sein großer Bruder direkt vor seinem Gesicht in die Hände geklatscht hatte, um ihn zu erschrecken und anschließend zu verhöhnen: „Was zuckst du? Hast du geglaubt, ich will dich schlagen?“ Wallace litt darunter, dass sein Körper in dieser Weise auf Henrik reagierte. Gegen seinen Willen und immer wieder, wie damals. Die klatschenden Hände dicht vor seiner Nase.
Henrik lebt jetzt in Vassar, wo er ein eigenes Labor leitet und Studenten ausbildet, wie er früher Wallace ausgebildet hat. Ist Wallace neidisch? Henriks alter Labortisch ist kein Schrein, im Gegenteil, er ist leicht verstaubt und leer bis auf einen grünen Textmarker. Wallace dreht sich wieder zu seinem eigenen Tisch um, auf dem sich die Unterlagen stapeln: Sequenzalignierung, Genbibliothek, Stammbögen und ein paar Artikel, die er seit Monaten lesen will. Der Computer ist im Ruhezustand, aus dem dunklen Monitor starrt ihm eine bernsteinbraune Version seiner selbst entgegen. Auf dem Kaffee vom Vortag hat sich eine Haut aus ranziger Sahne gebildet. Wallace schiebt die Arbeit vor sich her, das ist ihm klar. Er kann sich nicht überwinden, den Labortisch endlich in Augenschein zu nehmen, obwohl er weiß, es muss sein. Schließlich hebt er den Kopf und zwingt sich hinzuschauen, es wirklich zu sehen.
Wallace arbeitet an einem der größeren Tische im Labor. Er hat ihn vor vier Jahren von einem Postdoktoranden übernommen, der nach Cold Spring Harbor ging, um dort mit Stammzellen im Darm von Mäusen zu forschen. Der Tisch ist breit, die glatte schwarze Oberfläche durch das jahrelange Hin-und-her-Schieben der sechseckigen Bunsenbrenner und harten Mikroskopfüße zerkratzt. Ein helles Holzregal am Rücken der Tischplatte trennt ihn von der benachbarten Labornische, die Dana gehört. Flaschen mit farbigen und klaren Flüssigkeiten lugen aus weißen Plastikständern heraus wie neugierige Kinder. Auf allen Flächen liegen Werkzeuge und Instrumente herum, als wollten sie Wallace verhöhnen. Die Türme aus Petrischalen, die vor ihm in die Höhe ragen, erinnern an eine Miniaturhochhaussiedlung. Das ausgeschaltete Mikroskop wartet, sein Anblick ist wie ein böses Omen, eine Warnung.
Während Katie ihn unauffällig über die Schulter beobachtet, fällt ihm die andere Sache wieder ein. Eines von Wallace’ fehlgeschlagenen Experimenten: Immunfärbung und Gewinnung von immunhistochemischen Daten – der einzige Versuchsaufbau, den er besser als jeder andere im Labor beherrscht. Simone oder Katie erzählen davon, als wäre er ein Savant oder ein Zirkuspony: siebenhundert perfekte Präparate in weniger als acht Minuten, ordentlich dokumentiert, alle Variablen und Bedingungen markiert und vermessen, die Bildgebung gestochen scharf. Anscheinend liegt Wallace’ Talent nicht im Forschen, sondern im Warten. Er kann Stunden im embryonalen Dunkel des Mikroskopraums zubringen, bis sich das dreidimensionale Abbild einer Gewebestruktur zeigt, zusammengesetzt aus mikrometerbreiten Schnitten durch die Keimbahn, und unter dem Fluoreszenzmikroskop tritt jede Zelle als makellos umgrenzter Kern hervor. Dass die Abstufungen bei ihm sauberer und deutlicher zu erkennen sind als selbst bei Katie, ist allerdings kein Beweis für seine Kompetenz oder seinen überragenden Verstand, sondern legt nur nahe, dass er zu viel Zeit hat und es sich leisten kann, stundenlang in untätiger Stumpfheit vor dem Mikroskop auszuharren. Manchmal vergeht ein ganzer Tag, ohne dass er den dunklen Raum verlässt; dann wartet er darauf, dass eine bestimmte Form hervortritt, und er bewegt sich nur, um einen Objektträger zu wechseln, neue Keimbahnen zu suchen oder den Laser nachzujustieren.
Simone hatte ihn gebeten, eine Publikation zu unterstützen, die die Grundlage von Katies Dissertation bilden soll. Er hatte nur eingewilligt, weil er sich der Aufgabe ausnahmsweise gewachsen fühlte. Daran hatte er gearbeitet, und seine Nematoden hätten an diesem Tag das richtige Alter erreicht. Jetzt, da Katie ihn beobachtet, begreift er plötzlich, warum sie so genervt von ihm ist: Auch ihre Würmer sind verloren, abgetötet durch die Keime und den Schimmel. Für ihn ist das Ganze kein Drama, er wird das Experiment einfach wiederholen, doch Katie hat kostbare Zeit verloren. Sie ist dem Ziel näher als er, hat jetzt größere Erwartungen an die im Labor verbrachten Stunden, und das völlig zu Recht. Verbitterung, Bedauern also. Katie kehrt ihm den Rücken zu und lässt den Deckel der Zentrifuge aufschnappen. Das braune Sediment pelletierter Zellen. Sie setzt die nächste Charge hinein.
Der Apparat heult leise auf.
Endlich an seinem Platz, schiebt Wallace eine Petrischale nach der anderen unter das Mikroskop. Da ist nichts als Schimmel, eine regelrechte Baumwollplantage im Spätherbst, dunkel, schlammig und von Stängeln durchsetzt. Klumpen von Bakterien. Schlimm genug, diese lebensfeindlichen Bedingungen. Schlimm genug, die Löcher im Agar, wo die Nematoden am Plastikboden der Schale kleben und wo ihnen die Feuchtigkeit aus dem Körper gesaugt wird. Doch Wallace macht noch eine viel beunruhigendere Entdeckung: tote Eier. Nematoden mit krummen, knorrigen Keimbahnen. In einigen Schalen zucken winzige Larven wie lebendig gewordene Schriftzeichen. Es sind weniger als erwartet, als hätte schon vor dem Gemetzel etwas nicht gestimmt und die unsichtbare Katastrophe heraufbeschworen. Die Würmer sind nicht nur von Sporen durchsetzt, was die Arbeit genug verkompliziert hätte, der Schimmel hat sie ganz und gar unfruchtbar gemacht. Ihre Körper sind voller Löcher, als hätten Luftblasen die empfindlichen Fortpflanzungsorgane ersetzt. Leere Körperhöhlen, anomale Strukturen. Wallace weiß, was er vor Augen hat. Möglicherweise hat die Kombination der Mutationen einen nicht überlebensfähigen Organismus hervorgebracht. Der Stamm wird sterben. Was die Antwort auf eine Frage sein könnte – oder doch nur das Ergebnis einer Verunreinigung, ein bloßer Störfaktor. Er wird in Zukunft gründlicher arbeiten müssen. Noch gründlicher.
Jeweils zwölf Würmer aus fünfzig Schalen, das macht sechshundert Würmer, die einzeln und mehrfach vom Schimmel befreit werden müssen, was auf insgesamt etwa achtzehnhundert Durchgänge hinausläuft. Und das ist nur der Anfang. Davor war er geflüchtet – vor dem schieren Ausmaß der Arbeit, die nötig sein wird, um den Fehler auszubügeln. Dass die Aufgabe zu schaffen ist, lässt sie nur noch unmöglicher erscheinen; wenn man weiß, dass das Ziel nicht vollkommen unerreichbar ist, fühlen sich die Hürden höher an, denn man hat keine Wahl. Ganz kurz ist Wallace versucht, einfach aufzugeben und, statt dem Durcheinander auf seinem Labortisch einen Sinn abzugewinnen, noch einmal von vorn anzufangen. Er blickt vom Mikroskop auf, mustert die Stapel aus Petrischalen. Er rückt sie gerade, sie quietschen leise. Er könnte sie einfach wegwerfen, hier und jetzt. Wallace legt die Stirn an das Okular seines Mikroskops.
„Verdammt. Verdammt. Verdammter Mist.“
Henrik würde jetzt wissen, was zu tun ist. Henrik würde sagen: „Los, fang an. Worauf wartest du?“ Wallace greift nach dem nächsten Instrument, einem abgeflachten Stück Titandraht in einem Glasröhrchen. Er hält den Anzünder über den Bunsenbrenner, dreht das Gas auf, schlägt Funken. Der faule, süßliche Geruch von Erdgas, die Zündung, ein orangefarbenes Glühen, ein Aufblitzen, eine Flamme. Er hält das eine Ende des Röhrchens hinein, um es zu sterilisieren. Dann nimmt er sich eine neue Petrischale vor, tunkt das Ende des Drahtes in E. coli – sein Klebstoff – und stellt eine der alten Schalen unter das Objektiv. Es ist, als starrte er vom höchsten Punkt eines Zirkuszeltes in die Tiefe. Er wartet auf eine Bewegung, dreht die Schale hin und her und verändert den Einfallswinkel des Lichts, sodass der Agar sonderbar metallisch schillert. Er sucht und wartet, sucht, dreht, wartet und sucht.
Endlich entdeckt er einen Wurm mit klebrigen Sporenbüscheln auf dem Rücken. Er lässt das Instrument herabsinken wie eine Greifklaue auf dem Jahrmarkt und stupst den Wurm sanft an, sanfter als sanft, und dann hebt er ihn in die Höhe, befördert ihn aus seinem Element in die Luft, wo er sich, an den Draht geklebt, nach oben zu winden scheint. Er legt ihn in eine saubere Petrischale, mitten auf eine weite, leere Ebene.
Ein einziger Wurm.
Bleiben noch fünfhundertneunundneunzig.
Wallace lässt das Instrument herabsinken. Beginnt von vorn.
Nicht alle Tiere sind tot. Wallace ist erleichtert. Er hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch viele sind steril, überall geschrumpfte Eizellen und leere Samenleiter, was das Weiterarbeiten erschwert. Die unbrauchbaren Exemplare verbrennt er wie ein wütender Gott in der Bunsenbrennerflamme.
Brigit fegt in bequemer grauer Freizeitkleidung an Wallace vorbei und lässt sich in Henriks alten Stuhl fallen.
„Wally“, sagt sie genervt. „Mom hat heute schlechte Laune.“
„Sie ist bestimmt sauer wegen meiner Schalen.“
„Was für ein Pech.“ Brigit ist voller Mitgefühl. Sie ist immer nett zu ihm, auf eine unkomplizierte Art. Nie vermittelt sie ihm das Gefühl, dass sie für ihre Freundlichkeit etwas zurückerwartet oder ihn anders behandelt als die anderen. Wallace, der unkomplizierte Hilfsangebote und Großzügigkeit nicht gewohnt ist, überrascht das immer wieder. Brigit wuchtet die Füße auf Henriks Schreibtisch und legt sich die gefalteten Hände auf den Bauch. „Ist schon komisch, oder?“
„Was?“, fragt Wallace und sieht sie an. Etwas in ihrer Stimme, diese Note von kühlem Misstrauen, lässt ihn aufhorchen.
„Ach, nichts“, sagt Brigit. „Ich finde es nur komisch, dass ausgerechnet deine Schalen ruiniert sind. Ich meine, so vollkommen aus dem Nichts, wo doch alle anderen Proben im selben Brutschrank … Na egal, ich habe schon zu viel gesagt.“ Sie legt sich den Arm über die Augen, als wäre ihr alles zu viel, und seufzt.
„Worauf willst du hinaus? Dass alle anderen Proben unbeschädigt sind?“ Die Hitze, das leise Rauschen seines Zorns. Wallace schwingt auf dem Drehstuhl herum. Brigit ist etwas kleiner als er, dunkelhaarig und sommersprossig. Ihre Eltern, chinesische Einwanderer, leben in Palo Alto. Ihre Mutter ist Kardiologin und ihr Vater im Vorruhestand, seit sein Technologie-Start-up, eines der ersten überhaupt, von Google verschluckt wurde. Sie hat getanzt, bevor sie in die Wissenschaft ging – zu lockere Bänder, sagt sie nur –, und sich trotz ihrer sanften, gutmütigen Art eine zähe Flexibilität und eine gewisse Härte bewahrt. In diesem Moment leuchten ihre Augen schadenfroh und verschwörerisch. Sie und Wallace lästern gern.
„Ich weiß nichts Konkretes. Nein. Überhaupt nicht. Aber Soo-Yin, deren Schalen direkt unter deinen standen, hat mir erzählt, dass ihre völlig in Ordnung waren. Absolut sauber. Nicht mal ein Staubkorn.“
„Das ergibt überhaupt keinen Sinn“, sagt Wallace. Und ist selbst überrascht, wie aufgebracht er klingt – seine Stimme ist hoch und gepresst. Brigit zuckt stirnrunzelnd die Achseln. Dann verfinstert sich ihre Miene, sie zieht die Brauen zusammen, nimmt die Füße vom Schreibtisch und rollt mit ihrem Bürostuhl an Wallace heran. Das grelle Laborlicht lässt ihr dunkles, zu einem lockeren Knoten zusammengestecktes Haar kurz aufschimmern.
Sie spricht mit leiser Stimme. „Ich glaube, jemand hat sich an deinen Proben zu schaffen gemacht, Wally. Nicht, dass ich was gesehen hätte. Absolut nicht. Aber es würde mich nicht wundern. Denn Faye hat gesehen, dass Du-weißt-schon-wer die ganze Woche lang Überstunden gemacht hat. Dabei wissen wir doch alle, dass Du-weißt-schon-wer eigentlich um Punkt fünf den Stift fallen lässt.“
„Und Du-weißt-schon-wer ist Dana?“
Brigit zischt ihn an und sieht sich hektisch um. „Wer sonst?“
Dana kommt aus Portland oder Seattle oder irgendeinem kleineren Kaff dort im Norden. Einmal, sie war zu dem Zeitpunkt noch nicht lange im Labor, hatte Wallace gesehen, wie sie ihre Proteinproben durch die falsche Säule laufen ließ. Sie hatte irrtümlich ein Set zur DNA-Aufreinigung verwendet. „Sieht danach aus, als hättest du die falsche Schachtel erwischt. Kein Wunder, die sehen alle gleich aus.“
Dana hatte eine Hand auf die blau-weiße Schachtel gelegt und die Stirn gerunzelt.
„Nein, habe ich nicht“, sagte sie.
„Oh“, sagte Wallace. „Na ja, da auf der Seite steht DNA-Präparation. Ich meine ja nur.“
Dana hatte ihre hellbraunen Katzenaugen aufgerissen und dreimal hintereinander missbilligend mit der Zunge geschnalzt.
„Nein, Wallace“, sagte sie langsam und ruhig. „Ich bin nicht behindert. Ich würde es merken, wenn ich das falsche Set genommen hätte.“
Ihre heftige Abwehr ließ Wallace erstarren. Aber es war ihr Tisch, ihr Experiment. Ihre Entscheidung. Wallace wich zurück, seine Wangen glühten.
„Tja dann. Okay. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.“
„Brauche ich nicht“, sagte sie.
Für den Rest des Tages beobachtete er sie. Er war damals im zweiten Jahr, sie im ersten; sie waren jung und mussten beide noch ihren Weg finden. Was wusste Wallace schon? Eigentlich hatte er sich im Labor von Anfang an unbehaglich gefühlt, irgendwie verunsichert. Er hatte geglaubt, dass jeder dieses Gefühl kennt, diese Scheu, um Hilfe zu bitten und sich damit eine Blöße zu geben. Er wollte ihr zu verstehen geben, dass er verstand, wie beängstigend es war, sich nicht auszukennen, die meisten Leute ihr aber gern halfen. Er wollte ein guter Laborpartner, ein hilfsbereiter Kollege sein. Aber stattdessen hatte Dana eine dicke, rote Linie zwischen ihnen gezogen. Er war so, sie war anders. Sie war begabt, er nicht.
Am Ende jenes Tages aber stand Dana vor ihren Säulen und fragte sich, was schiefgelaufen war. Verwirrt las sie die ausgedruckten Messwerte, die sich nicht einordnen ließen, natürlich. Die Spektralanalyse hatte ergeben, dass sich überhaupt keine Proteine in der Röhre befanden. Wie konnte das sein? Sie hatte doch alle Anweisungen befolgt. Simone kam an ihren Labortisch und ging die Daten mit ihr durch. Sie winkte Wallace zu sich, er ging verschüchtert hinüber. Hinter dem Fenster war die Nacht als glatter, dunkler Schleier aufgezogen. Wallace sah ihre drei Spiegelbilder in der Scheibe.
„Weißt du etwas darüber, Wallace?“, fragte Simone.
„Worüber?“
„Danas Ergebnisse. Sie sagt, dass du die Sets vertauscht hast.“
Wallace schüttelte stirnrunzelnd den Kopf. „Nein. Ich glaube, Dana hat einfach nur das falsche benutzt.“
Simone drehte die Schachtel um und zeigte auf den Aufdruck, Wallace las und erkannte das Proteinset. Ein tintenschwarzes, schlüpfriges Gefühl machte sich in ihm breit.
„Hast du vielleicht beim Aufräumen die DNA-Reinigungsreagenzien in die falsche Schachtel gelegt? Wallace, du musst besser aufpassen.“
„Nein, habe ich nicht“, sagte er.
„Nun, diese Zahlen ergeben sonst keinen Sinn.“
„Und du hast noch versucht, mich zu warnen“, sagte Dana mit hoher, tonloser Stimme. Sie schüttelte den Kopf. „Dir war wohl klar, dass du einen Fehler gemacht hast.“
„Du musst besser aufpassen“, wiederholte Simone. „Ich weiß, du bist ehrgeizig und so weiter, aber du musst aufmerksamer sein.“
Wallace schluckte angestrengt.
„Okay“, erwiderte er. „In Ordnung.“
Dana legte ihm eine Hand auf die Schulter und meinte: „Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.“
Wallace sah sie an. Er sah sie an und versuchte zu verstehen, was für ein Mensch sie war. Doch er sah nichts als die abgestorbenen Hautschüppchen, die sich in den rotblonden Härchen zwischen ihren Augenbrauen verfangen hatten.
Simone ließ ihn die Reagenzien vor ihren Augen sortieren. Sie zwang ihn, die Schachteln auf seinem Labortisch zu ordnen, und als er fertig war, musste er den Vorgang wiederholen, nur zur Sicherheit, nur für alle Fälle.
„Deinetwegen hat sie einen ganzen Tag verloren, Wallace. Einen ganzen Tag! Wir können es uns nicht erlauben, durch Unachtsamkeit so viel Zeit zu verlieren.“ Simone stand neben seinem Tisch und schaute zu, wie er alle Reagenzien, Glaskolben und Flaschen zum dritten Mal sortierte. Er hätte das mit geschlossenen Augen tun können. Er war sorgfältig, immer. „Ich tue das nicht, um dich zu bestrafen. Ich will dir nur helfen, dich zu verbessern.“
Trotzdem. Mutwillig seine Schalen zu ruinieren – das traut er nicht einmal Dana zu. Dana ist nicht böse, sie ist einfach nur faul und schlampig.
„Überstunden?“, fragt er Brigit. „Ich war mindestens bis Mitternacht hier. Jeden Abend.“
„Und sie bis um zwei Uhr morgens“, raunt Brigit, und Wallace setzt sich auf.
„Unmöglich!“
„Wie gesagt, ich habe nichts gesehen. Ich habe es bloß gehört.“
„Warum sollte sie so was tun?“
„Sie braucht keinen Grund. Sie ist begabt“, höhnt Brigit. Begabt, so nennt Simone Dana am liebsten. Wallace muss lachen. Begabung ist allein dazu da, die Bitterkeit einer Niederlage zu versüßen. Ein Mensch kann immer wieder scheitern, und es ist in Ordnung, denn solange er begabt ist, ist er trotzdem etwas wert. Darauf läuft alles hinaus, nicht wahr? Wenn die Welt sich einmal entschieden hat, einen Menschen und das, was er anzubieten hat, zu brauchen und zu wollen, dann ist es egal, wie viel Mist er baut. Allerdings fragt Wallace sich, wo die Schmerzgrenze liegt. Ab wann ist nicht mehr zu übersehen, dass jemand einfach fürchterlich ist? Ab wann kann man sich nicht mehr auf sein Talent berufen, ab wann muss man Ergebnisse vorweisen?
Brigit stemmt sich aus dem Bürostuhl und schiebt ihn zurück unter Henriks Schreibtisch. Sie seufzt, streckt sich. Er hört, wie die Gelenke knacken und ihre Knochen sich neu ausrichten. „Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren.“
„Keine Ahnung, ob es mir jetzt besser geht“, sagt er, und sie umarmt ihn flüchtig.
„Halt durch, Wally“, sagt sie. Katie kommt an seiner Arbeitsnische vorbei, einen großen Glaskolben schwenkend; als sie die beiden entdeckt, macht sie auf dem Absatz kehrt und verschwindet wieder.
„Wie ich schon sagte“, murmelt Brigit. „Top Laune.“
„Sie ist nicht mein Boss.“
„Vielleicht nicht. Vielleicht doch.“
Brigit zieht sich zurück und winkt ihm noch einmal zu. Er salutiert und ist wieder allein.
Es würde sich für Dana ganz und gar nicht lohnen, seine Präparate zu ruinieren. Sie sitzen an verschiedenen Projekten, vor allem wegen eines Zwischenfalls bei ihrer letzten Zusammenarbeit. Um Dana in die Arbeitstechniken des Labors einzuführen, hatte Simone ihr aufgetragen, zusammen mit Wallace die Synthese verschiedener Oligonukleotide vorzunehmen. Dana war Genetikerin und der Meinung, sie müsse die Oligomere entwerfen, obwohl sie in der Technik wenig praktische Erfahrung besaß und Wallace bereits mindestens zweihundert Oligomere konzipiert hatte. Dana aber hörte ihm gar nicht erst zu, als er versuchte, ihr seine Herangehensweise zu beschreiben, und was er über die optimale Temperierung, das Gen-Targeting, die Nützlichkeit von Enzymen beim Klonen und bei der Genfusion, Screening-Methoden und kompetente Zellen in Erfahrung gebracht hatte. Er versuchte es auf zwanzig verschiedene Arten und ging ihre Verbohrtheit aus allen möglichen Richtungen an, doch alles perlte von ihr ab. Sie wollte seine Hilfe nicht.
Weil ihm die Ideen ausgingen, wandte er sich an Simone. Zu einem Zeitpunkt, an dem etwa zwanzig Oligonukleotide zur Injektion bereitstehen sollten, hatten sie dank Danas Eigensinn noch kein Einziges geschafft. „Wallace“, sagte Simone, „vielleicht solltest du es in einem anderen Ton probieren? Könnte es sein, dass du ein bisschen herablassend rüberkommst?“ Als er verneinte, fügte sie hinzu: „Sicher? Denn Dana ist wirklich clever. Behandele sie nicht von oben herab.“
Bei den Injektionen stellte Dana sich allerdings reichlich ungeschickt an: Statt die Tiere aufzulesen, spießte sie sie mit der Nadel auf, oder sie rammte sich das Ding in den Finger, sodass Wallace die Arbeit am Ende allein machen musste. Sie tat sich auch schwer, die Würmer zügig auf das Saccharose-Pad aufzubringen, sie mit Levamisol und Nährlösung zu betupfen, um sie zu beruhigen und vor dem Austrocknen zu bewahren, und so verwandelten sich die Exemplare noch dort auf dem Objektträger in harte Pralinen. Er versuchte, ihr zu helfen. Er redete leise und ruhig auf sie ein. Er wartete geduldig, selbst wenn er sah, dass das Tier längst gestorben war. Einmal drehte sie sich mit einem so stolzen Gesichtsausdruck zu ihm um, dass er dachte, sie hätte es endlich geschafft, aber als er den Wurm unter dem Mikroskop untersuchte, war er hinüber. Seine Innereien herausgerissen und umgestülpt. Ein schrecklicher, grausamer Tod.
Irgendwann hatte er die Nase voll von der fruchtlosen Zusammenarbeit und bat um ein anderes Projekt. Womöglich hatte Dana es ihm übel genommen, aber das alles war nun zwei Jahre her. Sie kommt noch immer regelmäßig ins Labor und verbringt dort ein paar halbwegs produktive Stunden. Auf ein Promotionsprojekt hat sie sich jedoch noch nicht festgelegt. Ihre Herangehensweise ist umständlich, ihr Denken sprunghaft. Schlimmer noch, ihre Fehlschläge bringen sie dazu, Menschen und Projekte einfach zu verwerfen. Wenn etwas sich nicht nach ihren Erwartungen entwickelt, versenkt sie es wie ein kaputtes Boot. Ihre Laborpräsentationen sind eine Ansammlung halb garer Ideen, ihre Fingernägel blutig abgekaut. Sie wirkt reizbar und verletzt.
Dennoch – wozu sollte Dana seine Kulturen zerstören? Sie hätte keinen materiellen Vorteil davon, und ihr Egoismus ist Wallace immer schon sehr pragmatisch erschienen. Es wäre ein sinnloser, unnötig anstrengender Akt.
Wallace bekommt Kopfschmerzen.
Die Menschen können unberechenbar sein in ihrer Grausamkeit. Der Gedanke lässt ihn aufschrecken. Kurz denkt er an die furchtbare Zeit im letzten Jahr zurück, als er die Vorprüfung ablegen musste und drei Monate lang kaum aus dem Bett kam. Er schaffte es nicht, regelmäßig zu essen und zu duschen. Diese drei Monate waren wie ein langsamer Sturz durch eine unförmige, kalte Dunkelheit. Er hatte seine Tage damit verbracht, im Bett zu liegen, im Internet alte Arztserien zu schauen und zu beobachten, wie sich das Licht an den Wänden veränderte. Wenn er sich doch einmal aus dem Bett schleppen konnte, saß er stundenlang in der Wanne und fühlte sich ängstlich und klein. Verzweifelt fragte er sich, was er tun würde, wenn er die Prüfung nicht bestand. Nicht einmal die Demütigung fürchtete er so sehr wie den jähen Schritt ins Ungewisse. Er würde die Uni verlassen. Sich überlegen müssen, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Das war es, was ihn all die Monate gelähmt hatte: Er konnte sich einfach nicht entscheiden.
An einem Tag im späten September war Henrik dann zu Wallace’ Wohnung gekommen und hatte geklingelt, bis Wallace klein beigab und ihm aufmachte. Oben in der Wohnung angelangt, ließ Henrik einen Stapel Fachtexte, Schreibblöcke und Textmarker auf den Teppich fallen und sagte Wallace, er solle sich an die Arbeit machen. Er schaute jeden Tag für mehrere Stunden vorbei und gab Wallace Nachhilfe. Sie nahmen Signaltransduktion und Gradienten durch, Morphologie und Proteinstruktur, den Aufbau der Zellwand, die evolutionäre Entwicklung von Gonadengewebe in Fliegen und Nematoden, mikrobielles Screening. Henrik legte ihm Methode für Methode dar, erst geduldig und dann ungeduldig, und wenn sie nicht vorankamen, schlug er mit seiner schweren Hand auf den Tisch und rief: „Das musst du wissen, Wallace! Reiß dich zusammen!“ Wallace saß da, hörte zu, machte sich Notizen. Und las abends die Fachtexte, bis die Buchstaben vor seinen Augen verschwammen. Er nahm zwei Kilo ab, dann fünf, dann acht. Henrik nahm ihn mit ins Fitnessstudio. Er nötigte ihn, auf dem Laufband zu lesen, er befragte ihn während des Trainings zur embryonalen Entwicklung der Nematoden, zum Abbaumechanismus bestimmter Proteine in bestimmten Gewebearten unter bestimmten Bedingungen, er fragte nach anderen Bedingungen und anderen Gewebearten, bis die Szenarien hin- und herschwangen wie eine Tür in losen Angeln. Nach einer Weile wusste Wallace, wie sich das Licht in Henriks Bart brach. Auf seinem dicken Haar. Er kannte seinen breiten Mund. Er konnte Henriks Stimmungen erspüren wie Säugetiere auf kargen Inseln die ersten Zeichen eines Vulkanausbruchs.
An einem tristen Dezembernachmittag bestand Wallace die Prüfung, auch wenn er sich vor der Prüfungskommission gefühlt hatte wie vor einem Erschießungskommando. Beim feierlichen Mittagsempfang suchte er Henriks Blick.
Aber Henrik schaute bereits weg, aus dem Fenster.
Bei Simones alljährlicher Adventsfeier wechselten sie kaum ein Wort, und drei Tage später ging Henrik nach Vassar, wo eine Anstellung auf Lebenszeit winkte. Kurz darauf besuchte Wallace die Weihnachtsfeier seines Instituts und machte den fatalen Kommentar über Miller und die Trailerparks.
Wallace vermisst es, um drei Uhr morgens aufzuwachen und den schlafenden Henrik auf dem Sofa im Wohnzimmer vorzufinden, laut schnarchend und so schwer, dass sein Körpergewicht das billige Möbelstück verformt. Er vermisst die gemeinsamen Mahlzeiten und Henriks fast schon wütende Art zu essen. Möglicherweise vermisst er auch andere Dinge, namenlose Gefühle, die durch seinen Körper zirkulierten. Und diese Gefühle haben sich in etwas Gemeines, Grausames verwandelt.
Dem Ganzen lag eine gewisse Berechnung zugrunde, auch wenn er das anfangs nicht sehen konnte, eine Schattenkalkulation, die heimlich ihr ganzes Leben durchzog.
Am Ende ist egal, wer was getan hat. Am Ende ist das alles nicht wichtig.
In diesem Sinne. Zurück an die Arbeit.
Die Teeküche ist leer. Wallace schlägt mit der Hand gegen den klemmenden Hahn, bis der Griff nachgibt und das Wasser in einem harten Strahl herausschießt. Es trommelt ins Becken, als wollte es gegen Wallace’ Gewalt protestieren. Er lässt das Wasser in einen ramponierten Alutopf laufen und stellt ihn auf den Elektroherd. Die Herdplatte erwärmt sich tickend. Ganz hinten im Regal stehen die bunt zusammengewürfelten Tassen dicht gedrängt wie vergessene Pflegekinder. Wallace legt die Stirn an das warme Glas der Fensterscheibe: Weit unten teilt sich die Hauptstraße und schließt die lutherische Kirche inselgleich ein. Nur wenige Autos sind unterwegs. Von der Hauptverkehrsader zweigt eine schmale Straße ab, führt einmal um den Biochemiekomplex herum und endet am Bootshaus und dem botanischen Garten. Im Frühjahr findet dort die Spendengala statt, bei der reiche weiße Leute Brotstücke in den Koiteich werfen und sich in gedämpftem Ton über den demografischen Wandel an der Universität unterhalten. In seinem ersten Jahr als Doktorand war Wallace zu einem Willkommensdinner in ebenjenem Garten eingeladen. Im Laufe des Abends wurde er einem beleibten, bärtigen Mann vorgestellt, der nach Schweiß und Eichenlaub roch. „Das ist Bertram Olson, Wallace. Er finanziert dein Stipendium hier im ersten Jahr.“ Als er dort in der herabsinkenden Dunkelheit stand und ein kondenswassernasses Glas Ginger Ale in der Hand hielt, begriff Wallace, was der wahre Zweck der Veranstaltung war: Willkommen. Dies ist die Person, die deine Ausbildung bezahlt. Du darfst sie jetzt anbeten.
Aber Wallace weiß, er kann sich glücklich schätzen. Sein Stipendium ist großzügig, ihm steht doppelt so viel Geld zur Verfügung, wie seine Mutter als Haushälterin verdient hat. Er hat praktisch keine materiellen Sorgen mehr, kann sich Essen, eine eigene Wohnung und andere Dinge wie einen Laptop und eine neue Brille für fast tausend Dollar leisten. Objektiv betrachtet ist es nicht viel, aber es ist mehr, als er in seinem Leben je besessen hat. Außerdem erhält er es regelmäßig, jeden Monat, darauf ist Verlass. Das Wasser vor ihm fängt zu blubbern an, und Wallace gießt es über den Chai, den er in dem überteuerten Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt gekauft hat. Im Labor denken alle immer nur ans Geld: wer das große Fachbereichsstipendium bekommt (Miller), welchem Doktorvater Fördermittel verweigert wurden (dem von Lukas), welches Labor private Forschungsgelder einstreicht (das von Wallace), wer sein Projekt am ehesten in der freien Wirtschaft unterbringen könnte (Yngve), wer den Job bei Brandeis ergattern wird (Caroline), wer ans MIT geht (Nora, eine Promotionsstudentin aus Yngves Labor), wer vielleicht nach Harvard wechselt (Coles Vorgesetzte), wer an die Columbia (Emmas Doktorvater) oder an die University of Texas (niemand). Sie reden über die Entscheidungen und die Zukunft der Fakultätsmitglieder, als verfolgten sie kleine Planeten in ihrem Orbit. Die meisten Karrieren bewegen sich in durch bestimmte Faktoren festgelegten Bahnen. Typischerweise verbleibt man auf dem Niveau seiner Doktorandenstelle, oder man steigt eine Stufe ab. Es ist schwierig, diese Stufen zu überwinden. Stipendien führen zu guten Doktorandenstellen, gute Doktorandenstellen führen zu guten Forschungsprojekten und gute Forschungsprojekte zu Lehrstühlen an Einrichtungen, die mehr oder weniger den Status des ersten Stipendiengebers innehaben. Alles steht und fällt mit dem Geld. Inzwischen wird Wallace’ Stipendium von einem durchschnittlich angesehenen und überregional bekannten Forschungsfonds bezahlt. Simone gilt als Expertin auf ihrem Gebiet. Und so können sie sich freuen auf das, was sie noch erwartet, auf eine halbwegs stolperfreie Laufbahn. Auf eine solche Zukunft, auf die Gewährung gewisser Privilegien, hat Wallace sein Leben lang hingearbeitet.
Doch der Preis, denkt Wallace. Der Preis, den er für sein Glück bezahlen muss.
Der Tee ist ein Kompromiss. Eigentlich hätte er lieber Kaffee, aber dann könnte er sich nicht mehr konzentrieren. Als er im Labor anfing, trank Wallace im Laufe des Vormittags drei extragroße Cappuccinos, nur um wach zu bleiben, und in den Nachmittagsseminaren ließ er sich von Vorträgen über DNA-Sequenzierung und Protein-Kernspinresonanz einlullen. Die Dozenten warfen ihm scharfe Blicke zu, doch ihre Stimmen klangen so samtig und satt wie die Tonspur einer Kunst- oder Wissenschaftsdokumentation. Immer fing es an mit „Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen“ oder „Heute habe ich drei spannende Narrative für Sie“ oder „Ich möchte Ihnen demonstrieren, wie wir von A nach B gekommen sind“. Die Sitze des Auditoriums waren hart, es gab keinen Empfang und kein WLAN. Helles Holz, wo er nur hinsah. Die Wände waren mit wellenförmigen Paneelen, die Stufen mit schalldämpfendem Teppich bedeckt. Wallace ließ sich treiben, er fürchtete, in diesen Gewässern nicht schwimmen zu können. Er trank mehr Kaffee als je zuvor und bekam jeden Nachmittag einen brennenden, heftigen Durchfall.
Er trank Kaffee, bis ihm die Welt ein wenig heller erschien und sich zu verformen begann, bis ihm die Lichtteilchen entgegenflogen. Und dann, eines Tages, gab Henrik ihm den entscheidenden Hinweis: „Koffein ist ein Aufputschmittel.“ Wallace stutzte und war verwirrt. Der Satz klang nach einem falschen Aphorismus. Henrik wiederholte ihn jedes Mal, wenn Wallace mit einem Kaffee aus der Cafeteria im Untergeschoss ins Labor zurückkehrte, oder wenn sie nach einem Seminar, bei dem Wallace sich eine Tasse nach der anderen gegönnt hatte, zusammen Aufzug fuhren. Wallace’ Herz flatterte. Sein Mund war trocken. Seine Fingerspitzen fühlten sich steif und geschwollen an. Ihm war, als würde er wie eine Wurst aus der Pelle gepresst. Wenn er nachts allein im Labor stand, ließen seltsame Geräusche ihn aufschrecken, und eines Tages fing seine Hand während des Sezierens wild zu zittern an, wie bei einem plötzlichen Krampf. Er ließ das Skalpell fallen, und es bohrte sich in seinen Oberschenkel. Nicht besonders tief, aber tief genug, und da verstand Wallace, was Henrik gemeint hatte.
Jetzt am Nachmittag verschwimmen die weißen Kacheln zu einem Meer aus Licht, Wallace’ müde Augen überfliegen die grauen Buchseiten. Er zieht nacheinander an seinen Fingern, bis die Gelenke knacken. Auf dem flachen weißen Fenstersims hockt ein Vogel, ein kleines rundes Ding mit grauen Federn und weißem Bauch, und putzt die Unterseite seines Flügels. Sein Kopf ist winzig, kaum vom Körper zu unterscheiden. Er sieht aus wie eine flauschige Kugel. Der Schatten des Vogels hüpft über den Laborboden, und Wallace schaut zu, wie er abhebt und verschwindet. Auf dem Weg ins Labor hat er kurz in der Bibliothek vorbeigeschaut. Er hat das Buch gefunden, von dem Thom erzählt hat.
Samstags sitzt er manchmal im Labor und liest. Dass Simone ihn dabei erwischt, ist eher unwahrscheinlich. In Wallace’ zweitem Jahr kam Simone einmal in die Teeküche, als er mit einem Buch und einer Schale Instantnudeln dort saß. An dem Tag war ein ungewöhnlich starkes Gewitter aufgezogen, die ganze Welt war in ein unheimliches aquamarinblaues Leuchten getaucht. Simone stellte sich ans Fenster und beobachtete den Regen, der vom Wind durch die fahlen Lichtkegel der Straßenlaternen gepeitscht wurde. Als sie sich wieder zu ihm umdrehte, wirkte sie entnervt, geradezu wütend: „Hast du nichts Besseres zu tun, als Dr. Seuss zu lesen, oder was immer das da ist?“ Wallace ließ langsam das Buch sinken, zuckte wehrlos die Achseln. „Das ist Proust“, sagte er. „Ein französischer Autor.“
Wallace hat dreißig Seiten geschafft, als ein Schatten auf die Buchstaben fällt, fordernd wie ein Fingerzeig. Er hebt den Kopf und sieht Millers gleichgültiges Gesicht, seinen kühlen Blick aus großen Augen, den Vorwurf darin. Sein zerzaustes Haar. Er trägt immer noch das graue Sweatshirt und die Shorts vom Vortag, auf seinen endlos langen, sonnengebräunten Beinen wächst ein feiner Flaum aus rotgoldenen Haaren.
„Du bist einfach verschwunden.“
„Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen“, sagt Wallace.
„Habe ich gelesen.“
„Na dann, kein Grund zum Rumheulen.“
Miller schnaubt, aber er lächelt auch. Wallace ist erleichtert. Zugleich fühlt er sich, als würde er aufs offene Meer hinaustreiben.
„Ich meine ja nur. Du hättest mich wecken können.“
„Du hast so friedlich geschlafen“, sagt Wallace, lässt sich zufrieden in die harte lilafarbene Sitznische zurücksinken und strahlt dabei mehr Selbstvertrauen aus, als er eigentlich besitzt. Miller legt wie immer die natürliche Gleichgültigkeit eines Riesen an den Tag, er hält sich zurück und beobachtet die Welt durch halb geschlossene Lider. Wallace gerät ins Wanken. Seine Gliedmaßen kribbeln, als stünden sie unter Strom. Ein Sirren breitet sich in ihm aus, während die Spulen heiß laufen. Etwas in seinem Inneren glättet sich und glüht.
„Trotzdem“, insistiert Miller. „Du hättest mich nicht alleinlassen dürfen. In deiner eigenen Wohnung.“
„Möchtest du dich setzen?“
„Klar, warum nicht.“
Wallace macht Platz und stellt die Schlägertasche auf seine andere Seite. Millers Haut ist warm. Im Sitzen berühren sich ihre Oberschenkel. Die Sitzfläche aus Kunstleder kommt ihm plötzlich klebrig vor, Wallace rückt zur Seite und drückt sein klammes Bein an Millers, das trocken ist und nicht ganz so heiß. Sie halten die Arme eng am Körper, sitzen dichter beisammen als nötig. Wallace sieht auf Millers knochige Fußgelenke hinunter, auf den nackten, blassen Knorpel über den Fersen. Er erinnert sich an den salzigen Geschmack von Millers Haut, so anders als sein eigener; immer sind die Körper der anderen fremd, so fremd, als bestünden sie aus seltenen Elementen oder unbekannten Metallen. Miller lässt die Fingerknöchel knacken, wirft Wallace einen Blick zu. Scham liegt darin, oder etwas in der Art. Miller neigt den Kopf, bis er fast die Schulter berührt. Ein schüchterner Junge, denkt Wallace, schüchtern und wachsam.
„Wie geht es dir?“, fragt Miller. Wallace ist enttäuscht. Die ganze Verspieltheit, der Flirt – für die Katz.
Wallace stützt beide Ellbogen auf die Tischplatte, die gefährlich ins Wanken gerät. Der Tee schwappt über den Tassenrand, Millers Augen weiten sich fast unmerklich. Wallace hält den Atem an und wartet, bis sich der Tisch und der Tee und die Welt beruhigt haben.
„Sind wir jetzt gute Bekannte?“, fragt er. „Wie geht es dir?“
Miller runzelt die Stirn. Wallace’ Enttäuschung wächst. Wie es geht, fragt höchstens der Hausarzt. Die Frage hat überhaupt nichts zu bedeuten. Aber vielleicht hat Miller sie gerade deswegen gestellt, ein sanfter Schritt zurück zum Anfang, eine Art von Verleugnung? Wallace fährt sich mit der Zunge über die Zähne und überlegt. Wägt die unterschiedlichen Antworten ab. Millers Stirn glättet sich, seine Mundwinkel zucken und entspannen sich dann. Da ist ein nüchternes, dunkles Glühen in seinen Augen.
„So meinte ich das nicht. Ich möchte nur wissen, wie es dir geht. Nach gestern Abend. Du weißt schon.“
„Sind wir jetzt wieder in der Highschool?“, fragt Wallace. „Du bist erwachsen. Sprich es einfach aus.“
Die Ratlosigkeit in Millers Gesicht gefällt Wallace. Er spürt einen freudigen Schauder, eine wohlige Gänsehaut.
„Sei nicht so gemein, Wallace“, sagt Miller. „Komm schon.“
Gut, denkt Wallace. Er wird nachsichtig sein. Er küsst Miller auf die Schulter, schmiegt das Gesicht an seine harten Knochen. Es ist eine Wohltat, die Augen zu schließen, und sei es nur für einen Moment. Millers große Hand auf seinem Oberschenkel. Kühl, trocken und rau. Wallace spürt ein leises Lachen in sich aufsteigen.
„Hey“, sagt er, aber da hat Miller die Hand schon wieder weggezogen.
„Was tun wir hier?“
„Keine Ahnung. Sag du es mir.“ Das knarrende Kunstleder, der ächzende Holzrahmen der Bank. Wallace rückt von Miller ab, seine Haut löst sich nur widerwillig von der Sitzfläche. Miller legt einen Daumen an den Henkel seiner Teetasse und dreht sie zu sich.
„Ich wollte nur rücksichtsvoll sein. Deswegen habe ich gefragt.“
„Wirklich? Aus Rücksicht?“
„Mach dich nicht lustig.“
„Mach mir keine Vorwürfe“, sagt Wallace in einem vorübergehenden Anfall von Stolz oder Rechthaberei. Ganz kurz sieht Miller getroffen aus, aber er fängt sich sofort wieder und wendet sich Wallace zu, sodass er der Teeküche den Rücken zukehrt. Sie sitzen in einer Ecke. Sonnenlicht fällt auf Millers Nasenrücken und auf die Haut unter seinen Augen, hell und golden. Sie sitzen dicht nebeneinander. Ein Knistern oder Rauschen erfüllt den Raum. Millers Wimpern sehen so unglaublich weich aus. Wallace legt eine Hand auf Millers Augen, fühlt das Kitzeln seiner Wimpern. Und da ist noch ein Gefühl: Erleichterung darüber, in diesem Moment unbeobachtet zu sein. Millers Gesicht ist das eines gutmütigen Jungen, auf mürrische Weise geduldig. Noch mehr Nachsicht, denkt Wallace und kniet sich auf die Bank. Das Polster sinkt unter seinem Gewicht ein, er muss sich mit einer Hand an Millers Schulter abstützen.
„Was machst du da?“, fragt Miller leicht besorgt. Wallace summt, statt zu antworten. Spürt die Anspannung in Millers Körper, der sich unter seiner Hand windet wie eine gespannte Feder. Wallace beugt sich vor, bis ihre Lippen, Nasen, Augen auf einer Höhe sind. Sieht seine dunklen, rissigen Knöchel an Millers Gesicht. Miller rutscht auf seinem Platz herum, sicher kann er Wallace’ Atem spüren, den Druck seiner Finger. Er fragt noch einmal: „Wallace? Was machst du da?“
Fast muss Wallace lachen. Fast sagt er: Ich handle. Oder: Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Aber dann schweigt er. Beugt sich noch tiefer hinunter. Ihre Lippen berühren sich. Das seifige Aroma von Zahnpasta, der beißende Alkoholgeruch von Mundwasser. Darunter der hartnäckige Nachgeschmack des Schlafs. Kein Kaffee für Miller. Wallace schmeckt Millers Lippen, erkundet den weichen Amorbogen, dann die Mundwinkel. Dringt in die feuchte, warme Mundhöhle vor.
Das reicht, denkt er und zieht sich zurück.
Miller öffnet die Augen nicht sofort. Ganz kurz fürchtet Wallace, er könnte zu schnell vorgeprescht sein, zu weit, könnte sich geirrt oder verrechnet haben. Aber dann schlägt Miller ganz langsam die Augen auf. In seiner Iris ein spitzer Splitter aus Sonnenlicht.
„Deine Hände riechen gut“, sagt er.
„Das kommt vom Tee. Hier, nimm einen Schluck.“ Wallace führt die Tasse an Millers Mund, und Miller trinkt, den Blick fest auf Wallace gerichtet. Seine Kehle knackt bei jedem Schluck. „Braver Junge.“
„Sag das Tennisspielen ab“, fordert Miller. Wallace lässt die Tasse sinken und hält den Atem an.
„Das geht nicht.“
„Doch.“
„Tut mir leid.“
„Und später?“
„Lass uns das spontan entscheiden“, sagt Wallace. Er fühlt sich schwach, seine Knie zittern. Millers Atem riecht nach Chai, nach seinen eigenen Händen.
„Okay?“, fragt er.
Er steht auf, nimmt sein Buch und die Tasche.
„Tja, die Arbeit ruft“, fügt er hinzu und schiebt sich um den Tisch herum, doch Miller streckt die Hand aus.
„Wallace.“
„Mach keinen Quatsch. Wir sollten vernünftig sein.“
Miller lässt die Hand sinken. Das Sonnenlicht kribbelt in Wallace’ Nacken, in seinen Kniekehlen.
„Klar“, brummt Miller. „Was sonst.“
Ein Wurm zieht sich abwechselnd zusammen und streckt sich wieder, schleppt sich dahin.
Nematoden sind durchsichtig. Diese Eigenschaft macht sie zum idealen Modellorganismus fürs Mikroskopieren. Weitere Merkmale sind die einfache genetische Manipulierbarkeit, das überschaubar kleine Genom, eine kurze Generationszeit und eine unkomplizierte Handhabung. Nematoden sind zähe Wesen und können sich selbst befruchten. Ab einem bestimmten Punkt in der Larvenentwicklung gehen die Keimbahnen von der Spermienproduktion zur Eireifung über. „Aus den kleinen Jungs werden junge Frauen“, sagt Simone dazu.
Ein einziger Wurm in einer einzigen Schale bringt bereits nach einer Woche Tausende von Nachkommen hervor. Bei Nahrungsknappheit wird die Fortpflanzung zurückgefahren. Die Embryonen schlüpfen noch im Mutterleib. Sie fressen sich ins Freie und zerstören auf ihrem Weg in die Welt die mütterliche Cuticula; einige von ihnen tragen da selbst schon Embryonen in sich. Wie in den großen Schöpfungsmythen, denkt sich Wallace manchmal.
Der Wurm, den er in diesem Augenblick auswählt, ist stark ausgebeult. Offenbar stecken Dutzende kleinerer Würmer in ihm. Es handelt sich um ein altes Weibchen, randvoll mit Nachwuchs. Trotzdem ist es noch am Leben, mehr als ein bloßes Gefäß. Ausgehungerte Exemplare auszusuchen wäre sinnlos. Denn in deren Nachkommen wütet ab der Geburt ein Katastrophenalarm.
Wallace kann Miller immer noch schmecken. Dieser letzte Kuss war ein Fehler. Seltsam, dass Wallace jetzt jemand ist, der küsst. Der metallische Nachgeschmack der Scham, nicht konsequenter gewesen zu sein. Ihm ist übel, als müsste er den Sinneswandel vor einer höheren Macht, einer übergeordneten Autorität rechtfertigen. Er wundert sich über sich selbst, über seinen unzuverlässigen Körper. In seinem Kopf herrscht Tumult, dunkle Schemen erheben sich und ringen miteinander. Die Erinnerung an Millers warmen Körper in seinem Bett, an das trübe Morgenlicht in den Vorhängen, an Millers blasse, knochige Hüfte, sein lockiges Haar, den abgestandenen Geruch nach Schweiß und Bier. Die dunklen Haarbüschel auf seiner Brust. Bedauern darüber, ihn am Morgen im Bett zurückgelassen zu haben. Und in der Teeküche. Doppeltes Bedauern? Keins? Ach Wallace, tadelt er sich selbst. Es gibt Wichtigeres.
Im Labor ist es hell und ruhig. Wallace lehnt sich in seinem Sessel zur Seite und wirft einen Blick in den Gang, aber da ist niemand. Am hinteren Ende des Labors nur bläuliche, reglose Schatten. Es ist die Tageszeit, zu der die anderen sich zurückziehen und er die Stille für sich allein hat – die Welt draußen weit und blau und schön. Auf der anderen Straßenseite sitzen Vögel in der Kiefer, klein und dunkel umflattern sie die Baumkrone. Wie merkwürdig, denkt Wallace, ein Vogel zu sein und die Welt unter sich zu haben. Diese Umkehrung des Maßstabs: Was klein ist, wird groß, und das Große wird klein. Ein Vogel bewegt sich durch den Raum, wie er will, da gibt es keine Dimension, die unerreichbar wäre. Wallace ist dankbar, allein zu sein. Die anderen werden erst am Abend zurückkehren, wie eine dunkle Herde werden sie in das Gebäude einfallen, um ihre Experimente voranzutreiben und ihre Projekte in kleinen, mühseligen Schritten der Vollendung entgegenzuschieben.
Genau genommen ist die Laborstille eine Anhäufung von Geräuschen. Die Rüttler schlagen Krach wie wütende Demonstranten. Hier ist Wallace in der Unterzahl, doch seltsamerweise hat der Lärm eine beruhigende Wirkung auf ihn. Als er noch klein war, ließ er den Ventilator auch im Winter laufen, weil das stetige Surren ihm das Leben auf irgendeine Art leichter machte. Wenn er den Luftstrom gegen die Wand richtete, rauschte er wie das Meer – oder wie der Bach hinter dem Kiefernwald, der das Farmland seiner Großeltern begrenzte. Wallace ließ den Ventilator laufen, während er seine Hausaufgaben in Mathematik, Chemie, Biologie erledigte, und er wurde dabei immer besser, bis er eines Tages der beste Schüler in ganz Alabama war, zumindest wenn es ums schriftliche Dividieren ging oder darum, das Gewicht einer Bowlingkugel in metrischen Einheiten zu schätzen. Der Ventilator in seinem Zimmer blendete seine Eltern aus, die darüber stritten, wer das letzte Light-Bier aus dem Kühlschrank genommen, das letzte Stück Brathähnchen gegessen oder das Gemüse aus den Augen gelassen hatte, das nun verkohlt am Boden ihres einzigen guten Topfes klebte. Genauso wenig hörte Wallace seinen Bruder und dessen Freundin nebenan, denn das Meeresrauschen übertönte auch die quietschenden Bettfedern. Wenn das Fenster offen stand, drang das Gebell der Wildhunde im Wald zu ihm herein, ihr einsames Jaulen und Heulen, das aus den Bäumen aufstieg wie Gespenster oder Vögel. Er hörte das Echo von Gewehrschüssen und das Bersten der Kanister, die hinter dem Haus in die brennende Tonne geworfen wurden. Nicht die Außenwelt galt es zu überstimmen, sondern das Innenleben des Hauses; immer schon war ihm seine Familie unberechenbarer und fremdartiger erschienen als alles, was ihm draußen im Wald hätte begegnen können.
Später schaltete er den Ventilator ein, um das Schnarchen des Mannes zu übertönen, den seine Eltern auf dem Sofa übernachten ließen, weil er kein Zuhause hatte und ein Freund war. Manchmal fragt sich Wallace, ob er nur wegen des Ventilators nicht gemerkt hat, dass der Mann mitten in der Nacht aufstand, in sein Zimmer kam und die Tür hinter sich schloss.
Die alte Wut überrollt ihn, ganz kurz verschwimmt seine Sicht. Seit Jahren hat er nicht mehr daran gedacht, doch plötzlich ist alles wieder da, selbst das Klicken des Schlosses, als die Tür in jener ersten Nacht zugezogen wurde. Die Endgültigkeit, mit der das Türblatt über den sandigen Holzboden wischte, das schabende Geräusch. Es war schrecklich. Das dumpfe Türenschlagen, und wie sich alle Konturen auflösten, als die Dunkelheit sein Zimmer verschluckte. Die tiefe, tintenschwarze Dunkelheit. Warum fällt ihm das jetzt wieder ein? So viele Meilen entfernt, so viele Jahre. Ein Stück seines alten Lebens, abgeschüttelt, herausgeschnitten wie ein grauer Star, aber nun ist es wieder da, es hat sich am Grund seiner Erinnerungen festgesetzt wie ein Stück Müll. Während er hier an diesem Ort ist. Allein im Labor. Die Erinnerung ist so umfassend, dass Wallace hochschreckt. Sein Körper hat nichts vergessen. Sein Körper verrät ihn.
Nun ist sein Vater also tot. Sein Vater, der nichts für ihn getan hat.
Tot, seit Wochen schon. Wallace hatte es kurzzeitig vergessen. Er will nicht vergeben, nur vergessen. Irgendwie scheint es dasselbe zu sein.
Sein Vater. Der Hass durchdringt ihn wie ein glühender, zischender Draht. Wallace’ Sichtfeld dellt sich ein, als würde sein Blick an den Rändern zusammengedrückt und nach innen umgelenkt. So sorgfältig hat er sein neues Leben über das alte, frühere gebreitet. Er versucht, nicht daran zu denken. Wendet sich völlig davon ab. Auf diese Weise werden sie einander wieder fremd, vage bekannte Gesichter in einem großen Strom aus Gesichtern. Es ist das Beste, was er für sich und die anderen tun kann. Sein Anspruch auf Teilhabe an ihrem Leben wird immer prekär sein.
„Noch bei der Arbeit?“, fragt jemand. Dana. Er braucht nicht einmal den Kopf zu heben.
„Manche Leute haben eben viel zu tun.“
„Und manche Leute sind ganz schön selbstgefällig“, sagt sie und schwingt sich auf Henriks Labortisch. Ihr Körper ist sehnig und sportlich, seine asketische Dürre bildet einen seltsamen Kontrast zu ihrem eher breiten Gesicht. Ihre Finger sind wund und gerötet, die Haut schuppt sich ab. Sie zupft an einem Nagelbett, zieht einen schmalen Dorn heraus und beißt ihn ab. Weiß gehärtete Haut, ein Blutstropfen. Sie belauern einander schweigend. Dana hat die Augen halb geschlossen, aber irgendwie schafft sie es, gleichzeitig nach unten und nach oben zu blicken. Ihr Sweatshirt sitzt locker und droht, sie zu verschlucken. Sie ist wie ein Mädchen in einer Muschelschale. Vielleicht wird sie sich eines Tages dorthin zurückziehen und die anderen sich selbst überlassen. Ihre Sticheleien treffen ihn kein bisschen, denn ihre um Lässigkeit bemühte Stimme klingt dünn und näselnd, geradezu verzweifelt.
„Kann ich dir irgendwie helfen, Dana? Ich habe zu tun“, sagt er, wendet sich wieder seinem Labortisch zu und rückt die Schale unter dem Mikroskop zurecht. Schlagartig hat er keine Lust mehr zu arbeiten. Seine Hände sind unruhig. Ein Zittern läuft durch seine Finger, einmal bis in die Spitzen und zurück. Die Knöchel schmerzen.
„Komm schon, hab dich nicht so.“ Ein unterkühltes Lachen. Wallace streckt die Finger. Er kann das Gas riechen, die kleine blaue Flamme züngelt.
„Ich habe mich nicht, Dana. Ich habe einfach nur zu tun. Mit Forschung. Vielleicht hast du schon mal davon gehört? Forschung erfordert jede Menge Arbeit. Sind dir diese Begriffe vertraut?“
„Du klingst wie Brigit. Ihr zwei solltet eure eigene kleine Sekte gründen.“
„So was nennt man Freundschaft, Dana. Auch das wird ein unbekannter Begriff für dich sein.“
„Gib es doch zu“, redet sie weiter. „Ihr zwei steckt ständig die Köpfe zusammen und lasst den Rest links liegen. Als wärt ihr die einzigen Menschen hier. Über uns redet ihr nur Mist.“
„Wir sind Freunde, Dana. Wir unterhalten uns gern.“
„Ich habe gehört, was ihr gesagt habt. Ich weiß, wie ihr redet, wenn ich nicht dabei bin“, sagt sie leise.
Wallace dreht sich wieder zu ihr um. Zu seiner Überraschung starrt sie in die Lücke zwischen ihren Oberschenkeln. Ihre Kopfhaut ist gerötet und trocken, ihre Haltung eigenartig. Sie sieht aus wie ein Stofftier, das jemand auf den Tisch gesetzt und dann vergessen hat. Diese klaffende Leere, wo ihr Körper ist. Er erinnert sich an den Vorabend, an das Gefühl, als Gesprächsstoff zu dienen, und plötzlich flackert Mitgefühl in ihm auf.
„Selbst wenn. Woher willst du das wissen?“, fragt er, obwohl die Antwort offensichtlich ist. Klatsch bleibt nie folgenlos, Loyalitäten verschieben sich. Er ist nicht der Einzige hier, der Verbündete hat. Aber Dana ignoriert den Köder und knabbert am nächsten Nagelbett. Wallace’ Finger schmerzen allein vom Zusehen. „Ich glaube nicht, dass du meine Schalen verunreinigt hast. Nur falls du dir deswegen Sorgen machst.“
Ein kurzes Schweigen. Die Flamme zischt und windet sich im Luftstrom. Unter leisem Flappen krümmt sich das Feuer in sich selbst. Die Stille ist so durchdringend, dass Wallace die Luftlöcher im Gas hören kann.
Und dann geschieht etwas Seltsames. Ein Zucken geht durch Danas Schultern, Arme und Beine, als würden Teile ihres Körpers elektrisch in Bewegung versetzt. Zuerst ist es leise wie ein Flüstern, aber dann platzt es aus ihr heraus. Sie lacht los und wirft so abrupt den Kopf in den Nacken, dass er fürchtet, sie könnte ihn gegen das Regal auf Henriks Tisch schlagen. Aber nichts geschieht, Dana lacht einfach nur. Sie hält sich den Bauch und klatscht sich auf die Oberschenkel, ihre Augen füllen sich mit Tränen.
„O mein Gott, hör dich an. Wie arrogant kann man sein? Denkst du echt, es interessiert mich, was du glaubst?“ Dana trocknet ihre Tränen. „Ich fasse es nicht. Du glaubst tatsächlich, es interessiert mich!“
„Ich verstehe nicht, was du meinst“, erwidert Wallace und fühlt sich so müde wie noch nie zuvor im Leben. „Und ich will dich auch gar nicht verstehen. Lass mich in Ruhe.“
„Ja, Wallace, genau. Ich habe dein großes Experiment ruiniert, weil ich sonst nichts zu tun habe. So bin ich.“
„Ich sagte, ich glaube nicht, dass du es warst, Dana. Mach dich nicht lächerlich.“
„Ich hasse dich, Wallace. Und willst du wissen, warum? Willst du wissen, warum ich dich hasse? Weil du hier rumläufst und einen auf wichtig machst, bloß weil du deine ganze Zeit mit Arbeiten verbringst. Du steckst deine ganze kostbare Lebenszeit in dieses Labor und in deine dummen kleinen Experimente, die absolut bedeutungslos sind, und trotzdem hast du den Nerv, mir zu erzählen, manche Leute hätten zu tun. Du sagst das zu mir. Ausgerechnet du. Du bist nicht Katie, und schon gar nicht Brigit. Und glaubst trotzdem, du hättest das Recht, mich zu kritisieren.“
Wallace riecht sein eigenes Blut. Er berührt sich an der Nasenspitze und betrachtet seine Finger, aber da ist nichts. Er nimmt das metallische, alles durchdringende Aroma von Blut wahr, seine Wärme und Bitterkeit. Er glaubt, Blut zu schmecken.
„Oh, niemand könnte dich kritisieren.“
Dana setzt sich auf. Ihr Lachen ist verstummt, scheint aber noch als Echo durch das Labor zu hallen.
„Weißt du, was ich glaube, Wallace? Ich glaube, du bist ein Frauenhasser.“
Das Wort schießt an ihm vorbei wie ein silbrig blitzender Pfeil. Ganz kurz schnürt eine raue Verbitterung ihm die Kehle zu.
„Ich habe nichts gegen Frauen.“
„Mir als Frau brauchst du nicht zu erklären, was Frauenhass ist, Arschloch. Lass es.“
„Okay.“
„Wenn ich also sage, du bist ein Frauenhasser, dann bist du einer.“
Wallace wendet sich ab. Über so etwas lässt sich nicht streiten. Deshalb bleibt er lieber für sich. Deshalb spricht er mit niemandem und hält sich raus.
„Ihr verdammten Schwulen glaubt tatsächlich, ihr wärt die Einzigen, die benachteiligt werden.“
„Das glaube ich kein bisschen.“
„Du bildest dir wohl ein, du könntest dir alles erlauben, bloß weil du schwul und schwarz bist und so tust, als könntest du keine Fehler machen.“
„Das stimmt nicht.“
„Was glaubst du, wer du bist? Die beschissene Königin der Welt?“, ruft sie und schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch. Wallace zuckt zusammen.
„Dana!“
„Ich habe die Schnauze voll von deinem Mist. Du kannst nicht von oben herab mit mir reden und so tun, als wärst du was Besseres. Ich habe es satt.“
„Niemand will dir Böses, Dana. Keiner hat dir was getan. Wir wollen dir alle bloß helfen, aber du lehnst jede Hilfe ab, weil du dich beweisen musst.“
„Ich muss mich beweisen, weil du und Männer wie du mich ausgrenzen. Scheiß drauf, Frauen sind die neuen Nigger und die neuen Schwuchteln!“
Ein säuerlicher, dumpfer Geschmack breitet sich an Wallace’ Gaumen aus. Für einige Sekunden wird die Welt von einem grellen Gleißen erhellt. Wallace blinzelt. Er umfasst die Armlehnen seines Sessels, wie um sich zu stützen. Er denkt an Brigit und ihre herzliche Art, ihre freundliche Stimme.
Dana keucht wie ein waidwundes Tier. Sie tobt, sie steigert sich in ihre Wut hinein. Sie ballt immer wieder die Fäuste, auf ihren kleinen Handrücken zeichnen sich die weißen Knöchel ab. Wallace empfindet kein Mitleid, über den Punkt sind sie hinaus, doch da ist etwas, was ihm bekannt vorkommt. In Danas Mundwinkeln sammelt sich weißer Schaum, ihre glühenden Augen sind zu Schlitzen verengt. In ihrer hilflosen, um sich schlagenden Wut erkennt Wallace sich selbst wieder. Das Unfaire daran ist, dass sie es sich leisten kann, Dampf abzulassen. Sie wird sich wieder einkriegen. Sie ist begabt, und er ist nur Wallace.
Nichts davon ist gerecht. Nichts davon ist angemessen, das weiß er. Aber er weiß auch, dass es hier nicht um Gerechtigkeit geht. Es geht nicht darum, fair oder angemessen behandelt zu werden, es geht einfach nur darum, seine Arbeit zu erledigen. Auf die Ergebnisse kommt es an. Er könnte ihr widersprechen, aber am Ende würde das keine Rolle spielen, und die Arbeit wird ihm niemand abnehmen. Niemand wird sagen: Weißt du, Wallace, es ist okay, wenn du deinen Teil nicht beitragen kannst, denn du wurdest schlecht behandelt. Und da ist noch etwas: der Schattenschmerz, wie er ihn nennt, weil er den richtigen Namen nicht aussprechen kann. Es zu benennen würde ihm nur Ärger einbringen, würde hohe Wellen schlagen und noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Sache lenken. Als bekäme sie nicht schon genug davon. Einmal hat er versucht, Simone zu erklären, wie Katie mit ihm spricht. Wie mit einem Schwachkopf. „So redet sie mit niemandem sonst, nur mit mir.“ Simones Antwort: „Wallace, mach nicht so ein Drama. Dahinter steckt kein Rassismus. Du musst einfach nur aufholen und dich noch mehr anstrengen.“
Das Unfairste daran ist, denkt Wallace, dass Weiße alles, was man als rassistisch kritisiert, sofort gegen das Licht halten und es prüfen. Als bezweifelten sie, dass man die Wahrheit sagt, als könnten sie an der bloßen Form einer Aussage erkennen, ob sie rassistisch ist oder nicht. Und natürlich vertrauen sie ihrem eigenen Urteilsvermögen bedingungslos. Das ist unfair, weil Weiße ein persönliches Interesse daran haben, Rassismus herunterzuspielen – sein Ausmaß, seine Intensität, seine Form und seine Folgen. Sie sind der Fuchs im Hühnerstall.
Wallace hat sich angewöhnt, in solchen Situationen zu schweigen. Seine Lektion hat er im dritten Jahr gelernt, als Simone ihn nach bestandener Vorprüfung zur Nachbesprechung in ihr Büro bat. Sie saß mit übergeschlagenen Beinen am Schreibtisch, hinter dem Fenster erstreckte sich der schöne Wintertag licht und makellos bis an den blauweißen Strudel des Sees, und die Bäume am Ufer wirkten wie filigrane Schnitzereien in einem Diorama. Er fühlte sich gut in seiner Haut. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft hier hatte er den Eindruck zu erfüllen, was Simone von ihm verlangte, er hatte aufgeholt und bildete sich ein, Stolz in ihren Augen zu sehen. Er war aufgeregt. Er war bereit, sich von nun an richtig ins Zeug zu legen. „Was meinst du, wie es gelaufen ist?“, fragte sie. Und er antwortete: „Ach, ganz okay, glaube ich.“ Doch da schüttelte sie grimmig den Kopf und sagte: „Weißt du, Wallace … Ehrlich gesagt habe ich mich für dich geschämt. Wäre heute ein anderer an deiner Stelle gewesen, wäre er nicht so glimpflich davongekommen. Ein anderer hätte nicht bestanden. Aber wir haben lange darüber diskutiert, was für dich angesichts deiner Möglichkeiten machbar ist, und wir haben beschlossen, dich nicht durchfallen zu lassen. Wir werden dich trotzdem beobachten, Wallace. Es reicht. Du musst endlich besser werden.“ Sie klang, als spendete sie ihm gerade den Segen, als erweise sie ihm eine große Gnade. Es war, als wollte sie ihn retten. Was sollte er dazu noch sagen? Was hätte er tun können?
Nichts. Außer zu arbeiten.
Und jetzt wendet sich die Arbeit gegen ihn. Die anderen empfinden seinen Einsatz als Beleidigung. Dana hasst ihn, weil er arbeitet, dabei arbeitet er nur, damit die Menschen ihn nicht hassen und ihm einen Platz in der Welt einräumen. Er arbeitet, um mit dem, was er mitbringt, irgendwie zurechtzukommen. Aber nichts davon wird ihn retten, das sieht er jetzt ein. Nichts davon könnte ihn jemals retten.
Wallace langt hinüber und dreht die Flamme ab. Für einen kurzen Moment fürchtet er, dass er den Griff zu fest gepackt und abgebrochen hat, dass der Raum sich mit Gas füllt. Aber der Griff ist stabil. Wallace dreht sich noch einmal zu der keuchenden, unglücklichen Dana um. Ihr Gesicht ist immer noch gerötet, ihre Augen glänzen. Er geht auf sie zu, bis er ihre Schuhsohlen an den Oberschenkeln spürt.
Er empfindet keinen Hass. Er hasst sie nicht, dafür bedeutet sie ihm zu wenig. Genauso gut könnte man ein Kind hassen. In dem Fall wäre er nicht besser als seine Eltern, die ihn gehasst haben, auf ihre Weise. So möchte er niemals werden. Doch gut und großzügig zu sein, das schafft er genauso wenig.
„Fick dich, Dana“, sagt er schließlich, und es fühlt sich so befreiend an, dass er ihr für die Gelegenheit dankbar ist. „Fick dich einfach.“ Er spürt einen Windzug, der ihm neuen Auftrieb gibt, und zieht die Schlägertasche aus dem unteren Fach. Dana starrt ihn an, als hätte er sie geschlagen.
Er richtet sich auf, sie wechseln einen letzten Blick. Dana sieht aus, als wollte sie etwas sagen, aber er dreht sich um und geht, mitten durch das blaue Halbdunkel des Labors. Seine Schritte lösen die Bewegungsmelder nicht aus, gerade so, als wäre er ein Teil der Einrichtung oder ein Geist.
Dana ruft ihm nach, sie sei noch nicht fertig mit ihm, er könne das Gespräch nicht einfach so beenden, sie wolle auch noch ihre Meinung sagen. Sie brüllt, weil sie nicht weiß, wohin mit ihrer Angst und ihrem Zorn, ihre Schreie verwandeln sich in Schluchzer. Aber da ist Wallace schon durch die Tür.
Das Licht im Korridor schlägt ihm grell und gleißend entgegen. Wallace’ Schritte hallen von den Wänden wider, sein Schritt ist fest. Immer schon hatte er einen schweren Gang. Seine Mutter hat sich deswegen über ihn lustig gemacht: „Du bist so ein Trampel, nie schaust du nach unten.“ Jetzt schon. Er sieht seinen Schatten über die Kacheln fliegen, eilt an der Teeküche und an Millers Labor vorbei.
„Hey“, ruft Miller, doch Wallace bleibt nicht stehen. Er hört Millers Schritte hinter sich, was ihn nur anspornt, noch schneller zu gehen, vorbei an den Plakaten mit Experimenten und den Flyern mit Jobangeboten, vorbei an den obligatorischen Schwarzen Brettern mit Karikaturen und dummen Sprüchen, an einer langen Reihe von Schließfächern, wo die Studierenden irgendwann in den Achtzigern ihre Sachen aufbewahrt haben. Er geht so schnell, dass immer nur ein Fuß den Boden berührt. Als Miller ihn einholt, hat er die Treppe mit Blick ins Atrium erreicht.
„Was ist denn los?“ Miller betont jedes einzelne Wort gleich.
„Angeblich bin ich ein Frauenhasser“, antwortet Wallace.
„Wie bitte? Quatsch. Hat da jemand geschrien?“ Millers Blick ist freundlich und besorgt. Er legt Wallace eine Hand auf den Arm, und es fühlt sich an wie eben in der Teeküche. Wallace spürt, dass er am ganzen Leib zittert, aber er weiß nicht, ob vor Wut oder vor Angst.
„Da war nichts“, sagt er.
„Tu das nicht.“
„Was? Die Wahrheit sagen? Da war nichts!“
„Das stimmt ganz offensichtlich nicht.“
„Es ist nicht dein Problem“, sagt Wallace und macht sich von Miller los. „Ich habe alles im Griff.“
Plötzlich wirkt Miller ungeduldig. Er streckt die Hand aus, Wallace weicht zurück.
„Komm schon.“
„Nein. Es geht mir gut.“
„Das stimmt nicht.“ Miller ergreift seine Hand und zieht ihn in die Bibliothek im zweiten Stock, wo es kleine Leseräume mit abschließbaren Türen gibt. Miller wartet, bis Wallace sich auf den Tisch gesetzt hat, und schiebt sich dann zwischen seine Beine. Nun gibt es kein Entkommen. Der Geruch von Staub und Whiteboard-Markern hängt in der Luft, der Teppich ist scheußlich violett. Miller riecht nach seinem Shampoo, nach Seife. Sein Auge ist immer noch geschwollen von den Nachos und den Jalapeños am Vorabend.
„Ich bin sauer“, setzt Wallace an, als er verstanden hat, dass Miller nichts sagen und das Gespräch nicht beginnen wird. Er hält nur die Arme vor der Brust verschränkt und sieht Wallace geduldig an.
„Das sehe ich.“
„Sie hat behauptet, Frauen wären die Nigger und Schwuchteln von heute.“
„Was soll das heißen?“
„Sie hasst mich.“
„Klingt danach.“
„Weißt du, du bist mir keine große Hilfe.“
„Tut mir leid, dass es so schlimm ist“, sagt Miller und küsst Wallace sanft auf den Mund. „Wirklich.“
„Hör auf, so nett zu mir zu sein. Bis vor Kurzem hast du mich auch gehasst, weißt du noch?“
„Ich habe dich nicht gehasst, ich habe dich bloß nicht verstanden. Ich verstehe dich immer noch nicht, aber ich habe dich nie gehasst“, erklärt Miller. Wie seltsam, denkt Wallace. Was für eine eigenartige Wortwahl. Er kann Miller nicht ins Gesicht sehen, fühlt sich ihm seltsam ausgeliefert. Der gelbe Tisch aus laminiertem Sperrholz ist wackelig, und Wallace will aufstehen, doch Miller rührt sich nicht. Wallace zupft am Bündchen seines grauen Sweatshirts.
„Ich hasse dich. Sehr sogar.“
„Ich weiß“, sagt Miller. „Fühlst du dich jetzt besser?“
„Nein“, erwidert er, und dann zuckt er mit den Achseln. „Na ja, ein bisschen vielleicht.“
„Gut.“ Noch ein Kuss und noch einer, und dann schiebt Wallace die Finger in Millers Haar, und Miller beißt ihn sanft in den Hals. Der Tisch knarrt, während Wallace nach vorn an die Kante rutscht und wieder zurück, vor und zurück.
„Mach mir bitte keinen Knutschfleck. Ich habe keine Lust, das irgendwem zu erklären.“
„O Mist, das habe ich ganz vergessen“, sagt Miller.
„Tja. Willkommen in meinem Leben.“ Wallace drückt sich von Millers Brust ab, und Miller erinnert sich, wo und wer sie sind. Er tritt einen Schritt zurück.
„Tut mir leid, Wallace. Dass du dir so was anhören musst.“
„Ist schon okay. Weißt du, jeder hat sein Päckchen zu tragen.“
„Ja, aber du … du gehörst für mich zur Familie, und es macht mich traurig, dass du das aushalten musst.“
„Danke“, sagt Wallace und ist ganz gerührt, dass jemand ihn so wichtig nimmt, so zärtlich an ihn denkt.
„Dann gehst du jetzt zum Tennis?“
„Ich bin verabredet.“
Sie wissen nicht, was sie miteinander anfangen sollen, außer das Naheliegende, was sich in diesem Moment aber verbietet. Also küsst Wallace Miller auf die Wange. Miller errötet.
„Ich muss los.“
„Okay.“
Wallace geht die Treppe hinunter, und als er noch einmal den Kopf hebt, sieht er Miller oben am Geländer stehen. Er muss wieder an die Vögel denken, an ihre Sicht auf sie und wie alles unter ihnen, die ganze große Welt, platt und klein erscheinen muss. Wie sieht Miller ihn jetzt in diesem Augenblick, verzerrt durch die Entfernung und das Licht aus den Deckenfenstern des Atriums, halb im Schatten und halb im Licht? Von unten betrachtet wirkt Miller gestaucht. Er hebt die Hand und winkt, Wallace winkt zurück.
„Ruf mich an“, ruft Miller.
„Mach ich.“ Die Antwort auf die Frage von eben, als er Miller in der Teeküche sitzen ließ und insgeheim erwog, ob gestern Nacht vielleicht alles war, was er brauchte, lautet: nein. Das weiß er jetzt ganz sicher. Immer weiter steigt er die Stufen hinunter, und Miller entfernt sich stetig. Er steht immer höher über ihm. Gleich kommt der Moment, da er Millers Blick kreuzt und sie einander erneut nahe sind, denn wenn jemand von noch weiter oben auf sie herunterschauen würde, wären sie identisch, der eine deckungsgleich mit dem anderen.
Doch es macht einen Unterschied, ob man in einen anderen eindringt und in ihm ist oder nur daneben. Es ist unmöglich, gleichzeitig in und neben jemandem zu existieren. Wenn man ihm nahe genug kommt, hört man auf, zwei getrennte Wesen zu sein. Und verschmilzt zu einer glatten Oberfläche, die in der Sonne schimmert.
„Ich meine es ernst“, ruft Miller, und seine Stimme weht herunter. „Ruf mich an, oder schreib mir.“
„Wird gemacht, Dad“, ruft Wallace und geht lachend ein paar Schritte rückwärts.
„Lass das.“
„Okay, Dad.“
„Wallace!“
„Bye.“
„Bye.“
Ihre Stimmen sind ein Zwillingsecho, das sich entzweit und verhallt oder das in sich kollabiert, bis seine Energie verbraucht ist und nichts bleibt als Schweigen. So oder so ist Wallace jetzt weg, und Miller auch, und im Atrium ist es warm und still.
Nur die Rüttler schlagen, schlagen, schlagen immer weiter.





















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.