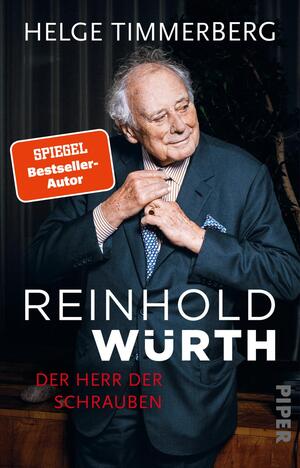
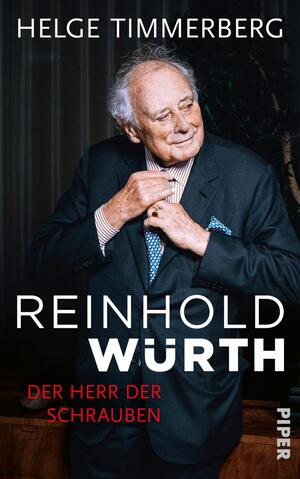
Reinhold Würth Reinhold Würth - eBook-Ausgabe
Der Herr der Schrauben
— Die inspirerende Biografie eines der größten deutschen UnternehmerReinhold Würth — Inhalt
Der Selfmade-Mann, der ein Milliardenunternehmen aufbaute
Als sein Vater verstarb, da war er gerade neunzehn. Reinhold Würth übernahm die elterliche Schraubenhandlung und zeigte es allen: Künzelsau wurde zum Sitz eines Weltkonzerns.
„Schrauben braucht jeder.“ - Die brillant geschriebene Biografie eines der größten deutschen Unternehmer
Wer ist dieser Mann, der durch Schrauben reich wurde und als vielleicht letzter Patriarch Deutschlands alle Entscheidungen in seinem Unternehmen kontrolliert bis ins letzte Detail? Wie waren seine Anfänge? Welche Rolle spielt seine Familie? Helge Timmerberg begibt sich auf Spurensuche – und taucht tief ein in eine unglaubliche Geschichte von Macht und Milliarden …
„Helge Timmerberg erzählt auf eine innige, fast zärtliche Weise vom Werden und Werk eines Mannes, der eines der größten Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit vollbracht, sich selbst zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat und bei alledem doch stets ein feiner Kerl geblieben ist.“ ― Die Welt
- Erfolgsstrategien eines Unternehmers: Lernen Sie, wie Reinhold Würth den Grundstein für ein globales Imperium legte.
- Inspirierende Lebensgeschichte: Eine Biografie, die Mut macht und zeigt, dass Erfolg mit Vision und harter Arbeit erreichbar ist.
- Kunst und Unternehmertum: Erfahren Sie mehr über Würths kulturelles Engagement und seine Rolle als Kunstmäzen.
- Motivierender Schreibstil: Helge Timmerberg begeistert mit einem lebendigen, fesselnden Ton, der das Lesen zum Vergnügen macht.
Ein Buch für alle, die sich für Erfolgsgeschichten, Unternehmensführung, Motivationsbücher und die Lebenswege berühmter Persönlichkeiten interessieren.
Leseprobe zu „Reinhold Würth“
Am Anfang war die Schraube
Am Anfang war die Schraube. Dann kam der Krieg. Und als der Krieg zu Ende war, was brauchte man da? Für seinen Vater war das keine Frage, für seine Mutter auch nicht. Die Meinungsverschiedenheiten seiner Eltern betrafen die grundsätzliche Einstellung zur Schraube. Dreht man sie als Angestellter oder als Chef? Zu diesem Zeitpunkt war Reinhold Würth zehn Jahre alt und trug eine kurze Lederhose. Sein kleiner Bruder lag noch im Kinderwagen, ihr eigenes Heim in Künzelsau hatten sie gerade eben an die Amerikaner verloren, sie waren [...]
Am Anfang war die Schraube
Am Anfang war die Schraube. Dann kam der Krieg. Und als der Krieg zu Ende war, was brauchte man da? Für seinen Vater war das keine Frage, für seine Mutter auch nicht. Die Meinungsverschiedenheiten seiner Eltern betrafen die grundsätzliche Einstellung zur Schraube. Dreht man sie als Angestellter oder als Chef? Zu diesem Zeitpunkt war Reinhold Würth zehn Jahre alt und trug eine kurze Lederhose. Sein kleiner Bruder lag noch im Kinderwagen, ihr eigenes Heim in Künzelsau hatten sie gerade eben an die Amerikaner verloren, sie waren bei Freunden evakuiert. Die Wohnungsübergabe war ungeordnet verlaufen. Zuerst hatte Reinhold Würth einen Gewehrlauf gesehen, dann einen Helm und schließlich den ersten Afroamerikaner seines Lebens, der die Englischkenntnisse des Jungen testete: „Out, out, out!“
Danach musste es ja irgendwie weitergehen. Sein Vater plädierte für die Wiederaufnahme seines Angestelltenverhältnisses beim Schraubengroßhandel Reisser, sobald es die Besatzungsmächte erlaubten. Adolf Würth hatte es dort vor dem Krieg bis zum Prokuristen gebracht. Das war nicht schlecht für einen 34-Jährigen, und seine Frau gab ihm recht. Nicht schlecht ist nicht schlecht, aber ist es auch gut?
Gut ist ein selbstbestimmtes Leben. Gut ist, morgens im Spiegel einen Mann zu sehen, der ein risikofreudiges Gesicht rasiert. Die Spiegelbilder derer, die auf Nummer sicher gehen, schauen einen anders an. Adolf Würth hatte alles, was ein Unternehmer braucht. Er konnte gut mit Zahlen, er konnte gut mit Menschen, und er hatte einen exzellenten Ruf in seiner Branche. Aber er war auch ein Genießer und neigte zur Gemütlichkeit. So ein Mann wiegt sich gern in Sicherheit.
Von der nichts mehr vorhanden war. 282 britische Lancaster-Flieger hatten am 4.12.1944 1260,8 Tonnen Bomben auf Heilbronn geworfen. Waldenburg, wo sich die SS verschanzt hatte, wurde von den B52-Bombern der Amerikaner dem Boden gleichgemacht. Jagdflieger der Alliierten hatten Künzelsau beschossen und anscheinend auch über den Wiesen und Feldern Hohenlohes gejagt, denn tote Pferde lagen hier und da, außerdem zersiebte Kühe – der April 1945 war kein schöner Anblick, und der Krieg war verloren.
Aber auch zu Ende, und das war die gute Nachricht. Nach jedem Ende kommt ein Anfang. Und jedem Anfang wohnt eine Schraube inne, die uns hilft, Hohenlohe wieder aufzubauen. So in etwa argumentierte Alma Würth. Man brauchte Schrauben, Schrauben und nochmals Schrauben – sonst nichts, außer ein bisschen Mut vielleicht, denn welcher Zeitpunkt wäre besser für den Schritt in ein neues, selbstständiges Unternehmerleben als die Tage, in denen niemand mehr etwas hat und alle wieder von vorn beginnen?
Alma Würth war keine Tochter Baden-Württembergs, sie kam aus Schleswig-Holstein, also von der Waterkant, und da herrscht ein anderer Wind als in dem milden Klima des Südwestens. Sie war energischer, konsequenter und vielleicht auch mutiger als ihr Mann, und sie war sich sicher, dass es klappen konnte. Noch bevor sie die Großeltern erreichte, war die Sache entschieden: Adolf Würth wird Chef.
Großvaters gezirkelter Kaiser-Wilhelm-Bart hielt die Stellung in Krieg und Frieden. Der Schnauzer war zu beiden Seiten horizontal nach außen gezwirbelt und an seinem Ende mit einer Locke verziert. Solange Großvaters Bart besteht, wird auf seiner Wiese das nasse Gras in großen Schwüngen mit der Sense gemäht und in seinen Geschäftsbüchern jeder Pfennig, der eingenommen oder ausgegeben wird, mit einer Schrift notiert, die schön ist, ohne verspielt zu sein, und gleichzeitig so korrekt wie der prächtige Bart in seinem Gesicht. Weil er mit seinem Bauernhof, seiner Weingärtnerei und einer kleinen Weinwirtschaft immer selbstständig gewesen war, unterstützte er das Aufbegehren seines Sohnes gegen die Enge des Angestelltendaseins. „Tue recht und scheue niemand“, sagte er zu ihm, und das wird auch sein Enkel nie mehr vergessen. Auch das Dachkämmerle nicht und die riesige Daunendecke mit der Wärmflasche im Bett, sie hatte immer Reinhold Würths Träume beschützt. Und stets kam die Großmutter am nächsten Morgen mit einer großen Tasse Milch und einem Brot, dick mit Butter bestrichen und mit Käse belegt.
Reinhold Würth wird später in seinem Leben oft darüber sprechen, dass er sich als Glied in der Kette seiner Ahnen versteht. Und nie wurde sein Urvertrauen in die Familie gebrochen. Selbst der Welterfolg seiner Schrauben hat mit seinem Großvater begonnen, denn der war es, der seinen Vater in die Lehre zu einem Schraubengroßhändler geschickt hatte und nun auch dabei beriet, wie man seinen eigenen Laden aufmacht – den Reinhold Würth zehn Jahre später übernehmen wird. Die Schraube rollt durch diese Familie, und sie lässt sich, Gott allein weiß warum, nicht stoppen.
Am 16. Juli 1945 nimmt die Schraubengroßhandlung Adolf Würth in einem Nebengebäude der alten Schlossmühle von Künzelsau ihren Betrieb auf. Das Lager: rund 170 Quadratmeter, das Büro: 15 Quadratmeter, wenn’s hochkommt. Personal: ein Angestellter, der aber gleichzeitig noch Herbergsvater in einer Jugendherberge ist, der Fuhrpark: ein Handleiterwagen, eine Sackkarre und ein Ochsenfuhrwerk. Es sind 17 Kilometer bis zur Schraubenfabrik L. & C. Arnold in Ernsbach. Züge fahren nicht mehr, denn die Brücken sind gesprengt. Irgendwas Motorisiertes hat weder die eine noch die andere Firma, also muss das liebe Vieh ran, bis es in Künzelsau endlich gelingt, einen alten Lkw wieder fahrbereit zu machen. Allerdings anders als vorher: Kein Benzin, kein Diesel, sondern Holzgas treibt ihn an. Der Kessel mit dem Generator qualmt hinter dem Führerhäuschen, zum „Tanken“ wird Holz nachgeschoben, das in Säcken mitgeführt wird. Höchstgeschwindigkeit: 25 Stundenkilometer. Notbremse: Zwei meißelähnliche Eisendorne an der Hinterachse können herabgelassen werden, die sich in die Straßendecke verkrallen. So rollten in den Pioniertagen der Firma Würth die Schrauben in die Schlossmühle. Im Lager stand in der Mitte zwischen den Regalen ein großer Tisch mit gedrechselten Beinen und darauf eine Küchenwaage mit zwei Schalen. In einem Eimer unter dem Tisch befand sich die eingegangene Ware. Mit einem Milchtopf wurden die Schrauben aus dem Eimer auf den Tisch geschöpft, wo sie gezählt, gewogen und abgepackt wurden. Bis zu 100 Schrauben wurden grundsätzlich mit der Hand gezählt und dann entsprechend ihrem Gewicht zu 500 oder 1000 Stück multipliziert. Von wem? Nun, in einem Familienbetrieb macht so etwas die Familie.
Der große indische Musiker Ravi Shankar sagte einmal, dass jeder, der es zur Meisterschaft an der Sitar bringen will, im Alter von sechs oder sieben Jahren mit dem Üben anfangen muss. Dasselbe gelte für die Tablas und jedes andere klassische Instrument des Subkontinents. In Europa saß Mozart noch früher am Klavier, Beethoven auch. Beide waren schon mit sechs Jahren konzertfähig. Beim Sport gilt dasselbe. Studiert man die Lebensläufe von Weltmeistern, egal welcher Disziplin, wird man feststellen, dass fast alle bereits als Kind begannen, professionell zu trainieren. Und früh übt sich natürlich auch, was später ein Milliardär werden soll. Reinhold Würth begann mit zehn Jahren. Die Schule öffnete zwar im Herbst 1945 wieder ihre Pforten, sogar mit einer extrem hübschen Lehrerin namens Fräulein Göltenbot, die höchstens 19 Jahre alt war, aber fürs Leben lernte er zu Hause. Er half bei praktisch allem, was die Schraube verlangte, doch Kinderarbeit würde er das später niemals nennen – dafür machte es ihm zu viel Spaß, mit den Ochsen oder dem Holzgas-Lastwagen die Schrauben zu holen, mit der Mutter die Schrauben zu zählen und mit dem Tischler die Regale für die Schrauben zu bauen. Am liebsten aber ging er mit dem Vater die Schrauben verkaufen. Erst zu Fuß bei den Handwerkern in Künzelsau und Umgebung, und als die Eisenbahnen wieder nach Schwäbisch Hall und Heilbronn fuhren und der Postbus endlich wieder das gesamte Kreisgebiet erschloss, ging es weiter in die Ferne, allerdings so weit nun auch wieder nicht, weil die Siegermächte ihre Besatzungszonen wie eigenständige, autonome Wirtschaftsgebiete organisierten und Handel und Wandel über ihre Grenzen hinaus verboten. Trotz der beengten Verhältnisse entdeckte Reinhold Würth während dieser Touren die Leidenschaft seines Lebens. Oder besser: Er entdeckte gleich zwei. Das Verkaufen und das Reisen. Und glücklich ist, wer nie vergisst, dass beides zusammengehört.
1947 vereinigten Amerikaner und Briten ihre Zonen zu einem Wirtschaftsgebiet, und nun reisten Vater und Sohn bereits ins Sauerland und nach Westfalen, um mit den dort ansässigen Schraubenfabrikanten ins Geschäft zu kommen. Denn Gewinne, das ist klar, macht man am leichtesten beim Einkauf. Probleme gab’s nur beim Bezahlen. Nicht weil kein Geld da war – im Gegenteil, es gab jede Menge, aber es war nichts wert. Die Inflation hatte aus einer Mark einen Pfennig gemacht. Niemand wollte einen Sack voller Scheine für ein Pfund Schrauben. Aber Zigarren nahm man natürlich gern.
Adolf Würth war ohne Zigarre kaum vorstellbar. Es schien, als sei er mit ihr geboren. Es gibt kein Foto von ihm ohne Zigarre, selbst ins Bad nahm er sie mit, und auch beim Schwimmen blieb sie zwischen seinen Lippen. Was für den Großvater der Kaiser-Wilhelm-Bart war, das war für ihn die Zigarre. Nicht angewachsen, nur angesaugt, balancierte sie Gewinne und Verluste aus, Kältewelle und Hungersnot, Leben und Tod. Solange ich rauche, bin ich. Es gab keinen Adolf Würth ohne Zigarre, und sie stand ihm auch sehr gut. Sie passte zu seinem Gesicht mit den lebensfrohen Wangen und der hohen Stirn, und in seiner Hand wurde sie zum Dirigentenstab. Natürlich hatte so ein Mann exzellente Quellen für den Nachschub, und sein Sohn brachte die Zigarren mit dem Fahrrad zur Schraubenfabrik nach Ernsbach, deren Direktor Ruhnau sich jedes Mal sehr darüber freute, weil auch er ein fanatischer Zigarrenraucher war. Sie war der Trost aller Unternehmer. Und ihr Ansporn. Wenn die Zigarre raucht, dann raucht auch der Schornstein.
Tauschhandel statt Geldverkehr war illegal, aber in den Zeiten, in denen vieles illegal ist, fällt das unter zivilen Ungehorsam; außerdem wurden Feinde zu Freunden. Den Kindern schenkten die Amerikaner Schokolade, den jungen Damen Nylonstrümpfe und Deutschland den Marshallplan. Am 20. Juli 1948 wurde Reinhold Würth von seinen Eltern zur Volksbank geschickt, um das Beste davon abzuholen. Längliche Scheine, ein ähnliches Format wie die Dollarnote, in Blaugrau-Lila gehalten und mit kleinen Farbtupfern versehen. Die D-Mark war da.
Und Ludwig Erhard war da. Er ging später als Vater des Wirtschaftswunders in die Geschichte ein, und jetzt fing er damit an. Er war der deutsche Bundesminister für Wirtschaft in der Bizone und entschied, ohne die Alliierten zu fragen, dass von Stund an Schluss war mit der Rationierung der meisten Gebrauchsgüter. 4000 Artikel, für die man bis dato Bezugsscheine brauchte, waren wieder frei. Und was kauften die Deutschen? Zunächst einmal alles, was plötzlich wieder in den Schaufenstern lag, denn die trostlose Leere der vergangenen Jahre war wie von Zauberhand der Fülle gewichen. Und nachdem das erledigt war, was kauften sie dann?
Das Auto war da. Bis Ende 1949 waren es 365455 Pkws, ein Jahr später verdoppelte sich die Zahl, und zählt man die Lkws und Motorräder dazu, rollten die Deutschen frohgemut mit über zwei Millionen Kraftfahrzeugen in die Fünfzigerjahre. Und immer rollten die Schrauben mit. Blechschrauben, verchromte Gewindeschrauben aus Messing, Nummernschildschrauben und Messingrosetten wurden jetzt gebraucht. Adolf Würth setzte voll auf den neuen Wachstumsmarkt, und das war eine seiner größten unternehmerischen Taten, weil sie die Weichen für den späteren Welterfolg der Firma stellte. Die andere: Er nahm seinen Sohn von der Schule. Adolf Würth wusste um seinen Herzfehler, aber er wusste nicht, wie viel Zeit ihm noch blieb. Er wollte aus seinem Sohn so schnell wie möglich einen Unternehmer machen, der auch ohne ihn klarkommen würde. Er wollte die Schraube weitergeben.
Mit vierzehn begann Reinhold Würth seine offizielle Ausbildung im väterlichen Betrieb, die sich von der inoffiziellen nur darin unterschied, dass er jetzt auch schon vormittags mit den Schrauben seinen Spaß hatte und außerdem nun seinen Vater jederzeit auf dessen Reisen begleiten konnte. 1950 schafften sich die Würths ihr erstes Auto an. Einen gebrauchten Opel Olympia, Baujahr 1937, grau, mit roten Felgen. Der Starter befand sich am Boden, neben dem Gaspedal konnte man auf die Straße durchschauen, und eine Heizung gab es nicht. Weil Adolf Würth sich entschieden dagegen wehrte, eine Fahrschule zu besuchen, musste seine Frau den Führerschein machen und ihn chauffieren. Alma am Steuer, Adolf an der Zigarre und die beiden Buben auf dem Rücksitz, so ging es am ersten Tag an Heidelberg vorbei bis Hannoversch Münden. Am nächsten Tag rollte die würthsche Schrauben-Offensive bereits in die norddeutsche Tiefebene ein, mit Hamburg als Ziel. Das Tor zur Welt. Und die Stadt mit der größten Dichte an Autowerkstätten. Gut fürs Geschäft, aber auch gut für die eigene Karre, denn sie erwies sich als extrem reparaturanfällig.
Von außen sah der Opel Olympia jedoch verdammt gut aus – und noch besser, wenn sich das Ehepaar Würth dazustellte. Ein schönes Paar und hocheffizient. Er wusste, wie man mit Kunden redet, und sie fuhr ihn hin. Sie war die treibende Kraft, sie lenkte nicht nur den Opel, sondern auch ihn. Gottgewollt, das Ganze. Sie hatten sich in einer Kirche kennengelernt. Sie im Chor, er in den Bänken. Damals, als Adolf Würth noch für die Firma Reisser arbeitete und auf einer Dienstreise in Schleswig-Holstein war, hatte er als braver Christ den Gottesdienst der Kneipe vorgezogen und war dafür mit Alma belohnt worden. Guter Mann, glücklicher Mann, aber die Uhr tickte.
1951 übernahm sein Sohn das Steuer im Opel. Eigentlich war er zu jung, aber weil sein Vater glaubhaft versichern konnte, dass es sich um eine familienbetriebliche Notwendigkeit handelte, bekam er die Ausnahmegenehmigung für den Führerschein schon mit sechzehn. Nun ging das Reisen erst richtig los. Im Inland, aber auch ins Ausland. In die Schweiz, nach Bern, Aarau und Huttwil, um den eidgenössischen Karosseriebauern verchromte Gewindeschrauben aus Messing zu verkaufen. Auf diesen Touren lernte Reinhold Würth so schnell und so viel, dass er bereits im selben Jahr mit immer noch 16 Jahren von seinem Vater auch allein losgeschickt wurde.
Es war im Hochsommer, als er in Sulzbach, südwestlich von Schwäbisch Hall, bei der Firma Mulfinger zwar ordentlich Schrauben verkaufen konnte, aber irgendwas schien trotzdem nicht in Ordnung zu sein. Denn der Kunde musterte ihn ein bisschen amüsiert, ein bisschen ungläubig und auch ein bisschen misstrauisch, von oben bis unten, weil der Juniorverkäufer der Firma Würth kurze lederne Seppelhosen und Kniestrümpfe trug …
In Düsseldorf war er dann schon im Anzug unterwegs. Seine Mutter hatte ihn ausgesucht, sie hatte in der Familie den besten Geschmack. Ein Zweireiher mit Nadelstreifen und breitem Revers. „Bis 25 Grad Innentemperatur“, sagte sie, „bleibt die Krawatte fest gebunden, ab 26 Grad darfst du sie lockern und den obersten Hemdknopf öffnen.“ In Düsseldorf war das nicht nötig. Ende Januar 1952 kam Reinhold Würth mit dem Zug in die Stadt, suchte sich über die Zimmervermittlung eine Bleibe und stapfte dann in seiner fabelhaften Garderobe vierzehn Tage durch den Schneematsch. Wieder lernte er etwas fürs Leben. Die Straßen in Großstädten sind manchmal länger als die in Künzelsau. Und nicht immer sind auf diesen Straßen die geraden Hausnummern auf der einen Seite und die ungeraden auf der anderen. Trotzdem fand er ein paar VW-Händler, die ihm genügend Aufträge über Nummernschildschrauben für ihre Käfer und Bullis gaben, um stolz nach Haus zurückkehren zu können. Doch sein Vater war offensichtlich kein Mann, der gerne Loblieder sang. „Na ja“, sagte er, als er das ansehnliche Bündel von Aufträgen in die Hand gedrückt bekam, „so besonders ist das ja nicht.“ Erst Jahre später erzählt Reinhold Würths Mutter, dass ihr Mann damals schmunzelnd zu ihr in die Küche gekommen sei: „Das ist gar nicht so schlecht, was der Kerle da gemacht hat.“
Beide Erlebnisse, das Seppelhosen-Desaster in Sulzbach sowie seine Enttäuschung über die mangelnde Anerkennung seines Erfolgs in Düsseldorf, haben bis heute im Konzern Spuren hinterlassen. Das eine führte zu einem legendär konservativen Dresscode, das andere machte „danke“ zum wichtigsten Wort der Unternehmenskultur.
Pakete allerdings werden mittlerweile anders gepackt, als es Reinhold Würth von seinem Vater gelernt hat. Zuerst kommt das Packpapier auf den Tisch, dann die Wellpappe und darauf die Schraubenpakete, zu Würfeln aufgebaut. Die Wellpappe wird umgeschlagen und seitlich mit Triangeln verschlossen. Das Packpapier kommt drum herum, das Ganze wird mit Schnur verzurrt und mit einem fünffachen Knoten gesichert, damit später das Ende nicht durchrutschen kann. Reinhold Würth hätte mit dieser Methode jedes Paket-Wettpacken gewinnen können, aber am Dienstag, dem 14. Dezember 1954, war er langsamer als gewöhnlich, denn eine Unruhe lenkte ihn ab, die er sich nicht erklären konnte. Er rief zu Hause an. Niemand ging ans Telefon. Es war eine Hausverbindung. Man musste nur ein Mal an der Scheibe drehen, um den Klingelton in der Wohnung auszulösen. Immer wieder drehte er die Scheibe, wieder und wieder.
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Menschen spüren, wenn der Vater oder die Mutter stirbt. Warum, weiß man nicht. Gibt es eine unsichtbare Nabelschnur, die nur der Tod durchschneiden kann? Adolf Würth hatte einen Herzfehler, der jederzeit gefährlich werden konnte, aber ansonsten erfreute er sich guter Gesundheit, war nicht krank oder schwach gewesen in diesen Wochen und Monaten. Noch am Vormittag waren die beiden durch die Gegend gefahren, um Kunden zu besuchen; zurück in Künzelsau, hatten sie sich getrennt, Adolf Würth wollte zu Hause Schriftverkehr erledigen, sein Sohn im Lager arbeiten. Stattdessen drehte er die Scheibe am Telefon mit wachsender Nervosität, bis schließlich seine Mutter zurückrief und sagte, er solle ganz schnell kommen, der Vater sei auf der Toilette zusammengesunken.
Plötzlicher Herztod, eine Katastrophe für die Familie. Und den Betrieb. Aber wie das immer so ist: In den ersten Minuten, Stunden und Tagen reagiert man wie gelähmt, das Bewusstsein weigert sich, die Tragweite des Verlustes zu begreifen. Erst bei der Beerdigung erkennt es in der Regel wieder die Realität. Ein Loch in der Erde verschluckte den wichtigsten Menschen, den Reinhold Würth in seinem Leben hatte.
Reinhold Würth liebte seinen Vater so sehr, dass er, als er noch ein kleiner Junge war, für ihn eine kleine Wiege aus Sperrholz zugeschnitten, sie mit Linsenkopf-Holzschrauben aus Messing zusammengefügt und alle sichtbaren Teile mit filigran ausgesägten Löchern versehen hatte. Wie gesagt, eine kleine Wiege, gerade groß genug für Vaters Zigarren – das war sein Weihnachtsgeschenk 1943 gewesen. Reinhold Würth liebte seinen Vater so sehr, dass er ihn zehn Jahre später auch beim Binokel hatte gewinnen lassen: ein in Schwaben populäres Kartenspiel, bei dem zur Hälfte das Kartenglück und zur Hälfte die Intelligenz entscheidet. Der Sohn hatte immer wieder gewonnen, bis er freiwillig zu verlieren begann, aber der Vater bemerkte es und schimpfte darüber so laut, dass die Mutter die Karten einfach ins Feuer warf.
Vielleicht liebte Reinhold Würth seinen Vater auch deshalb so sehr, weil dessen Herzfehler ihn vor der Einberufung an die Front geschützt hatte. Er war nicht, wie so viele andere Väter, als gebrochener Mann aus dem Krieg zurückgekommen. Seine Seele war kein Trümmerhaufen, er konnte Vorbild bleiben, Vater, Freund und Bruder in einem.
Und nun verschluckte ihn das schwarze Loch da unten. Aber Adolf Würth hatte vom Schicksal einen gnädigen Tod geschenkt bekommen. Und er hatte es geschafft: Er hatte seinen Sohn alles lehren können und ihm die Schraube übergeben, denn als Reinhold Würth nach der Beerdigung und schon wieder außerhalb des Friedhofs von einem Geschäftsfreund des Vaters gefragt wurde, wie es denn nun mit dem Schraubenhandel weitergehen solle, antwortete er zu seiner eigenen Überraschung sehr konkret: „Ich werde ihn weiterführen.“









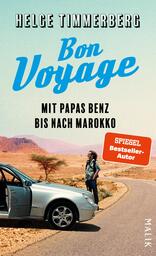




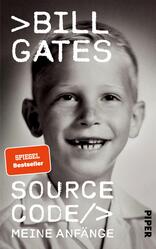
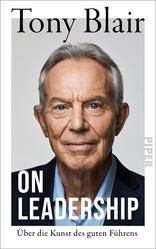

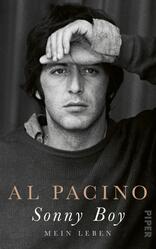





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.