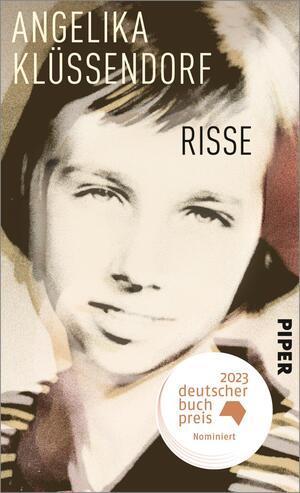
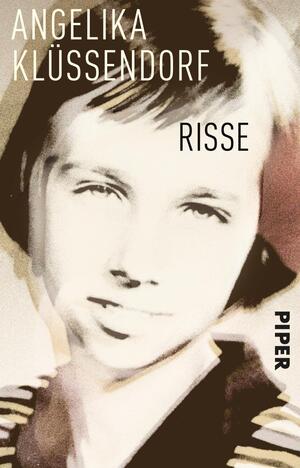
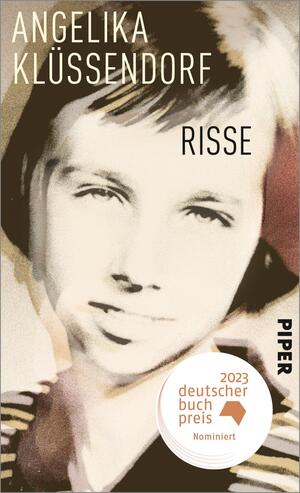
Risse Risse Risse - eBook-Ausgabe
»Der amerikanische Schriftsteller und Literaturprofessor George Saunders hat diese Poetik des ökonomischen Schreibens in seinem wundervollen Buch ›Bei Regen in einem Teich schwimmen‹ (deutsch 2022) an Hand russischer Meistererzählungen des 19. Jahrhunderts im Einzelnen erklärt. Den dort aufgezeigten Gesetzen und Möglichkeiten werden Klüssendorfs Geschichten in einer Weise gerecht, für die es in der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur wenig Parallelen gibt. Man kann, wenn man eine begonnen hat, nicht aufhören zu lesen, was durchaus auch mit ihren Stoffen zu tun hat, aber eben doch vor allem mit einer kunstvoll einfachen, zwingenden Schreibweise.« - Süddeutsche Zeitung
Risse — Inhalt
Das Mädchen und wie es die Welt sah
Das Mädchen ist zurück:In zehn Geschichten entfaltet Angelika Klüssendorf ein Kinderleben in der DDR in den 60ern und 70ern, geprägt von Ungeborgenheit und Sehnsucht. Nach dem Tod der geliebten Großmutter muss das Mädchen Übergriffen und Teilnahmslosigkeit begegnen. Es ringt darum, seine Eltern auszuhalten und zu verstehen und die Schwester zu beschützen. Lichtblicke liefern Bücher, das Lesen bietet selbst im Kinderheim noch einen Ausweg.
Die Kaschnitz-Preisträgerin erzählt die Vorgeschichten zum Erfolgsroman „Das Mädchen“ neu, die vor zwanzig Jahren erschienen und nicht mehr lieferbar sind. Und sie überprüft schonungslos, was nicht erzählt wurde und warum. Ist Wahrhaftigkeit im Erzählen von sich möglich?
Autofiktion, radikal und bewegend!
„Wenn ein Buch die Axt für das gefrorene Meer in uns sein muss, wie Kafka sagt, dann ist für mich eines davon „Risse“ von Angelika Klüssendorf. Warum? Weil sie ihren Figuren und uns eine Suche nach dem Abgrund in sich selbst zumutet - eine Suche, die schmerzt und Mitgefühl ermöglicht. Ich bewundere sie dafür.“Corinna Harfouch
Leseprobe zu „Risse“
Die Großmutter im Kirschbaum
Die junge Frau schloss das Fenster. Sie wollte nicht, dass die Nachbarn den Streit mitbekamen, sie wollte nicht schon wieder auf der Straße schief angeschaut werden, sie wollte so vieles nicht. Auf dem Boden lagen Glasscherben und entkernte Pflaumen in ihrem Saft. Die junge Frau nahm die mit Obst gefüllten Einweckgläser vom Küchentisch und versuchte, sie in Sicherheit zu bringen. Sie stellte sie in die Speisekammer, in der es kein Licht gab. Ihr Mann lehnte an der Wand und sah scheinbar unbeteiligt zu, wie sie die Gläser [...]
Die Großmutter im Kirschbaum
Die junge Frau schloss das Fenster. Sie wollte nicht, dass die Nachbarn den Streit mitbekamen, sie wollte nicht schon wieder auf der Straße schief angeschaut werden, sie wollte so vieles nicht. Auf dem Boden lagen Glasscherben und entkernte Pflaumen in ihrem Saft. Die junge Frau nahm die mit Obst gefüllten Einweckgläser vom Küchentisch und versuchte, sie in Sicherheit zu bringen. Sie stellte sie in die Speisekammer, in der es kein Licht gab. Ihr Mann lehnte an der Wand und sah scheinbar unbeteiligt zu, wie sie die Gläser vorsichtig einsortierte. Vor Minuten noch hatte es in der Küche wunderbar nach Kompott und Gewürzen gerochen; jetzt roch alles nur noch sauer. Ihr Mann kam auf sie zu und nahm ihr behutsam ein Glas aus der Hand. Er hob es sehr langsam in Schulterhöhe und ließ es einfach fallen.
Später saßen sie sich gegenüber. Während sie schluchzte, bemühte er sich, mit einem frisch gebügelten Taschentuch ihre Nase zu putzen. Sie war dreiundzwanzig, und er war sieben Jahre älter. Sie hatten sich am Silvesterabend vor sechs Jahren in einer kleinen Dorfkirche trauen lassen. Diese Art von Streitereien, die oft in wilden Schlägereien endeten, hatte es von Anfang an gegeben.
Aber seit einiger Zeit beteuerten sie sich ihre Liebe nicht mehr nach solch einem Spektakel.
„Ich hab es satt, endgültig satt“, sagte sie.
„Hör auf zu heulen, hör endlich auf“, sagte er und drückte ihr das Taschentuch auf die Nase.
Sie erhob sich ruckartig und ging an ihm vorbei, während er mit seinem Taschentuch in der Hand sitzen blieb. Sie nahm Schaufel und Besen und begann, die Scherben aufzukehren.
„Ich besorg dir morgen neues Obst“, sagte er und zündete sich eine Zigarette an.
„Ich will hier raus“, sagte sie, ohne aufzuschauen. „Ich will meine eigenen vier Wände. Ich hab diesen Krankenhausmief satt.“
„Es ist nicht meine Mutter“, sagte er, und sie spürte sein Grinsen in ihrem Rücken.
„Und ich hab sie mir nicht ausgesucht“, sagte sie.
Plötzlich kniete er neben ihr, streichelte ihr übers Haar.
„Es wird bald vorbei sein“, sagte er, nahm sie in die Arme und wiegte sie sanft hin und her. „Bald, mein Baby“, und sie hatte das Gefühl, er meinte wirklich, was er sagte.
Ich lag im Nebenzimmer und hörte alles durch die Wand, ich war zu klein, um die genaue Bedeutung der Worte zu verstehen. Es war Abend, und neben mir ruhte meine Großmutter und stieß die Luft mit tiefen, raschen Atemzügen aus. An der Zimmerdecke verlief das Schattenmuster der Jalousie, und trotz der Dunkelheit sah ich, wie meine Großmutter mich anlächelte. Sie hatte noch fast alle ihre Zähne, darauf war sie stolz. Seitdem ich auf der Welt war, schliefen wir in einem Bett. Die Engel hätten mich direkt zu ihr ins Zimmer gepustet, hatte sie mir immer wieder gesagt, und ich hatte ihr geglaubt. Wir falteten unsere Hände und sprachen das Nachtgebet. Als es im Nebenzimmer lauter wurde, betete meine Großmutter ebenfalls lauter, und als es den großen Krach gab, beendete sie schnell das Gebet und legte ihre Hände über meine Ohren. Ihre Hände waren warm und rochen vertraut nach Glycerin. Ich hörte nur noch das Rauschen meines eigenen Blutes und schlief ein.
Der Tag brach an, als wäre nichts geschehen. Ein Streifen Tageslicht, das Geräusch der Klospülung, Schritte auf dem Flur, Türenwerfen, unversöhnt aneinandergereihte Worte. Die Großmutter lag neben mir. Sie hatte die Augen geöffnet und rührte sich nicht. Ich versuchte, eine Weile die Luft anzuhalten. Und dann schaffte ich es nicht mehr auf die Toilette.
Ich weiß nicht, wofür ich die erste Ohrfeige bekam: für die nassen Hosen oder für jene drei Worte, die ich an meine Mutter richtete. Ich sagte: „Oma ist tot“, und genau in diesem Moment entstand die Pfütze auf dem Boden.
Der junge Mann lag auf dem Rücken und dachte an seine Frau. Er ließ heißen Sand durch seine Hände rieseln, und das Meerwasser leckte seine Füße. Er hatte sich vor drei Wochen gleich nach der Beerdigung seiner Schwiegermutter aus dem Staub gemacht, und er hatte es als noble Geste empfunden, so lange gewartet zu haben, bis die Alte unter der Erde war. Sie hatte keinen Pfennig auf dem Sparbuch gehabt, nur den Schmuck und ein Fitzelchen Gold. Der Schmuck hatte ihm die einundzwanzig guten Tage an der Ostsee gebracht – eine Suite im Hotel an der Strandpromenade, die verrücktesten Cocktails und Kontakt mit einer Frau, die sein Talent zu schätzen wusste. Er stellte sich ihr als Landschaftsmaler vor, saß stundenlang vor ihr und entwarf Bilder aus Worten, wofür sie ihn zu bewundern schien. Aber dann ging ihm das Geld aus, ihr Interesse ließ nach, und das Feuer in seinen Worten auch. Der junge Mann hasste den Gedanken an die Heimkehr, obwohl er sich den ganzen Vormittag diesen Satz vorbetete: Zeit, heimzukehren, sagte er sich, während er mit geschlossenen Augen im Sand lag und das Meer seine Füße umspülte. Er legte sein Gesicht auf den Unterarm, suchte blinzelnd unter den Badegästen nach einem hübschen Geschöpf, und schließlich fiel ihm das Fitzelchen Gold wieder ein. Er hatte es nie gesehen, und vielleicht wurde sein Wert vor ihm heruntergespielt, vielleicht war das Fitzelchen ein Fitzel oder gar ein Brocken. Er erhob sich rasch, zu rasch, ihm wurde schwindelig. Trotzdem versuchte er, seine Schritte schnell durch den erhitzten Sand zu setzen, und fast übermütig wandte er dem Meer den Rücken zu. Im Hotelzimmer packte er seine wenigen Sachen zusammen, und ohne sich zu duschen oder zu rasieren, ohne auch nur die Rechnung zu begleichen, verließ er das Hotel durch den Hintereingang.
Das kleine Mädchen saß am Tisch, während die Mutter im lauten Selbstgespräch über der Küchenanrichte Sellerie und Porree schnippelte. Vielleicht waren ihre Worte auch an das Kind gerichtet, aber eigentlich hörte es sich nicht so an. Das Mädchen saß schon lange am Tisch und versuchte, ein Stück Fleisch zu zerkauen. Das Fleisch war zäh und wollte einfach nicht durch die Kehle rutschen. Es kaute und schob das Fleisch mit der Zunge hin und her, hörte dabei das gleichförmige Gemurmel der Mutter, das ab und an durch einen Fluch unterbrochen wurde, hörte sie auf irgendwelche Flittchen schimpfen und stellte sich vor, wie die Mutter diese Flittchen mit einer Bürste schrubben und dann in den Topf zu dem Gemüse werfen würde, und natürlich hielt es diese Flittchen für besonders zähe Fleischbrocken. Irgendwann unterbrach das Mädchen die endlose Kauerei und sah sich nach einem geeigneten Versteck für den Klumpen in seinem Mund um. Auf der Treppe näherten sich Schritte, und die Mutter erstarrte; für sie schienen Schritte auf der Treppe um diese Tageszeit nichts Gutes zu bedeuten. Sie beendete ihr Selbstgespräch, setzte sich zu ihrer Tochter an den Tisch, und als die Tür aufging, sah sie nur das Mädchen an. Herein kam der Vater, braun gebrannt und unrasiert, mit einer Alkoholfahne, die sie schon von Weitem riechen konnten. Er schien durchaus guter Laune zu sein, und die Mutter entkrampfte sich. Er hatte Geschenke mitgebracht, die er hinter dem Rücken versteckt hielt. Er wirbelte einen weißen Bademantel durch die Luft, auf dem sie sofort den Namen des Hotels entdeckte. Dem Mädchen überreichte er mit einem übertriebenen Augenzwinkern einen Plastikglobus, dessen Fuß geklebt war. Die Mutter hatte sich entschlossen, seine gute Laune auszunutzen: Sie warf den Bademantel auf den Boden, schloss das Fenster und begann ihn zu beschimpfen, nannte ihn Herumtreiber, Zigeuner, Taugenichts, den allerletzten Abschaum. Sie beschimpfte ihn, bis ihr die Worte ausgingen, und es interessierte sie nicht im Geringsten, dass das Mädchen dabei war.
Doch schon wenig später trug die Mutter ihr bestes Kleid, und ihre Lippen glänzten knallrot. Das Mädchen betrachtete den Globus, auf dem einige Länder mit einem Stift schwarz umrandet waren. Inzwischen rauchte die Mutter, und der Herumtreiber versuchte sie mit seinem stoppeligen Kinn zu kitzeln. Dann tranken sie Wein und lachten dabei, und irgendwann verließen sie die Wohnung. Das Mädchen ging zum Mülleimer und spuckte den Fleischklumpen aus.
Er hatte die Hoffnung gehabt, er könne etwas Großes tun. Er wollte alles anders machen und mit ihr noch einmal den Zauber der ersten Tage erleben. Stattdessen stank er aus dem Maul, und wahrscheinlich roch sogar seine Haut nach dem Alkohol der letzten Wochen. Er hatte es an ihrem Blick gesehen, dem er nicht entkommen konnte. Sie sah ihn so, wie er war, und keinen Deut besser, und kein Zauber und gar nichts. Einen Augenblick lang versuchte er, sich gegen dieses schäbige Bild zu wehren, versuchte, ihr zu sagen, dass er dem nicht mehr entsprach, aber der Impuls dauerte nicht länger als die Vierteldrehung seines Arms, mit der er den Bademantel vor ihr ausbreitete. Dann war er wieder gefangen im Trott, in vorhersehbaren Atemzügen. Woher hätte sie auch wissen sollen, dass er sich gewünscht hatte, ein anderer zu sein; ein ums andere Mal.
Er zog sie ins Bett, und sie ließ es geschehen. Während er mit einer fremden Gier verschiedene Stellungen mit ihr ausprobierte, dachte sie an noch nie erlebte Liebesnächte. Er hatte sie gekitzelt, und zwischen zwei nah ihrem Ohr hingehauchten Küssen hatte er sie nach dem Fitzelchen Gold gefragt. Sie schwieg, und er berichtete von seiner Reise, von seiner Sehnsucht nach ihr und all den Cocktails, die aus den ungewöhnlichsten Mixturen bestanden hatten: Da draußen in der Welt habe er mit jedem Schluck an sie gedacht. Nun lag er mit geschlossenen Augen neben ihr, und sie wusste, dass er auf eine Antwort wartete. Fast hätte sie auflachen können, wie durchschaubar er doch war. Ein Schweißtropfen rann seinen Nacken herunter, sie wischte ihn weg, und dann stellte sie ihm eine Frage, nur um an seiner Stimme zu erkennen, wie viel Zeit sie noch hatte. Wie viele Sekunden, Minuten oder Stunden, ehe er grob werden würde. Irgendwann würde sie ihm das Gold zeigen müssen, und er würde nur noch wütender werden. Sie leckte vorsichtig mit der Zunge über das wertvolle Metall in ihren Backenzähnen; es war wirklich nur ein Fitzelchen gewesen.
Inzwischen gab ein leises Schnarchen zu erkennen, dass er eingeschlafen war. Sie stand auf, hustete laut, aber er rührte sich nicht. In Windeseile kontrollierte sie seine Jacken- und Hosentaschen; schließlich entdeckte sie in seinem Schuh drei zusammengefaltete Zehnmarkscheine, und sie lächelte bei dem Gedanken, dass ihr Versteck einfach besser war.
Das Mädchen fand seine Mutter ganz hübsch, aber eine richtige Meinung hatte es nicht dazu. Sie war ihm zu vertraut, und wahrscheinlich wollten alle kleinen Mädchen eine hübsche Mutter haben. Die Mutter war blond, blauäugig, von kleiner, weicher Statur, ihre Nase ein wenig groß, aber nicht so, dass es auffiel. Sie zog sich gern schön an, und deshalb servierte sie ab und an in einem Café. Von ihrem Lohn kaufte sie sich Kleider, mit denen sie Staat machen konnte, und den ganzen dazugehörigen Klimbim. Natürlich verbarg sie diese Sachen vor ihrem Ehemann, er hätte sofort wieder alles zu Geld gemacht oder für Alkohol eingetauscht. Sie versteckte ihre Schätze in einem schmalen Holzschrank, einer Art Spind, den sie abschließen konnte. Den Schlüssel trug sie immer bei sich. Der Holzschrank sollte den Eindruck erwecken, als wäre er mit Besen, Handfegern, Wischlappen und dergleichen gefüllt, also vollkommen uninteressant für einen Mann, der nie einen Besen in die Hand nahm. Täglich kontrollierte sie das Schloss, und stets war es unbeschädigt. Sie öffnete den Schrank nur, wenn ihr Mann fünfhundert Meter entfernt in seiner Stammkneipe war oder im Nebenzimmer, wo er oft wie im Koma auf dem Boden lag, unfähig, sich vor der Mittagszeit zu rühren.
Jetzt stand sie vor dem Schrank, eine angezündete Zigarette in der Hand und bereit, sich die Freude zu gönnen, all ihre Sachen auf dem Tisch auszubreiten. Das Mädchen saß an der Fensterbank und kritzelte auf ein Blatt Papier. Es hörte die Mutter den Schlüssel umdrehen, dann eine eigenartige Stille. Das Mädchen hob den Blick und sah die Mutter nach Luft schnappen, wieder und wieder, ein fassungsloser Fisch. Der Fisch setzte sich an den Tisch, begann zu wimmern und wurde wieder die Mutter. Tränen rollten ihr über Wangen und Hals. Dann stand sie auf, nahm das Mädchen bei der Hand und zeigte ihm den leeren Schrank. Ihr Mann hatte die Rückwand abgeschraubt und alles ausgeräumt. Sie setzte sich auf den Stuhl, zog das Mädchen auf ihren Schoß, wollte, dass es seine Arme um sie legte. Das Mädchen küsste sie auf die nassen Wangen. Es fragte sich, wann dieser Anfall vorüber sei und die Mutter sich wieder den Geschäften des Tages zuwenden würde. Es streichelte ihr Gesicht, sah dabei klar und scharf umrissen die Äste des Kirschbaums vorm Fenster. Jemand hatte ihm gesagt, dieser Kirschbaum sei ein Wunder, denn ein Kirschbaum habe mitten in der Stadt einfach nichts zu suchen. Aber das Mädchen wusste es besser: Diesen Kirschbaum hatte schon die Mutter der Großmutter gepflanzt, und manchmal saß seine Großmutter weiß und federleicht in den Ästen und lächelte dem Mädchen zu.
Die Mutter schob es von sich und stand auf. Sie ging durch die Küche, auf und ab, blieb eine Weile vor dem Schrank stehen. Irgendwann trat sie wütend mit dem Fuß dagegen. Dann stand sie wieder vor dem Mädchen und sagte: „Du bist mein Kind“, und es klang, als überraschte sie diese Feststellung.
Das Mädchen sah zu dem Kirschbaum hinüber, doch seine Großmutter saß auf keinem der Äste.
„Ich hab nicht gewusst“, sagte die Mutter, „… dass Liebe so ist.“
Das Mädchen schwieg und versuchte ein Lächeln.
„Was denkst du, wie alt ich bin?“, fragte die Mutter.
Das Mädchen wusste die Antwort nicht.
„Bin ich jung oder alt?“
„Du bist jung“, sagte es schnell.
Die Mutter betrachtete es nachdenklich, dann begann sie, in einem Magazin zu blättern, und zeigte ihm das Foto einer Frau. „Wer ist jünger von uns beiden?“
Das Mädchen glaubte zu wissen, was die Mutter hören wollte, und wies mit dem Finger auf sie.
Aber aus irgendeinem Grund zweifelte die Mutter an seinen Antworten, klappte das Heft zu und warf es auf den Tisch. Sie rauchte mehrere Zigaretten, trank eine halbe Flasche Goldbrand, trat immer wieder gegen den Schrank und fluchte. Dann stand sie vor dem Mädchen, sah es an, schob den Pullover hoch und zeigte auf ihren Bauch. „Wie findest du meinen Bauch?“
Das Mädchen sah wieder zum Kirschbaum, Wind fuhr durch die Äste, die Blätter säuselten, aber es konnte nichts verstehen.
Die Mutter zuckte ungeduldig die Achseln: „Nun sag schon!“
Der Bauch war fahl und verschwitzt, mit Dellen und Rissen in der Haut. Das Mädchen versuchte, mit dem Kopf zu nicken. Nein, es war kein schöner Bauch.
„Fass ihn an“, sagte die Mutter. „Fass meinen Bauch an.“
Das Mädchen stand auf und legte die Hand auf das warme, weiche Fleisch und schloss die Augen. Es roch den säuerlichen Atem der Mutter, die ihre Hand über die des Mädchens gelegt hatte. Es blieb vor ihr stehen und spürte ihre Verzweiflung, spürte ihre ganze Einsamkeit, die Gier nach Leben, einem anderen Leben, von dem die Mutter selbst nicht wusste, wie es aussehen sollte.
„Und?“, sagte die Mutter. Dieses „und“ klang erschöpft, gereizt, und plötzlich verstand das Mädchen das Säuseln und Wispern der Blätter und flüsterte: „Ein toller Bauch.“ Es löste sich aus ihrer Hand und pochte mit dem Finger, so als würde es morsen, die Buchstaben noch einmal in das weiche Fleisch: „Ein toller Bauch.“
„Das reicht“, sagte die Mutter. Das Mädchen atmete jetzt so flach, als wäre seine Lunge zwischen zwei Buchseiten gepresst, aber sein Atem hatte einen Rhythmus; einen Rhythmus wie das Säuseln und Wispern der Blätter im Kirschbaum.
An einem der letzten Wintertage liefen wir in Zweierreihen durch Matsch und Eispfützen. Unter einer blassen Sonne kamen zwanzig kleine Kinder von einem Tagesausflug zurück und marschierten in den Kindergarten.
Nieselregen wehte uns ins Gesicht. Ich lief als Letzte neben der Erzieherin, die wortlos mit ihren schweren Stiefeln an meiner Seite stapfte. Aus dem Nieseln wurde ein feiner, stechender Eisregen, meine Schuhe waren durchweicht, mir war kalt, und ich hatte Hunger. Vor mir liefen zwei Paar rote Lackschuhe, sie tippelten und tänzelten durch den Schneematsch. Mein Blick blieb an den geflochtenen Zöpfen der Mädchen hängen, ich hörte sie kichern und irgendwelche Lieder vor sich hin trällern. Sie sangen in einer hohen Tonlage, und ich wünschte, sie würden aufhören. Als wir an einer Kreuzung hielten, ging die Erzieherin nach vorn und führte die kleine Kolonne über die Straße. Ich lief schneller, lief ganz nah hinter den Mädchen und versuchte, ihnen in die Hacken zu treten. Dann pikste ich den Mädchen in den Rücken und drohte ihnen mit fremder Stimme: „Wenn ich euch allein erwische, reiß ich euch die Zöpfe aus. Ich zerkratze eure Lackschuhe, zerkratze eure Gesichter, zerkratze euer alles.“ Ich gab grunzende Geräusche von mir, und die Mädchen liefen schreiend nach vorn. Während sie rannten, versuchte ich mich an dem Lied, das ich sie vorher singen gehört hatte. Aber ich bekam die Melodie nicht hin. Irgendwann hielt die Gruppe, und die Erzieherin stand vor mir. Die Sonne sah plötzlich aus, als wäre sie mit Packpapier überklebt. Ich schaute so lange in das durchschimmernde Licht, bis meine Augen schmerzten. Die Erzieherin verlangte eine Entschuldigung für mein boshaftes Verhalten, aber ich bekam kein Wort heraus.
Abends, im Bett, sagte ich das Gebet auf, das ich mit meiner Großmutter vor dem Einschlafen gesprochen hatte. Es war das erste Mal seit ihrem Tod, dass ich es aufsagte. Die Worte hörten sich blechern an, ohne Sinn, und ich suchte vergeblich nach der Melodie in den Sätzen.
Ich erinnere mich vor allem daran, mit welcher Langsamkeit mein Vater die Einweckgläser vom Tisch nahm und fallen ließ, wie in Zeitlupe, als wäre dies ein Schauspiel und die Angst meiner Mutter eine verdiente Zugabe. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir zwar leidtat und auch ich Angst hatte, aber ebenso eine vage Lust an dieser Angst empfand. Ich hatte mich längst in einen Raum zurückgezogen, zu dem niemand sonst Zutritt hatte. Wir wohnten in einer Kleinstadt, im Hinterhaus, ganz oben. Mein Vater wurde der schöne Egon genannt. Meine Mutter hatte ihm regelrecht nachgestellt, ihn wollte sie haben und keinen anderen. Sie bekam mich, ihre Tochter, da war sie siebzehn, mein Vater war zehn Jahre älter, Aushilfskellner, aber er konnte Ölbilder malen, Schiffe auf tosendem Meer, und manchmal verkaufte er eins. Die ersten Jahre wuchs ich bei meiner Großmutter auf, die ein Stockwerk tiefer zwei kleine Zimmer bewohnte. Vater und Mutter waren in dieser Zeit im Gefängnis; wegen einer Spionagetätigkeit meines Vaters, so das Narrativ, der Doppelagent für Russen und Amis gewesen sein soll, und meine Mutter seine Helferin. Dies scheint zu stimmen, denn meine Mutter bekam eine zusätzliche Rente von dreihundert Euro, die sogenannte SED-Opferrente. Ich weiß nichts Genaues darüber, meine Mutter erzählte die Geschichte stets vage, die Zeit im Gefängnis muss die Hölle für sie gewesen sein.
Ich hatte damals keine Freunde. Nur ein Junge interessierte sich für mich. Dieser Junge kommt nicht vor in der Geschichte von meiner Großmutter im Kirschbaum. Er war ungefähr fünfzehn, sechzehn, er nahm mich mit in einen Schuppen, nicht weit von unserem Hof. Er hob mich auf einen Tisch, ich war vier oder fünf Jahre alt, zeigte mir sein erigiertes Glied. Ich sollte es anfassen und benennen, wie es sich anfühlte. Ich sagte, es sei wie eine Bockwurst. Ich erinnere mich vor allem an den Stolz, es war mir bewusst, dass wir etwas Verbotenes taten, doch die Freude, gebraucht zu werden, überwog alles Unbehagen. Was mich verletzte, war, dass der Junge mich am nächsten Tag nicht mehr kannte, als ich ihm auf der Straße zuwinkte. Ich dachte, dass etwas mit mir nicht stimmte, und da muss es begonnen haben: so korrumpierbar für ein wenig Zuneigung.
Samstag, zwanzig vor zwölf
Jedes Mal, wenn sie von dem Franzosen nach Hause kam, hatte sie Appetit auf ein Leberwurstbrot. Im Flur streifte sie die Schuhe von den Füßen, wurde um etliche Zentimeter kleiner. Dann legte sie die Armbänder und Halsketten ab; das Mädchen beobachtete sie dabei.
Die junge Frau sah auf die Uhr und lächelte, es war kein gutes Lächeln. Sie ging in die Küche, und das Mädchen folgte ihr. Es war ein grauer Oktobertag, es wurde nicht richtig hell, und das Deckenlicht schaffte es auch nicht. Sie verdünnte sich Kirschsirup mit Wasser und trank das Glas in einem Zug aus, wischte sich den Mund ab und schmierte sich dabei Lippenstift an die Hand. Es war Samstag, zwanzig vor zwölf.
„Du musst noch einkaufen gehen“, sagte sie zu dem Mädchen, ohne es anzusehen. Die Frau, die auch die Mutter des Mädchens war, war drei Tage und zwei Nächte nicht in der Wohnung gewesen. Sie hatte diese Zeit mit dem Franzosen und dessen Freunden verbracht, hatte in weichen Sesseln gesessen, gefeiert, getanzt unter Kristallleuchtern; der Franzose war seit dem Sommer ihr Liebhaber. Jetzt fuhr sie sich mit beiden Händen durchs Haar und starrte, ihren Erinnerungen nachhängend, aus dem Fenster. Das Mädchen stand in der Mitte der Küche und folgte ihrem Blick. Das Fenster zum Hof im ersten Stock zeigte die Äste eines Kirschbaums, der Himmel dahinter war ein Stück weit aufgerissen, als hätte er eine Öffnung. Der Wasserhahn über der Spüle tropfte. Der dunkle Fleck an der Wand ähnelte einer Landkarte, allerdings kannten nur Eingeweihte die Ortschaften darauf. Der Fleck bestand aus Resten alter Leberwurst und war mindestens drei Jahreszeiten alt.
Die Mutter setzte sich an den Küchentisch, und es sah aus, als würde sie nachdenken, schwer zu sagen, worüber, wenn sie denn überhaupt dachte, wer konnte schon sagen, wo das Denken anfing und wo es aufhörte. Vielleicht rief sie nur innerlich Befehle ab, als wäre da eine Schultafel in ihrem Kopf, aus ihrer Kinderzeit. „Bring mir Zettel und Bleistift“, las sie gerade die mit Kreide geschriebenen Worte von der Tafel ab. Das Mädchen gehorchte und brachte ihr das Gewünschte. Inzwischen hatte die Mutter den Kopf auf den Tisch gelegt und träumte den zwei letzten Nächten hinterher, und einem Kuss. Die Kristallleuchter hatte sie gegen ein blasses orangefarbenes Licht eingetauscht, in einer engen Bar, und beim Abschied hatte ein Unbekannter, dessen Gesicht ihr längst wieder entschwunden war, ihre Stirn geküsst, so zart, so überaus eigen. Sie hob den Kopf und wies das Mädchen an, ihre Zigaretten aus dem Flur zu holen. Als das Mädchen die Handtasche danach durchsuchte, hatte es einen winzigen Funken Hoffnung. Es wusste nicht genau, worauf, aber das Gefühl war da. Gleichzeitig hörte es einen Düsenjäger vorbeifliegen und dachte, dass es noch nie einen Krieg erlebt hatte. Das Mädchen reichte der Mutter die geöffnete Schachtel, blieb vor ihr stehen und sah sie an. Es konnte nicht aufhören, sie anzusehen. Die Mutter griff sich eine Zigarette aus der Packung, entzündete sie und zog den Rauch tief in die Lunge. Dann schaute sie auf die Uhr und lächelte das Mädchen an und sagte: „Es wird höchste Zeit, dass du losgehst.“
Das Mädchen wusste, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gab zu lächeln. Es blieb neben dem Küchentisch stehen, ohne sich zu rühren. Für einen Augenblick meinte es, Tränen auf dem Gesicht der Mutter zu sehen, aber es war sich nicht sicher. Ein Windstoß jaulte vorm Fenster auf, wirbelte Blätter durch die Luft. „Kraul mich“, sagte die Mutter. Das Mädchen stellte sich hinter den Stuhl und begann, mit den Fingerspitzen ihren Kopf zu massieren, und während es die dünne Haut über dem Schädel spürte, verfolgte es den Sekundenzeiger auf der Armbanduhr der Mutter. Nach einer Weile schüttelte diese unwillig den Kopf und zog sich im Sitzen Bluse und Unterhemd aus, legte den Kopf auf die Hände und sagte: „Nun kraul mir den Rücken.“ Ihre Stimme klang leise, als würde sie versickern. „Es ist Samstag“, sagte das Mädchen, „die Geschäfte schließen früher.“
„Nun mach schon“, erwiderte die Mutter, und das Mädchen streichelte ihr den Rücken und war sich sicher, dass das Fleisch unter seinen Händen tot war. Aber es traute auch dem toten Fleisch nicht. Der Wind jaulte abermals auf, rüttelte an dem Fensterrahmen, und das Mädchen sah die durchgeschüttelten Äste des Kirschbaums vorm Fenster und versuchte, den Abstand zwischen Fensterbrett und Baum zu schätzen.
„Ich weiß, dass heute Samstag ist“, sagte die Mutter und streifte sich das Hemd über, nahm einen Bleistift und schrieb ihren ersten Wunsch auf den Zettel, überlegte, zündete sich die nächste Zigarette an. Dann sagte sie: „Wasch deine Hände.“
Das Mädchen stand vor dem Waschbecken, stellte sich auf Zehenspitzen, um in den Spiegel zu sehen, vergebens. Es lächelte hoch in Richtung des Spiegels, irgendwo würde das Lächeln schon landen, dachte es.
In der Küche sagte die Mutter: „Ich will feine Leberwurst, bring mir ja nicht die grobe.“ Dann sah sie wieder auf die Uhr. „Es ist wirklich schon spät, die haben bestimmt schon alles abgeräumt und sind beim Saubermachen.“
Das Mädchen steckte Zettel und Geld in die Schürzentasche, zog eine Jacke an.
„Beeil dich und bring mir ja nicht die grobe“, sagte die Mutter und nahm dann erst den Blick von dem Mädchen. Als die Tür ins Schloss fiel, war sie mit ihren Gedanken schon woanders.
Das Mädchen lief die Treppe hinunter, übersprang drei, vier Stufen. Auf der Straße rannte es mit dem Wind um die Wette. Es wusste, dass es überhaupt nichts brachte, doch es war ein vertrautes Spiel. Die Fleischerei lag an der nächsten Straßenecke, und natürlich war das Geschäft wie jeden Samstag um diese Zeit längst geschlossen. Die Jalousien waren heruntergelassen, hinter der Tür Stille. Die Fleischerei schloss pünktlich um zwölf Uhr, und die Verkäuferinnen begannen schon vorher mit dem Abräumen der Ware. Was verständlich war, dachte das Mädchen, schließlich war nun Wochenende, und die Leute wollten nach Hause zu ihren Familien. Die Straßen waren eine halbe Stunde nach Ladenschluss leer, es war ganz anders als kurz vor zwölf, wenn die Menschen noch auf die Straße eilten, weil sie etwas vergessen hatten.
Hinter dem Schaufenster lagen tote Fliegen. Das Mädchen fragte sich, wie lange die schon da lagen, wie lange eine Fliege wohl brauchte, um sich in Staub aufzulösen. Die grüne Jalousie bewegte sich kaum merklich über den toten Fliegen, als gäbe es noch irgendwo einen Luftzug im Raum. Das Mädchen wusste, dass niemand mehr dort drinnen war. Aber es stand draußen und konnte sich die toten Fliegen ansehen, und wenn es wollte, auch sein Spiegelbild. Es hatte jetzt sehr viel Zeit und begann, vorsichtig über die Bordsteinkanten zu balancieren.
In Wirklichkeit hatte ich an den Leberwursttagen einen Tick entwickelt; wenn meine Mutter mich mit solchen aussichtslosen Aufträgen losschickte, die sie natürlich auch später nicht als solche eingestand, dauerte der Weg Stunden. Ich setzte einen Schritt vor, ging ihn zurück, dann zwei Schritte, ging einen zurück, und das ging so weiter bis kurz vor dem Ziel, und auch da musste ich noch einmal umkehren, um den letzten Schritt setzen zu dürfen. Es war ein Zwang, ich konnte nicht anders. In meinem späteren Leben sah ich manchmal einen Mann oder eine Frau, die genau dies taten, sie hüpften auf der Stelle, kamen nur schwer von einer Straßenseite auf die andere. Ich erkannte mich wieder und war froh, davongekommen zu sein.
Schon damals waren Bücher für mich Heimat, wie später auch das Schreiben. Ich las alles, was mir unter die Finger kam, ich besaß sogar einen Bibliotheksausweis. Ich erinnere mich, wie die Bücher rochen, an ein Wohlgefühl und die Gewissheit, dass mir diese Welt niemand würde entreißen können.
Als ich mit meiner Mutter später über meine Lieblingsbücher reden wollte, sagte sie: „Ach, du tust doch nur so.“
In der Erzählung kommt meine Schwester nicht vor, die ihre Tage in einem Gitterbett verbrachte, ihr Spielzeug waren Rollen aus Toilettenpapier. Sie weinte oft, und manchmal schlief sie weinend ein, denn ich spielte nicht mir ihr, ich wollte nur, dass sie ruhig war. Damals empfand ich keine Geschwisterliebe. Doch ich versank oft stundenlang in Tagträumen, ich hielt mich in ihnen auf, als wären sie eine reale Welt. In diesen Träumen war ich fürsorglich, ich fällte Bäume im Wald, baute uns eine kleine Hütte, in der es einen Kamin gab, eine gemütliche Küche und einen Fußboden aus blau-weißen Fliesen. Ich erzählte mir die Geschichte jedes Mal neu, fügte bestimmte Details dazu, andere verschwanden wieder. Im Gegensatz zu meinem späteren Schreiben waren meine Tagträume geradezu ausschweifend. Ich richtete die Räume in der kleinen Hütte sorgfältig ein, ordnete Tüten und Konservendosen in der Speisekammer, buk Brot. Allein dieser Vorgang, ich knetete den Teig und roch daran, zog sich Ewigkeiten hin.
Als wir vor dem Grab unserer Mutter standen, erzählte ich meiner Schwester, dass der Fußboden in meiner Küche genau so aussieht wie der aus meinen Kindheitsträumen. Sie erinnerte sich nicht an meine Träume, wie sollte sie auch, ich hatte sie ihr nie erzählt. Auch ich wusste umgekehrt wenig über meine Schwester. Nachdem ich fünfundzwanzigjährig von Leipzig nach Westberlin ausgewandert war, klingelte sie an den Türen meiner Freunde und sagte ihnen, sie wolle die Freundschaft mit ihnen an meiner Stelle weiterführen. Während meine Schwester versuchte, die Lücke zu füllen und meinen Platz einzunehmen, wohnte ich in Moabit und verließ kaum das Bett. Von Heimweh gequält, rief ich nachts in den Bars und Kneipen an, wo ich meine Freunde vermutete, um ihre Stimmen zu hören. Es dauerte, bis ich im Westen angekommen war.
Manchmal versuche ich, den Fußboden aus meinen Träumen mit dem heutigen zu verbinden, doch es gelingt mir nicht. Es ist mir, als würde ich länger als möglich die Luft anhalten müssen. Wenn ich heute Heimweh habe, dann nach dem Zuhause aus meinen Kindheitsträumen.
»Der amerikanische Schriftsteller und Literaturprofessor George Saunders hat diese Poetik des ökonomischen Schreibens in seinem wundervollen Buch ›Bei Regen in einem Teich schwimmen‹ (deutsch 2022) an Hand russischer Meistererzählungen des 19. Jahrhunderts im Einzelnen erklärt. Den dort aufgezeigten Gesetzen und Möglichkeiten werden Klüssendorfs Geschichten in einer Weise gerecht, für die es in der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur wenig Parallelen gibt. Man kann, wenn man eine begonnen hat, nicht aufhören zu lesen, was durchaus auch mit ihren Stoffen zu tun hat, aber eben doch vor allem mit einer kunstvoll einfachen, zwingenden Schreibweise.«
„In ihren autofiktionalen Romanen leistet die Autorin das, was die Grande Dame dieser Gattung, Annie Ernaux, schon seit den 70er-Jahren leistet: die Verbindung der eigenen Geschichte mit der allgemeinen. Insofern ist Angelika Klüssendorf eine Autorin, die es neu zu entdecken gilt, weil sie mit unglaublicher sprachlicher Präzision und ohne jede Larmoyanz über Abgründe und Verstörungen zu berichten weiß.“
„In den Episoden nistet die gleißende Brutalität dieser Existenz. Dass sich das Mädchen retten konnte, ist die eigentliche Nachricht.“
„Die zehn kurzen Geschichten, die das erzählerische Rückgrat des Romans ›Risse‹ bilden, gehören zweifellos zum Besten, was die Autorin geschrieben hat.“
„Ihre Texte fesseln durch ihre Klarheit und berühren, ohne je gefühlig oder gar voyeuristisch zu sein. Damit weisen sie stilistisch und inhaltlich weit über das Gros dessen hinaus, was an Autofiktionalem publiziert wird.“
„Ein zartes Statement zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Literatur. Angelika Klüssendorf macht neue Türen auf zu ihrem Leben, ihrem Schreiben, ihren Texten und lässt dabei doch auch wieder einiges gekonnt in der Schwebe.“
„Es ist große große Literatur, was Angelika Klüssendorf da notiert. Sie ist und bleibt die Königin der Auslassung; diese schlanke, asketische Prosa, kein Wort zu viel, aber auch keins zu wenig.“
„Klüssendorf beherrscht die Kunst, mit wenigen Worten Bilder zu gestalten.“
„Die Erzählungen stehen für sich, doch in der Summe sind sie mehr als ihre Teile. Man könnte sie als fragmentarischen Roman begreifen, dessen Kraft sich aus den Leerstellen speist.“
„Ein Meisterwerk der autofiktionalen Literatur.“
„Man liest eine Literatur, die ›durchgearbeitet‹ wirkt und doch von nichts anderem als vom Leben spricht und so turmhoch über vielem steht, was an interessanten Geschichten auf den Markt geworfen wird.“
„Ein menschliches Buch über Schuld und Sühne und Verzeihen.“
„Klüssendorfs Kunstfertigkeit ist bestechend.“
„eindringlich“
„Man kann sich diesem bewegenden Roman einfach nicht entziehen. Starke Herbstliteratur.“
„Angelika Klüssendorf erzählt in klarer, brutaler und schnörkelloser Sprache von ihrem Überlebenskampf und von ihrer Sehnsucht ins Soziale zu finden und zu sich selbst.“
„Was ›Risse‹ zum Lektüreereignis macht, sind die mit Härte und Brillanz vor zwei Jahrzehnten geschriebenen Erzählungen.“
„Einmal mehr und beeindruckend anders erzählt Angelika Klüssendorf von einer Kindheit zwischen Vernachlässigung und Misshandlung, von nächtlichen Nadelstichen, kleinen Diebstählen, lüsternen Polizisten, Kinderheimen und Ausreißversuchen, von Verletzungen, die ganz heimtückisch als Zärtlichkeiten beginnen.“
„Es sind eindringliche, detailbewusste und eminent lebendige Schilderungen, die Klüssendorf hier gibt, meistens aus der Perspektive der Hauptfigur selbst.“
„Wir haben es mit einem der berührendsten Texte der Gegenwart zu tun. Das Erzählen schimmert darin als Krisenbewältigungsstrategie auf und trägt dazu bei, dass das Unfassbare begreifbar wird. Wo ansonsten beklemmendes Schweigen zurückbliebe, triumphiert – die Sprache.“




































Aktuell sind nur die auf unserer Internetseite bei Angelika Klüssendorf angegebenen Termine zu Lesungen bestätigt. Es werden aber definitiv noch mehr folgen. Eine Lesung in der Schweiz ist bislang nicht geplant. Herzliche Grüße, Ihr Piper-Team
Wo sind die weiteren Termine von Angelika Klüssendorf? Und kommt sie in die Schweiz? Grüsse A. Zanker
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.