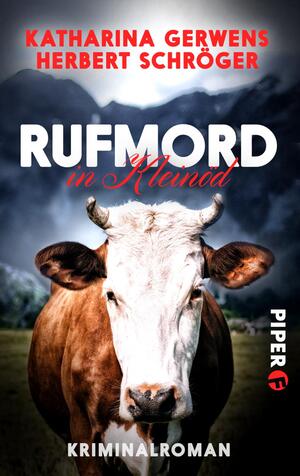
Rufmord in Kleinöd (Kleinöd-Krimis 4) - eBook-Ausgabe
Kriminalroman
„Ein witziger Krimi, in dem man förmlich das Muhen der Kühe hört.“ - Oberösterreichische Tageszeitung (A)
Rufmord in Kleinöd (Kleinöd-Krimis 4) — Inhalt
Als in Kleinöd ein Mann erschossen wird, richtet sich der Verdacht der Bevölkerung schnell auf Leopold Schmiedinger, der erst seit Kurzem im Dorf lebt. Nicht nur, dass der Cousin des einheimischen Polizeiobermeisters erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde, nein, er scheint nach dem Mord mit einem Mal über auffällig viel Geld zu verfügen. Während Bürgermeister Waldmoser das Misstrauen gegen den Verdächtigen kräftig schürt, geht Hauptkommissarin Franziska Hausmann ihre eigenen Wege, denn sie zweifelt an Schmiedingers Schuld.
Leseprobe zu „Rufmord in Kleinöd (Kleinöd-Krimis 4)“
Kapitel 1
Niemand machte ihm deswegen einen Vorwurf, aber er sollte sich ein Leben lang schuldig fühlen, weil er an diesem einen Tag nicht aufgepasst hatte und deshalb das Rätsel um die Herkunft des Fremden nicht schneller gelöst werden konnte. Dabei hätte es ihm doch auffallen müssen, dass da plötzlich einer in seinem Schulbus saß, der da gar nicht hingehörte.
Er konnte sich auch dann nicht an ihn erinnern, als man ihm genau sieben Tage später Fotos der Leiche zeigte. Die Kinder behaupteten hinterher, bereits an der Haltestelle bei der Zuckerfabrik habe [...]
Kapitel 1
Niemand machte ihm deswegen einen Vorwurf, aber er sollte sich ein Leben lang schuldig fühlen, weil er an diesem einen Tag nicht aufgepasst hatte und deshalb das Rätsel um die Herkunft des Fremden nicht schneller gelöst werden konnte. Dabei hätte es ihm doch auffallen müssen, dass da plötzlich einer in seinem Schulbus saß, der da gar nicht hingehörte.
Er konnte sich auch dann nicht an ihn erinnern, als man ihm genau sieben Tage später Fotos der Leiche zeigte. Die Kinder behaupteten hinterher, bereits an der Haltestelle bei der Zuckerfabrik habe der Mann auf der Fahrerseite in der vorletzten Bank gesessen, eng ans Fenster gedrückt und so konzentriert nach draußen schauend, als suche er etwas oder jemanden. Der Busfahrer konnte sich einfach nicht erklären, wie er ihn hatte übersehen können.
Wofür er jedoch seine Hand ins Feuer gelegt hätte, war die Tatsache, dass der Bus in Tabertshausen noch leer gewesen war, schließlich übte er auf dieser Strecke – natürlich nur, wenn er allein war – für das geplante Sommer-Song-Festival der Freilichtbühne in Eggenfelden, und er hatte sich an jenem Donnerstag das Lucio-Dalla-Lied „Te voglio bene assai“ in den Rekorder geschoben und inbrünstig mitgeschmettert. Kurz vor dem Friedhof Plattling war er an genau jene Stelle gekommen, die die meergrünen Augen eines weinenden Mädchens beschreibt, was die Stimme des Interpreten in eine sentimentale Kipplage zu bringen hatte, und mit Tränen in den Augenwinkeln hatte er den Part schnell zu Ende gesungen, bevor er den Bus zum Stehen und seine Stimme zum Schweigen brachte.
In der Nähe des Friedhofs waren dann die ersten Schulkinder eingestiegen. Er hatte auf Bayern 3 umgeschaltet und geschwiegen, war konzentriert weitergefahren und hatte im Zehnminutentakt weitere Grüppchen von Schülern aufgenommen. Enger und lauter war es in dem Bus geworden, bis das Zusteigen von Kindern in der Höhe von Wallerfing seinen Gipfelpunkt erreicht hatte: Jetzt hatte er für die nächsten zehn Minuten ein Gefährt voller johlender, lachender und lauthals miteinander schwätzender Schülerinnen und Schüler kutschiert, aber Blicke in den Rückspiegel hatten ihn beruhigt: Gerauft wurde da nicht. Eigenartig, dass er auch bei diesen Kontrollblicken den Fremden in der vorletzten Bank nicht wahrgenommen hatte.
Nächtelang sollte er darüber nachdenken und verzweifelt nach einer Erklärung suchen. Warum hatte er ihn nur übersehen? Und was alles in seinem Leben übersah er sonst noch, nur weil er nicht damit rechnete?
An der Grundschule von Pankofen waren die Schwestern Laura und Rosa Blumentritt zugestiegen und hatten ihn freundlich gegrüßt. Sie waren die Einzigen, die von seinem Traum, ein großer Opernstar zu werden, wussten, da er einmal wöchentlich von ihrer italienischen Mutter Gesangsunterricht erhielt und dazu neigte, an diesen Nachmittagen mit italienischen Vokabeln zu renommieren. Gelegentlich rief ihm die achtjährige Rosa beim Einsteigen ein „Buon giorno“ zu, und die zehnjährige Laura verabschiedete sich in Kleinöd gern mit dem Wort „Arrivederla“. Er nickte dann wohlwollend und murmelte leicht errötend: „Ciao, bella.“
Im gleichen Rhythmus, wie der Bus die Kinder eingeladen hatte, spuckte er sie wieder aus, und der Lärmpegel ebbte ab.
Laura Blumentritt sollte später erzählen, dass sie an diesem Tag gegen einen Fremden gedrückt worden war, der unbeweglich auf seinem Platz gesessen und stur aus dem Fenster gestarrt hatte. Es sei ein Mann mit Glatze gewesen, Hals, Hände und Unterarme seien mit blauen Zeichnungen tätowiert gewesen. Fasziniert hatte sie ihn angestarrt und gesehen, dass er überall Ringe und kleine Schmuckstücke trug: Herzchen, Anker und stilisierte Blütenblätter. „Der muss völlig durchlöchert sein“, vertraute sie ihrer Schwester auf dem Heimweg an und stellte sich vor, dass das Wasser in der Badewanne oder im Schwimmbad durch ihn hindurchfließe, als sei er ein Sieb: Nasenringe, Lippenringe, Ohrringe, sogar in den Ohrmuscheln, an den Augenbrauen und im Mundwinkel waren silberne Schmuckstücke durch die Haut gestochen.
Der Mann hatte ihre forschenden Blicke bemerkt, sie unwillig angeschaut, die Stirn in Falten gelegt – wobei der Silberring an der oberen rechten Augenbraue gezittert hatte – und beide Hände so fest um den Griff seines kleinen Koffers gekrallt, dass die mit blauen Schlangenlinien tätowierten Fingerknöchel weiß hervortraten.
In weiteren Befragungen sollte sich ein kleiner Junge an die Glatze des Fremden erinnern und unerschütterlich behaupten, er habe genau gesehen, dass darauf zwei Teufelshörnchen gewesen seien. Einige beschrieben seine Kleidung als bunt und farbenprächtig, während andere schworen, dass er ganz in Weiß oder völlig schwarz gekleidet gewesen sei. Die meisten der Kinder aber hatten ihn gar nicht gesehen.
Der Fahrer des Busses würde von nun an nie wieder behaupten, nur weil er an einem Ereignis teilgenommen habe, habe er auch alles bemerkt. Er würde überhaupt niemandem mehr trauen. Und erst recht nicht sich selbst.
Teres Schachner, die Wirtin des Blauen Vogels, steckte sich ihr verwegen geflecktes Haar hoch und band sich eine Schürze um. Frühjahrsputz im zweiten Stock. Von den acht Gästezimmern war nur eins belegt, da bot es sich an, an diesem schönen Vormittag die restlichen Zimmer und den Flur mitsamt den Fenstern gründlich zu reinigen. Während sie schnaufend die Treppe hochstieg, dabei Putzeimer, Schrubber, Besen sowie eine große Flasche Essigreiniger von Stufe zu Stufe wuchtete, fragte sie sich erneut, was dieser Fremde in Nummer acht wohl den ganzen Tag machte. Vor nicht ganz einer Woche war er dort eingezogen und hatte sein Zimmer seitdem kein einziges Mal verlassen. Ein komischer Typ, vielleicht ein Popstar, der in Klausur gegangen war, um Texte für ein neues Album zu dichten? Popstars sahen ja immer irgendwie schräg aus, und dieser hier war haarlos, an Hals, Armen und Händen tätowiert und mit silbernen Ringen durchbohrt.
Gelegentlich hörte sie ihn durch die geschlossene Tür hindurch telefonieren und stellte sich vor, dass er mit seinem Manager oder Agenten verhandelte oder der Bravo ein Interview gab, und einmal hatte sie durchs Schlüsselloch gesehen, wie er auf seinem Laptop schrieb. Er hatte schnell getippt, mit beiden Zeigefingern, und dabei zischend Luft durch die Zähne gezogen. Einerseits schmerzte ihr der Rücken vom vielen Schlüssellochgucken, andererseits aber hatte sie es nun bestätigt bekommen: Die Investition, zu der der junge Enzo Blumentritt sie überredet hatte, war richtig und gut.
Denn Teres Schachner hatte ihr Gasthaus zum Blauen Vogel, das sie insgeheim und mit verhaltenem Stolz „Hotel“ nannte, mit der in Kleinöd einmaligen Einrichtung eines Hotspots aufgewertet. Seitdem kehrten andere und bessere Gäste bei ihr ein als nur Lastwagenfahrer, Erntehelfervermittler und Pferdehändler. Nun kamen richtige Vertreter in Anzügen, mit gestärkten Hemden und mit goldenen Armbanduhren, die sich auskannten in Deutschland und mit Gott und der Welt vertraut waren. Sogar berühmte ausländische Popstars wie dieser hier pflegten in ihrem Hotel abzusteigen.
Auch die Jugendlichen aus der Neubausiedlung, ihre zukünftige Klientel, hatten den Internetzugang begeistert angenommen und überbrückten im Blauen Vogel die dort ansonsten stille Zeit zwischen siebzehn und neunzehn Uhr, tranken Limo und chatteten sich mit ihren Netbooks durch eine mehr oder weniger virtuelle Welt, während ihre Eltern daheim per Onlinebanking Rechnungen beglichen und in Internetshops einkauften.
Die Wirtin des Blauen Vogels stellte sich vor, dass auch ihr Gast aus Zimmer acht das Hotspotlogo gesehen und gleich gewusst hatte, dass er hier kreativ sein könne, weil man ihn in Ruhe lassen würde. Mit der Sicherheit eines Menschen, der weiß, was er will, würde er seinen Fahrer angewiesen haben, anzuhalten, ihm den Koffer zu reichen und heimzufahren, wo immer dieses Daheim auch sein mochte. Niemand sollte Rückschlüsse auf seine Identität ziehen können – Teres war sich sicher, dass er eine Auszeit brauchte, eine Phase der Ruhe, wie alle wirklichen Künstler das in regelmäßigen Abständen brauchten. Das wusste sie von Hansi Hinterseer, der das neulich in einem Fernsehinterview gesagt hatte.
Der Fremde aus Zimmer acht war an einem frühen Nachmittag gekommen, als Teres im Schankraum stand und ihre Edelstahltheke wienerte. In der Gaststube war es eigenartig still gewesen, einzig zwei junge Männer saßen im hintersten Eck des Raums und tippten auf der Tastatur ihres Notebooks. Teres hatte ihnen stirnrunzelnd zugesehen, aber nichts gesagt. Die kamen fast jeden Tag, bestellten je ein Spezi und waren dann stundenlang im Internet unterwegs. Vermutlich hatten sie keinen Internetzugang. Da war sie ausnahmsweise mal der Zeit voraus. Aber verdienen konnte sie an solchen Kunden nicht.
Der Fremde dagegen hatte eine Woche im Voraus bezahlt, keine Rechnung gewollt und in fast akzentfreiem Deutsch darum gebeten, dreimal täglich mit Mahlzeiten versorgt zu werden. Abends hätte er gegen ein, zwei Halbe Bier nichts einzuwenden, mittags jedoch lieber Wasser, denn er müsse arbeiten. Außerdem brauche er absolute Ruhe zum Denken. Das hatte Teres beeindruckt, und ganz kurz war in ihr die Vorstellung aufgeblitzt, dass mit ihm ein großer Philosoph vor ihr stehen könne. Aber Philosophen waren vermutlich weder tätowiert, noch ließen sie sich die Haut mit Nieten durchlöchern.
Ein Künstler, ein Popstar, war ihr zweiter Gedanke gewesen, ein geistig Verwandter ihres Idols Hansi Hinterseer, und voller Bewunderung hatte sie den Fremden im diskretesten Raum ihres Hotels im zweiten Stock untergebracht, wo er weder von hitzigen Stammtischgesprächen noch von überlauten Fernsehgeräuschen behelligt werden würde. Wenn er wollte, konnte er die Fenster öffnen und den Frühling hereinlassen, allerdings würden ihm dann die Amseln was zwitschern, hatte sie bemerkt, hilflos ihrem kleinen Witz hinterhergekichert und ihm die Tür aufgeschlossen. Er hatte ihren Scherz nicht verstanden. Aber sie verzieh ihm. Große Künstler schwebten bisweilen in ihren eigenen Welten.
Abends hatte sie ihrer Mutter Kreszentia von dem Mann mit den abenteuerlichen Tätowierungen und dem Kopf voller silberner Kettchen und Ringlein erzählt und ihr gesteckt, dass das sicher eine ganz berühmte Persönlichkeit sei, die nun inkognito bei ihnen wohne.
Klar, dass es sich die inzwischen fast Neunzigjährige nicht nehmen ließ, ihren seit Wochen einzigen Hotelgast persönlich in Augenschein zu nehmen und ihm das Frühstück zu servieren, wobei ihr jedoch Daniela, die Küchenhilfe, das Tablett bis vor die Nummer acht tragen musste.
„Das glaubst doch g’wiss selber ned, dass der da oben ein berühmter Künstler wär“, hatte sie ihrer Tochter mitgeteilt und verwundert über so viel Blauäugigkeit den Kopf geschüttelt. „Ich hab mir extrig noch meine gute Brillen aufg’setzt und auf den Schlag g’spannt, dass der da ein ganz ein normaler Mensch ist, wenn ned gar ein Hungerleider. So was seh ich nämlich gleich an den Schuhen. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass du den Leuten auf d’ Schuh schaun sollst. An den Schuhen siehst nämlich gleich, was jemand für einer wär.“
Dabei könnt doch aus jedem einfachen Menschen irgendwann auch noch einmal was ganz was Großes, so wie ja alle Großen eigentlich früher auch einmal ganz normal gewesen sein müssen, dachte Teres trotzig, während sie den weitläufigen Flur mit seinen breiten Holzdielen betrat, von dem rechts und links je vier Zimmertüren abgingen und an dessen Stirnseite sich in einem großen Westfenster die Kühlturmwolke des Atomkraftwerks Ohu zeigte. Wenn sie hier oben stand, wusste sie wenigstens immer gleich, woher der Wind wehte.
Sie putzte in aller Ruhe die Fensterflügel des Westfensters, hörte den Fremden hinter verschlossener Tür telefonieren und versuchte gewohnheitsmäßig, etwas aufzuschnappen. Er redete in einer Sprache, die sie nicht verstand. Seine Sätze waren kurz und abgehackt, manchmal wurde die Stimme laut, als gäbe es etwas zu beklagen, dann wieder leise und lockend. Eine schöne Stimme, dachte Teres, die ihr Leben lang nur von Träumen gelebt hatte und bedauerlicherweise nie in Versuchung gekommen war, irgendwelchen Verlockungen nachzugeben. Dafür pflegte sie jedoch alles, was auch nur im Entferntesten mit Liebe zu tun haben könnte, gedanklich mit rosafarbenem Zuckerguss zu überziehen.
Rechtzeitig zu ihrem fünfzigsten Geburtstag waren Teres’ Haare grau geworden, jetzt, mit Anfang sechzig, hatte sie von einer Stammkundin die Geheimnisse der Chemie erfahren und färbte sich ihr langes und immer dünner werdendes Haar allsamstäglich in einer gewagteren Farbe. Da es ihr bisher noch nie gelungen war, die Substanz gleichmäßig zu verteilen, erinnerte ihr Schopf an eine Vorführpalette für Erdfarben.
Hingebungsvoll wienerte sie die Glasscheibe des Westfensters und versank dabei in ihrem Lieblingstraum, dessen Haupthandlung sich darin erschöpfte, dass der große Hansi Hinterseer sie entdeckte und um ihre Hand anhielt. Okay, sie war fast zwanzig Jahre älter als er, und garantiert würde ein Aufschrei des Entsetzens durch die Presse gehen, aber Hansi würde zu ihr halten, ihre inneren Werte loben, ihre Liebenswürdigkeit preisen, und an seiner Seite würde sie aus dem Musikantenstadel im Fernsehen auf ihre treuen Stammgäste im Blauen Vogel hinunterblicken und diese gnädigst grüßen.
»Mei, unser Teres, da schau her, so weit hat’s die nun doch noch bracht, bis ins Fernsehen, dabei war die doch allerweil stinknormal«, würde es heißen.
„Seht gut hin, Brüder und Schwestern, und lasset eure Hoffnung ned fahren, denn es kann eben doch zum Ruhme des Herrn jederzeit direkt aus unsrer Mitten naus was ganz was Großes herwachsen“, würde Hochwürden Moosthenninger an der Stelle verkünden und ...
Der Schlag kam plötzlich, ohne Vorwarnung, und war höchst wirkungsvoll. Lautlos sackte die Juniorwirtin des Blauen Vogels auf ihrem eigenen Flur vor dem halb geputzten Panoramafenster zusammen.
Der Riese hinter ihr atmete auf, legte unter einem dunklen Wolltuch eine Zweikilohantel frei, schlug sich einen ebenfalls schwarzen Schal um den Hals und platzierte die Hantel mit behandschuhten Fingern neben Teres. Dann vergewisserte er sich, dass die bewusstlose Frau nicht auf Anhieb vom Bewohner des Zimmers acht entdeckt werden konnte, straffte sich und klopfte dreimal kurz an die Tür.
„Mittagessen heute besonders früh, oder?“, murmelte es auf Deutsch von innen, und ein Schlüssel drehte sich im Schloss.
Dann ging alles ganz schnell. Die Waffe an der Stirn des vermeintlich größten Popstars aller Zeiten. Wegen des Schalldämpfers hörte sich der Schuss an, als fiele ein großer Korken zu Boden. Der tödlich Getroffene brach augenblicklich in sich zusammen. Der Riese zog ihn an seinem Hemdkragen in die Mitte des Zimmers und schloss die Tür. Zielstrebig riss er den silbernen Piercingschmuck ab, Stück für Stück, zerrte Ringe, Kettchen und Stifte aus Mundwinkel, Lippen, Ohren, Augenbrauen, Nasenflügeln und von der Zunge des Toten. Dann entkleidete er ihn, rümpfte die Nase über vermutlich geschmacklose Tattoos und pflückte weitere Silberteile vom nackten Körper des Opfers. Achtlos stopfte er sich den blutigen Schmuck in die Hosentasche und verschwand ebenso unbemerkt, wie er gekommen war.
Kapitel 2
Seit acht Uhr vormittags hatten die drei Männer eine Skulptur nach der anderen aus ihrem Kunsttransporter herausgetragen, von dicken Noppenfolien befreit und in den sonnendurchfluteten Vorgarten der Bildhauerin gestellt.
„An der Binder merke ich, dass und wie sich die Jahreszeiten verschieben“, sagte Vincent Delle, der Kunstspediteur, und fügte hinzu: „Früher ist die nie vor Ende April gekommen. Und jetzt schon Anfang März. Das alles haben wir nur der Erderwärmung zu verdanken.“
„Wie lang machst du das eigentlich schon?“, wollte der kräftige Mann neben ihm wissen.
„Zwölf Jahre bestimmt. Und soll ich dir was verraten? Schöner werden sie auch nicht mehr, weder sie noch ihre Werke.“ Der Spediteur grinste.
Sein Kollege nickte und griff sich ans Kinn: „Weißt du, ich verstehe das Prinzip nicht. Angeblich sind einige von den Skulpturen fertig und andere nicht. Die fertigen sollen in den Ausstellungsraum und die unfertigen ins Atelier – nur, ich sehe da keinen Unterschied. Weißt was, ich stell erst mal alle in den Hof. Soll sie uns dann sagen, wo es langgeht.“
Vincent Delle gab ihm recht: „Genau, sie wollte ja am frühen Nachmittag hier sein.“
Das kleine schmale Männlein, das von der südlichen Grundstückskante her auf sie zugeschlendert kam, bemerkten sie erst, als es schon neben ihnen stand.
„Ja, was soll denn das da vorstellen, wenn’s fertig ist?“, fragte der Mann, pfiff kurz und trocken durch die Zähne und stellte sich mit einer angedeuteten Verbeugung vor: „Grüß Gott beieinand, Schmiedinger ist mein Name, Leopold Schmiedinger. Tät ich höflichst fragen dürfen, was ihr mir da herstellt? Ich wohn nämlich da.“
Vincent Delle musterte ihn interessiert von oben bis unten. „Schmiedinger? So heißt doch der Polizeiobermeister von Kleinöd. Der Schmiedinger Adolf. Sind Sie sein Bruder?“
„Ja um Gottes willen! Das tät mir grad noch abgehn!“ Der kleine Mann schüttelte energisch den Kopf. „Naa, das ist bloß ein Vetter von mir – allerdings, wenn S’ mich schon direkt fragen, ein sauber zu fetter Vetter.“ Er lachte gackernd und mit bebenden Schultern.
„Wenn der Kerl hier wohnt, müsste er doch eigentlich wissen, was wir hier anliefern“, meinte der jüngere der beiden Möbelpacker. „Also, eigenartig ist das alles schon.“
Das kleine Männchen stellte sich sehr gerade und aufrecht hin.
„Wohnen Sie denn nicht beim Schmiedinger?“, fragte Vincent Delle und wies auf das Haus des Polizeiobermeisters, das im Südwesten an den Grundstücksrand der Bildhauerin anschloss.
„Ach, geh weiter, schon ewig nimmer. Da hab ich mich doch lieber auf meine eigenen Füß g’stellt und wohn jetzt dahinten im Gartenhaus. Seit Januar, um genau zu sein. Ist garantiert besser so. Für uns alle zwei.“
„Dann sind also Sie jetzt der Hausmeister von Frau Binder?“
„Horch zu, auch wenn ich vielleicht ned so ausschau: Ich bin fünfundsechzig. Sie glauben doch wohl ned, dass ich da noch irgendwas arbeiten tät“, stellte Leopold Schmiedinger klar. „Ich leb da und fertig. Das Leben an und für sich ist schon anstrengend g’nug für unsereins. Da brauch ich mir die Arbeiterei ned auch noch antun. Die Frau, der was das Haus g’hört, weiß übrigens schon Bescheid. Der Bürgermeister selber hat in meine Angelegenheiten mit ihr telefoniert und alles abklärt. Im Sommer werd ich sie dann mal selber kennenlernen dürfen. Da freu ich mich schon drauf. G’wiss ist das eine ganz eine weltgewandte Person.“
„Nicht erst im Sommer, mein Freund“, murmelte Vincent Delle. „Heute Nachmittag schon.“
Der kleine Herr Schmiedinger hob den Kopf: „Was haben Sie g’sagt?“
„Nichts Besonderes – außer, dass wir hier Kunst anliefern. Danach hatten Sie ja gefragt. Frau Binder ist nämlich eine sehr berühmte Bildhauerin. Das hier sind übrigens ihre Skulpturen. Sie sollten sich schon mal mit ihnen vertraut machen.“
Leopold Schmiedinger umrundete schweigend die Objekte und schien ihren Wert abzuschätzen. Dann nickte er mit Kennermiene: „Ned schlecht – und das in aller Herrgottsfrüh. Apropos früh: Wissen S’ was? Ich geh jetzt erst einmal zum Supermarkt nüber und hol mir was zum Essen. Habe die Ehre.“ Er verbeugte sich leicht und verschwand.
„Was für ein komischer Vogel. Aber irgendwie passt er hierher. In Kleinöd gibt es eine Menge komischer Vögel – möglicherweise heißt deshalb das Gasthaus Zum Blauen Vogel“, beendete Vincent Delle das kurze Intermezzo, sprang auf die Ladefläche seines Transporters und umarmte die nächste Skulptur aus dem Atelier der Binder mit solcher Behutsamkeit, als halte er seine Geliebte im Arm.
Vier Stunden lang arbeiteten sie verbissen und konzentriert, machten keine Pausen, rauchten keine Zigaretten und stellten eine Skulptur nach der anderen vor dem gläsernen Atelier der Künstlerin auf, als wüssten sie, dass die Nachbarn alles genauestens im Blick hatten.
Im Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte Eduard Daxhuber gegen acht Uhr dreißig die Gardine des Wohnzimmerfensters ein klein wenig zur Seite geschoben und gerufen: „Otti, schau dir das da einmal an! Was täten denn die jetzt schon wollen bei uns? Die Binder hat doch in all den Jahren allerweil einem jeden verzählt, dass sie bloß die Monate ohne r im Dorf verbringen möcht. Aber der März hat ja wohl ein r und der April auch. Das tät unterm Strich heißen, dass die heuer fast sechs Wochen zu früh dran wär.“
„Wird schon am Klimawandel liegen“, stellte Frau Daxhuber lapidar fest, warf einen kurzen Blick aus dem Fenster und murmelte ärgerlich: »Nachad geht der ganze Zirkus heuer schon vor Ostern los. Mit Sicherheit hat die wieder ihre hunderttausend g’schreimauligen Katzen dabei und ihren polnischen Stecher, ihren komischen Gärtner da! Ach, was red ich überhaupt drüber, im Grunde will ich doch gar nix Genaues wissen davon.« In den Kitteltaschen ballte sie die Hände zu Fäusten und ging zurück in die Küche.
„Was hast denn jetzt gar so gegen die?“, wollte ihr Mann wissen.
„Nix! Gar nix!“ Ottilies Stimme klang hart.
Er würde es ja doch nicht verstehen. Aber die Binder hatte alles, während sie, Ottilie, ihr ganzes Leben lang nur eine unverschämt kleine Auswahl an Freude gehabt hatte und nun nichts mehr besaß außer einem gebrochenen Herzen. Die Tochter war weggezogen und mit ihr das einzige Enkelkind, das nun bereits in die Schule gekommen sein musste und garantiert schon schreiben gelernt hatte, aber noch keinen einzigen Brief an seine Oma geschickt hatte. Bis heute nicht. Undankbar war die Welt und grausam. Und was letztendlich für sie übrig blieb, waren die Küchenabfälle des Lebens, waren neidische Blicke auf das pralle Leben jener, die im Überfluss schwelgten, während sie von nichts als Trostlosigkeit umgeben war: kochen, essen und fernsehen. Und dort drüben lebte eine Frau namens Ilse Binder, und die nahm und erlaubte sich alles, was sie wollte, und je mehr sie sich erlaubte, umso erbärmlicher wurde das Leben der Ottilie Daxhuber.
Einen Liebhaber hatte ihre prominente Nachbarin sich gekauft und ihn dem ganzen Dorf als ihren Gärtner vorgestellt: „Karl, mein Mann fürs Grüne!“ Ottilie schüttelte verächtlich den Kopf. Schämen sollte die sich!
Sie verstand nicht, warum die hässlichen Skulpturen der Bildhauerin ständig für Hochglanzmagazine fotografiert und in Ausstellungen gekarrt wurden, wieso ausgerechnet diese Nachbarin, der sie schon tagsüber nicht unbedingt begegnen wollte, sie abends am Fernsehschirm selbstsicher anlächelte und in Talkshows über alte und neue Werte redete. Ilse Binder durfte dick und hässlich werden wie ihre eigenen Figuren und wurde dennoch immer bewundert und von allen geliebt. Sie leitete in München an der Akademie der Bildenden Künste einen Kurs und durfte sich seitdem Frau Professor nennen und ihre Lieblingsschüler zu sich einladen. Diese schönen und blässlichen jungen Männer und Frauen schwebten dann mit erleuchteten Blicken über die einzige Dorfstraße und hielten sich für so auserwählt, dass man mit denen schon gar nicht reden konnte.
Sie, Ottilie Daxhuber, hatte niemanden mehr, den sie lieben konnte. Ihr Mann war wie ein Teil von ihr, und wer käme schon auf die Idee, sich in die eigene Hand oder den eigenen Fuß zu verlieben. Ach, das Leben war ungerecht.
„Das Autorenpaar Katharina Gerwens und Herbert Schröger legt mit dem vierten Kleinöd-Krimi erneut eine spannende Geschichte vor, verbrämt mit wunderbarem Lokalkolorit, vielen Dialogen im Dialekt und angereichert mit liebevollen Liebesgeschichten.“
„Die Figuren sind so schräg, liebenswert und unterhaltsam verschroben gezeichnet, dass es eine Freude ist, den Charakteren durch diese ziemlich abstruse Geschichte zu folgen.“
Bajuwarisches Gegrantel, menschliche Abgründe und eiskalte Morde – in Kleinöd fühlt sich jeder Krimifan sofort heimisch.
„Ein witziger Krimi, in dem man förmlich das Muhen der Kühe hört.“
„Das Autorenpaar Katharina Gerwens und Herbert Schröger legt mit dem vierten Kleinöd-Krimi erneut einen spannende Geschichte vor, verbrämt mit wunderbarem Lokalkolorit, vielen Dialogen im Dialekt und angereichert mit liebevollen Liebesgeschichten. (…) Ein unterhaltendes Lesevergnügen.“
Kleinöd ist überall!
„Die niederbayerische Szenerie lebt von ihren Details.“











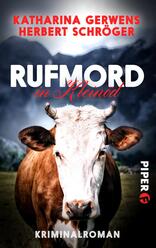



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.