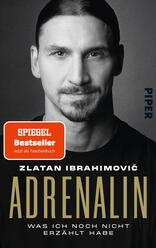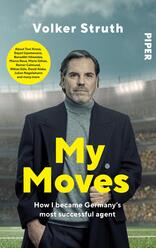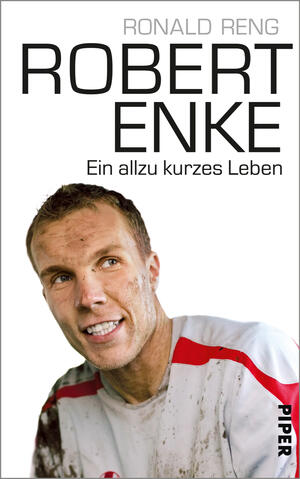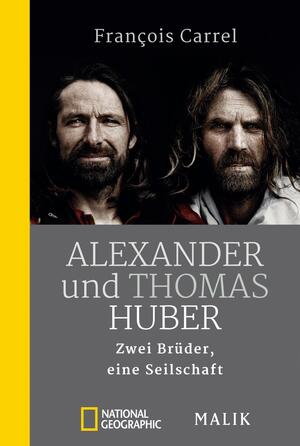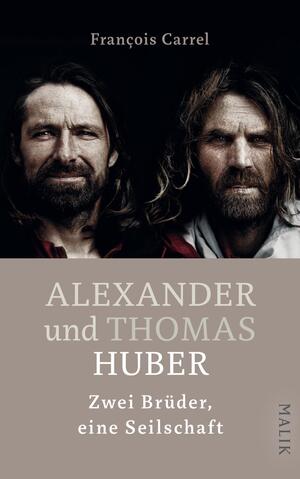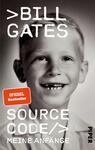Prolog
Die nachlassende Kraft der Poesie
Sie hätte gerne ein Gedicht, sagt Teresa, und für eine Sekunde, die eine Ewigkeit dauert, wird es still im Haus.
Robert Enke sieht seine Frau fragend an, unsicher, ob sie das ernst meint. Ein Gedicht soll er ihr zum Geburtstag schenken? „Das wäre doch mal schön“, sagt Teresa beiläufig und denkt schon bald nicht mehr daran.
Er dagegen wird die Idee nicht mehr los.
Es ist einige Jahre her, seit er das letzte Mal ein Gedicht gelesen, geschweige denn geschrieben hat. Er versucht, sich daran zu erinnern. Ein Gedicht, findet er, muss sich reimen, ein schönes Gedicht, glaubt er, sei wie ein angedeutetes Lächeln, mit feinem Humor zwischen den Zeilen. Mit dieser Idee im Kopf beginnt Robert Enke zu schreiben.
An manchem Nachmittag lügt er Teresa an, er ginge kurz in sein Büro, Steuerunterlagen abheften, Banküberweisungen erledigen. Dann sitzt er mit Kugelschreiber und einem Schmierblatt am Schreibtisch. Der Blick schweift in den Garten. Ein einziges riesiges Fenster bildet die Rückseite seines Büros, es ist ein behagliches Gefühl, wenn im Frühling die Sonnenstrahlen durch die Scheibe auf ihn fallen. Jetzt im Winter allerdings ist es am Schreibtisch weniger angenehm. Die Heizung in seinem Büro funktioniert nur leidlich. Ihr Haus in Empede, auf dem flachen niedersächsischen Land, ist ein umgebauter Bauernhof. Sein Büro war der Stall.
Krumm und ruppig sehen die Worte aus, die er auf das Papier bringt, er benutzt die wertvollen Finger eines Fußballtorwarts nur selten zum Schreiben. Doch in seinem Kopf formen sich die Worte immer schneller zu Reimen, eine Freude ergreift ihn, nicht so flutartig wie das Glück, wenn er einen schwierigen Schuss über die Torlatte lenkt, eher sanft, aber doch so intensiv, dass Robert Enke immer mehr schreiben muss, im Büro, im Hotel am Abend vor einem Bundesligaspiel, auf Schmierzetteln, auf Rechnungsrückseiten. Manchmal, wenn er kein Papier zur Hand hat, tippt er seine Einfälle ins Handy. Als der große Tag, der 18. Februar 2009, gekommen ist, hat er ein Gedicht mit 104 Zeilen geschrieben.
Er gratuliert Teresa noch im Bett zum Geburtstag. Während sie ins Bad geht, schleicht er hinaus in die Diele und lässt die Hunde ins Freie. Sie haben neun, dazu zwei Katzen. Teresa hat sie in ihren Jahren in Südeuropa auf der Straße aufgelesen. Zu ihrem vorherigen Geburtstag wünschte sie sich ein Hausschwein. Er entschied sich, es für einen Witz zu halten.
Er zündet im Wohnzimmer Kerzen an.
„Lass uns das mit den Geschenken doch heute Nachmittag machen, wenn wir mehr Ruhe haben“, sagt Teresa, als sie hereinkommt.
Er schüttelt den Kopf, es dauere nicht lange, er bittet sie, sich doch nur kurz an den alten Bauerntisch zu setzen, er drückt sie sanft an den Schultern auf den Stuhl und hört dabei nicht auf, vor Vorfreude zu lächeln. Dann nimmt er auf der anderen Seite des Tischs Aufstellung.
Er legt sein Gedicht vor sich. Aber er spricht frei.
Zum Geburtstag, was soll es sein?
Ein Diamant, ganz groß und rein?
Oder doch die Uhr vom Juwelier?
Bielert ist nicht teuer, glaube mir.
Wie wäre es mit einem Schwein für das Haus?
Das schließt der Robbi komplett aus.
Katzen, Pferde oder ein Hund,
nein, jetzt wird’s mir doch zu bunt.
Es muss doch noch was anderes geben,
wonach Teresa strebt im Leben.
Ja, sie wünscht sich ein Gedicht!
Mir treibt’s ein Lächeln ins Gesicht.
Endlich mal nicht groß, viel, teuer,
trotzdem ist es mir nicht geheuer.
Teresa ist still vor Glück. Strophe für Strophe trägt er ihr halbes Leben vor, der Umzug nach Empede, ihre Tierliebe, auch der Tod ihrer Tochter Lara, die mit einem schweren Herzfehler auf die Welt kam und mit zweieinhalb Jahren nach einer Operation starb, Dann kam Lara mit halbem Herzen/das bereitete uns Schmerzen/doch sie war stark, und man bedenke/es handelt sich um eine Enke. Als sein Vortrag zu Ende ist, hat Teresa Tränen in den Augen. Sie sagt nur einen Satz: „Bitte lies es mir noch einmal vor.“
Er beginnt von vorne, alle 26 Strophen, 104 Zeilen. Am Ende reimt er:
Man fragt sich, wie geht es jetzt weiter
auf unserer langen Lebensleiter?
Bleibt der Opi, bleibt er nicht?
Ist ein Umzug bald in Sicht?
Ich mache mir keine großen Sorgen,
das Heute geht, es kommt das Morgen.
Nur eins ist sicher, hör auf mich:
Ich brauche und ich liebe Dich!
Robert Enke ist 31, Torwart der deutschen Fußball-Nationalelf, stark, frohen Mutes, glücklich. Es wird der letzte Geburtstag sein, den Teresa mit ihm erlebt.
Am Dienstag, den 10. November 2009, ruft er „Hallo, Ela!“ aus der Küche, als die Haushälterin um neun Uhr zu ihnen kommt. Er gibt seiner zweiten Tochter Leila, die zehn Monate alt ist, einen Kuss auf die Stirn und verabschiedet sich von Teresa. An der Magnettafel in der Küche hat er sich mit Filzstift notiert, was noch alles zu erledigen ist, vier Karten für das Bayern-Spiel. Dann ist er aus der Tür. Er habe zweimal Einzeltraining, morgens mit dem Fitnesstrainer, nachmittags mit dem Torwarttrainer von Hannover96, gegen 18Uhr werde er zurück sein, wie immer. Das hat er Teresa gesagt.
Aber es ist kein Training an diesem Dienstag verabredet.
Ich erreiche ihn kurz nach halb eins auf seinem Handy im Auto. Ich soll zwei Anfragen ausrichten, ein befreundeter englischer Journalist will ihn interviewen, die Deutsche Olympische Sportbibliothek möchte ihn für ihre Jahrestagung im Januar als Gastredner gewinnen, Mensch, jetzt bin ich schon dein Sekretär, der dir Anfragen überbringt, will ich scherzen. Doch er ist kurz angebunden am Telefon; natürlich, er ist im Auto zwischen den zwei Trainingseinheiten, denke ich, er will sicher zum Mittagessen ins Espada oder Heimweh, wie immer. „Ich rufe dich heute Abend zurück, Ronnie, okay?“, sagt er, und ich erinnere mich nicht mehr, wie er sich verabschiedet.
Abends rufen dann nur viele andere Leute bei mir an.
Sein Selbstmord an diesem frischen Herbstabend vereinte Menschen, die ihm nahe waren, und Leute, die seinen Namen nie zuvor gehört hatten, in jenem Zustand, wenn man sich innerlich roh, wie aufgerissen fühlt. In den Tagen danach grenzte die Anteilnahme oft an Hysterie; dass in London die Times Robert Enke die halbe Titelseite widmete, in China das Staatsfernsehen in den Hauptnachrichten berichtete und die Nachrichtenagenturen die Zahl der Gäste der Trauerfeier wie Rekorde verkündeten („So viele wie noch nie in Deutschland seit Bundeskanzler Konrad Adenauers Begräbnis“), solche Dimensionen waren nur noch damit zu erklären, dass heutzutage alles, auch der Tod, zum Event wird. Im Innersten aber blieb ein echter Schmerz, eine tiefe Lähmung. Robert Enkes Tod offenbarte den meisten von uns, wie wenig wir von dieser Krankheit Depression verstehen. Den anderen von uns, und das waren erschreckend viele, wurde schlagartig bewusst, wie wenig wir über Depressionen sprechen können. Genau wie Robert Enke hatten sie immer geglaubt, ihre oder die Krankheit eines Familienangehörigen verheimlichen zu müssen.
Die Fakten stehen regelmäßig in der Zeitung: Mehr Leute sterben jedes Jahr durch Selbstmord wegen Depressionen als bei Autounfällen. Aber mehr als eine diffuse Vorstellung, dass für manche Menschen die Traurigkeit zu schwer zu ertragen sei, gaben uns diese Zahlen nicht. Und wenn die Schlagzeilen dicker wurden, weil Berühmtheiten wie Marilyn Monroe oder der Schriftsteller Ernest Hemingway sich umbrachten, dann schien dies – auch wenn man es nicht laut sagte – doch irgendwie seine Logik zu haben: Künstlern traut man das zu. Denn gehört Melancholie, eine düstere Seite, nicht unausweichlich zur Kunst?
Robert Enke aber war Deutschlands Nummer eins. Der Torwart ist der letzte Halt, ruhig und kalt in den heißesten Situationen, imstande, Stress und Ängste in den extremsten Momenten zu kontrollieren. Profisportler wie er leben uns jedes Wochenende wieder den Traum vor, alles sei machbar, und Robert Enke schenkte dem Publikum mehr als die meisten Fußballer die Illusion, jedes Hindernis sei überwindbar: Er fand mit 29 Jahren noch den Weg ins Tor der Nationalmannschaft, nachdem er nach einer ersten Depression vier Jahre zuvor schon arbeitslos gewesen und dann in der Zweiten Liga gestrandet war; ihm und Teresa gelang es, nach Laras Tod 2006 ein Leben parallel zum Schmerz zu finden. Und in einem Moment, in dem er nach unseren äußerlichen Wertvorstellungen doch das Glück endlich wiederentdeckt hatte, als er eine Familie mit Tochter hatte sowie die Aussicht, bei der Weltmeisterschaft in Südafrika im Tor zu stehen, bricht die Depression Anfang August 2009 schlimmer denn je aus.
Welche Kraft muss diese Krankheit besitzen, wenn sie einen wie ihn in den Trugschluss lockt, der Tod sei eine Lösung? Welche Finsternis muss ihn umgeben, wenn ein einfühlsamer Mensch wie er nicht mehr erkennt, welches Leid er anderen mit seinem Tod zufügt, denen, die er liebt, genauso wie dem Lokomotivführer, vor dessen Zug er sich an jenem Novemberabend stellt?
Wie lebt es sich mit Depressionen oder nur mit der Ahnung, sie könnten jeden Moment wiederkommen? Mit der Angst vor der Angst?
Die Antworten wollte Robert Enke gerne selber geben.
Er wollte dieses Buch schreiben, nicht ich.
Wir kannten uns seit 2002, ich berichtete gelegentlich für Zeitungen über ihn, auf einmal lebten wir in derselben Stadt, Barcelona. Wir trafen uns immer öfter, ich hatte das Gefühl, dass uns dieselben Dinge im Leben wichtig waren: Höflichkeit, Ruhe, Torwarthandschuhe. Irgendwann sagte er: „Ich habe ein Buch von dir gelesen, fand ich super!“ Ich errötete von dem Lob und antwortete panisch, nur um mit etwas vermeintlich Keckem dem Gespräch schnell eine andere Richtung zu geben: „Eines Tages schreiben wir gemeinsam eines über dich.“ Meine Verschämtheit wuchs, als ich merkte, er verstand meinen spontanen Spruch als ernsthaften Vorschlag.
Danach erinnerte er mich immer wieder einmal an unser Projekt, „ich habe mir Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse“. Heute weiß ich, warum ihm die Biografie so sehr am Herzen lag: Wenn seine Torwartkarriere vorbei war, würde er in der Biografie endlich von der Krankheit erzählen können. Ein Torwart, der letzte Halt, darf in unserer Leistungsgesellschaft nicht depressiv sein. So wandte Robert Enke ungeheure Kraft auf, um seine Depressionen geheim zu halten. Er sperrte sich in seiner Krankheit ein.
So muss ich seine Geschichte nun ohne ihn erzählen.
Es ist schwer vorstellbar, dass ich jemals wieder auf solch schonungslos offene Interviewpartner treffen werde wie auf der Reise durch Roberts Leben. Freunde von ihm erzählten plötzlich von ihren eigenen schwarzen Gedanken. Seine Torwartkonkurrenten, die sich, ein Gesetz des Profisports, doch in Interviews die Maske des Unverwundbaren aufsetzen sollen, redeten auf einmal über ihre Zweifel und Ängste.
Der Tod eines geliebten Menschen löst in den meisten von uns den Drang aus, ehrlich zu sein, Gutes zu tun, die Dinge ändern zu wollen. Doch in erster Linie bringt ein öffentlicher Tod eines hervor: unsere menschliche Hilflosigkeit.
Wir wussten nicht einmal, wie wir angemessen trauern sollten. Grausam wogten die Diskussionen durch Deutschland, ob die Trauerfeier im Fußballstadion von Hannover noch pietätvoll oder schon Teil eines Events war. Auch Roberts Mutter störte sich daran, dass der Sarg im Stadion aufgebahrt war. „Da dachte ich mir: Mensch, er ist doch nicht Lenin!“, sagt Gisela Enke, als wir in ihrer Küche in Jena sitzen. Robert, sportlich-elegant im samtblauen Pullover mit V-Ausschnitt unter dem grauen Anzug, hält sie fest im Arm auf einem der vielen Fotos über dem Esstisch. Aber wie sie hier sitzt, eine energiegeladene, herzliche Frau, lehrt sie uns alle Demut: Sie hat verstanden, dass es absurd ist, sich darüber zu streiten, wie gelungen die Trauerfeier war, sie hat ihren Frieden gefunden im Wissen, dass alle das Beste wollten; dass wir gerade auch dann, wenn wir beseelt sind, Gutes zu tun, sehr viel falsch machen.
Viele haben seinen Tod falsch verstanden: Er habe sich umgebracht, weil er sein Leben nicht mehr aushielt. Es gab Nachahmungstäter, weil sie sich in den Irrsinn hineingesteigert hatten, dann seien sie wie er, dann seien sie ihm nahe. Welch ein tragisches Missverständnis. Die meisten depressiven Menschen, die einen Selbstmordversuch begehen, wollen nicht sterben. Sie wollen nur, dass diese Finsternis endlich verschwindet, die ihre Gedanken bestimmt. Robert Enke ging es wohl nicht anders. „Wenn du nur einmal eine halbe Stunde meinen Kopf hättest, dann würdest du verstehen, warum ich wahnsinnig werde“, sagte er einmal zu Teresa.
Es spielt keine Rolle, wie viele solcher Erklärungen ich finde, die Fragen, die immer wiederkehrenden, sich im Kreise drehenden Fragen, lassen sich von keiner Antwort aufhalten.
Ist etwas in seiner Kindheit passiert, das ihn anfällig für Depressionen machte? Was ging ihm an jenem Novemberdienstag durch den Kopf, als er acht Stunden lang mit seinem Auto umherfuhr, ehe er auf die Zuggleise trat?
Die Fragen melden sich unerbittlich wieder, auch am Tag nach Teresas 34. Geburtstag, der gleichzeitig ihr erster Geburtstag ist; der erste ohne ihn. Wir sitzen in der Küche in Empede, Leila vergnügt sich mit dem Lieblingsspiel aller einjährigen Kinder: Sie räumt die Küchenschränke aus.
Die Geburtstagsfeier am Vorabend war erträglich gewesen. Das sind Teresas neue Maßeinheiten: erträglich oder unerträglich. Viele Nachbarn kamen mit ihren Kindern vorbei und brachten selbst gebackenen Kuchen, Blumen, beste Wünsche, ohne dass ihnen Teresa, ohne dass ihnen irgendjemand etwas gesagt hatte. In der Küche versammelte sich ein Dutzend Freunde. Die Glückwunschkarten lese sie lieber erst später, sagte Teresa. Und kurz wurde es still. Wie falsch vermeintlich exakte Wörter klingen können: Glückwunschkarten.
Nun, am Morgen danach, sind die Gäste wieder abgereist. Die Leere im Haus, diese absolute Abwesenheit, ist wieder spürbar, und zwangsläufig muss Teresa an den Geburtstag davor denken, ihren 33., der auf eine Art immer auch ihr letzter bleiben wird. Als Robert ihr das Gedicht schenkte.
Teresa hat noch an die Kraft der Poesie geglaubt, als ihn die Depression im Spätsommer 2009 erwischte. „Schreib mir doch mal wieder ein Gedicht“, sagte sie ihm am Telefon, als er Anfang September in Köln auf einem Lehrgang der Nationalelf im Hotelzimmer lag und die Angst vor dem neuen Tag, die Furcht, irgendjemand erwarte irgendetwas von ihm, ihn nicht aus dem Bett kommen ließ. Abends schob er einen Stuhl auf den Balkon seines Hotelzimmers, im Hintergrund leuchtete der Kölner Dom, und Robert Enke dichtete wieder auf dem Handy:
Sitze auf dem Balkon,
mein Kopf ist ein Ballon.
So schwer wie Blei und Stein,
das kann doch so nicht sein.
Er spürte die Freude nicht mehr, die schöne Worte auslösen können, die Zufriedenheit, die es verschafft, Gedanken aufzuschreiben. Sein Gedicht war ihm gleichgültig.
Auch in seinem Tagebuch, das er während seiner Depression führte, wurden die Einträge immer knapper, je heftiger die Krankheit ihm zusetzte. Auf der letzten Seite steht ein einziger Satz in riesigen Buchstaben. Es sollte vermutlich eine Mahnung an ihn selbst sein, aber heute liest sich sein Satz wie eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns:
„Vergiss nicht diese Tage.“
Eins
Ein Glückskind, eigentlich
An einem Sonntagnachmittag ging Robert Enke zum Jenaer Westbahnhof und begann zu warten. Der Fernzug aus Nürnberg fuhr ein, Passagiere stiegen aus, und er ließ sich keine Enttäuschung anmerken, als sie alle an ihm vorbei vom Gleis gingen. Er wartete weiter. Zwei Stunden später traf der Vorabendzug aus Süden ein. Wieder ließ er alle Ankommenden gespielt beiläufig an sich vorbeiziehen. Es war Winter, Dezember 1995, nicht die optimale Jahreszeit, um im zugigen Bahnhof den halben Sonntag den Zügen hinterherzuschauen. Er entschied sich, bis zur nächsten Zugankunft ins Kino zu gehen. Er lebte noch bei seiner Mutter im Plattenbau in der Liselotte-Herrmann-Straße, vor vier Monaten war er 18 geworden, ein Alter, das fast jedes eigenwillige Verhalten entschuldigt und in dem, nach eigener Meinung, sich doch eigentlich immer nur die anderen eigenartig verhalten.
Teresa kam sonntags immer mit dem letzten Zug aus Bad Windsheim ins Sportgymnasium nach Jena zurück. Auch in ihrem zweiten Jahr in Jena fuhr sie noch jedes Wochenende zu ihren Eltern nach Franken. Sie legte einen Schritt zu, um aus dem eisigen Bahnhof zu gelangen, als sie ihn auf der Bank entdeckte. Sie saß neben Robert in der Schule. Als sie, eine Fremde aus Bayern, anderthalb Jahre zuvor in die zwölfte Klasse des Sportgymnasiums gekommen war, hatte es nur zwei freie Plätze zur Auswahl gegeben, alleine in der letzten Reihe oder neben Robert. Sie kamen gut miteinander aus, fand sie, nur über seine Frisur würde sie an seiner Stelle noch einmal nachdenken. Seit er neben der Schule bei den Profifußballern von Carl Zeiss Jena trainierte, trug er die blonden Haare nach deren Modeverständnis seitlich kurz, oben lang, „wie ein Vogelnest auf dem Kopf“.
„Hallo, was machst du denn hier?“, fragte sie ihn auf dem Bahnsteig, es war nach 22 Uhr.
„Ich warte auf jemanden.“
„Ach so. Na dann, noch einen schönen Abend.“
Sie lächelte ihm kurz zu und hastete weiter.
„Mann!“, rief er ihr hinterher. „Auf dich warte ich natürlich!“
Und zwar schon seit über fünf Stunden, erzählte er ihr kurz darauf, als sie im French Pub etwas tranken.
Er hatte niemandem davon erzählt, dass er einfach einmal auf Teresa am Bahnhof warten würde. Seine Gefühle, seine wichtigen Entscheidungen machte er alleine mit sich aus. Noch wochenlang, während er und Teresa sich näherkamen, erzählte er seinen Freunden nichts davon. Es überraschte sie allerdings nicht, dass die beiden dann ein Paar wurden, dass Robert Enke auch das schaffte. „Wir unterhalten uns noch oft darüber“, sagt einer der Jugendfreunde, Torsten Ziegner, „dass der Robert ein richtiges Sonnenkind war, dem alles gelang, den nichts aus der Bahn werfen konnte, der immer gut gelaunt war.“ Torsten gibt dem Wasserglas vor ihm eine Drehung, um die kurze Stille nicht zu groß werden zu lassen. Und jeder für sich im Wohnzimmer von Andy Meyer, einem weiteren Freund von damals, denkt augenblicklich dasselbe. Wie seltsam es klingt, an Robert Enke heute als Sonnenkind zu denken.
Das Tageslicht, vom Schnee reflektiert und greller gestimmt, fällt durch das Fenster des Einfamilienhauses in Jena-Zwätzen, einem Neubaugebiet draußen vor der Stadt. Es ist 13Uhr, Andy ist gerade aufgestanden. Ein Rest Müdigkeit liegt noch in seinen Augen. Er ist Krankenpfleger und hatte Nachtschicht. Bei Torsten sitzt die Jeans locker, sportlich-leger, die Jacke mit kleinen Karos und Stehkragen würde den Rockstars von Oasis gefallen. Er ist Fußballprofi, mit 32 wieder beim FC Carl Zeiss Jena in der dritten Liga, ein schmaler, drahtiger Athlet. Man sieht Andy und Torsten, Anfang 30, und spürt schnell die Wärme, den Humor der Jugend; von damals. »Wir haben gleich gemerkt, dass wir dieselben Interessen haben; das heißt vor allem dieselben Desinteressen«, sagt Torsten. „Mehr als alles andere“, sagt Andy, „haben wir gelacht.“
Immer zu viert waren sie damals, Mario Kanopa, den es als Lehrer an die holländische Grenze verschlagen hat, Torsten Ziegner, Andy Meyer und Robert Enke, den sie Enkus nannten, den sie weiter Enkus nennen, weil er für sie der von damals geblieben ist. „Aber doch“, redet Andy schließlich tapfer gegen die Stille an, „eigentlich denke ich das noch heute, trotz allem: Der Enkus war das Glückskind.“
Er wuchs zwischen den Wäschestangen auf. Sie trafen sich nachmittags im Innenhof, über die Stange hieß das Spiel der Siedlung. Einer stand zwischen zwei Wäschestangen im Tor, lupfte den Ball über die gegenüberliegende Stange, auf der anderen Seite wartete der Spielpartner, um den Ball volley auf das Tor zu schießen.
Von Ferne ist seine Heimat, die Trabantenstadt Lobeda, noch heute das Erste, was man von Jena sieht. 40000 Menschen sollten hier wohnen, mehr als ein Drittel der Einwohner Jenas. 17000 sind geblieben. Zwischen den 15-stöckigen Plattenbauten an den kommunistischen Boulevards stehen in den Seitenstraßen etliche niedrigere Mietblöcke, die sich von denen in Frankfurt-Schwanheim oder Dortmund-Nordstadt nicht unterscheiden. Während die beiden deutschen Staaten sich permanent an ihre Unterschiede erinnerten, ähnelte sich in den Achtzigern zwischen diesen Mietblöcken das Jungenleben in Ost und West. Wäschestangen regierten die Welt von Jena-Lobeda bis Frankfurt-Schwanheim.
Von den Erwachsenensorgen, sagt Andy Meyer, hätten sie erst nach dem Zusammenbruch der DDR erfahren; vielleicht hätten sie sie als Kinder aber auch einfach langweilig gefunden und deshalb ignoriert. Dass Andys Vater nicht Lehrer werden durfte, weil er nicht in der Partei war; dass Roberts Vater Anfang der Sechziger als 400-Meter-Hürdenläufer aus der Leistungssportförderung flog, weil er Postkarten von seinem in den Westen geflüchteten Bruder erhielt.
Sie unterbrachen das Fußballspielen im Innenhof nur für besondere Anlässe – wenn sie zum Fußballtraining mussten. Andy Meyer, der ein paar Blöcke weiter wohnte, war früh vom großen Klub der Stadt, dem FC Carl Zeiss, gesichtet worden. Er war sieben Jahre alt gewesen und es gewohnt, mit Carl Zeiss immer zu gewinnen. Deshalb erinnert sich Andy besonders an die eine Niederlage. Auf dem holprigen Sportplatz Am Jenzig, zu Füßen des Jenaer Hausbergs, verlor der FC Carl Zeiss 1:3 gegen den SV Jenapharm. Große Klubs haben ihre Art, sich solche Niederlagen nicht gefallen zu lassen, selbst in Kinderteams: Helmut Müller, der Trainer von Carl Zeiss, ging sofort nach dem Spiel zu den Eltern des Stürmers von Jenapharm, der alle drei Tore erzielt hatte, und sagte ihnen, der Sohn solle sich doch augenblicklich Carl Zeiss anschließen. Es war Robert Enke.
In jeder Sportlerbiografie findet sich ein Moment, bei dem die einen sagen: Was für ein Zufall! Und die anderen: Das also nennt man Schicksal. Muhammad Ali wurde mit Zwölf sein Swinn-Fahrrad gestohlen, und der Polizist, der seine Anzeige aufnahm, riet ihm, statt zu heulen doch Boxer zu werden. In der D-Jugend des FC Carl Zeiss Jena, in der Robert Enke mittlerweile einen passablen Offensivspieler gab, wurde der Vater von Thomas, dem Torhüter, beruflich nach Moskau versetzt. Die brauchten einen neuen Torwart. „Der Trainer hatte keine Idee“, sagt Andy Meyer, „also musste jeder mal zur Probe ins Tor. Bei mir hatte sich das Thema schnell erledigt. Unser Glückskind wurde zweimal angeschossen und war fortan die Nummer eins.“
Ohne zu wissen wie, machte er alles richtig, der kräftige Absprung, die Handhaltung mit den gespreizten Daumen beim Fangen, die Entscheidung, die eine Flanke aus dem Himmel zu holen und sich bei der nächsten nicht daran zu wagen.
Er entdeckte ein neues, ein betörendes Gefühl. Wenn er flog, wenn er den Druck des hart geschossenen Balls in seinen Händen spürte, dann wusste er, wie sich Glück anfühlt.
Wobei er doch, ehrlich gesagt, „die meiste Zeit gar nichts tat“, sagt sein Vater. „Carl Zeiss war in den Kindermannschaften so überlegen, dass der Torwart sich langweilte. Aber ihm hat es gepasst.“ Ein sanftes Lächeln, für Sekunden frei von Schmerz, entwischt dem Vater bei dieser Erinnerung. „Da musste er nicht so viel laufen.“
Dirk Enke hat dasselbe Lächeln wie sein Sohn. Ungewöhnlich langsam, als wolle es sich vornehm zurückhalten, breitet es sich im Gesicht aus. Der Vater sagt, er habe Angst vor dem Moment gehabt, für die Biografie über Robert zu sprechen; davor, dass die Erinnerungen zu stark werden. Deshalb lässt er in seiner Wohnung am Marktplatz, hoch über den Dächern von Jena, erst einmal die Dias sprechen. Jemand hat ihm kürzlich – Dirk Enke sagt „danach“ – einen Projektor geschenkt, damit er die alten DDR-Dias aus Roberts Kindheit noch einmal anschauen kann. Die drei Kinder beim Zelturlaub an der Ostsee, Anja, Gunnar und Robert, der Nachzügler, der neun Jahre nach der Schwester, sieben Jahre nach dem Bruder zur Welt kam. „Die Stellplatzgenehmigung für ein Zelt bekam man in der DDR eigentlich erst ab vier Kindern“, sagt der Vater, aber es gab Dinge, die seien auch in einem Überwachungsstaat nicht so ganz genau überwacht worden. „Wir haben einfach immer vier angegeben, keiner hat nachgezählt.“ Der Projektor klickt weiter, Robert mit seiner dritten Oma. „Meine richtige Oma“ nannte er Frau Käthe, eine Rentnerin von nebenan, die oft auf ihn aufpasste, deren Nähe er noch als Jugendlicher suchte. Als Kind zählte er immer auf: „Ich habe eine dicke Oma, eine dünne Oma und eine richtige Oma.“
Irgendwann sind die Dias zu Ende. Irgendwann hatten auch im Leben des Glückskindes die schönen Bilder eine Pause.
Er war elf, als er von der Schule in die Liselotte-Herrmann-Straße zurückkam. Der Vater stand mit einer Tasche in der Hand vor der Tür.
„Papi, wo willst du denn hin?“
Dirk Enke schaffte es nicht zu antworten. Er ging wortlos, mit wässrigen Augen zum Auto. Der Sohn lief zu seiner Mutter in die Wohnung.
„Was ist denn passiert?“
Die Mutter schluckte. „Wir haben uns ein wenig gestritten. Dein Vater zieht erst einmal auf die Hütte nach Cospeda.“
Es gab eine neue Frau im Leben des Vaters.
Robert fragte die Mutter jeden Tag, wochenlang: „Mama, wie geht es dir denn?“ Gisela Enke konnte in seinem Gesicht sehen, wie er sich vor einer traurigen Antwort fürchtete.
Doch die Eltern wollten nicht glauben, dass ihre Ehe zu Ende ging. Sie sahen sich weiter, „und wir haben das nicht nur wegen der Kinder gemacht“, sagt die Mutter, »ich war dreißig Jahre mit Dirk zusammen, wir hatten uns als Jugendliche kennengelernt«. Im Sommer fuhren sie gemeinsam an den Balaton in den Urlaub. Robert saß auf dem Rücksitz und sagte laut, aber beiläufig, als ob er zu niemandem Bestimmten rede, „na, wenn es zur Versöhnung beiträgt, fahren wir halt an den Balaton in den Urlaub“. Mehr als glücklich klang er angestrengt hoffnungsvoll.
Wieder geeint wurde die Familie dann überraschend von einer größeren Vereinigung. „Die Wende hat uns noch einmal zusammengeschmiedet“, sagt die Mutter. Der Rausch der Montagsdemonstrationen, die Aufregung der herannahenden großen Veränderungen schuf vor der staatlichen erst einmal ihre familiäre Einheit. Dirk Enke zog wieder zu Hause ein, zur Silberhochzeit gingen sie auf Fahrradtour am Rhein bei Koblenz.
Die Enkes gehörten zu denen, die die Wiedervereinigung ohne Skepsis begrüßten. Der Vater wusste den größten Teil seiner Familie auf der westlichen Seite der Grenze. „Mein Gefühl war: endlich!“ Die Jungen zwischen den Wäschestangen waren bei der Wende zwölf, dreizehn. Sie sind die letzte Generation, die bewusst noch beide deutsche Staaten erlebt hat, die erste, die in beiden Staaten erwachsen wurde. Er könne sich noch erinnern, wie Robert und er mit ihrer Carl-Zeiss-Jugendelf zu Ehren von DDR-Staatspräsident Erich Honecker bei einer Parade den Löbdergraben rauf- und runtermarschieren mussten, sagt Andy Meyer, „und was wir toll fanden, war, dass es nachher Essensmarken für Bockwürste gab“. Ähnlich beiläufig nahmen sie die neue Zeit zur Kenntnis. Sie spielten einfach weiter, über die Veränderungen hinweg. Sie nahmen sich nicht einmal eine Halbzeitpause für die Wiedervereinigung. „Einschneidend war daran für uns Kinder nichts“, sagt Andy. Er lacht, etwas fällt ihm ein. »Das Fußballtraining lief doch weiter.«
In Lobeda, dem einstigen sozialistischen Traum vom Schöner Wohnen, zeigte sich nun allerdings ein neues Proletariat. Damit mussten sich die Kinder sehr wohl arrangieren. Türken aus Westdeutschland gingen mit Teppichen hausieren, im Glauben, die Ossis marktwirtschaftlich übers Ohr hauen zu können. Jugendliche aus der Trabantenstadt schlossen sich auf einmal zu Banden zusammen und nannten sich rechtsradikal.
„Lass niemanden herein“, mahnte die Mutter den Sohn, der nach der Schule regelmäßig alleine zu Hause war, weil beide Eltern arbeiteten, sie als Lehrerin für Russisch und Sport, der Vater als Psychotherapeut an der Städtischen Klinik.
Vorsichtig machte Robert die Tür auf, als es klingelte. Der Großonkel Rudi, Universitätsprofessor für Latein, kam zu Besuch.
„Guten Tag, sind die Eltern zu Hause?“
Der Junge sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an.
„Du erkennst mich nicht, oder? Ich bin dein Großonkel Rudi.“
„Das kann ja jeder sagen“, rief Robert, schob den verdutzten Professor aus der Tür und knallte sie zu.
Ein anderes Mal lauerten ihm die rechten Halbstarken auf dem Nachhauseweg von der Schule auf. Sie packten ihn, sie schubsten ihn. Bevor sie ihn schlugen, erkannte ihn einer. „Hört doch auf, das ist doch Robert Enke.“ Er war zwölf. Er war offensichtlich schon berühmt als der Torwart. Sie ließen ihn gehen.
Doch die Angst wich nicht. Er sehnte sich nach einer Schutzhaut: Er flehte die Mutter an, sie solle ihm eine Bomberjacke kaufen. Darin würden die Rechten ihn fälschlicherweise für einen der Ihren halten und in Ruhe lassen. „Ich war zunächst entsetzt, dass er denen so nachgeben wollte“, sagt die Mutter, „aber, okay, dachte ich, wenn er dann keine Angst mehr hat. Er trug die Jacke dann auch nur ein paar Wochen.“
Als im vereinten Deutschland die erste Desillusionierung einkehrte, verlor die Wiedervereinigung 1994 auch ihre Kraft, die Ehe der Enkes zusammenzuhalten.
Die Familie saß sonntags im Wohnzimmer, als der Vater innerlich Anlauf nahm.
„Ich muss euch etwas sagen.“
Die Mutter wusste es schon. Die andere Frau in seinem Leben war nie ganz verschwunden.
„Gisela und ich trennen uns. Ich ziehe aus.“
Robert sprang vom Sofa auf und rannte aus der Tür.
„Gunnar, lauf, hol den Jungen zurück!“, rief die Mutter. Der Bruder fand ihn auf der Straße. Er weigerte sich zu reden.
Niemand sollte ihm etwas anmerken. Er hatte sich angewöhnt, Traurigkeit mit sich selbst auszumachen.
Den drei Freunden erschien er unverdrossen als ihr Sonnenschein. „Der Enkus warf ein Glas Wasser um, und alle wurden nass, nur er nicht, so war es doch immer“, sagt Andy. Die Lehrerin erwischte Robert Enke während einer Biologiearbeit beim Abschreiben. Er bekam eine Sechs. Aber als die Zeugnisse verteilt wurden, stand bei ihm in Biologie ein Befriedigend. Er war auffallend hilfsbereit, besonnen und ein begabter Torwart, diese Kombination stimmte seine Lehrer offensichtlich milde.
Er wusste, er kam in der Schule ohne großen Aufwand ganz gut durch, und strebte nicht nach mehr.
Die Freunde trafen sich nun oft bei Mario Kanopa und Torsten Ziegner auf dem Internatszimmer. Mit 14 waren die beiden vom Land ins Sportgymnasium gekommen, in den Namen ihrer Heimatvereine lag noch der Klang einer dörflichen Welt, weit weg von Jena: Von der BSG Traktor Frauenprießnitz kam Mario, Torsten von der BSG Mikroelektronik Neuhaus/Rennweg. Oft genug zankten sie sich in ihrem kleinen Internatszimmer. Wenn ihn etwas störte, polterte Torsten gleich los. Diese Impulsivität brachte Mario auf. Der Enkus verstand sich mit jedem von ihnen bestens; wenn er dabei war, kamen alle gut miteinander aus.
In der Eingangshalle des Sportgymnasiums hingen immer öfter Zeitungsartikel über sie aus. 1993 fuhren Robert Enke, Torsten Ziegner und Mario Kanopa mit der thüringischen Auswahl nach Duisburg zum traditionellen B-Jugendpokal der Bundesländer. Hinter der Seitenlinie standen die Späher der Profivereine. Bei dem jährlichen Turnier in der Sportschule Wedau werden in der Wahrnehmung der Fußballszene aus 15-Jährigen erstmals potenzielle Profis. Zunächst hielt es die Thüringer Elf für einen schönen Witz, was in Duisburg passierte, am Ende „lachten wir uns über uns selbst tot“, erinnert sich Torsten Ziegner. In einer absurden Wiederholung glich ein Spiel dem anderen. Regelmäßig wirkten sie wie die unterlegene Elf. Nie verloren sie. „Es war“, sagt Torsten, „als ob Robert alleine spielte.“ Er wurde immer größer. Mit jedem gehaltenen Torschuss erschien er den Stürmern, die vor ihm auftauchten, riesiger. Er erreichte den höchsten Geisteszustand eines Torwarts: Auf einmal überkommt dich in all der Hektik dieses Spiels die absolute Ruhe. So fest ihn die Stürmer auch treten, du glaubst, der Ball gehorcht nur dir. Eine allgewaltige Sicherheit füllt dich aus und macht dich noch größer, immer größer. 0:0, 0:0, 1:0, 4:0 lauteten Thüringens Ergebnisse in Duisburg. Gegen ihn schoss man kein Tor.
Im selben Jahr erreichte Carl Zeiss Jena das Endspiel der deutschen B-Jugendmeisterschaft, was in den nächsten 15 Jahren kein Klub mit ähnlich bescheidenen Möglichkeiten nachmachen würde. Der Klubpräsident lud das Team in eine Bar namens Sockenschuss; zu einer Runde Cola. Sie verloren das Finale 1:5 gegen Borussia Dortmund. Aber selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung schickte einen Reporter, um das Internat in einem Bericht zu würdigen. Die Internatsleiterin gab über ihre Fußballer zu Protokoll: „Sie sind nicht besonders ordentlich, sie essen alles, treten fast immer als Mannschaft auf und haben ein ausgeprägtes Selbstvertrauen.“
Später werden die vier Freunde das gesamte Spektrum dessen abdecken, was aus einem talentierten Fußballer werden kann: Robert Enke wird Nationaltorwart. Torsten wird local hero, Kapitän, Spielmacher bei Carl Zeiss Jena in der Zweiten und Dritten Liga. Mario wird mit 22 nach einer schweren Verletzung seine Profikarriere beenden und studieren, in der Bilanz steht: ein Zweitligaspiel, ein Tor. Andy bekommt mit 15 von Carl Zeiss gesagt, es tue ihnen leid, aber es reiche nicht mehr, und wird fortan nur noch zum Spaß in kleineren Teams spielen.
Damals träumten sie gemeinsam.
Vor 30000 Schulkindern spielten Robert Enke, Torsten Ziegner und Mario Kanopka mit der deutschen Jugend-Nationalelf gegen England im legendären Wembley-Stadion. Sie waren 15. Das Spiel endete 0:0, der Daily Telegraph, Margaret Thatchers Lieblingszeitung, berichtete: »Eine Kombination aus phantastischen Torwarttaten und armseligen Torschüssen verhinderte Englands Sieg.« Robert Enke war gemeint.
Er lag noch am Boden, nachdem er einen furiosen Schuss von Stephen Clemence im Flug abgewehrt hatte, als bereits Jay Curtis zum Nachschuss ansetzte. Er sprang auf, es ging zu schnell für das Publikum, um zu verstehen, wo seine Hand herkam. Aber er wehrte auch diesen Schuss ab.
Er wurde entdeckt. Deutscher Jugendfußballer des Monats, ein ganzseitiger Bericht im Kicker. Der Stern porträtierte ihn in einem Sonderheft „Die 16-Jährigen“ als Protagonisten seiner Generation. „Oft denke ich nicht über die Welt nach“, sagte Robert Enke, sehr 16-jährig, dem Stern, „aber manchmal habe ich ein Gefühl, als ob sie untergeht.“
Auf der Tribüne des Wembley-Stadions saß Dirk Enke mit einigen anderen Eltern der Mitspieler. Der Fußball wurde für den Vater das Band zu seinem Sohn.
Seit er ausgezogen war, versuchte er zu jedem Spiel zu kommen. Er beobachtete die anderen Väter, er sah, wie manche ihre Kinder bei Fehlern anbrüllten, und wenn den Kindern eine Aktion gelang, brüllten sie schon wieder, jetzt schieß doch, pass den Ball, schneller, schieß doch! Dirk Enke saß still, aufmerksam am Spielfeldrand. Er fand, er machte es richtig. „Dirk war ein toller Vater“, sagt die Mutter. „Aber nach der Trennung hatte er es schwer mit den Kindern.“
Nach den Spielen redeten Vater und Sohn.
Stark gehalten.
Danke.
Wie du den einen Ball aus dem Winkel holst.
Fast wäre ich nicht mehr drangekommen, mir hat es die Fingerspitzen weggehauen, so fest war der Schuss.
Und der Torsten, der Ziege wieder, Wahnsinn!
Du weißt doch, wie er ist.
Ich dachte am Ende, Mensch, Ziege, bist du verrückt? Ein Gegner will an ihm vorbei – und der Ziege rennt den Kerl einfach um, rennt frontal in den Gegner rein. Und das macht er dreimal! Normal sieht er drei Rote Karten.
Papa, ich muss in die Umkleidekabine.
Sie lächelten sich an im angestrengten Versuch so vieler Väter und Söhne, über den Sport dem anderen seine Nähe zu versichern; mit dem Gespräch über Fußball die Sprachlosigkeit zwischen ihnen zu übertünchen. „Dirk und Robert haben viel zu selten wirklich geredet“, sagt die Mutter. „Ich war ja auch nicht in der Lage, in der Familie zu streiten, mal etwas Negatives zu sagen. Und ich denke, Robert konnte das auch nicht. Da war immer so eine vornehme Zurückhaltung in unserer Familie.“
Wenngleich ihm gelegentlich die Worte fehlten, so besaß der Vater ein Auge. Während die Mutter ihrem älteren Sohn Gunnar noch tagelang gutmütig glaubte, er habe ihre Gitarre bei einem Freund vergessen, bemerkte der Vater die Verdruckstheit des Sohnes. Er fand heraus, dass Gunnar die Gitarre verkauft hatte.
Der Vater erkannte Roberts gehetzten Gesichtsausdruck, als er erstmals in der A-Jugend, bei den 18-Jährigen, spielen musste. Er war noch immer 16. Die Trainer schickten ihn in die höhere Altersklasse, damit er einmal richtig gefordert wurde; für die Gleichaltrigen sei er doch zu gut. Er hielt auch in der A-Jugend tadellos. Aber er nahm es nicht so wahr.
Für einen 16-Jährigen sind 18-Jährige die Großen. Die meisten 16-jährigen Torhüter, die bei den Älteren spielen müssen, haben Angst. Denn der Torwart wird in letzter Instanz immer nur an seinen Fehlern gemessen, und wie kann er keinen Fehler machen, wenn die gegnerischen Stürmer so groß und kräftig sind? Wie werden die Großen, Starken in seinem Team auf ihn herabschauen, wenn er versagt?
Robert Enke weinte, als er nach dem Spiel mit seinem Vater alleine war, und sagte, er wolle nicht mehr in der A-Jugend spielen. „Papa“, sagte er, „du wärst mir doch nicht böse, wenn ich mit dem Fußball aufhören würde?“
Die Freunde kennen diesen Robert nicht. „In den Jugendteams gab es immer Verrückte, die auf die Schwächsten eingedroschen haben, da hat der Enkus sicher auch mal die Pfeile und Spitzen abbekommen“, erzählt Torsten, „aber ihn konntest du nicht runterziehen, im Gegenteil. Wir hatten damals den Eindruck, den Enkus bringt nichts aus der Ruhe. Er war schon als 17-Jähriger im Tor so souverän wie andere nach zehn Jahren als Profi.“
Die Mutter erlebte in der Episode mit der A-Jugend einen ganz anderen Robert als der Vater. „Ich erinnere mich noch, wie er nach einem Abendessen aufstand und zu mir sagte: ›Mutter, ich muss was klären.‹“ Er nahm die Straßenbahn zum Ernst-Abbe-Sportfeld und sagte Ronald Prause, dem A-Jugend-Trainer, dass er wieder in der B-Jugend spielen wolle. Ein Junge von 16 Jahren, selbstbewusst und charmant genug, dem autoritären Trainer zu erklären, was er wollte.
Doch Dirk Enke ist Psychotherapeut. Er hat einen anderen Blick. Zu Hause, sagt die Mutter, habe sie schon einmal gerufen: „Scheiß Psychos!“, wenn die Schwägerin und der Schwager zu Besuch waren, beide auch Psychologen, „und sie mir zu dritt erklären wollten, wie ich war. Aber“, sagt sie, „der Dirk hatte schon einen Riecher.“
Der Vater legt Messer und Gabel beim Mittagessen am Marktplatz von sich, er reibt die flachen Hände über die Oberschenkel. Dann sagt er: „Ich dachte mir, was passiert da gerade? Hat er Probleme mit seinen Mitspielern? Nein, es wurde schnell klar, es findet etwas in ihm statt: Die Angst vor Fehlern setzte ihm zu, dieses Denken: Wenn ich nicht der Beste bin, bin ich der Schlechteste. Damals als B-Jugendlicher in der A-Jugend muss diese Qual begonnen haben.“
Aber es war doch nur ein einmaliger Moment; ein kurzer Augenblick der Angst, wie ihn Hunderte Jugendtorhüter erleben!
„Doch die Seele erinnert sich immer an diese Grenzerfahrung.“
Als 17-jähriger Schüler, mit einer Sondergenehmigung vom Deutschen Fußball-Bund, unterschrieb Robert Enke bei Carl Zeiss Jena einen Profivertrag für die Zweite Liga. Mutter und Vater begleiteten ihn ins Büro des Vereins. Ernst Schmidt, der Geschäftsführer, und Hans Meyer, der Trainer, erwarteten sie. Sein spezieller Hang, ein Gespräch sofort mit launigen Ansichten zu dominieren, würde Meyer später zu einem Entertainer der Bundesliga machen. In der Geschäftsstelle hatte er dem 17-jährigen Torwart auch gleich etwas von Jenas mythischem Torhüter der Fünfzigerjahre zu erzählen. „Der Harald Fritzsche war hier über zehn Jahre lang an keinem einzigen Tor schuld“, sagte Meyer. „Zumindest, wenn man ihn fragte.“
Der Vater horchte auf. Wusste Meyer von Roberts quälerischen Selbstvorwürfen nach Fehlern? Wollte der Trainer ihm eine Botschaft schicken? Mach dich mal nicht verrückt.
Robert Enke teilte seine Leben. Er bekam in der Schule Einzelunterricht, um vormittags als Ersatztorwart mit der Zweitligaelf trainieren zu können, er war jetzt ein Profisportler mit all dem Ernst, mit all dem Nichtabsteigendürfen des Berufs – und gleichzeitig begann sonntags am Jenaer Westbahnhof mit Teresa eine unbeschwerte Jugend.
Sie kampierten bei seiner Mutter auf einer Matratze im Wohnzimmer und sagten ihr, sie müssten für das Abitur lernen. Manchmal gingen sie abends aus, er trank vielleicht ein Bier mit Limonade, „und ich tanzte auf den Tischen“, sagt Teresa, was vermutlich nicht wörtlich zu nehmen ist. Doch er fühlte, dass sie die Lebensfreude besser zeigen konnte.
Ihr ging alles so leicht von den Lippen, die Herzlichkeit, die Neugierde, die Entscheidungsfreudigkeit. Er glaubte, sie sei viel stärker als er.
„Ich habe nie gelernt, so zu feiern wie du“, sagte er, als ob er sich verteidigen müsste. Ihr gefiel gerade sein zurückhaltender, sanfter Charme. Sein Gesicht war das des ewigen lieben Jungen.
Sie war mit zwei älteren Brüdern auf dem Dorf in Franken groß geworden, der Vater hatte ihnen allen seine Leidenschaft für den Modernen Fünfkampf mitgegeben, Schwimmen, Fechten, Reiten, Schießen, Laufen. Zu Hause im Kinderzimmer schossen Teresa und ihr Bruder heimlich mit der Luftpistole auf Playmobilmännchen, „schau mal, wenn du sie auf der Brust triffst, zerspringen sie in tausend Teile“, sagte der Bruder, stolz über seine Entdeckung. Offiziell kam Teresa wegen des Sports nach Jena auf das Gymnasium. Dass es auch darum ging, dem bayrischen Schulsystem mit dem verfluchten Latein zu entfliehen, musste sie ja nicht sagen. „Zieh keine Markenklamotten an, damit du nicht als Besserwessi rüberkommst“, gaben ihr die Freunde aus dem Westen mit auf dem Weg. „Und dann sah ich am ersten Tag an der neuen Schule, dass sie nur Markenklamotten trugen.“
Ost und West, die Gegensätze, die in jener Zeit so viele sehen wollten, waren für sie kein Thema; nur gelegentlich Anlass zum gemeinsamen Lachen. Als Robert den Heiligabend bei Teresas Familie verbrachte, zeigte er wegen seiner atheistischen DDR-Erziehung bei der Weihnachtsgeschichte Lücken. „Wer war denn das, der Josef?“
Sein Fußballsport interessierte Teresa wenig. Fußball stand für sie für enttäuschende Teenager-Samstagabende, „wenn ich zu Hause die Serie Beverly Hills schauen wollte und nicht konnte, weil meine Brüder den Fernseher wegen der Sportschau in Beschlag nahmen“.
Auch deshalb erzählte er ihr gar nicht von seinen ersten Profispielen, bis sie irgendwann, viel später, danach fragte. Er fand, darüber rede man nicht von sich aus, das sei Angeberei.
Carl Zeiss Jena hielt sich bemerkenswert gut in der Hinrunde der Saison 1995/96. Im Mittelfeld fiel gelegentlich ein 21-Jähriger namens Bernd Schneider durch seine Eleganz auf; ein paar Jahre später würde er als der technisch beste deutsche Fußballer gelten. Die Elf hatte sich in der Tabelle im vorderen Mittelfeld eingependelt, als es im Herbst zwei heftige Niederlagen hintereinander setzte, 1:4 in Duisburg, 0:4 gegen den VfL Bochum. Der Torwart Mario Neumann hatte schon glücklichere Tage erlebt. Am 11. November 1995 spielte Carl Zeiss bei Hannover96. Gute Torhüter, heißt es, bräuchten mehr als alles andere Erfahrung, und Robert Enke war 18. Trainer Eberhard Vogel stellte ihn erstmals ins Tor.
Das Beeindruckendste war die Leere im Stadion. 6000 Zuschauer verloren sich auf den 56000 Plätzen. Da fielen die eigenartigen Flutlichtmasten noch mehr auf. Wie gigantische Zahnbürsten wuchsen sie in den Himmel. Es war Fußball, bevor der Sport ein Event, die Volksparty wurde.
Das Spiel lief, Robert Enke wartete. Hin und her ruckte der Kampf im Mittelfeld, er konzentrierte sich, weil gleich der Gegner an seinem Strafraum erscheinen könnte, und dann ging es doch wieder in die andere Richtung. Dann, plötzlich, eine halbe Stunde war schon vorbei, ein Kopfball von Hannovers Reinhold Daschner. Auch ein fast leeres Stadion konnte auf einmal laut klingen. Robert Enke stand schon genau dort, wo der Kopfball hinflog, und fing ihn sicher.
Es dauerte nicht einmal zwei Minuten, ehe er nach seiner ersten bemerkenswerten Tat sein erstes Gegentor im Profifußball kassierte. Die Ostthüringer Zeitung fand recht ungewöhnliche Worte, um ihn in Schutz zu nehmen: „Am 1:0 für Hannover hatte Jenas Verteidiger Dejan Raickovic, aber keinesfalls Robert Enke eine Aktie.“
Es blieb der Kleinkram eines Torwarts zu erledigen, ein paar Eckbälle entschärfen, die Abschläge genau platzieren. Einmal entlockte er dem Stadion noch ein Raunen. Er begrub einen Schuss von Kreso Kovacec unter sich. Am Ende stand ein 1:1, ein Spiel, das die Zuschauer bereits zu vergessen begannen, als sie die Stadiontreppen hinausgingen, und ein junger, glücklicher Torwart, der beim Gang in die Umkleidekabine noch einmal einen Schrecken bekam. Über ihm donnerte es auf dem Tunneldach aus Plexiglas. Sein Vater hing über dem Tribünengeländer und schlug von oben stolz gegen das Dach des Spielereingangs, um ihm zu sagen, Mensch, Junge!
Er würde selbstverständlich im Tor bleiben.
Am Samstag darauf war seine Mutter mit einer Freundin in die Berge um Jena gefahren. Sie hatten das Radio eingeschaltet. „Mir wurde schlecht“, sagt Gisela Enke.
„Freistoß für Lübeck am linken Flügel“, rief der Reporter im Radio, „Behnert flankt, Enke ist draußen, er hat den Ball – und lässt ihn durch die Hände gleiten! Tor für Lübeck! Ein krasser Torwartfehler!“
Es war in Momenten wie diesem, da sich Andy Meyer bestätigt sah: Der Enkus war das Glückskind. Denn wenn er schon einmal danebengriff, was sowieso fast nie vorkam, gewann sein Team prompt, und niemand redete mehr über den Torwartfehler.
3:1 besiegte Jena den VfB Lübeck.
Wenn er sich anstrengte, konnte Robert Enke sehen, was Andy meinte: Sein Fehler war unerheblich gewesen. Aber später, viele Jahre danach, gestand er, wie er das als junger Torwart wirklich sah: „Ich konnte mir einen Fehler nicht verzeihen.“ Die Mitspieler sagten, macht nichts, der Trainer sagte, das passiert jedem einmal, nächsten Samstag geht es weiter, natürlich bleibst du im Tor, doch „ich hatte die ganze nächste Woche lang den Fehler vor Augen, ich bekam ihn nicht aus dem Kopf“.
Er ging die gesamte Woche nicht in die Schule. Er sagte, er sei krank.
Es ist die Tortur der Torhüter: der unhaltbare Anspruch an sich selbst, fehlerlos zu sein. Vergessen kann keiner von ihnen seine Fehler. Aber ein Torwart muss verdrängen können. Ansonsten kommt das nächste Spiel und bricht über ihm zusammen.
Carl Zeiss musste zum Derby nach Leipzig. Der Vater traf auf der Tribüne eine Bekannte aus alten Leichtathletik-Tagen. Sie setzten sich nebeneinander. Sie hielt zum VfB Leipzig, aber in der dritten Spielminute schrie selbst sie mitleidig: „Oh nein!“
Robert Enke hatte einen Weitschuss aus zwanzig Metern, mit wenig Effet, mit nicht besonders viel Kraft dahinter, unter dem Bauch ins Tor rutschen lassen.
Ein Torwart muss jetzt so tun, als sei gar nichts passiert.
In der 34.Spielminute rannte Leipzigs Stürmer Ronny Kujat alleine auf ihn zu. In solchen Momenten scheint das Spiel plötzlich in Zeitlupe abzulaufen. Der Torwart registriert jede Fußbewegung des Stürmers, die Zuschauer verharren mit offenen Mündern. Der Torwart wartet eingefroren auf den Stürmer, er darf sich jetzt nicht bewegen, wer hier zuerst zieht – er die Hand oder der Stürmer den Fuß –, hat meistens verloren, denn der andere kann sein Manöver durchschauen. Kujat schoss. Robert Enke flog. Er wehrte den Ball ab. Es war die beste Parade seiner noch kurzen Profikarriere. Aber er genoss sie wohl schon nicht mehr.
In der Halbzeitpause sagte er verzweifelt zum Trainer: „Bitte wechseln Sie mich aus.“
„Darauf muss man auch erst einmal kommen“, sagt der Vater.
Ein Profi macht das nicht. Ein Profi kennt keine Schwäche.
Eberhard Vogel, der Trainer, erwiderte Robert Enke in der Halbzeitpause in Leipzig, er solle keinen Blödsinn reden, und ließ ihn bis zum Abpfiff weiterspielen. Danach stellte er ihn nie wieder ins Tor.
Die Mutter bemerkte, wie er zu Hause kaum noch redete, wie er nach dem Essen in sein Zimmer ging und die Tür hinter sich schloss. „Aber das kannte ich von Dirk doch auch schon so nach einem schlechten Hürdenrennen.“
Nach einer Woche entdeckte Robert Enke zögerlich das Lächeln wieder und fuhr zum Westbahnhof. Er dachte damals nicht darüber nach, er sah keinen Zusammenhang, aber in den restlichen sechs Monaten der Saison, in denen er wieder der junge Ersatztorwart war, von dem niemand etwas erwartete, war er auch wieder fröhlich, ausgeglichen. Er dachte allenfalls, es müsse an Teresa liegen.
Der Trainer hatte offen über den Vorfall in Leipzig geredet. „Dem Jungen fehlt jetzt das Selbstvertrauen. Er wollte, dass ich ihn in der Halbzeit rausnehme. Aber so einfach ist das nicht“, sagte Vogel den Sportreportern direkt nach dem Spiel.
Zehn Jahre später hätte dies das Ende für einen Torhüter sein können: Er machte einen Anfängerfehler und bettelte danach, zur Halbzeit verschwinden zu können. Die Nachricht wäre durch das Internet gegangen, über das Deutsche Sportfernsehen und unzählige anderen Medien verbreitet worden, die aus Zweitligaspielen mittlerweile ein Ereignis machen. Ein Ruf hätte sich in der klatschsüchtigen Profifußballszene zementiert: Der ist labil. Damals aber blieb die Nachricht in einer 16-Zeilen-Randmeldung in der Ostthüringischen Zeitung hängen.
Die Bundesligavereine, die bei seinen bemerkenswerten Jugend-Länderspielen auf ihn aufmerksam geworden waren, interessierten sich ungebrochen für ihn. Einige hatten in den zurückliegenden Jahren bei den Eltern vorgesprochen, darunter ein Herr von Bayer Leverkusen, der sagte: »Guten Tag, Reiner Calmund hier«, und dann Punkt und Komma nicht benutzte, der in vierzig Sekunden zehn Sätze unterbrachte. Den besten Eindruck hinterließen die Gesandten von Borussia Mönchengladbach. Denn anders als etwa Leverkusen oder der VfB Stuttgart, anders als üblich, schickte die Borussia nicht nur den Sportdirektor, sondern auch den Torwarttrainer.
Vor dem Abitur gehe er nicht fort, hatten ihm die Eltern auferlegt, nun aber rückte der Sommer 1996 näher, das Ende der Schulzeit.
Teresa überlegte laut, wo sie gemeinsam zur Universität gehen könnten, sie dachte an ein Lehramtsstudium oder Tiermedizin.
„Was hältst du von Würzburg?“
„Na ja, ich spiele ja auch noch Fußball.“
„Ist das denn so wichtig? Aber gut, in Würzburg gibt es sicher auch einen Verein.“
„Nein, also, ich meine Profifußball. Es gibt da einige Angebote.“
„Und?“
„Die bieten ja auch nicht das schlechteste Gehalt. In Mönchengladbach könnte ich 12000 Mark im Monat verdienen.“
Also, dachte sich Teresa, da habe sie jetzt vielleicht doch ein klein wenig naiv geklungen dank ihrer Ignoranz in Sachen Fußball.
Wenige Tage, nachdem der Vater und Robert sich das erste Mal in Mönchengladbach mit den Machern der Borussia getroffen hatten, klingelte bei Dirk Enke das Telefon.
Pflippen am Apparat. Er sei der Berater von Günter Netzer gewesen, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Mehmet Scholl gehörten zu seinen Klienten. „Ich könnte Ihrem Sohn helfen.“
Gewöhnlich nahm ein Fußballagent einen Spieler unter Vertrag und kümmerte sich dann für ihn um die Vereinssuche. Damals aber ging es oftmals noch etwas bequemer für die Handvoll Agenten, die den Markt beherrschten. Über ihre Informanten in den Bundesligavereinen erfuhren sie, wenn der Klub einen jungen Fußballer verpflichten wollte, der noch ohne Berater war. Postwendend bot sich der Agent dem Spieler an. So lief es mit Norbert Pflippen und Borussia Mönchengladbach in den Achtzigern und Neunzigern wohl gerne einmal.
Pflippen, der Flippi, hatte eine Stärke: Er war einer der Ersten im Geschäft gewesen. So hielt sich jahrzehntelang sein Ruf, er sei einer der Besten.
Der Flippi besuchte die Enkes in Jena. Ein Mann mit fleischigen Unterarmen und hemdsärmligen Umgangsformen, sparte er nicht mit Anekdoten, wie er den Günter damals zu Real Madrid gebracht habe und den Lothar zu Inter Mailand. Es war eine Zeit, in der noch kaum ein Jugendspieler einen Berater hatte, und da bot sich dieser Mann aus den höchsten Sphären des Fußballs Robert Enke an. Ein bisschen fühlten sich die Enkes geehrt. Recht sympathisch war der Flippi in seiner launigen Art auch. Sie sahen darüber hinweg, dass er am Ende dann doch recht plump wurde. „Wenn wir ins Geschäft kommen“, raunte Pflippen dem Vater zu, „schenke ich Ihnen ein kombiniertes Telefon-Fax. Und“, er wandte sich an Robert, „du bekämst ein Auto von mir.“
Noch vor der mündlichen Abiturprüfung in Geografie, Thema: Gesteine, unterzeichnete Robert Enke im Mai 1996 einen von seinem Berater Norbert Pflippen ausgehandelten Dreijahresvertrag beim Erstligisten Borussia Mönchengladbach.
Einige Zeit zuvor hatte auf der A2 von Dortmund Richtung Osten der Motor eines kleinen Peugeots Funken geschlagen. Dann war unter der Motorhaube Rauch aufgestiegen. Mit so einem Auto zu fahren sei lebensgefährlich gewesen, das Öl und Kühlwasser seien leer, Ventile verstopft, erklärte der ADAC-Pannenhelfer den Enkes. Torsten Ziegner und Mario Kanopa waren nach einem Jugendländerspiel in Bocholt auch an Bord.
Dafür könne er aber nichts, rief der Flippi, dass sich der Gebrauchtwagen, den er Robert Enke geschenkt hatte, in solch einem Zustand befand.
Zwei
Der Knall
Er lag am Boden, den Kopf im stellenweise schon braunen Gras. Er richtete den Blick auf, und in drei Metern Entfernung, auch auf Höhe der Grashalme, warteten zwei graublaue Augen auf ihn. Na, komm schon, sagten die Augen, starr vor Konzentration: Dir werde ich es zeigen.
Sie sollten sich gemeinsam aufwärmen.
Bäuchlings lagen sie sich im Strafraum des Trainingsplatzes gegenüber und warfen sich beidhändig den Ball zu. Ihre Körper waren wie biegsame Wippen, rhythmisch schwangen sie hoch und runter, nur ein kurzes, ersticktes Klatschen war zu hören, wenn der Ball im weichen Schaumstoff ihrer Torwarthandschuhe versank. Es reicht doch, dachte sich Robert Enke nach einigen Minuten, es ist doch nur Aufwärmen, warum hört er nicht endlich auf?
Robert Enke brauchte eine Woche in Mönchengladbach, um zu begreifen, dass Uwe Kamps nie aufhören würde. Er wollte ihn, Enke, den neuen Ersatztorwart, den potenziellen Rivalen, aufgeben sehen; ihn besiegen, in der kleinsten Aufwärmübung, jeden Tag.
Kamps hatte bereits über 300 Bundesligapartien für Borussia Mönchengladbach bestritten, er war 32, der Liebling der Fans und eigentlich, nach dem Training, doch umgänglich. Robert Enke war 19, der dritte Torwart, ein Junge. Er sollte in den ersten Jahren von Kamps lernen, und irgendwann würde er dann reif für die Nummer eins sein, hatte ihm Dirk Heyne gesagt, der Torwarttrainer, wegen dem er die Borussia anderen Bundesligisten vorgezogen hatte, der ihm sympathisch und kompetent erschien.
Er schaute zu Heyne. Der Torwarttrainer schwieg. Aber er hatte doch gesehen, was Kamps machte!
„Okay“, sagte der Torwarttrainer, „jetzt schießt euch den Ball auf Brusthöhe zu.“
Kamps schoss und schoss immer härter, immer fester, immer schneller. Er wollte sehen, wie Enke den Ball fallen ließ.
Abends, mit Abstand zum Training, lachte Robert Enke innerlich über die Erlebnisse, nicht ohne Sympathie für Kamps, was für ein Typ. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zum Training, erschien ihm die Sache wieder ernst. Er fragte sich, ob ein Bundesligatorwart so sein musste wie Kamps, und vor allem, ob er jemals so sein könnte.
Druck machen war das Bundesligamotto der Neunziger. Immer mussten alle Druck machen, der Trainer den Spielern, die Ersatzspieler dem Trainer über die Presse, der Ersatztorwart der Nummer eins, die Nummer eins den Ersatztorhütern und der Sportdirektor sowieso allen. Der Einzige, der Robert Enke in Jena jemals unter Druck gesetzt hatte, war er selbst gewesen.
Manchmal ging er nach dem Training in Mönchengladbach in den Kraftraum, weil man ihm sagte, das sei wichtig, weil das die meisten Mitspieler taten. Er hatte sich früher praktisch nie an die Fitnessmaschinen gesetzt, sie bedeuteten ihm nichts. Er musste nicht zusätzlich trainieren, er hatte das Talent. Im Kraftraum gab es keine Fenster. Kamps war meistens schon mit Jörg Neblung da, dem Athletiktrainer. Die beiden maßen sich im Bankdrücken. Neblung, ein ehemaliger Zehnkämpfer, hatte mit seinen langen Beinen aufgrund der Hebelwirkung eigentlich keine Chance, so viel Gewicht zu drücken wie der kleine, bullige Kamps, aber der Sportler in Neblung lebte, er pumpte, er drückte, er legte 120Kilo vor, und Kamps zog nach, er wollte ihn übertreffen, unbedingt, jedes Mal. Robert Enke tat, als ob er gar nicht hinschaute.
„Na, soll ich dir die Gewichte runternehmen?“, sagte Kamps, als er sah, dass sich Enke an einer Hantel versuchte, „am besten nimmst du nur die Stange, damit du dich nicht überhebst.“ Kamps lachte, wie man über gute Witze lacht.
So sollte ein gutes Verhältnis unter Torhütern sein, fand Kamps; sportlich fair, herzlich hart.
„Uwe genoss es, aus allem einen Wettkampf zu machen“, sagt der Athletiktrainer Neblung. „Er hatte eine hochprofessionelle Einstellung, er verließ immer als Letzter das Trainingsgelände. Nur mit solch einer Berufsauffassung konnte ein Profi Erfolg haben, da waren wir uns damals sicher.“ Mit seinem kompromisslosen Trainingsfleiß hatte Kamps seine natürlichen Nachteile überwunden, eigentlich schien er zu klein für einen Torwart, doch trotz seiner Größe von nur 1,80 Metern hielt er sich schon ein Jahrzehnt unerschütterlich im Tor der Borussia.
Der Athletiktrainer versuchte, den neuen Torwart zu einem ähnlichen Krafttraining wie Kamps zu überreden. Enke besaß eine breite Schulterachse, aber die dünnen Arme und Beine eines ungeformten Teenagers. „In ihm schlummerte ein Athlet“, sagt Neblung. Der Athletiktrainer hatte als ehemaliger Leichtathlet bei den Fußballern zunächst einen schweren Stand, denn Leichtathlet wurde man doch, weil man nichts am Ball konnte. Nach und nach waren mehr Spieler zu ihm gekommen, „Jörg, wir müssen dehnen“; „ey, Neblung, ich will was für meine Schnelligkeit tun“. In seinem dritten Jahr bei der Borussia war er in der Elf endlich halbwegs etabliert, da insistierte er nicht, als sich Robert Enke beharrlich einem gezielten Athletiktraining verweigerte. Er war doch nur der dritte Torwart. „Er trat nicht wirklich in Erscheinung“, sagt Neblung.
Als Schüler war er auf andere zugegangen. Als dritter Torwart wurde er zum Beobachter.
Borussia Mönchengladbach hatte in der Saison zuvor den DFB-Pokal gewonnen, die erste Trophäe seit sechzehn Jahren. Die Pokalsieger hatten Heldenverträge erhalten. Finanziell waren die Gehaltserhöhungen von beängstigendem Wagemut, aber Manager Rolf Rüssmann dachte zuerst an mögliche Erfolge und danach an Kreditrückzahlungsmodelle. Jäh war die Erwartung erwacht, dies könnten noch einmal die Siebzigerjahre werden, als der Verein das Utopia der Avantgarde war. Mit langhaarigen Spielern und freigeistigem Fußball hatte die Borussia Meisterschaften in Serie erobert. Nun besaß Mönchengladbach mit dem Weltklassemann Stefan Effenberg, mit Martin Dahlin oder Christian Hochstätter wieder Figuren. Sie demonstrierten ihren Stellenwert auch gerne.
Im Bus vom Trainingsplatz in Rönneter zurück zu den Duschen im Stadion am Bökelberg musste Robert Enke stehen. Es gab nicht genug Sitzplätze. Die Jüngsten blieben im Gang. Sollten erst einmal etwas leisten, fanden die Älteren.
Als der Bus von der Kaldenkirchener scharf in die Bökelbergstraße einbog, stieß Robert Enke mit einem anderen der stehenden Jungen zusammen, Marco Villa. Villa war 18 und schmächtig. Als ihn Trainer Bernd Krauss zu Beginn der Saison in den Angriff schickte, weil die Etablierten keine Siege brachten, schoss Villa drei Tore in seinen ersten sieben Erstligaspielen. Das gab es noch nie in 33 Jahren Bundesliga. Wer etwas leistete, wer richtig Druck machte, der wurde auch mit 18 akzeptiert, erkannte Robert Enke an Villa.
Villa schmierte den Älteren Seife in die Unterhose, während diese in der Dusche standen. Und die Älteren lachten.
Er tat es nicht, um aufzumucken. Er wollte nur Spaß haben. „Ich habe nicht viel nachgedacht“, sagt Marco Villa. „Im Prinzip wollte ich nur aufgenommen werden bei den Etablierten im Team wie Effenberg oder Kalle Pflipsen. Ich wollte so sein wie sie.“
Als Kamps Villa eines Tages von oben herab belehrte, antwortete er: „Weißt du, Uwe, es gibt Spieler, die respektiert werden, und solche, die gerne respektiert werden möchten. Du gehörst zu den zweiten.“ „Uiuiui!“, rief Christian Hochstätter, der mit 33 gerne den Stammesältesten des Teams gab.
Wenn Villa sich mit 18 erlaubte, was kein 18-Jähriger sich bei der Borussia erlauben durfte, grinsten die Älteren innerlich, und der Große Effenberg schlug ihm auf die Schultern. Villa schoss Tore, und zudem gibt es Menschen, die jeder sofort mag, ohne genau zu verstehen, warum. Marco Villa gehört dazu.
Robert Enke machte nie Scherze mit Seife und Unterhosen. Aber er war auf wunderbar schwerelose Art glücklich, wenn andere in seiner Nähe albern waren.
Manager Rolf Rüssmann betrat die Umkleidekabine.
„Hat mal einer Gesichtscreme? Meine Haut ist so trocken.“
„Hier“, sagte Außenverteidiger Stephan Passlack.
Fünf Minuten später war Rüssmanns Gesicht in eine Kunststoffmaske gepresst. Passlack hatte ihm Haargel gegeben.
Nach dem Training war Robert Enke schnell zu Hause. Es waren nur fünf Minuten vom Bökelberg zu ihrer Wohnung im Loosenweg. Er blieb nicht, wenn die anderen Fußballer noch etwas essen gingen. Er dachte, dass er nicht dabei sein sollte, der Neuling, der dritte Torwart.
Drei- und vierstöckige Mietblöcke aus ockerbraunen Klinkersteinen stehen im Loosenweg nebeneinander, hier läuft die Stadt aus. In den Gärten wehen heute Deutschlandfahnen. Damals standen Porzellangänse mit Schleifchen um den Hals auf dem Rasen des Gemeinschaftsgartens.
Obwohl Robert bereits zur Gehaltsklasse der Besserverdienenden gehörte, überwiesen Teresas Eltern monatlich die Hälfte der Miete. So wie es sich nach ihren Vorstellungen im Studium der Tochter gehörte.
Jeden Tag fuhr Teresa die dreißig Kilometer zur Universität nach Düsseldorf, Studiengang Lehramt, Fächer Sport und Deutsch, und nach den Vorlesungen fuhr sie wieder nach Hause. Sie wollte bei Robert sein, auch schienen die anderen Studenten bereits feste Freundeskreise in den Wohnheimen gefunden zu haben. Sie wusste nicht recht, wie sie sich integrieren sollte. Plakate kündigten eine große Mensaparty an, und sie beschloss, mit Robert zu dem Fest zu gehen.
Die meiste Zeit standen sie allein da.
Sie musste plötzlich an ihre alte Schulfreundin Chris aus Bad Windsheim denken. Melancholisch schickte sie der alten Freundin eine SMS: „Weißt du noch, wie wir mit 13 immer im Café Ritter saßen und uns das Universitätsleben vorstellten, mit der täglichen Frage: Gehen wir in eine Vorlesung oder doch ins Café?“
Nur der Studentenjob erinnerte sie an ihre ursprüngliche Idee vom Universitätsleben. Sie arbeitete in einem Schuhgeschäft. „Leider habe ich dreißig Prozent Rabatt bekommen, da war das verdiente Geld noch im Laden schnell wieder ausgegeben.“
Er staunte, wie leichtherzig sie ihr Geld für Schuhe ausgab. Ihm fiel es schwer, sich etwas Teures zu kaufen. Auf sein Geld, fand er, müsse man aufpassen.
„Entschuldigung“, sagte der Bankangestellte, als Teresa einmal Geld vom gemeinsamen Konto abhob, „aber bei Ihrem Kontostand frage ich mich gerade, ob Ihr Freund und Sie das Geld nicht mal irgendwie anlegen wollen?“
Robert Enkes Gehalt ging auf sein Girokonto, und dort ließ er es liegen. Er hatte Flippis gebrauchten Peugeot gegen einen kleinen Audi getauscht, er kaufte sich zweimal im Jahr Kleidung, Sommer wie Winter im Schlussverkauf, und hatte ansonsten wenig Wünsche, die man sich mit Geld erfüllte. Er lag gerne mit Teresa zu Hause auf dem Sofa.
Wenn sie für die Universität lernte, schaltete er den Fernseher ein oder las Zeitung, gelegentlich einen Kriminalroman, aber er ging nicht aus. Er wartete darauf, dass sie mit dem Lernen fertig wurde.
Als Teresa ein Jahrzehnt später am Tag nach seinem Tod mit ihren offenen Worten über Roberts Depressionen die Öffentlichkeit bewegte, werden viele in ihr die starke Frau gesehen haben, die doch hinter jedem starken Mann stehe. Ihre Freunde dagegen haben in all den Jahren davor das Gefühl gehabt, dass die beiden einfach immer füreinander da waren. In Mönchengladbach, zum ersten Mal gemeinsam alleine in einer fremden Stadt, entstand eine vollkommene Nähe zwischen ihnen. „Wir gehen ja auch mal ohne Frauen aus“, sagt Torsten Ziegner, der Ziege, der Freund aus Jena, „das gab es beim Enkus eigentlich nicht. Wenn du mit dem Enkus verabredet warst, warst du mit ihm und Teresa verabredet.“
Sie waren glücklich in der frischen Unabhängigkeit von den Eltern, mit all den Erfahrungen dieser Lebensphase, die einem später auf so milde Art peinlich sind: das unkontrollierte Herumgammeln, der Wäscheständer als Kleiderschrankersatz, der erste selbst gekaufte Badvorleger. Aber die Liebe und die große Freiheit des eigenständigen Lebens konnten ein Unbehagen nur überdecken, nicht tilgen. „Wir waren zwei 19-Jährige, die eigentlich in eine Wohngemeinschaft gehörten, die Monate zuvor noch Teil einer Gruppe in Jena gewesen waren“, sagt Teresa. „Und plötzlich waren wir in diese fremde Kleinstadt ohne Studentenszene geworfen worden, wo wir keine Freunde hatten und sie auch nicht so leicht fanden.“ Manchmal fragte sie sich: Das also war das Erwachsenenleben?
Jeden sechsten Freitag putzte Teresa oder Robert das Treppenhaus. Die anderen fünf Mietparteien im Haus hatten beschlossen, die zwanzig Mark für die Putzfrau zu sparen. Einmal kam Teresa freitags spät von den Vorlesungen, Robert war zu einem Spiel mit Borussias Reserveelf unterwegs. Sie würde die Treppe samstags putzen, dachte Teresa. Am Freitagabend klingelte es an ihrer Tür.
Corinna, eine ordentliche Nachbarin, stand vor Teresa.
„Die Treppe ist nicht geputzt!“
„Ich weiß. Robbi ist nicht da, und ich bin ziemlich müde von der Universität. Ich mache es morgen, gleich in der Früh.“
„Die Treppe muss freitags geputzt werden!“
Corinna klingelte immer öfter. Die Treppe sei an den Rändern nicht richtig geputzt. Jemand sei mit dreckigen Schuhen über die noch nasse Treppe gelaufen.
Robert gab sich Mühe, der Frau unverändert mit zurückhaltender Höflichkeit zu begegnen. Teresa zog nach ein paar Wochen freitags eingeschüchtert die Schuhe unten am Hauseingang aus und ging in Strumpfsocken die Treppen hinauf in den dritten Stock.
Marco Villa besuchte sie manchmal im Loosenweg. Robert und er kannten sich seit drei Jahren, ohne etwas Substanzielles über den anderen zu wissen. Sie hatten gemeinsam in der Jugend-Nationalelf gespielt. Marco Villa kam aus Neuss, Robert Enke aus Jena. Ihr erster Trainer in der Jugend-Nationalmannschaft, Dixie Dörner, habe das Ost-West-Denken gefördert, fand Marco, schon beim Aufwärmen habe es eine Gruppe Ost, eine Gruppe West gegeben.
Einmal kam Marco zum Mittagessen. Robert saß im roten Ledersessel und las ein Buch. Marco erhaschte einen Blick auf den Titel.
100 Jobs mit Zukunft. Von Claudia Schumacher und Stefan Schwartz.
„Was liest du denn da? Suchst du einen neuen Job, oder was?“
„Ich wollte mal schauen, was man außer Fußball machen könnte.“
„Hast du einen an der Waffel? Du bist Bundesligaprofi!“
„Bei dir ist es anders, Marco. Du spielst, du machst deine Tore. Aber ich bin nicht einmal als Ersatzmann bei den Spielen dabei. Ich trainiere, und wenn es zählt, sitze ich zu Hause oder auf der Tribüne. Ich bin nutzlos.“
„Du bist 19, Robbi! Das ist dein erstes Jahr hier. In ein paar Jahren wirst du spielen, mach dich doch nicht verrückt.“
Sie vertieften das Thema nicht. Wenn Marco Robert Jahre später an die Szene erinnerte, sagte Robert, „was erzählst du da, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, solch ein Buch jemals besessen zu haben“. Doch das Buch steht noch heute in seinem Büro in Empede, die Silbermedaille der Europameisterschaft 2008 baumelt daneben. Teresas Vater hatte ihm das Buch geschenkt. „Schau doch einmal rein“, hatte er gesagt, „vielleicht interessiert dich ja ein anderer Beruf.“ Wenn es mit dem Fußball wirklich so schlimm sei.
Er wollte nicht mehr zum Training. Es war Winter, Januar 1997, um halb fünf brach die Dunkelheit herein, und er saß in dieser Kleinstadt, mit der ihn nichts verband, in diesem Haus, in dem die Gartenzwerge liebevoller behandelt wurden als die Nachbarn. Und all das, um dritter Torwart zu sein, um mit der Reservemannschaft vor 120 Zuschauern zu spielen, um jeden Tag die Anspannung im Training zu ertragen.
Die Stimmung in der Umkleidekabine war gereizt. Trainer Bernd Krauss stand jeden Samstag wieder 90 Minuten vor dem Rauswurf, im Dezember war es dann so weit. Die Pokalsiegerelf, zum Generalangriff auf die Bundesligaspitze hochgerüstet, dümpelte im Mittelfeld der Tabelle herum. In einem Trainingsspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Köln durfte Robert Enke einmal in der ersten Elf spielen. Die Borussia verlor 1:4.
Er spürte wieder das heiße, hektische Pochen. Die Angst aus der A-Jugend, die Großen zu enttäuschen, war wieder da. Er fürchtete, er könnte nie so werden wie Kamps, immer Druck machen; immer Druck aushalten. Er hatte das Gefühl, keinen interessiere, was der dritte Torwart mache, er sei unsichtbar – und gleichzeitig fürchtete er, er könnte sich in der angespannten Lage mit Fehlern im Training den Zorn der Großen im Team zuziehen. Das war ein Widerspruch, aber diese Angst ist ein einziges Paradoxon.
Für Teresa war das ein neuer Robbi. Sie war verwirrt, wo kam diese Angst her, so kannte sie ihn nicht. Gleichzeitig spürte auch sie eine Enttäuschung angesichts ihres anonymen Universitätslebens, vielleicht quälte ihn ebenso wie sie die Sehnsucht nach dem unbeschwerten Leben mit den Freunden in Jena. Oder es waren einfach nur ein paar schlechte Tage.
Eine Woche verging, und jeder Morgen begann gleich.
„Ich will nicht ins Training.“
„Robbi, es ist doch nicht so schlimm.“
„Ich will da nicht hin, verstehst du nicht, ich will einfach nicht.“
„Marco ist doch auch da. Du wirst sehen, wenn du erst einmal dort bist, geht es schon.“
Als er aus der Tür war, rief sie seinen Vater an.
Dirk Enke kam am nächsten Wochenende.
Er kannte die Angst von seinen Patienten. „Aber sehen Sie“, sagt er, „ich bin da als Therapeut einfach nicht zuständig, das kann ein Vater nicht leisten.“ Er konnte dem Sohn nur sagen: Gib deinem Tag eine feste Struktur. Bei seinem Besuch warf er ihn morgens um sieben aus dem Bett, damit der Tag gleich losging, damit es feste Ziele am Horizont gab, Dinge, die der Sohn erledigte, und wenn es nur ein Spaziergang war, der ihm das Gefühl gab: Ich habe etwas geschafft.
„Und geh zu einem Arzt“, sagte der Vater zum Abschied.
Bei der Borussia stand das Wintertrainingslager an. Aus Angst wurde Panik. Er glaubte, er könne da nicht hin, eine Woche ausschließlich in dieser Fußballelf, in der er nicht beachtet wurde und in der jeder Fehler von ihm im Training ganz genau registriert werden würde.
Er ging zu Heribert Ditzel, dem Mannschaftsarzt.
Ärzte von Profimannschaften stehen unter einem immensen Druck der Trainer, wöchentlich werden sie bedrängt, gegen ihren medizinischen Sachverstand verletzte Spieler mit Schmerzmitteln in den Kampf zu schicken.
Dieses Mal jedoch dachte der Arzt nur an den Menschen vor ihm, nicht an den Klub. Ditzel mochte den zurückhaltenden Jungen. Er dichtete Robert Enke einen Grippevirus an, sodass der Torwart nicht ins Trainingslager fahren musste.
Als die Mannschaft zurückkam, erhielt er einen neuen Spitznamen. Robert Enke war nun Cyrus für die Kollegen. Nach Cyrus dem Virus, einer Figur aus dem Kinofilm Con Air. Niemand zweifelte daran, dass er an einem Grippevirus litt. Er konnte über den neuen Spitznamen herzlich lachen. Ohne erkennbaren Anlass hatte sich die Angst nach vier Wochen wieder verzogen.
Er strengte sich an, von Kamps zu lernen. Wenn der es offenbar zur Motivation brauchte, ihn als Rivalen zu betrachten, dann würde er eben heimlich von ihm lernen. Er beobachtete den Alten beim Training aus den Augenwinkeln. Er habe sich dann auch bei Schüssen aus nächster Nähe spekulativ in eine Richtung geworfen oder Flanken gefaustet, die er vielleicht hätte fangen können, sagte Robert später, fast verschämt. „Ich habe Uwes Stil ein wenig kopiert.“
Einige deutsche Torhüter wie Uwe Kamps legten nach einer erfolgreichen Flugparade unter dem Raunen des Publikums noch zwei Rollen auf dem Rasen hin. Sie orientierten sich an der Lehre des Achtzigerjahre-Idols Toni Schumacher. Tauchte der Stürmer alleine vor ihnen auf, warfen sie sich ihm mit aller Macht in den Weg. Lenkten sie den Ball über die Torlatte, zogen sie während des Sprungs die Knie nach oben, damit auch der Letzte die Dramatik der Situation begriff. Deutsche Torhüter waren die besten der Welt, fanden die Deutschen.
Niemand im deutschen Publikum störte sich Ende der Neunziger daran, dass selbst exzellente Torleute wie Andreas Köpke, Stefan Klos und ein junger Mann aus Karlsruhe namens Oliver Kahn tief im eigenen Strafraum spielten, nah an der Torlinie, während in Argentinien, Spanien oder den Niederlanden der Torwart zum Ersatzlibero wurde. Weit vorgerückt machte er dem Gegner Steilpässe in die Sturmspitze unmöglich oder brach als zusätzliche Anspielstation für die eigene Abwehr das Pressing des Gegners. Einer der radikalsten Propheten des offensiven Torwartspiels war Edwin van der Sar von Ajax Amsterdam. Robert Enke sah van der Sar im Fernsehen, sah Uwe Kamps im Training, verglich und orientierte sich am deutschen Modell, spektakulär zu retten statt vorausschauend zu agieren.
Nach einem Dreivierteljahr in Mönchengladbach erhielt er erstes Lob. „Die Borussia kann sich glücklich schätzen, diesen Jungen zu haben“, sagte der neue Trainer Hannes Bongartz der Rheinischen Post. „Ihm gehört die Zukunft.“
Robert Enke hatte in seinen ersten Monaten bei der Borussia gelernt, dass Fußball kein Spiel, sondern Kampf sei, dass Fußballer ihre Ziele mit Druckmachen und Druckbekommen erreichten. Aber was ihn betraf, so fühlte er sich von Bongartz’ Lob beflügelt wie von keinem Druck.
Bei der Saisonabschlussfeier, bei der die Borussia weniger ihren belanglosen elften Rang als den Fakt feierte, dass das Spieljahr vorbei war, wollte er gegen Mitternacht nach Hause. Teresa mochte gerne noch bleiben.
Sie war neugierig auf diese Bundesligawelt, außerdem gab es endlich einmal ein Fest, wie sie sich viele von der Universität erhofft hatte. Sie saßen in einem Gewächshaus. Ein Blumengroßhandel war für die Feier umgestaltet worden.
„Dann bleib du noch, ich gehe nach Hause“, sagte Robert und verabschiedete sich.
Die letzte Handvoll Spieler weilte noch auf der Feier, als Stefan Effenberg in die Nacht rief: „So, wo gehen wir jetzt noch hin?“
Effenberg war als Fußballer längst zu groß für die Borussia und musste dieses Gefühl des Öfteren kompensieren.
„Wir können auch noch zu uns gehen“, sagte Teresa, so wie sie es an der Universität gesagt hätte.
„Nein, lass mal“, sagte Effenbergs Frau. Das kam offenbar gar nicht infrage.
Als Teresa Robert am nächsten Morgen davon erzählte, antwortete er: „Wenn ihr hierhergekommen wärt, hätte ich sie rausgeworfen. Und dich mit ihnen.“ Sie erschrak über den Ernst in seiner Stimme.
Sie tat sich schwer zu verstehen, warum er meistens nur still wurde, wenn andere laut feierten. „Heute bin ich stolz auf ihn, dass er damals schon so einen festen Charakter hatte“, sagt sie, „dass er sagte: ›Ich mache eben nicht gerne Party, also gehe ich auch nicht auf ein Fest oder in eine Disko, selbst wenn alle anderen mich dazu drängen.‹“
Er schätzte Effenberg für seine Art, mit jungen Spielern fürsorglich wie ein großer Bruder umzugehen. Wenn einer wie Marco Villa mit 18 begeisternd spielte, zollte ihm Effenberg nicht nur Respekt, sondern gewährte ihm Schutz. Aber anders als Marco hatte Robert Enke kein Interesse daran, die Welt der Effenbergs und Kamps’ außerhalb des Bökelbergs zu erkunden. Er hatte ein Bild im Kopf von Nächten im Neonlicht mit großspurigem Gehabe, und er fühlte, er passe dort nicht hinein.
Gelegentlich gab es für Robert Enke Ferien vom anonymen Alltag als Ersatz des Ersatztorwarts. Zu den Junioren-Länderspielen wurde er weiterhin als Nummer eins berufen. In Belfast spielten sie gegen Nordirland, er teilte sich mit Marco das Hotelzimmer. Sie kannten die Angewohnheit von Junioren-Bundestrainer Hannes Löhr, am Vorabend noch einmal aufs Zimmer zu kommen und sie auf die Partie einzustimmen. Sie kannten nach einem Jahr aber auch Löhrs Sprüche.
Morgen müssen wir unbedingt gewinnen. Das ist ein ganz wichtiges Spiel.
„Ich habe heute keinen Bock drauf“, sagte Robert.
Und sie schoben den Fernseher von innen direkt vor die Zimmertür. Wie erwartet, klopfte es gegen halb neun.
„Wer ist da?“
„Der Trainer.“
„Oh, Trainer, Moment mal, es ist gerade ganz schlecht, Vorsicht! Oh nein – Trainer, warten Sie bitte mal kurz!“
„Was ist denn los bei euch, Marco?“
Sie unterhielten sich noch immer durch die geschlossene Tür.
„Der Fernseher steht direkt vor der Tür, wir müssen den erst wegräumen, ich weiß nicht, ob das geht, boah, ist der schwer!“, rief Marco, der seelenruhig auf einem Stuhl saß.
„Ja. Okay, Jungs, lasst mal. War nichts Wichtiges.“ Und Löhr ging. Für die Mitspieler sah es immer so aus, als albere Marco herum, und Robert sei halt dabei. Robert hatte das Gefühl, Marco und er trieben gemeinsam Späße.
„Teresa sagte oft, ihr beide zusammen seid unerträglich albern“, sagt Marco. „Aber die Momente, als wir lachten – das war der glücklichste Robbi.“
Für einen Fußballprofi, der gewohnt war, dass sich alles im Leben dem Sport unterordnete, erhielt Robert Enke im Sommer 1997 eine ungünstige Nachricht. Er musste zur Bundeswehr.
Er hatte Zivildienst leisten wollen. Aber sein Realismus und ein klein wenig auch seine Bequemlichkeit waren größer als seine Überzeugung, niemals Dienst an der Waffe leisten zu wollen. Der Zivildienst hätte dreizehn Monate gedauert. Bei der Bundeswehr musste er als Profisportler in der Sommerpause die dreimonatige Grundausbildung durchlaufen, die restlichen sieben Monate der Wehrzeit wurden ihm als Mitglied der Sportfördergruppe de facto erlassen.
Marco Villa wurde mit ihm eingezogen.
Sie landeten in der Kaserne Köln-Longerich zwischen der Autobahn A1 und dem Gewerbegebiet Bilderstöckchen. Funker Enke und Funker Villa.
„Durchzählen“, brüllte der Ausbilder bei der Begrüßung, trat ganz nah an Robert Enke heran und zischte, Nase an Nase, „na, Sie Supersportler“.
„Was verdienst du, was verdiene ich, was verdienst du, was verdiene ich“, murmelte Robert Enke, als der Ausbilder wieder außer Hörweite war. Marco musste lachen.
„Was gibt es da zu lachen?“, brüllte der Ausbilder. Der Ton war gesetzt.
„Funker Enke!“, brüllte es über den Kasernenhof. Der Ausbilder stand am Fenster. „Kleiderordnung, Funker Enke!“
„Ja, Kleiderordnung“, murmelte Robert Enke unten auf dem Hof, auf dem Weg in die Cafeteria.
„Schauen Sie sich mal an!“
Er hatte das Schiffchen und die Koppel vergessen. Er musste einen vierseitigen Aufsatz schreiben. Über den Sinn der Kleiderordnung bei der Bundeswehr.
Einige Tage später rutschte ihm bei den Liegestützen das Hemd aus der Hose.
„Funker Enke, Kleiderordnung!“
„Ja, was, Kleiderordnung?“, zischte er.
Zur Strafe sollte er einmal um den Block sprinten.
Er trabte, statt zu sprinten.
„Sprinten, habe ich gesagt, Funker Enke!“
Der Ausbilder ließ ihn noch eine Runde laufen, und Robert Enke trabte weiter. Diesmal würde er sein wie Uwe Kamps. Er würde niemals aufgeben. Ihm war heiß vor Zorn. Wenn er etwas nicht ertrug, dann das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden.
Nach elf Runden gab der Ausbilder auf. „Abtreten, Funker Enke.“
Marco Villa erschien es längst zwangsläufig, dass immer Robert die Missgeschicke zustießen. Wenn sie mit der Borussia in einem Hotel waren, schlug Marco auf dem Weg zum Frühstück absichtlich die falsche Richtung ein. Robert tappte brav hinter ihm her, bis sie vor der Abstellkammer statt im Aufzug standen. „Er hatte den schlechtesten Orientierungssinn der Welt“, sagt Marco, »und er brachte mich jedes Mal wieder zum Lachen, wenn er dann panisch rief: ›Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet?‹«
Natürlich, sagt Marco, er wisse, dass jeder irgendwelche Bundeswehr- oder Fußballgeschichten zu erzählen habe, deren Charme für Außenstehende schwer begreiflich sei. Aber für ihn und Robert waren jene drei Monate in Köln-Longerich ein Schatz. Dort fand Robert Enke einen Freund, der ihm für immer bleiben würde.
Heute lebt Marco als Profifußballer mit seiner Frau und den zwei Kindern in Italien, der Heimat seines Vaters. Der italienische Einfluss ist nicht zu verkennen, aus dem braven Mönchengladbacher Schülerhaarschnitt ist eine modische Langhaarfrisur geworden. Er sitzt in Roseto an der Adria beim Frühstückskaffee in der Pasticceria Ferretti und redet über die Liedtexte von Vasco Rossi, „dich interessiert mehr die Schule“, singt Rossi, „aber dann, wer weiß, wie gut du im Rest vom Leben bist“. Da sei was dran, sagt Marco. Da erkenne er sich auch wieder, wenn man Schule durch Fußball ersetze. Wenn Marco erzählt, lauscht ihm jeder gerne. Robert Enke hatte bei ihm vor allem das Gefühl, verstanden zu werden.
Als im August 1997 in Mönchengladbach die nächste Saison nach der Bundeswehrzeit begann, war Marco Villa beim Torschusstraining besonders darauf erpicht, Uwe Kamps zu überlupfen. Er genoss es, wie Kamps dann jedes Mal tobte. „Um nicht falsch verstanden zu werden, der Uwe war im Prinzip sehr nett“, sagt Marco. Doch ohne dass sie jemals konkret darüber geredet hatten, ahnte Marco, wie Robert sich innerlich über den tobenden Kamps amüsierte, und die Vorstellung spornte Marco an, machte ihn glücklich.
Robert Enke machte in seiner zweiten Bundesligasaison den kleinsten Sprung, der in einer Bundesligaelf möglich ist, vom dritten zum zweiten Torwart. Auch der zweite Torwart spielte nie. Doch für ihn bedeutete der persönliche Aufstieg die Welt. Er gehörte endlich dazu. Der zweite Torwart reiste als Ersatzmann zu allen Spielen mit.
Bisher hatte er nur Marcos Geschichten gekannt. Wie die Mannschaft im Vorjahr mit dem Bus nach Freiburg gefahren war. Effenberg und Hochstätter saßen wie gewohnt in der zweiten Reihe direkt hinter dem Trainer, Marco hatte es sich ganz hinten mit Karlheinz Pflipsen und einigen anderen zum Kartenspielen bequem gemacht. Ihnen wurde warm.
„Mach doch mal die Klimaanlage an!“, riefen sie dem Busfahrer zu.
Hinter Karlsruhe wurde die Hitze unerträglich. Als sie in Freiburg zum Bundesligaspiel ankamen, saßen die Kartenspieler nur noch in Unterhose auf der letzten Bank, anders war es nicht auszuhalten.
Später fanden sie heraus, was passiert war.
Der Busfahrer verstand im Lärm des Motors nicht, was Marco Villa von der letzten Bank rief.
„Was wollen die?“, fragte der Busfahrer Effenberg.
„Denen ist kalt“, sagte Effenberg, ohne eine Miene zu verziehen.
„Was? Ich habe die Klimaanlage hinten doch schon auf 26 Grad.“
„Mach sie halt noch höher“, sagte Effenberg.
Nun war Robert Enke dabei. Er flachste mit Kamps, er hatte sich an dessen Ehrgeiz gewöhnt. Seit er in der Mannschaft als talentierter Ersatztorwart Anerkennung fand, war Kamps’ extremer Wettkampfgeist gar nicht mehr so schwer zu ertragen.
Vor den Bundesligaspielen teilte er sich mit Marco das Hotelzimmer. Der Große Effenberg klopfte bei ihnen an. Er wollte gegen Marco auf der Playstation Autorennen fahren. Einsatz 100Mark pro Rennen, sagte Effenberg. In wenigen Minuten hatte Marco 1000Mark verdient. Effenberg forderte ihn auf, weiterzuspielen, obwohl er sehen musste, dass er nie gewinnen würde.
Robert blieb im Hintergrund sitzen und sah still zu, wenn Effenberg im Zimmer war.
Zu Hause wünschte sich Teresa einen neuen Mitbewohner. Er reagierte abwehrend. Einen Hund?
Wenn Teresa sich als Kind das Erwachsensein vorgestellt hatte, hatte sie immer ein Haus auf dem Land mit vielen Tieren gesehen. Sie hatte Robert nach seiner Idee von der Zukunft gefragt. Er hatte keine Vorstellung. Er hatte seine Träume immer auf den Fußball beschränkt.
„Ein Hund wäre doch schön.“
Er schwankte. Er wollte kein Tier im Haus. Aber er hatte auch nichts dagegen. Was ihn glücklich machte, war, andere glücklich zu machen, vor allem Teresa. Also gut, ein Hund.
Sie nannten ihn Bo. Sie hatten keine Ahnung, wie man einen Hund erzieht.
Bo war den ersten Tag bei ihnen. Sie mussten einkaufen gehen. Der Hund schlief friedlich. Teresa wollte ihn nicht aufwecken.
„Komm, wir schleichen uns kurz raus, der merkt das gar nicht“, sagte Teresa. In ein paar Minuten wären sie doch wieder zurück.
„Als wir wiederkamen, war er natürlich traumatisiert.“ Teresa lacht sanft über sich selbst. „Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Nach ein paar Wochen waren wir wie besorgte Eltern mit dem ersten Kind. Wir gingen nur noch getrennt ins Kino, damit Bo nicht allein blieb und bellte.“
Der Hund war ein willkommener Anlass für die Nachbarn, sich aufzuregen. Er liefe immer über die frisch geputzte Treppe, schrie Corinna.
Für Teresa und Robert war der Hund ein weiterer Anlass, endlich auszuziehen. Borussias Busfahrer wohnte fünfzehn Kilometer südlich von Mönchengladbach. Seine Dachwohnung sei frei, sagte Markus Breuer.
Teresa knipste ein letztes Foto im Loosenweg, die Porzellangänse im Garten. Zum Ende des Jahres 1997 trugen sie ihre Möbel aus der Wohnung. Corinna rief zum Abschied, um 22Uhr solcher Lärm, das sei eine Unverschämtheit. Robert schrie zum ersten Mal zurück. „Jetzt ist es doch gut, wir ziehen aus, Corinna, in wenigen Minuten siehst du uns nie wieder, lass uns doch wenigstens jetzt in Ruhe!“
Man fährt die alte Landstraße über Wey durch Rüben- und Weizenfelder, an manchen Stellen wird die Straße fast zum Feldweg. Hinter Hoppers kommt Gierath.
In den zurückliegenden dreißig Jahren ist Gierath enorm gewachsen, das Neubaugebiet überragt den alten Ortskern. Das Dorf hat nun 1500 Einwohner.
Robert Enke wurde von Markus Breuer schnell integriert.
Im Erdgeschoss seines Hauses in der Schulstraße betreibt Breuer ein Sportgeschäft. Einmal musste er kurz weg, seine Frau war mit dem Kind beim Arzt, Breuer klingelte in der Dachwohnung. „Robert, könntest du bitte mal eine halbe Stunde den Laden übernehmen?“
Ein Kunde trat ein und verlangte prompt Torwarthandschuhe. „Haben Sie Ahnung davon?“
„Ein bisschen“, sagte Robert Enke.
Er erklärte dem Kreisligatorwart alles über den Unterschied zwischen fünf und sechs Millimeter Schaumstoffbelag, Titaniumhaftschaum oder Naturlatex. Als Markus Breuer zurückkam, wollte der Kunde gerade gehen. »Wer ist denn der neue Verkäufer, den du da hast?«, fragte er. „Der ist ja richtig nett. Und sogar kompetent.“
Breuer stellte ihnen einen Jäger vor. Hubert Roßkamp könne ihnen sicher einmal die Hunde abnehmen. Es waren mittlerweile zwei.
Nachmittags nach dem Training ging Robert oft mit Hubert und den Hunden durch die Felder spazieren.
„Man konnte ihm doch gar nicht anmerken, was er war, so bescheiden trat er auf, so normal war er angezogen“, sagt Hubert Roßkamp, 73 Jahre alt mittlerweile.
Er arbeitete als Industriekaufmann bei Rheinmetall in Düsseldorf. Seine Stube hat er zum persönlichen Museum umfunktioniert, überall hängen Roberts Trikots mit der Aufschrift „Für meinen Freund Hubert“. Auf dem Regal in Huberts Küche steht zuvorderst das Hochzeitsfoto von Robert und Teresa. Die Fotos von seiner Familie hat er dahinter platziert. Auf einem trägt Hubert zur Feier des Tages ein schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte zum weißen Anzug und den langen weißen Haaren. Vor zwei Jahren hat er sich einen Sportwagen gekauft, einen Mazda MX5, ein Jugendtraum, erfüllt mit 71. Und man merkt, wie wenig solche Symbole über Menschen sagen, nicht nur über Fußballer, auch über Rentner: Bescheidenheit gehört zu Huberts auffälligeren Eigenschaften.
Nachmittags in den Feldern stellte Hubert Robert Fragen. Sag mal, wie muss man eigentlich fliegen als Torwart? Haste keine Angst, wenn die Stürmer kommen? Ein Torwart, der dem Ball hinterherfliegt, strecke die untere Hand immer ein wenig weiter heraus als die obere und versuche beide Arme parallel zu halten, erklärte ihm Robert. Und Angst, nein, Angst habe er sicher nicht. Ein gesundes Maß an Nervosität sei wichtig, aber mehr sei da auch nicht.
Als er einige Tage nach dem 24. August 1998 auf der Terrasse in Gierath seinen 21.Geburtstag nachfeierte, war Hubert eingeladen, es kamen Nachbarn wie der Busfahrer Markus Breuer mit seiner Frau Erika und Teresas Freundin Christiane, die als Türsteherin in einer Diskothek arbeitete. Aus Borussias Mannschaft waren nur Marco Villa da und Jörg Neblung, der Athletiktrainer, dessen Einzeltraining Robert im ersten Jahr beflissentlich ausgewichen war. Im Juli 1998 hatte die Borussia Neblung nach vier Jahren den Vertrag nicht verlängert. Er war als Mitarbeiter zur Agentur von Roberts Berater Norbert Pflippen gewechselt.
Es gab Sekt, Christiane backte Pizza, Hubert brachte Robert wie gewohnt Erdbeerkuchen. Damals fiel es Marco gar nicht auf, dass außer ihm keine Gleichaltrigen, keine engen Freunde von Robert auf dem Fest waren. „Es war eine angenehme Feier mit lauter lieben, netten Menschen“, sagt Marco, „und Robbi war glücklich.“ Was nicht zuletzt am Fußball lag.
Es hatte geknallt, und aus Robert Enke war kurz vor seinem 21.Geburtstag jäh ein Mann im Auge der Öffentlichkeit geworden. Am 7.August1998 trainierte die Borussia auf dem Fußballplatz neben dem Bökelbergstadion. Die Torhüter übten getrennt vom Rest der Mannschaft, Dirk Heyne schlug Flanken, Enke stieg hoch, Kamps stieg hoch, sie wechselten sich ab. Den Knall hörten auch die Spieler in der anderen Hälfte des Spielfelds. Wenn eine Achillessehne reißt, klingt es wie ein Peitschenhieb. Uwe Kamps blieb am Boden liegen. Zunächst war es mehr der Schreck über den Knall, der ihn niederstreckte, als der Schmerz in seiner rechten Ferse.
Er wurde noch am selben Tag in der Unfallklinik in Duisburg operiert. Er werde vier Monate ausfallen, prognostizierte der Chirurg. Die neue Bundesligarunde begann in acht Tagen.
In Jena warf Andy Meyer am nächsten Morgen einen flüchtigen Blick in die Zeitung. Er musste, alleine im Zimmer, kurz lachen. „Der unangefochtene Stammtorwart verletzt sich direkt vor dem Bundesligastart schwer – wann passiert so etwas schon einmal“, sagt Andy. „Und natürlich profitiert wieder einmal der Enkus davon.“
In der Wahrnehmung von Teresa gingen die acht Tage so schnell vorüber und dauerten gleichzeitig so ewig lange. So oft ließ sich in acht Tagen freudig denken: Endlich. So oft ließ es sich in acht Tagen schaudern: Und wenn er ein Tor verschuldet?
Borussia Mönchengladbach hatte schlagartig einen Torhüter mit der Erfahrung aus 389 Bundesligapartien verloren; ein einziger Fußballer, Berti Vogts, hatte öfter als Kamps für den Klub gespielt. An seiner Stelle stand nun ein Torwart, der noch in keinem einzigen Bundesligaspiel erprobt war und der Jüngste in der Liga sein würde. „Robert hat unser vollstes Vertrauen“, verkündete Friedel Rausch, der mittlerweile vierte Trainer in Robert Enkes drittem Jahr bei der Borussia.
„Was sollte Rausch denn sonst sagen?“, sagt Jörg Neblung. »Meine Wette ist: In Wirklichkeit fühlte sich der Trainer unwohl. Sein Routinier verletzt sich, und jetzt hatte er da so einen Grünschnabel.«
Marco Villa sah es anders. „Viele in der Mannschaft fanden Robbi damals schon stärker als Kamps, unser Libero Patrik Andersson zum Beispiel. Deshalb machten wir uns keine Sorgen, wirklich nicht.“
Wahrscheinlich hatten alle Beteiligten Jörgs und Marcos Gedanken. Wie Teresa schwankten sie zwischen Zuversicht und Bedenken.
Robert Enke selbst wurde ganz ruhig.
Er hatte einen Mechanismus entwickelt, innere Nervosität in äußere Ruhe umzuwandeln. Ganz selten setzte der Mechanismus aus. Dann überkam ihn die Angst, wie drei Jahre zuvor im Zweitligaspiel für Carl Zeiss Jena in Leipzig, wie in seinem ersten Winter in Mönchengladbach. Doch fast immer waren Unruhe oder Aufregung für ihn der Stoff, um hochkonzentriert und ruhig zu werden.
Am Tag vor dem Bundesligaauftakt schrieb die Westdeutsche Allgemeine Zeitung: »Dieser 20-Jährige wirkt schon so unglaublich reif, so vernünftig, so ausgeglichen.« Er sagte der Zeitung: „Vorbilder habe ich nicht, jetzt sowieso nicht mehr.“
Der Vater kam aus Jena angereist, einer von Teresas Brüdern aus Würzburg. Gisela Enke war in der Slowakei im Urlaub. „Zu Roberts erstem Bundesligaspiel gehen wir gemeinsam“, hatten sie und Dirk Enke sich nach der Trennung versprochen. Das klappte nun nicht. Schalke04 hieß der Gegner am Bökelberg. „Wir haben uns auf der Tribüne gegenseitig fertiggemacht mit unserer Nervosität“, sagt Teresa.
In der vergangenen Saison war die Borussia erst am letzten Spieltag dem Abstieg entronnen, danach war der Große Effenberg für eine Ablöse von 8,5 Millionen Mark zu Bayern München weitergezogen. Ein bisschen Gemütlichkeit war von daher das Höchste, was sich die meisten in Mönchengladbach von der Saison 1998/99 erhofften, einen Platz im Mittelfeld der Bundesliga, nur weit genug weg von der Hatz des Abstiegskampfes.
Das Stadion war mit 34000 Zuschauern ausverkauft. Die Sonne schien. Die Stehplatzkurven direkt hinter den Toren stiegen am Bökelberg steiler an als irgendwo sonst in der Bundesliga. Wenn der Torwart unmittelbar vor dem Anpfiff von der Mittellinie seinem Tor entgegenlief, wurde die voll besetzte Tribüne dahinter mit jedem Schritt höher. Erreichte der Torwart den Fünfmeterraum, fühlte er sich wie am Fuße einer Schlucht.
Robert Enke spielte ganz in Schwarz, der Farbe großer Torhüter aus anderen Zeiten, Lew Jaschin, Gyula Grosics, Ricardo Zamora.
Das Spiel begann. Ein Stürmer setzte sich sofort am rechten Flügel durch, war vorbei am zweiten Gegner, scharf und flach trat er die Flanke auf Höhe des Fünfmeterraums, ins Revier des Torwarts. Der Verteidiger blieb weg, weil er glaubte, der Torwart kümmere sich um die Flanke. Aber der Torwart zögerte. In einer Zeit, in der kein Mensch einen Gedanken zu Ende bringen kann, muss sich ein Torwart entscheiden, ob er aus dem Tor eilt oder nicht. Nun war es schon zu spät.
Robert Enke sah vom anderen Ende des Spielfelds zu, wie Borussias neuer Mittelstürmer Toni Polster das Zögern von Schalkes Torwart Frode Grodås zum 1:0 nutzte. Die zweite Spielminute brach gerade erst an. Nach zehn Minuten erhöhte Mönchengladbach den Vorsprung auf 2:0.
Die Partie hatte ihre Hochspannung bereits verloren, ehe er das erste Mal ernsthaft auf die Probe gestellt wurde.
Das Publikum nahm Robert Enke nur noch unter dem Eindruck der klaren Führung wahr; beim Stand von 2:0 erschien alles und jeder ein wenig glänzender. Die Reduziertheit seiner Bewegung, die Abwesenheit jeglicher Hektik in seiner Körpersprache gaben ihm die Ausstrahlung eines Torwarts, den nichts erschüttern kann.
Die Borussia beließ es dabei, geballt zu verteidigen und schnell zu kontern. Zweimal schossen die Schalker den Ball an die Latte, einer Handvoll mehr oder minder gefährlicher Schüsse und Kopfbälle stellte er sich souverän entgegen. Zehn Minuten vor Spielende fiel das 3:0. Das war es.
„Ich dachte eigentlich, dass ich nervöser sein würde“, sagte Robert Enke den Sportreportern im Kabinengang. Mit leisem Enthusiasmus erzählte er von den Flanken, die viel schärfer hereingeflogen seien, als er es jemals im Training oder in der Reserverunde erlebt habe. Wie so oft, wenn er gut gelaunt war, antwortete er auf Lob mit Selbstironie: „Der Ball kam so schnell, dass mir manchmal überhaupt nicht klar war, wann ich zu einer Flanke raussollte; aber irgendwie lag der Ball dann immer in meinen Händen.“
Nach dem Spiel redeten wenige über den Torwart. Der neue Stürmer Toni Polster konzentrierte die Schlagzeilen auf sich. Die Rheinische Post veröffentlichte eine Doppelseite unter der Dachzeile „Borussia ist erstmals seit zehn Jahren wieder Tabellenführer“, was nach dem ersten Spieltag nicht die größte Kunst war.
Zu Hause legte Robert Enke die Handschuhe, die er mit Shampoo unter der Dusche gereinigt hatte, zum Trocknen aus und strich den weichen Schaumstoff ihrer Fangflächen glatt.
Drei
Niederlagen sind sein Sieg
In einer vor Regen triefenden amerikanischen Kleinstadt hatte der Mörder schon fünf Menschen auf dem Gewissen, als er eines Nachts einen Hundekadaver auf der Straße liegen sah. „Das war ich aber nicht“, sagte der Serienmörder trocken. An dieser Stelle des Kinofilms Sieben von David Fincher musste Robert Enke immer lachen. Eigentlich verabscheute er Gewalt, er war restlos davon überzeugt, was er bei einer Bedrohung machen würde. Weglaufen. Trotzdem schaute er sich den an Gewaltszenen nicht gerade armen Spielfilm fünf- oder sechsmal an. Sieben, mit Morgan Freeman und Brad Pitt in den Hauptrollen, gab ihm etwas, das immer schwieriger zu finden war, seit er für Borussia Mönchengladbach im Tor der Bundesliga spielte. Der Film war so spannend, dass Robert Enke alles andere und vor allem den Fußball für 127 Minuten vergaß. Abzuschalten war die schwierigste Aufgabe geworden.
Sein innerer Film lief unaufhörlich. Alles war neu, aufregend, begeisternd, und gleichzeitig hatte ihn der Profisport mit seinem ewigen Rhythmus sofort nach dem Debüt vereinnahmt. Jede Woche ein Spiel, pausenlos. Für ihn gab es keinen Schlusspfiff. Die Spielszenen spulten sich in seinem Kopf immer wieder ab, der Freistoß von Kaiserslauterns Martin Wagner, den er erst sah, als er nur noch eine Umdrehung vom Torwinkel entfernt war, der markante Fernschuss des Frankfurters Chen Yang aus 25 Metern präzise unter die Latte; für einen Torwartdebütanten bedeutet es wenig, ob ein Tor unhaltbar war oder nicht. Er grübelte nach jedem Tor, wie er es hätte halten können.
Im Videoladen kannte man ihn schon nach wenigen Wochen.
Zwei Monate waren seit dem Saisonstart gegen Schalke04 vergangen. Borussia Mönchengladbach hatte von den folgenden acht Spielen kein weiteres mehr gewonnen. Robert Enke war nur eine Fußnote in der Misere. Und der junge Torwart verhinderte noch Schlimmeres!, stand regelmäßig in den Nebensätzen der Spielberichte. Nach einer 1:2-Niederlage in Bochum fiel die Borussia auf den letzten Tabellenplatz.
Marco Villa schenkte Mittelstürmer Toni Polster eine seidene Unterhose mit Mickey-Maus-Aufdruck als Trophäe für den am schlechtesten gekleideten Mann der Mannschaft. Polster zog die Unterhose zufrieden an. Aber so richtig lustig war es nicht mehr.
Vor nicht einmal drei Jahren, als sich Robert Enke für die Borussia entschieden hatte, war der Klub Vierter in der Bundesliga gewesen, es sah nach Aufbruch aus. Nun waren die zwei besten Akteure der Elf, Stefan Effenberg und Torjäger Martin Dahlin, verkauft worden, weil die Banken drängten. Ordentliches Bundesliganiveau hätte sich mit den verbliebenen Spielern trotzdem erreichen lassen. Aber Fußball ist pure Dynamik, in diesem Punkt ist der Sport tatsächlich wie das Leben: Die Dynamik entscheidet über unseren Weg häufiger als jede sorgfältige Planung; die Dynamik gewinnt mehr Spiele als die Taktik. Sekunden nachdem Robert Enke einen Elfmeter gehalten hatte, geriet die Borussia gegen 1860 München 0:1 in Rückstand, sie verspielte den Sieg in Duisburg in letzter Sekunde durch ein Eigentor, und ehe die Spieler es merkten, war die Dynamik der Fehler schon in Gang gesetzt, jedes Missgeschick produzierte zwei neue und ließ die Mannschaft schnell wie einen einzigen großen Fehler aussehen. Wo noch im Jahr zuvor Dahlin das Pressing in vorderster Reihe gestartet hatte, konnte der Gegner nun das Spiel ruhig aufbauen, weil der neue Stürmer Toni Polster keine ausgeprägte Lust zum Laufen verspürte. Wo im Jahr zuvor Jörgen Pettersson Dahlins Pressing genutzt hatte, um den unter Druck schlecht platzierten Pass des Gegners abzulaufen, platzte Pettersson nun vor Wut über Polster, diesen Kaffeehausfußballer, im Zorn vergaß Pettersson dann für eine Sekunde zurückzulaufen, das Mittelfeld war deshalb in Unterzahl, und…am Ende wirkt es meistens zwangsläufig, wenn einem Klub die Zukunft entgleitet.
Der Trainer machte auf die Mannschaft nur begrenzt den Eindruck, als könne er sie aus dieser Dynamik befreien. Friedel Rausch hatte einmal mit Eintracht Frankfurt den Uefa-Pokal gewonnen. Das war 18 Jahre her. An einem seiner ersten Arbeitstage in Mönchengladbach hatte sich Rausch auf dem Trainingsplatz an den Mittelfeldspieler Valantis Anagnostou gewandt. „Herr Ballandi“, begann Rausch, „können Sie“, der Trainer dehnte das Siiie und zeigte auf Anagnostou, „mich“, Rausch deutete auf die eigene Brust, „ver-ste-hen?“
„Ja, Trainer“, sagte Anagnostou, »ich bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Und ich heiße Anagnostou, nicht Ballandi.«
„Ach so“, sagte Friedel Rausch.
„Und wer bist du?“, fragte er dann Marco Villa.
„Ich bin der Marco Villa.“
„Ach ja, der Markus.“
Jahrelang war Rausch ein etablierter Bundesligatrainer gewesen, ein passabler Taktiker und feuriger Motivator, die Spieler grinsten zwar wegen seiner schussligen Art, mochten ihn aber gerade deshalb. Rausch war noch immer genau derselbe. Doch eine Mannschaft, die zu oft verliert, sieht nur die Mängel ihres Trainers. Unter diesem Blick wirkten Trainingsmethoden lächerlich, die jahrelang als innovativ gegolten hatten. Gerne ließ Friedel Rausch „über den ganzen Platz“ trainieren, wie er das nannte: Auf dem Trainingsgelände in Rönneter reihten sich einige Spielfelder aneinander, und das Übungsspiel ging dann über zwei Rasenplätze, über 240 Meter. Robert Enke lächelte darüber noch Jahre später sehr amüsiert und ein wenig irritiert.
Als die Borussia auf den letzten Tabellenrang abgerutscht war, überzeugte der Trainer das Präsidium, zwei Spieler fristlos zu entlassen, Karlheinz Pflipsen und Marcel Witeczek. Im Profifußball nennt man das: ein Zeichen setzen. Die Dynamik ändern, irgendwie. Das Präsidium übermittelte die Nachricht den betroffenen Spielern. Als der Trainer merkte, dass die Mehrheit der Mannschaft über die Maßnahme empört war, wechselte er die Seiten. Also, das Präsidium habe Pflipsen und Witeczek ja nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen, sagte Rausch seiner Elf, aber das ließe er nicht mit den beiden machen! Er nominierte Pflipsen als stellvertretenden Mannschaftskapitän für die nächste Partie gegen Bayer Leverkusen, am 30. Oktober 1998.
Es war der Tag, als Robert Enke landesweit bekannt wurde.
Marco Villa verletzte sich in der zehnten Spielminute am Knie, das Innenband war gerissen, er lag am Spielfeldrand und wurde vom Arzt untersucht, als das 0:1 fiel. Nach seiner Auswechselung humpelte Marco auf die Geschäftsstelle, um das Spiel dort mit einer Eisbandage um das verletzte Knie im Fernsehen zu verfolgen. Als er den Apparat einschaltete, war auch Borussias Abwehrorganisator Patrik Andersson verletzt ausgeschieden, und es stand 0:2.
Robert Enke saß am Boden, die Hände hingen schlaff über die an die Brust gezogenen Knie, im regungslosen Gesicht ein Ausdruck tiefer Verständnislosigkeit. So wurde er bekannt. Denn das Bild wiederholte sich so oft, als wäre es ein Slapstick, Robert Enke verständnislos am Boden nach einem Tor und nach noch einem. 2:8 verlor Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen.
„Karneval in Gladbach“, sangen die Zuschauer. Das größte Debakel seit dreißig Jahren, riefen die Sportreporter. Und der junge Torwart verhinderte noch Schlimmeres!
Hoffentlich kommt der nächste Samstag, das nächste Spiel schnell, wünschte sich Robert Enke, damit sie dieses Spektakel hinter sich lassen konnten.
Eine Woche nach dem 2:8 gegen Leverkusen spielten sie in Wolfsburg. Teresa traf sich mit einigen Frauen von Borussias Fußballern in einer Mönchengladbacher Bar, um sich die Fernsehübertragung der Partie anzuschauen. Nach 53 Spielminuten sagte die Freundin von Uwe Kamps zu ihr: „Oh Gott, vier Tore war das Höchste, was Uwe jemals reingekriegt hat, und da war er schon immer fertig. Was ist denn da heute Abend bei euch los?“ Brian O’Neil hatte das 5:1 für den VfL Wolfsburg geschossen. Die Fans sangen: „Nur noch drei, nur noch drei!“ Dann hätten sie Leverkusens Schützenfest wiederholt. Das Spiel endete 7:1.
Robert Enke war berühmt. 15 Tore in einer Woche hatte noch nie ein Torwart in der Bundesliga hinnehmen müssen.
Ein einziges Tor davon, der Weitschuss von O’Neil, schien für einen Torwart vermeidbar.
Wie er sich gefühlt habe, fragten die Sportreporter vor der Umkleidekabine und setzten mitleidige Mienen auf. „Ach“, antwortete Robert Enke, „die Übung, den Ball aus dem Tornetz zu holen, hatte ich ja schon aus der Vorwoche.“
Am Tag nach dem Spiel ging er mit Teresa und dem Hund in den Feldern spazieren, es blieb bei Sieg oder Niederlage die Routine ihrer Sonntage. Uwe Kamps’ Freundin hätte sich gewundert, was da los war.
„Na, Schießbude Enke“, sagte Teresa. Und er, den jedes Tor quälte, konnte in all seiner Niedergeschlagenheit auf einmal herzlich lachen.
„Wir waren sehr unbeschwert“, sagt Teresa. „Wichtig war nur, dass er nichts für die Tore konnte, dann konnten wir Späße darüber machen.“
Nach unvergesslichen Niederlagen wie in Wolfsburg musste er allerdings mit kleinen Tricks nachhelfen, um die Gelassenheit zu bewahren. „Ich habe mir eingeredet, die Mannschaft hätte mich im Stich gelassen. Damit habe ich mich beruhigt.“
So oft hatte er sich als Torwart selbst beschuldigt; für Tore, an denen ihn wenig Schuld traf, oder dafür, die Mitspieler enttäuscht zu haben, wenn niemand von ihm enttäuscht war. Nie wurde er derart entschuldigt wie nach den 15 Toren.
„Und schützt mir diesen jungen Torhüter, der kann nichts dafür!“, hörte Teresa in der Bar den Fernsehkommentator rufen, als die Kamera zum letzten Mal Robert mit dem verständnislosen Blick am Boden einfing.
Während er von allen Seiten bescheinigt bekam, wie beeindruckend ruhig er in einer aufgescheuchten Mannschaft weiterspielte, vergaß er selbst, dass er einmal flatterig vor Angst gewesen war, vor drei Jahren mit Carl Zeiss in Leipzig und im ersten Winter in Mönchengladbach. „Ich bin psychisch nicht so labil, dass ich mir jetzt vor dem nächsten Spiel in die Hose mache“, sagte er den Sportreportern. „Bleibende Schäden sind bei mir nicht zu befürchten.“
Je mehr ihn die Leute für seine Ruhe und Souveränität lobten, desto abgeklärter spielte er; ohne dass er diese Wechselwirkung bemerkte. Ein Jahrzehnt später absolvierte er mit der Elf von Hannover 96 den Reiss-Profiltest, der die Persönlichkeit und Motivation eines Mitarbeiters feststellen soll. Er hätte nie gedacht, dass Anerkennung für ihn so elementar wichtig sei, sagte er verblüfft zu Teresa, als er das Ergebnis in den Händen hielt. Ihr aber war schon damals in Mönchengladbach aufgefallen, „wenn er spürte, dass andere an ihm zweifelten, bekam er Selbstzweifel, wenn er sich von anderen unter Druck gesetzt fühlte, wurde er unsicher. Und wenn er Rückendeckung erhielt, war er unglaublich stark als Torwart.“
In Hamburg stand es nach einer halben Stunde schon wieder 2:0 für den Gegner. Die Flanke flog herein, Hamburgs Stürmer Anthony Yeboah, der ein Tor kommen spürte, dessen Bewegungen in diesem Moment ein unfassbares Tempo, eine höhere Koordination erreichten, war zum wiederholten Male einen halben Schritt schneller als sein Mönchengladbacher Bewacher Thomas Eichin; und Robert Enke hatte das Nachsehen. Yeboahs Schuss flog durch seine Beine ins Tor. Ein präziser Schuss durch die Beine ist für einen Torwart unhaltbar, so schnell bringt niemand die Beine zusammen, der breitbeinig für den Absprung in jede Torecke bereitstehen muss. Aber ein Beinschuss lässt den Torwart immer lächerlich aussehen; tapsig landet er nach dem unmöglichen Rettungsversuch auf dem Hintern. Das Gespött des Publikums ist ihm sicher. Als er wieder aufstand, pochte die Wut in Robert Enke. Er fühlte sich alleine gelassen, gedemütigt, es war Eichins Fehler gewesen, und jetzt lachten die Leute über ihn. Er wollte gerne losbrüllen. Aber er glaubte, ein Torwart, der die Ruhe verliere, sei verloren. Er rang mit seiner Wut, und das Wissen, dass so viele ständig seine große Gelassenheit lobten, half ihm dabei. Er war der Coole, sagten die Leute; also würde er cool bleiben. In seinem Gesicht war Sekunden nach Yeboahs Tor keine Erregung mehr.
Mit den Wochen gelang es ihm immer öfter, den inneren Stummfilm abzustellen, der unaufhörlich von den jüngsten Toren und Flanken erzählen wollte. Abends fuhr er mit Teresa oft nach Rheydt zu Oma Frida. Die vierte Oma seines Lebens. Die alte Bäuerin hatte ihren Hof in Mietwohnungen umbauen lassen, Jörg Neblung lebte hier mit seiner Freundin Dörthe. Zu viert saßen sie zusammen und redeten unbeschwert über Gott und die Welt. Nur wenn ein Fußballspiel im Fernsehen gezeigt wurde, stand er auf und wollte es sehen.
Jörg setzte sich zu ihm auf das Sofa. Wenn Jörg lebhaft die Aufregungen des Spiels kommentierte, antwortete Robert knapp und analytisch. Danach schwieg er wieder. Er schaute Fußball im Fernsehen in sich gekehrt, konzentriert studierte er die Kollegen, ein Torwartingenieur auf der Suche nach den Mechanismen des Spiels; einerseits. Andererseits war Fußball im Fernsehen sein wirksamstes Betäubungsmittel. Das Fußballschauen half ihm, nicht an das Fußballspielen zu denken.
Die anderen wollten gerne ausgehen.
Es drohte, ein Konflikt zu werden.
„Man kann doch auch mal ausgehen“, sagte Teresa.
„Man kann auch mal zu Hause bleiben“, sagte er.
Wie oft hatten sie diesen Wortwechsel schon gehabt?
Wenn sie Dörthe und Jörg besuchten, hatte er drei gegen sich und fügte sich. Wenn Bon Jovi in der Diskothek gespielt wurde, tanzte er sogar.
Doch das nächste Mal hatte er wieder genauso wenig Lust auf das Nachtleben wie zuvor. Einmal ließ er sich etwas einfallen. Er wusste, heute wollten sie wieder ausgehen.
„Komm, wir fahren noch in die Gebläsehalle“, sagte Jörg.
„Geht nicht“, sagte Robert und versuchte, nicht triumphierend dreinzublicken.
„Wieso denn nicht?“
„Ich habe dummerweise Turnschuhe an. Da lassen mich die Türsteher nicht rein.“
Jörg Neblung sollte sich um ihn kümmern. „Kannste nicht mal was mit dem Jungen unternehmen, der hat hier keinen sozialen Kreis“, hatte Norbert Pflippen in Roberts zweitem Mönchengladbacher Jahr zu Jörg gesagt, der damals noch Borussias Athletiktrainer war. Kümmern konnte auch ein Beruf sein, erfuhr Jörg Neblung, nachdem die Borussia im Sommer 1998 seinen Vertrag nicht verlängert hatte. Der Flippi stellte ihn als Kümmerer ein. So heißen im Jargon die Mitarbeiter einer Beratungsagentur, die den Profisportlern im Alltag helfen sollen. „Kühlschrankfüller ist ein anderer Begriff“, sagt Jörg Neblung.
Eigentlich hatte er Industriedesigner werden wollen. Während der Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule Hannover hatte er auf der Suche nach Inspiration aus dem Fenster geblickt. Er sah die giftgrünen Straßenbahnen an den Herrenhäuser Gärten vorbeifahren, zeichnete die nächsten Entwürfe in dieser Farbe und wurde nicht genommen. Danach wollte er etwas ganz anderes machen. Er studierte Sportwissenschaften. Einer seiner Professoren wurde Präsident von Borussia Mönchengladbach, Karl-Heinz Drygalsky. Als dieser ihn 1994 als Athletiktrainer engagierte, kannte in der Bundesliga einzig Bayern München den Posten.
Jörg Neblung glaubte, im Profifußball würde es auch nicht viel anders zugehen als in der Leichtathletik, in der er als Zehnkämpfer aufgewachsen war. Er nahm an, die Mitarbeiter des medizinischen Teams eines Bundesligisten würden Hand in Hand arbeiten, und der Cheftrainer müsse an einem individuellen Trainingsplan interessiert sein. Dann sah er, wie sein erster Cheftrainer Bernd Krauss die Spieler entgegen jeglicher Trainingslehre zu überharten Ausdauerläufen zwang, womit angeblich ihr Wille geschult wurde. Er erlebte, wie Borussias Physiotherapeut ihn beim Trainerstab schlechtmachte, um die Rückkehr verletzter Spieler zur Wettkampffitness für sich zu reklamieren. „All diese Betreuer in einem Bundesligateam buhlen ständig um die Gunst des Trainers und der Spieler“, sagt er. „Und um denen zu gefallen, wird zur Not sogar gegen den eigenen Sachverstand gearbeitet.“
Es klingelt im Gang vor seinem luftigen Büro, als ob jemand hier im dritten Stock eines alten Fabrikgebäudes mit dem Fahrrad hereinkomme und sich mit der Glocke ankündige. Es ist eine Verkäuferin mit ihrem Korb voller belegter Brote. Sie macht jeden Tag ihre Runde, weil die Multimediadesigner und Kommunikationsberater in Büros wie diesem in der Kölner Lichtstraße keine Zeit zum Mittagessen haben. Jörg Neblung, norddeutsch blond, die Figur erinnert auch mit 43 noch an den Zehnkämpfer, führt nun seine eigene Fußballeragentur. Während des Gesprächs dreht er sich manchmal um, als rede er zu seinem Regal. Dort hat er Torwarthandschuhe und Fotos von Robert mit einer Kerze aufgestellt.
Es gibt Hunderte Arten von Freundschaft, und aus der, die 1998 zwischen Robert Enke und Jörg Neblung entstand, würde nie die Tatsache verschwinden, dass Jörg sich kümmern sollte. Aber der Wille, gemeinsam nach Zielen zu streben, verbindet mehr als die meisten Gefühle.
Jörg Neblung konnte nachvollziehen, dass Robert Enke in schwierigen Momenten alles immer mit sich selbst ausmachen wollte. „So bin ich auch“, sagt er.
Als Borussia Mönchengladbach im Herbst 1998 aus der Dynamik der Fehler nicht mehr hinausfand und sechs Wochen, sieben Spiele lang durchgehend verlor, verwandelte sich Robert Enke in einen Einzelsportler. Die Einsamkeit des Torwarts ist oft literarisch überhöht und bedauert worden, für den Torwart in einer untergehenden Mannschaft ist die Einsamkeit jedoch ein Segen. Er spielt sein eigenes Spiel und findet in den Niederlagen seine Siege. 0:2 gegen Bayern München zu verlieren hieß für ihn auch fünf schwere Schüsse zu halten. Wenigstens er hält noch, sagten die Experten, schrieben die Zeitungen.
„Während das Chaos tobt, bleibt einer ruhig in Gladbach“, schrieb der Düsseldorfer Express.
„Ruhe, Gelassenheit, Ausgeglichenheit; Klasse“, attestierte ihm der Meistertrainer Jupp Heynckes, der ein halbes Jahr zuvor Real Madrid zum Champions-League-Sieg geführt hatte und nun in einem Sabbatical in seiner Heimat Mönchengladbach oft Borussias Partien besuchte.
„Er war schon immer weiter als wir, in seinen Gedanken, im Verhalten, im Reden“, sagte Borussias Mittelfeldspieler Marcel Ketelaer, der mit Robert in den Jugend-Nationalteams groß wurde. „Er war schon immer erwachsener als wir.“
Mentale Stärke war ein Modeausdruck des neuen, psychologisierten Sports. Dieser Torwart war für alle ein Muster des neuen Sportlers. Galant wurde übersehen, dass er gelegentlich bei einer Flanke nicht aus dem Tor eilte oder Hertha BSC ein Tor ermöglichte, als er einen Schuss abprallen ließ. Wenig rührt das Fußballpublikum so sehr wie ein junger Torwart unter harten Männern, er wird für Paraden gefeiert, die bei erfahrenen Torhütern beiläufig zur Kenntnis genommen werden. Vollends würde Robert Enke dies erst ein Jahrzehnt später realisieren; als er ein älterer Nationaltorwart unter jungen Rivalen war.
In Mönchengladbach bemühte sich die Mannschaft angesichts ihres beispiellosen Niedergangs, sich selbst zu täuschen. Einer machte immer Witze in der Umkleidekabine. Im Gelächter hörten sie nicht, dass etliche Spieler mittlerweile lieber übereinander als miteinander redeten. Jörgen Pettersson rieb sich in einem stummen Konflikt an seinem Sturmpartner Toni Polster auf. Gegen Robert Enke hatte niemand etwas. Er beteiligte sich als Zuhörer an den taktischen Stammtischen in verschiedenen Ecken der Umkleidekabine, er war zu fast allen freundlich, er lachte, wenn andere über den Trainer lästerten; und niemand außer Marco Villa lernte ihn näher kennen.
Der Trainer hatte noch einigen Anlass für oberflächliche Heiterkeit geboten, als „wieder einmal der Friedel Rausch mit ihm durchging“, wie Jörg Neblung die Temperamentsausbrüche nannte. »Wenn ich den Martin Schneider in seiner derzeitigen Form aufstelle, fragen sich die Leute doch, ist der Rausch schwul, oder was?«, gab der Trainer auf einer Pressekonferenz zum Besten. Spät im November war Rausch dann entlassen worden. Aufsichtsratschef Michael Viehof sagte dazu: „Es muss diesmal mehr geschehen als eine Trainerentlassung.“ Also entließ der Verein auch noch seinen Manager Rolf Rüssmann.
In seinen ersten 22 Bundesligajahren war Borussia Mönchengladbach mit insgesamt drei Trainern ausgekommen. Robert Enke erlebte 1998, wie der Trainer zum vierten Mal in einem Jahr wechselte.
In den Weihnachtsferien fuhr Robert mit Teresa zu ihrer Familie nach Bad Windsheim. Seinen Vater schmerzte es. War der Sohn lieber bei den Schwiegereltern als bei ihm? Er traute sich nicht, Robert darauf anzusprechen.
Dem Vater waren Familienfeste sehr wichtig, Weihnachten, Geburtstage, an Festtagen forderte er das Gefühl ein, dass die getrennte Familie doch noch zusammengehörte. Robert vergaß Geburtstage oft.
Manchmal rettete ihn die Mutter. Sie rief ihn vorsorglich an, heute hat dein Vater Geburtstag, heute deine Nichte.
„Ich fand es schon schade, dass die Kommunikation zwischen uns so reduziert war“, sagt sein Vater. Er wartete immer auf eine Einladung nach Mönchengladbach. Als partout keine kam, suchte er nach Anlässen, um seinen Sohn zu besuchen. Das Spiel gegen Bayern würde er gerne sehen, er würde zu seinem Bruder nach Detmold fahren, da sei er sowieso in der Nähe.
Robert dachte nicht daran, dass man seine Eltern oder Geschwister einladen musste. Wenn sie kommen wollten, würden sie doch kommen. An Weihnachten fuhr er aus dem einfachen Grund zu Teresas Eltern, weil das Fest dort traditioneller gefeiert wurde.
Bad Windsheim ist fest umschlossen von Feldern und Wäldern. Robert Enke wollte dort noch einmal joggen am letzten Tag des Jahres 1998.
„Ich komme mit raus und gehe mit den Hunden spazieren“, sagte Teresa.
„Nein, brauchst du doch nicht, bleib bei deinen Eltern.“
Natürlich kam sie mit.
Sie fuhren mit dem Auto in die Felder hinter dem Galgenbuck, dort war es besonders abgeschieden, ideal, um die Hunde laufen zu lassen. Viel Spaß, sagte sie, bevor er loslief.
Zehn Minuten später war er zurück. Seine Augen waren zugeschwollen, er musste permanent niesen. Aus seinem Hals drang ein Fiepen.
„Ich bekomme keine Luft mehr!“
Sie rasten nach Hause. Im Bad fand Teresa ein altes Asthmaspray. Robert drückte wie besessen auf die Spraydose. Aber der Wirkstoff drang nicht mehr in seine Lunge vor, die Luftröhre war zugeschwollen.
Teresas Vater brachte ihn in die Stiftsklinik. Das Fiepen aus Roberts Hals war das lauteste Geräusch im Auto.
Der Vater rannte vor und stieß die Tür zur Notaufnahme mit Schwung auf. Die Rezeption war nicht besetzt. Verging eine halbe Minute, vergingen drei Minuten? Endlich erschienen zwei Krankenpfleger. Auf einer Trage rollten sie Robert Enke in die Intensivstation. Er hatte die Augen geschlossen. Während er sich darauf konzentrierte, durch seine verengte Luftröhre ein- und auszuatmen, hörte er nur, wie der eine Pfleger zum anderen sagte: „Das ist doch der Torwart von Gladbach, der immer die Bude vollkriegt.“
Sein Zustand stabilisierte sich. Mit einem Sauerstoffschlauch in der Nase lag er am Nachmittag im Bett, die zugeschwollenen Augen konnte er noch nicht öffnen, als ihn eine Krankenschwester fragte: „Herr Enke, wollen Sie etwas lesen?“
Da konnte er schon wieder schmunzeln.
Silvester feierte er mit Teresa schon wieder auf der Normalstation. Er habe vermutlich eine Sellerie-Apfel-Allergie, erklärten ihm die Ärzte, nachdem sie ihn untersucht hatten, jedes der Lebensmittel für sich könne er wohl problemlos vertragen, aber wenn er zum Beispiel abends eine Suppe mit Sellerie gegessen habe und am Morgen danach eine Apfeltasche, könne das einen Anfall auslösen. Wenn Teresa nicht beim Joggen dabei gewesen wäre, wäre er gestorben, wurde ihm klar, er hätte gar nicht mehr Auto fahren können.
Ein paar Wochen später war der Vorfall schon zur Anekdote geworden, die er gerne erzählte: Stell dir vor, was der Krankenpfleger sagte, während ich um Luft rang! Teresa und Robert Enke dachten nicht mehr tiefer darüber nach, was für Zufälle darüber entscheiden, ob jemand lebt oder stirbt.
Im Trainingslager im Januar 1999 bereitete sich Marco Villa auf Robert Enkes traditionellen Wutausbruch vor. Immer am dritten Tag des Trainingslagers störte den Freund plötzlich alles. Nie dauerte die Verstimmung länger als einen Tag. Marco nannte die Phase für sich „Robbis Tage“.
„Wie laut ist denn der Fernseher!“
„Sag es mir, Robbi, dann mache ich ihn leise.“
Ohne etwas zu entgegnen, verzog sich Robert ins Bad.
„Du hast mein Handtuch benutzt!“, rief er ins Zimmer.
„Ich habe irgendeines genommen. Es liegt noch ein unbenutztes im Fach.“
„Und warum ist die Klobrille schon wieder dreckig! Ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst nicht im Stehen pinkeln!“
„Alles klar, Robbi“, sagte Marco und sah weiter auf den Fernseher. Er wartete, dass Robbis Tage vorübergingen.
Neuigkeiten kamen im Trainingslager an. Uwe Kamps war wieder an der Achillessehne operiert worden. Er würde in dieser Saison nicht mehr zurückkommen. Robert Enke war bis zum Ende des Spieljahres konkurrenzlos im Tor der Borussia. Es stellte sich die Frage, was danach passieren würde. Sein Vertrag würde im Juli auslaufen. Die Vereinsführung schien das vergessen zu haben.
Seit Manager Rüssmann im November entlassen worden war, kümmerte sich niemand mehr um die Zukunft. Schon die Gegenwart überforderte die Verantwortlichen. Präsident Wilfried Jacobs fasste seine Amtszeit bei der Borussia so prägnant wie selbstgerecht zusammen: „In zwanzig Monaten hatte ich das Pech, keine einzige schöne Stunde zu erleben.“
Die Rückrunde wurde eine Kopie der Hinrunde. Im April 1999, ein Drittel der Saison lag noch vor ihnen, war Borussia Mönchengladbach als Tabellenletzter so weit, von der letzten Chance zu reden.
Am Samstag in Nürnberg müssen wir gewinnen.
Zwei Tage vor der Partie bat Trainer Rainer Bonhof Robert Enke in die Trainerkabine.
Er müsse die neue Saison planen, er müsse wissen, woran er sei. Könne er mit ihm rechnen?
„Ich kann es noch nicht genau sagen.“
„Robert, bitte. Ich brauche Klarheit.“
Robert Enke wollte gerne anständig sein.
„Also gut. Ich werde weggehen.“
Er wollte nicht für einen unorganisierten Verein in der Zweiten Liga spielen; und genau das wäre wohl nächste Saison die Situation bei der Borussia gewesen.
Er nannte dem Trainer den kleineren Teil der Wahrheit: Er gehe, weil er nicht wisse, woran er in Mönchengladbach nächstes Jahr sei, wenn Kamps zurückkehre.
Der Trainer sagte, wenn Robert sich so sicher sei, dann würde er seinen Weggang am besten gleich auf der Pressekonferenz bekannt geben.
Robert Enke war irritiert. Wozu, fragte er, das würde jetzt, unmittelbar vor dem entscheidenden Spiel im Abstiegskampf, nur unnötigen Aufruhr verursachen.
Nein, es sei besser, wenn die Dinge geklärt seien.
Er verstand Bonhof nicht. Der Trainer wusste doch nun Bescheid und konnte sich nach einem neuen Torwart umschauen. „Ich denke, vielleicht wäre es besser, das nicht öffentlich zu machen.“
Robert Enke sagte es vorsichtig, höflich.
Nach dem Training nahm Rainer Bonhof im Pressesaal des Bökelbergstadions Platz, schenkte sich ein Glas Wasser ein und sagte, ungefragt, er habe leider eine schlechte Nachricht. Robert Enke werde die Borussia zum Saisonende verlassen.
Am Samstag in Nürnberg gingen Teresas Eltern ins Frankenstadion, Bad Windsheim war nur siebzig Kilometer entfernt. Das Bettlaken entdeckten sie ziemlich schnell. Es flatterte über einer Werbebalustrade vor dem Mönchengladbacher Fanblock.
Borussen: Kamps Frontzeck Eberl stand darauf und daneben, getrennt durch einen sauberen Strich in der Mitte Verräter: Enke Feldhoff.
Robert Enke war der Liebling der Saison gewesen.
Nun spielte die Borussia um ihre selbsterklärte letzte Chance, und die Mönchengladbacher Fans begleiteten ihre Elf mit Rufen wie „Enke, du Stasi-Schwein!“, „Robert Enke, Söldner und Verräter!“ oder einfach „Uwe Kamps, Uwe Kamps, Uwe Kamps – Uuuuwe Kamps!“.
Mönchengladbach verlor 0:2 gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg, der seit einigen Wochen von einem Trainer namens Friedel Rausch betreut wurde.
Die Sportreporter warteten hinter mobilen Absperrgittern im Kabinengang des Frankenstadions. Robert Enke wusste schon, wonach sie fragen würden.
Robert, die Rufe der Fans heute.
Keiner würde ihm etwas anmerken, hatte er sich vorgenommen.
„Das Geschrei war sicher nicht schön, aber irgendwie auch zu erwarten.“
Hast du dich geärgert, dass der Trainer deine Entscheidung gegen die Borussia öffentlich machte?
„Ich habe dem Trainer meine Bedenken geäußert. Aber wohl nicht entschieden genug.“ Er klang beeindruckend sachlich. In solchen Momenten, wenn er sich anstrengte, entspannt zu wirken, „teilte sich sein Gesicht“, sagt seine Mutter. Zum Beweis zeigt sie auf ein paar Fotos. Wenn er locker wirken wollte, erkennt man auf den Bildern, lächelte sein Mund, und die Augen blieben ungerührt.
Nach einer verspielten letzten Chance sagen Fußballer: Das nächste Spiel müssen wir gewinnen, das ist unsere letzte Chance.
Bochum war der nächste Gegner. Minuten vor dem Anpfiff säuberten die Ordner am Bökelberg hektisch das Tor, vor dem Robert Enke in Stellung gegangen war. Um ihn herum lagen Klopapier, Feuerzeuge, Bierbecher. Hinter dem Tor standen die Fans der Borussia.
„Seht nur, da steht er, der Söldner und Verräter!“
Niemand würde ihm etwas anmerken.
Als er einen Flachschuss von Bochums Kai Michalke problemlos parierte, pfiffen die Mönchengladbacher Fans wüst. Einige Hundert wollten ihren Torwart bei jeder Ballberührung auspfeifen.
In der letzten Spielminute erzielte die Borussia das 2:1. Prompt kassierten sie noch in derselben Minute das 2:2, unhaltbar für Robert Enke.
„Stasi-Schwein, Stasi-Schwein!“
Teresa lief aufgelöst zum Zeltpavillon, wo die Profis sich nach dem Spiel mit ihren Angehörigen und Freunden treffen konnten. „Das ist Wahnsinn, was die mit dir machen.“
„Das gehört auch zum Beruf.“
Mit ruhiger Bestimmtheit sagte er zu Teresa, sie solle zu den letzten Heimspielen der Saison nicht mehr ins Stadion gehen, um ihre Nerven zu schonen. Sie war derart verblüfft, dass sie nicht widersprach; verblüfft über seine Selbstsicherheit.
„Ich habe nur gestaunt“, sagt Jörg Neblung, „wie ausgeglichen ist der denn?“
Der Flippi und er schauten ebenfalls regelmäßig in dem Zeltpavillon vorbei. So langsam galt es, bei der Suche nach einem neuen Klub Entscheidungen zu fällen. Es gab einige Vereine, die sich für Robert Enke interessierten, AS Rom, Hertha BSC, und ein beflissener Agent konnte versuchen, dieses Interesse zu konkretisieren. Es gab aber auch zwei konkrete Offerten, von 1860 München und von Benfica Lissabon. Portugals Lieblingsklub würde im nächsten Spieljahr von Jupp Heynckes trainiert werden. Zu Norbert Pflippens Arbeitsauffassung gehörte es wohl, sich nicht zusätzliche Mühe mit der Suche nach besseren Offerten zu machen, wenn man schon ein schönes Angebot hatte. Außerdem war er sehr damit beschäftigt, einen neuen Klub für Borussias 19-jährigen Mittelfeldspieler Sebastian Deisler zu finden. Es hieß, so einen Fußballer habe Deutschland seit Günter Netzer 1972 nicht mehr gesehen.
Also, um es kurz zu machen, sagte der Flippi, er sei für Benfica, die böten einen Wahnsinnsvertrag, da könne er Champions League spielen, und dort sei der Jupp Trainer, den Jupp kenne er schon seit dreißig Jahren, ein vortrefflicher Mann.
Er müsse sich das überlegen, sagte Robert Enke.
Am nächsten Samstag mussten sie erst einmal in Leverkusen spielen. Das ist unsere letzte Chance, sagten sie.
Als sie mit dem Bus am Ulrich-Haberland-Stadion vorfuhren, standen einige Borussia-Fans Spalier und klatschten. Vor den Spielen bejubelten die Fans die Profis, nach den Spielen bedrohten die Fans sie. „Wie absurd“, sagte Marco neben ihm und fing plötzlich an, den Fans zurückzuwinken, ihnen zuzulächeln und dabei zu rufen, was niemand durch die getönten Doppelglasscheiben hören konnte: „Hallo, ihr Hornochsen, hallo!“
„Natürlich richtete sich das gegen niemanden persönlich. Ich wollte nur eine Barriere aufbauen, mich schützen vor dem Hass, der später wieder über uns ausgeschüttet werden würde.“
„Komm, mach mit, Robbi“, sagte Marco.
Robert Enke zögerte.
„Komm, Robbi.“
„Hallo, Hornochsen, hallo!“ Als er es einmal geschafft hatte, es auszusprechen, ging es ganz leicht. Doch, es tat gut zu schimpfen.
Sie verloren in Leverkusen 1:4.
„Ohne Enke steigen wir wieder auf!“, sangen die Mönchengladbacher Fans.
„Ohne Enke steigt ihr wieder ab!“, antworteten die Leverkusener.
Noch eine halbe Stunde nach Schlusspfiff tanzten tausend Mönchengladbacher Anhänger auf der Tribüne gegen die Tristesse ihrer Mannschaft an. „Vor diesen Fans ziehe ich den Hut“, sagte Trainer Bonhof. Zu den wochenlangen Tiraden dieser Fans gegen Robert Enke sagte er nichts.
Die Sportreporter warteten. Was hältst du von so einem Trainer, Robert?
„Ich mache dem Trainer nur bedingt Vorwürfe, dass er meinen Abgang mitten im Abstiegskampf bekannt gab. Ich hätte meine Bedenken entschiedener äußern müssen. Wir haben beide nicht mit solch heftigen Attacken gerechnet.“
Er glaubte, er müsse versuchen, immer auch die Sicht der anderen zu verstehen. Der Trainer war wohl einfach nur ungeschickt. Und es war logisch, dass die Fans nach dieser Saison Schuldige suchten.
Er glaubte, dass ein Torwart die Schuld immer zuerst bei sich suchen muss.
Sie sollten sich Lissabon einmal anschauen. Er sagte zu Teresa, er könne nicht mitten in der Fußballsaison nach Portugal reisen, auch nicht für anderthalb trainingsfreie Tage; was, wenn das auch noch rauskomme. Teresa sollte sich Lissabon für ihn ansehen.
Jupp Heynckes flog Ende April nach Portugal, um die letzten Details seines Trainervertrags bei Benfica zu klären. Der Flippi und Jörg Neblung begleiteten ihn. Heynckes würde Benficas Vereinspräsidenten die Verpflichtung von Robert Enke als eine Bedingung für seine Unterschrift präsentieren. Teresa nahm ihre Mutter mit.
Als sie durch die Ankunftshalle des Aeroporto da Portela schritten, hörte Jörg Neblung zum ersten Mal im Leben bewusst Portugiesisch. Er hatte geglaubt, es sei dem Spanischen ähnlich. Plötzlich schien ihm Portugal unendlich fern.
Die Übersetzerin, von Benfica geschickt, begrüßte sie in grammatikalisch tadellosem Deutsch, ob sie einen guten Flug gehabt hatten, willkommen in Lissabon. Auf der Fahrt in die Stadt erkundigte sich Teresa bei ihr nach schönen Wohnvierteln. »Können Sie die Frage noch einmal wiederholen?«, bat die Übersetzerin. Könne sie ihr in Lissabon eine Gegend zum Leben empfehlen. „Was haben Sie gesagt?“ Die Übersetzerin lächelte. Teresa wurde bewusst, dass sie ihre Fragen nur selbst beantworten konnte.
Sie würde das Studium aufgeben müssen, falls sie nach Portugal zogen.
Als sie mit ihrer Mutter über den Praça Rossio mit seinem Mosaikboden spazierte und die Hügel des Bairro Alto erklomm, mit dem Blick über den Tejo bis zum Atlantik, ergriff sie das Gefühl, diese Stadt existiere in einer fernen Welt. Doch als sie abends auf der Restaurantterrasse am Gelände der Weltausstellung saßen, die riesigen Segel der Vasco-da-Gama-Brücke glitzerten in der Nacht, die Kellner servierten in Salz gebackene Goldbrasse, erschien ihr diese Ferne auf einmal verlockend.
Und, fragte Robert, als sie zurück war.
„Schön ist die Stadt. Von mir aus könnten wir dort hingehen.“
Aha, sagte er.
Wenige Tage später sagte der Flippi 1860 München ab. Er sei dann auch für Benfica, hatte sich Robert Enke überlegt, nachdem ihm Jupp Heynckes in seinem Wohnzimmer das Projekt erklärt hatte.
»Aber du solltest dir die Stadt schon einmal selber anschauen«, sagte Teresa.
Jetzt habe er keine Zeit, erwiderte er.
In Freiburg mussten sie gewinnen, das war die letzte all ihrer letzten Chancen. Sie verloren 1:2. Nach 34 Jahren in der Bundesliga war Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal abgestiegen. Es hatte Züge einer Erlösung. Das Gefühl, gerade abgestiegen zu sein, hatte die Mannschaft wochenlang jeden Samstag wieder getroffen. Endlich hatten sie Gewissheit.
Mit jämmerlichen vier Siegen aus 34 Spielen beendeten sie die Saison, seit dem neunten Spieltag waren sie ununterbrochen Tabellenletzter gewesen. Selbst der Drittletzte, Friedel Rauschs Nürnberg, das auch noch abstieg, lag 16 Punkte vor ihnen. 73 Tore hatte Robert Enke einstecken müssen. Und die Schlagzeilen nach all den Toren lauteten „Enke überragend“, „Auf Enke war Verlass“, „Enke ein Hoffnungsträger“.
Noch einmal kassierte er am Bökelberg zwei Tore, die letzten der 73, Dortmund war der Gegner zum Saisonabschluss, noch einmal erklangen die Rufe „Seht nur, da steht er, der Söldner und Verräter!“.
„Es hört sich blöd an, aber es machte trotzdem Spaß, in der Bundesliga zu spielen“, sagte er den Sportreportern zum Abschied.
Niemand würde ihm etwas anmerken.
Sechs Jahre später hob Robert Enke die rechte Hand, um die Fans in Mönchengladbach beim Abschiedsspiel für Uwe Kamps zu grüßen. Die Stimmung war festlich ausgelassen, ein Idol ging. Und viele Fans pfiffen auf Robert Enkes freundlichen Gruß.
Da war es ihm egal, ob ihm seine Freunde etwas anmerkten. Nach sechs Jahren ließ er seinen Ärger über die Anfeindungen der Fans heraus; auf seine Art. „In Mönchengladbach regnet es doch immer“, brummte er nur, wenn Marco wieder einmal über die Borussia reden wollte.
„Natürlich steckten ihm die Anfeindungen in Mönchengladbach tief in den Knochen“, sagt Jörg Neblung. „Hier war ein Mensch, der radikal missverstanden wurde: Er glaubte, fair zum Verein zu sein, indem er frühzeitig sagte, ich gehe zum Saisonende, ich gebe euch genug Zeit, einen Nachfolger zu finden. Er wollte anständig sein und erntete dafür nur Hass.“
Im Juni 1999 war der Vertrag mit Benfica Lissabon ausgehandelt. Er musste nur noch unterschrieben werden.
Im Flugzeug nach Lissabon saß er mit einem Portugiesisch-Sprachbuch auf dem Schoß und bastelte sich seinen ersten Satz in der fremden Sprache zusammen.
É bom estar aqui.
Damit wollte er die Sportreporter bei seiner Präsentation überraschen.
Es ist gut, hier zu sein.
Die Vertragsunterzeichnung war für den Nachmittag des 4.Juni geplant, direkt nach seiner Ankunft. Für den nächsten Tag war die offizielle Vorstellung auf einer Pressekonferenz im Stadion des Lichts angesetzt. Er war vorher nicht mehr nach Lissabon gereist, um die Stadt kennenzulernen.
Ein Dienstwagen wartete am Aeroporto da Portela auf sie. Jörg Neblung trug einen hellen Sommeranzug wie Pierce Brosnan in Der Schneider von Panama. Der Flippi hatte gesagt, ihr macht das schon, und war zu Hause geblieben. Robert Enke hatte ein blaues Hemd zum grauen Anzug gewählt, ohne Krawatte, er war doch Sportler. Als sie in der Tiefgarage des Flughafens losfuhren, bemerkte Teresa einen Fotografen, der sich hinter einem Pfeiler versteckte.
„Schau mal da“, sagte sie, zu erstaunt, um nachzudenken.
Robert drehte den Kopf in die Richtung, in die ihr Finger zeigte, und ein Blitzlicht knallte ihm in die Augen.
Empört sah er Teresa an, als habe sie abgedrückt.
„Entschuldigung, woher soll ich wissen, dass ein Paparazzo auf die Idee kommt, uns aufzulauern?“
Sie erreichten die Anwaltskanzlei von Benficas Präsidenten João Vale e Azevedo.
Freundliche Worte, nervös gezischt, wurden ausgetauscht, dann saß Robert Enke auf einem Stuhl mit Samtpolster. Der Vertrag lag vor ihm.
Er drehte sich um.
„Soll ich unterschreiben?“
Teresa schluckte. Sie sah ihm in die Augen und versuchte, entspannt zu klingen. „Unterschreib.“
Hände wurden geschüttelt, die von Vale e Azevedo war fleischig, im Profil glich das Gesicht des Präsidenten einem jung gebliebenen Intellektuellen, von vorne sah er mit der schimmernden hohen Stirn und den übertrieben lachenden Augen aus wie ein Lokalpolitiker, der besonders schlau sein möchte. Sie traten vor die Tür, dort warteten schon die Fotografen. Vale e Azevedo legte den Arm um Robert Enke, die Fotografen feuerten los, am nächsten Morgen würde das Bild auf dem Titel der Sportzeitung Record erscheinen. „Enke unterschreibt“, stand in Großbuchstaben darüber.
Er sieht rundum glücklich aus auf dem Foto.
Eine Stunde nach der Vertragszeremonie zogen sich Robert, Teresa und Jörg in ihre Hotelzimmer an der Praça Marques da Pombal zurück, um sich kurz auszuruhen. Jörg lag in seinem Sommeranzug ausgestreckt auf dem Bett, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Es klopfte.
Teresas Kopf erschien in der Tür.
„Jörg, Robbi bleibt nicht in Lissabon.“
Vier
Angst
Jörg Neblung regte sich nicht. Still blieb er auf dem Bett liegen, um ihn herum türmten sich die Zierkissen, silbergrau und bronzebraun mit Blumenmuster, wie immer in Hotels der gehobenen Klasse gab es viel zu viele Kissen, und man wusste nicht, wohin mit ihnen, wenn man das Bett benutzte. Langsam verarbeitete er die Worte, die er eben gehört hatte.
„Was soll das heißen: Robbi bleibt nicht in Lissabon?“
„Er will sofort zurück.“
Jörg richtete sich auf. Mit einem Lächeln kaschierte er seine Verwirrung. Sein Schweigen forderte Teresa auf, ihm von dieser fernen Welt zu erzählen, in die Robert Enke nach der Vertragsunterzeichnung schlagartig abgetaucht war.
Vor dem Anwaltsbüro, gleich nach der Vertragsunterschrift, hört Robert Enke, wie Teresa sagt, lass uns doch zum Weltausstellungsgelände fahren und ein wenig bummeln gehen.
Die Autos auf der Avenida da Liberdade fahren langsam, der Feierabendverkehr hat begonnen. Palmen, höher als Häuser, stehen am Boulevard, das feine Kopfsteinpflaster unter seinen Füßen ist weiß und glatt, geschliffen von Millionen Schuhen. Das Licht des Sommers im Süden, intensiver, glänzender, spiegelt sich noch in den Schaufenstern. Ein paar Fußgänger betrachten ihn aus den Augenwinkeln, ohne den Schritt zu verlangsamen, sie wollen nicht neugierig wirken, aber doch gerne wissen, wegen wem die Fotografen hier waren. Das Schwarz ihrer Haare ist wie das Sonnenlicht: intensiver, glänzender, als er es kennt. Er kann nicht festmachen, was genau ihm das Gefühl gibt, fremd zu sein.
Sie nehmen ein Taxi.
Die Pavillons der Weltausstellung bilden heute ein Vergnügungsviertel mit Aquarium, Boutiquen, Restaurants. Sie gehen in ein Einkaufszentrum. Vielleicht gibt es hier auch ein Schuhgeschäft, sagt Teresa spielerisch zu Robert und sieht ihn an.
Er hält den Kopf schief!
Genau so hielt er den Kopf immer im ersten Mönchengladbacher Winter schief, wenn er plötzlich von der Angst überwältigt wurde. Er saß am Esstisch im Loosenweg, er sagte verzweifelt, er wolle nicht ins Training, und dann schwieg er, den Kopf zur Seite gelegt, als wollte er ihn auf der Schulter ablegen, minutenlang verharrte er in dieser Haltung.
Nun steht er auf einmal mit schiefem Kopf im alten Weltausstellungspavillon, und sie sieht die Tränen, die sich in seinen Augen sammeln.
Er spürt Teresas Blick auf ihm lasten. „Ich gehe kurz auf Toilette“, sagt er und dreht sich abrupt um, als müsse er sich losreißen.
„Was ist los?“, fragt Jörg.
„Ich glaube, Robbi geht es nicht so gut.“
„Ach so?“
Es dauert ungewöhnlich lange, bis er von der Toilette zurückkommt.
„Fahren wir zurück ins Hotel?“, sagt Teresa sofort, um ihm eine Brücke zu bauen.
Er habe Kopfschmerzen, sagt er Jörg.
Jörg mustert ihn und findet nicht, dass Robert in irgendeiner Art schlecht aussieht. Im Taxi redet Teresa, um zu überspielen, dass Robert schweigt. Jörg sitzt vorne. Er sieht nicht, wie Robert unbeweglich mit schiefem Kopf aus dem Fenster starrt.
Sie würden sich eine Stunde ausruhen und sehen, wie es dann ginge, sagt Teresa, als der Fahrstuhl des fünfzehnstöckigen Hotels sie in ihre Etage mit Aussicht bringt.
„Bis später, Jörg.“
Als sie ihre Zimmertür hinter ihnen zumacht, wirft er sich auf das Bett, vergräbt den Kopf ins Kissen und weint so verzweifelt, dass es sich anhört, als könne er an seinen Tränen ersticken. Sie streichelt seinen Nacken, um ihn zu beruhigen.
„Robbi.“
„Ich kann hier nicht bleiben. Es geht nicht.“
„Aber du hast doch vor einer halben Stunden den Vertrag unterschrieben.“
„Was soll ich denn hier in der Fremde?“
Wenigstens spricht er nicht mehr ins Kissen.
Sein Weinen wird leiser.
„Gut“, sagt sie irgendwann. „Du bewegst dich nicht von der Stelle, und ich gehe hinüber, um Jörg Bescheid zu geben. Wir müssen es ihm sagen.“
Es klopft an Jörgs Zimmertür. Als Teresa eintritt, liegt noch ein Lächeln auf seinen Lippen, als habe er gerade einen schönen Traum gehabt.
Jörg folgte Teresa über den tiefen, grauen Teppich des Hotelflurs, noch immer nicht ganz erwacht aus dem Hochgefühl der reibungslosen Vertragsunterschrift. Als sie hereinkamen, lag Robert unverändert auf dem Bett. Ein Dialog wiederholte sich.
Ich kann hier nicht bleiben.
Aber du hast doch vor einer Stunde einen Vertrag unterschrieben.
Es geht nicht.
Für einen Moment war Jörg kampfunfähig. Er hatte nach dem Bundesligajahr in Mönchengladbach ein klares Bild von Robert Enke im Kopf, ein außergewöhnlich stressresistenter, abgeklärter, vernünftiger junger Mann.
Jörg sah Robert an, und plötzlich sah er sich selbst, mit 16 Jahren zu Hause, als ihn seine Eltern, Lehrer beide, fragten, ob er denn für ein Jahr als Austauschschüler in die Vereinigten Staaten wolle. Ein diffuses Gefühl aus Furcht und Einsamkeit war damals in ihm aufgekommen, „Amerika, oh Gott, ist das weit weg“, und Jörg hatte spontan das Angebot seiner Eltern abgelehnt. Er konnte Roberts Angst nachvollziehen. „Er war erst 21, ein Junge, der ins Unbekannte ging und im Ausland von der Fremdheit überwältigt wurde.“
Aber aus der Patsche half ihnen dieses Verständnis nicht.
Und wenn er eine Nacht darüber schliefe, vielleicht seien es nur die Nerven, verständlich natürlich.
Robert schüttelte energisch den Kopf. Er müsse hier raus, er reise ab. Auf seinen Wangen waren rote Flecken.
Jörg rief den Flippi an, schließlich war er nur ein Angestellter der Agentur, er konnte keine weitreichenden Entscheidungen ohne seinen Chef treffen. Der Flippi hatte einen eindeutigen Ratschlag.
„Hau ihm auf die Fresse“, sagte er Jörg.
Jörg verstand: Er musste die Situation alleine klären.
Die Einladung für Robert Enkes Präsentation am nächsten Morgen im Stadion des Lichts war schon an die Medien verschickt worden.
Teresa saß bei Robert auf dem Bett, Jörg setzte sich in den grauen Stoffsessel. Auf dem Schreibtisch stand ein Strauß weißer Rosen.
„Und wenn wir sagen, Teresa gehe es nicht gut, wir müssen kurzfristig abreisen?“
Sie würde da mitspielen, sagte Teresa.
Jörg sah Robert an.
Robert wartete, dass sie etwas unternahmen.
Dann kläre er das, sagte Jörg. Aber dem Trainer zumindest müsse er die Wahrheit sagen. Robert hatte den Vertrag bei Benfica allein Jupp Heynckes zu verdanken, schon deshalb seien sie ihm Ehrlichkeit schuldig. Was auch immer danach passiere.
Jörg Neblung trat auf die Straße. Schwierige Gespräche führte er besser, wenn er in Bewegung war. Er marschierte die Rua Castilho hinunter. Der Autoverkehr rauschte, während er über Handy im Büro von Benficas Präsidenten Bescheid gab, dass sie leider die Präsentation verschieben müssten, der Frau des Torwarts ginge es nicht gut, sie würden morgen mit dem ersten Flugzeug zurückreisen, ja, leider. Welche Erleichterung, dass der Anstand Sekretärinnen gebietet, keine neugierigen Nachfragen zu stellen. Es blieb Jupp Heynckes.
Jörg machte kehrt und ging die Rua Castilho wieder zurück, vorbei an der Sotheby’s-Vertretung und dem Ritz-Hotel, die er nicht wahrnahm. Es ging leicht bergauf, das war gut, je mehr körperliche Anstrengung, desto weniger bemerkte er die nervliche Anspannung.
Jupp Heynckes meldete sich freundlich am Telefon.
Jörg wollte es so schnell wie möglich hinter sich bringen und redete drauflos, ohne dem Trainer eine Chance zu geben, ihn zu unterbrechen. Robert gehe es schlecht, die Angst vor dem Ausland, ganz plötzlich, ein junger Kerl, kurz gefasst, sie müssten sofort abreisen, es gebe keine andere Möglichkeit, alles Weitere werde man sehen, aber um ehrlich zu sein, Roberts Wechsel zu Benfica sei fraglich.
„Herr Neblung, Sie sind maßlos arrogant.“
„Ja, das tut mir auch sehr leid. Aber es geht nicht anders.“
Er bemerkte, dass er schon wieder auf dem Weg die Straße hinunter war, als er aufgelegt hatte und stehen blieb.
»Heynckes musste sich angesichts der Gepflogenheiten im Profifußball natürlich gedacht haben, wir hätten plötzlich ein besseres Angebot für Robert und wollten ihn deshalb unter Ausreden bei Benfica rausboxen. Deshalb konnte ich verstehen, dass der Trainer mir in diesem Moment nur das Schlechteste unterstellte. Berater sind ja auch dafür da, die Schläge abzufangen, damit es nicht den Spieler trifft. Das war schon in Ordnung so, dass ich mich von Heynckes beschimpfen lassen musste.«
Am Abend blieben sie im Hotel. Jörg buchte die Rückflüge auf den nächsten Tag um. Robert ging früh ins Bett.
Am nächsten Morgen kaufte ihm Jörg am Flughafen den Record mit der Schlagzeile „Enke unterschreibt“. Robert Enke sah auf dem Titelfoto, wie glücklich er lächelte. Jetzt hatte er nur ein einziges Ziel: weg aus Lissabon. Er war zu erschöpft von der Angst, um daran zu denken, dass jemand, der wegfliegt, auch irgendwo ankommen und weitermachen muss.
Teresa und er fuhren erst einmal in den Urlaub. Gleich hinter dem kilometerlangen Strand von Domburg begannen die Dünen mit ihrem windzersausten Gestrüpp. Die Wolken schienen sich auf den Sandhügeln auszuruhen, so tief hingen sie über dem äußersten Zipfel Südhollands. Robert Enke sah den Hunden nach, wie sie durch die Dünen rannten.
Teresa und er erwähnten den Abend von Lissabon nicht, aber das Ausblenden hatte nichts Verkrampftes. Es schien hier einfach kein Thema zu sein.
Wir haben vier Wochen Zeit, bis bei Benfica das Training beginnt, dachte sich Teresa. In vier Wochen konnte alles Mögliche passieren.
In der Agentur von Norbert Pflippen planten sie unterdessen die Zukunft. Der Flippi rief noch einmal Edgar Geenen an, den Sportdirektor von 1860 München. Jetzt würde Robert Enke vielleicht doch noch zu 1860 kommen. Aber die Aussicht, sich in einen Rechtsstreit um einen Spieler zu stürzen, der vor zwei Monaten nicht zu ihnen wollte und nun bei einem anderen Verein unterschrieben hatte, fand Geenen wenig verlockend.
Der einzige Ausweg war, Robert dazu zu bewegen, doch nach Lissabon zu gehen.
Der Flippi telefonierte mit Jupp Heynckes.
„Liebe Leute, das kann doch alles nicht wahr sein!“, rief der Trainer.
„Wem sagst du das! Jupp, ich verstehe dich doch, ich bin auf deiner Seite. Der Junge ist nur ein bisschen durch den Wind, die Paparazzi in Lissabon haben ihn scheu gemacht, der Empfang war zu viel für ihn.“
»Seht ihr eigentlich noch die Realität? Der hat hier einen exzellenten Vertrag bekommen, und zwar weil ich für ihn gebürgt habe!«
„Das weiß ich doch, Jupp, das sage ich dem Jungen doch auch. Wir versuchen das zu regeln, gib ihm ein wenig Zeit.“
Er habe keine Zeit, er habe eine Saison zu planen, sagte Heynckes, und sein Ton näherte sich dem eines Trainers, der in der Halbzeitpause bei einem 0:4-Rückstand zu seiner Mannschaft spricht.
Wenig später kam eine Meldung aus Portugal. Jupp Heynckes hatte einen neuen Torwart verpflichtet.
Das Internet war in seinen Anfängen, Jörg gab den Namen des neuen Mannes in die Suchmaschine ein.
Carlos Bossio.
Vier Jahre älter als Robert Enke, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1996 mit Argentinien, 146 Spiele in der ersten argentinischen Liga für Estudiantes.
Den Rest sagten die Fotos im Internet. „Ein Riesenkerl, 1,94 Meter, und ein Kinn wie Sylvester Stallone“, sagt Jörg Neblung. „Das war ein Torwart mit dem Profil einer Nummer eins.“ Benfica Lissabon rechnete nicht mehr wirklich mit Robert Enke und vertraute ihm nach seiner überstürzten Abreise noch weniger. Das war die Botschaft in der Meldung aus Portugal.
Jörg erzählte Robert davon, als hätte es nicht besser kommen können. »Du hast jetzt überhaupt keinen Druck in Lissabon, die haben noch einen Torwart aus Argentinien geholt, eventuell wird der am Anfang spielen, aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dann kannst du dich in Ruhe dort einleben.«
Die Haut bronzefarben, das blonde Haar leuchtend nach dem Sommerurlaub, sagte Robert Enke, vernünftig, wie ihn alle kannten, natürlich verstehe er, dass er nach Lissabon müsse, wenn er den Vertrag unterschrieben habe.
Teresa organisierte den Umzug aus Gierath. Am Tag vor ihrer Abreise nach Lissabon sahen sie zu, wie die Möbelpacker die Kisten aus der Dachwohnung schleppten. Die Koffer und Taschen für den Flug standen in der Küche. Nachdem der Umzugslaster abgefahren war, schaute Teresa noch einmal durch die leere Wohnung, ob sie nichts vergessen hatten. Es war Samstag, die Grundschule gegenüber geschlossen, die Stille eines Dorfes am Wochenende passte zur Leere der Wohnung. Robert stellte sich vor Teresa.
„Ich komme nicht mit.“
„Was?“
„Ich komme nicht mit. Wo ist der Autoschlüssel?“
Teresa war zu perplex, um irgendetwas zu denken, geschweige denn zu unternehmen, als er die Treppen hinunterrannte.
Sie rief ihn auf dem Handy an. Er hatte es ausgeschaltet. Sie rief seine Eltern an. „Falls sich euer Sohn meldet, dann denkt euch etwas aus, wie ihr ihn beruhigt. Er ist nämlich gerade abgehauen.“
Es gelang ihr noch immer nicht, so ernst zu sein, wie sie es gerne wollte. Dazu war sein Verhalten zu unmöglich.
Sie fuhr mit ihrem Auto zu Jörg und Dörthe nach Rheydt. Unweit vom alten Bauernhof von Oma Frida sah sie Jörg in Joggingkleidung im Wald verschwinden. Lass ihn laufen, dachte sie sich, reicht auch, wenn ich ihn in einer Stunde mit der Neuigkeit erschrecke.
Mit dem angenehmen Gefühl der Erschöpfung nach dem Sport kehrte Jörg eine Dreiviertelstunde später zurück. Er begrüßte Teresa und fragte beiläufig: „Wo ist Robbi?“
„Abgehauen.“
„Quatsch.“
„Nein, wirklich. Er ist abgehauen.“
Teresa, Dörthe und Jörg waren sich bewusst, dass es absolut unangemessen war zu lachen, und deshalb war es das Einzige, was sie tun konnten: Sie lachten.
Alle paar Minuten wählten sie seine Handynummer. Das Telefon blieb ausgeschaltet. Sie schickten ihm SMS-Nachrichten. Sie konnten nur weiter warten. Die Dunkelheit vertrieb gemächlich den herrlichen Tag, es wurde 21 Uhr. Sieben Stunden hatten sie ihn vermisst, als es klingelte. Teresa rannte zur Tür und sah ihn am Fuß der steilen Treppe stehen. Er blickte kurz hinauf und dann wieder weg, als ginge ihn nichts auf dieser Welt irgendetwas an.
„Mein Gott, Robbi, wo warst du?“
„Weg.“
Eine konkretere Antwort hat Teresa nie erhalten. Sie drängte auch nicht darauf. Sie hatte das Gefühl, dass sein inneres Gleichgewicht gerade wiederhergestellt worden war und dass sie die feine Balance keinesfalls noch einmal ins Wanken bringen durfte.
„Dann geht es heute nach Lissabon“, sagte sie am nächsten Morgen, sehr bemüht, den Satz nicht wie eine Frage, aber auch nicht wie einen Befehl klingen zu lassen.
Er nickte, und niemand konnte erkennen, was er fühlte.
Fünf
Die Stadt des Lichts
Sie bezogen ein Hotelzimmer am Flughafen, wo die Leute wohnen, die schnell wieder wegwollen. Der kleine Park in der Nähe des Hotels hieß Tal der Stille. Von dort waren es nur fünf Minuten zum alten Weltausstellungsgelände, dem einen vertrauten Ort, von dem aus sie sich in die fremde Stadt vortasten konnten.
Die milde Luft der hereinbrechenden Nacht nach dem heißen Julitag legte sich auf ihre Körper, als Teresa von einer Restaurantterrasse auf dem Weltausstellungsgelände über den Tejo schaute. Die Lichter Lissabons schaukelten auf dem Fluss, die Fahnen aller Länder flatterten an den Masten zu Füßen der Vasco-da-Gama-Brücke. Es ging ein friedlicher Wind.
„Ist es nicht wunderschön hier, Robbi?“
Er schnitt weiter an seinem Steak.
»Ich höre die ganze Zeit nur das Quietschen der Fahnenmasten«, sagte er.
Teresa ist sich nicht sicher, ob er den Kopf schief hielt, sie weiß nicht mehr, ob sie wirklich stumm ihr Besteck fallen ließ. Aber so hat sie die Szene heute vor Augen.
Zum täglichen Training bei Benfica begleitete sie ihn, als bringe sie ihn ins Krankenhaus. Sie setzte Robert am Stadion des Lichts ab und ging im Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite in ein Café, eine Angehörige, die vor dem Operationssaal wartet und versucht, nicht mit den Fingern auf den Tisch zu trommeln. Er musste dem Trainer gegenübertreten, den er fast versetzt hatte.
Am Eingang des Stadions erwartete Robert Enke ein Adler. An Benficas steinernem Wappentier vorbei eilte er in die Umkleidekabine. Er verstand nicht, was die anderen Spieler redeten, aber er verstand ihr Lachen, es war dasselbe wie bei der Borussia in Mönchengladbach nach Marcos Späßen. Er fühlte sich noch fremd und schon wieder zu Hause.
Der Trainer stellte sich der Mannschaft vor, und schon ging es hinaus auf den Campo Numero3, den Trainingsplatz. Robert Enke hielt sich immer zwischen den neuen Mitspielern. So hatte Jupp Heynckes keine Gelegenheit, ihn unter vier Augen zu sprechen. Heynckes’ Torwarttrainer Walter Junghans tat gegenüber Robert Enke, als wisse er gar nichts von seiner Panikattacke.
Sie waren vier Torhüter, einer zu viel nach der kurzfristigen Verpflichtung von Carlos Bossio. Junghans war bemüht, alle Torhüter gleich zu behandeln. Er hatte in seiner aktiven Zeit sämtliche Gemütszustände eines Torwarts selbst erlebt, deutscher Meistertorwart mit Bayern München, nicht gefragter Ersatzmann, Kapitän auf Schalke, gestrandet in der Zweiten Liga, „diese Position bringt so viel Euphorie und Leid mit sich, ein Torwart muss damit rechnen, in jeder Sekunde der Depp zu sein“, sagt Junghans, „da sollte der Torwarttrainer als verständnisvoller Freund aller seiner Torhüter agieren“. Dementsprechend unangenehm war es ihm, dass er Robert Enke bei jeder Trainingsübung zuerst ins Tor stellte. Es ging nicht anders. Bossio konnte nur Spanisch, der dritte Torwart Nuno Santos Portugiesisch, Sergej Owtschinnikow, dem als vierten Mann die Abschiebung drohte, Russisch und Portugiesisch. Walter Junghans sprach bloß Deutsch und Englisch. Robert Enke musste die Übungen immer vormachen, damit sie die anderen verstanden. Darüber hinaus verständigten sie sich in der Sprache der Sprachlosen, mit Lächeln.
Der Rasen war noch herrlich feucht, direkt vor dem Training bewässert, der Ball haftete angenehm zäh an den Handschuhen. Robert Enke beobachtete die Konkurrenten. Alles an Bossio war riesig, die Oberarme, die Hände, tatsächlich auch das Kinn; und fulminant springen konnte er auch. Aber das Größte am Argentinier, bemerkte Robert Enke, war sein freundliches Lächeln. Er lächelte zurück.
Er dachte gar nicht mehr daran, an die Angst zu denken.
Sein Drang, perfekt zu sein, jede Herausforderung zu meistern, war auf dem Trainingsplatz instinktiv erwacht.
Wenn die anderen Profis sich nach dem Training verabschiedeten, ging er in den Kraftraum. Zu Beginn in Mönchengladbach hatte er sich an den Hanteln unwohl gefühlt, unter den Augen von Kamps. Nun setzte er sich als Einziger freiwillig an die Maschinen. Walter Junghans begleitete ihn, um mit 41 an den Maschinen ein wenig gegen das unvermeidliche Bäuchlein eines ehemaligen Profisportlers zu kämpfen, der die körperliche Anstrengung nach so vielen quälenden Jahren inzwischen verachtet. Plötzlich stand der Trainer neben ihnen.
Jupp Heynckes wartete, bis Robert Enke eine Pause zwischen den Serien an der Beinpresse einlegte. Der Trainer begann, von den ersten Eindrücken in Lissabon zu erzählen, wie zuvorkommend die Portugiesen waren, jedenfalls wenn sie nicht gerade Auto fuhren, wie viel klarer als im Norden das Licht sei. Jupp Heynckes redete leise, langsam, aufgeräumt, und irgendwann sagte er abrupt: „Schau, Robert, du bist hier nicht alleine. Ich weiß, was für ein Schritt das für einen 21-Jährigen ist, ins Ausland zu gehen, aber du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe dich geholt und werde dir helfen. Walter, du und ich, wir sind gemeinsam hier, und wir ziehen das auch gemeinsam durch.“
Niemand erinnert sich mehr, was Robert Enke antwortete. Es war Zeit für die nächste Serie an der Beinpresse. Er klemmte die Füße in die Maschine, die Knie angewinkelt, den Mund zusammengedrückt in Erwartung der Anstrengung. Und die Gewichte in der Maschine sausten nach oben, als ob er jede Anstrengung bewältigen könne.
»Ich mochte Robert von Anfang an. Ich hatte ihn ja im Frühling zweimal in meinem Haus am Spielberg in Mönchengladbach getroffen, um ihn für Benfica zu gewinnen. Er war unheimlich aufgeschlossen, sympathisch, auch sehr selbstbewusst, und dieser Eindruck blieb mir, obwohl ich zunächst richtig sauer geworden war, als er plötzlich nicht mehr nach Lissabon wollte. Aber ab dem Moment, als wir uns bei Benfica im Kraftraum aussprachen, war die Sache mit seiner Panikattacke für mich vergessen«, sagt Heynckes. „Ich habe erst vier Jahre später wieder daran gedacht.“
Robert Enke fiel es nicht so leicht zu vergessen. Sobald er das Trainingsgelände verließ, kehrte das Gefühl, fremd zu sein, langsam, lähmend zurück. Er wusste, er hatte keinen Grund, sich zu fürchten. Aber er konnte die Angst deswegen noch lange nicht abschütteln. Das Hotel am Flughafen wurde seine Festung. Er verschanzte sich darin.
„Robbi, Kopf gerade!“, rief Teresa, er schreckte vor dem Fernseher auf, richtete den Kopf auf, und eine Viertelstunde später wiederholte sich das Spiel.
Eines Nachmittags rief Tina an, ihre gemeinsame Freundin aus Jena. Robert war gerade beim Training.
„Und, was machst du?“
„Was soll ich machen, ich würde auch mal gerne raus, in die Altstadt oder so, aber Robbi geht es nicht gut, er sitzt immer nur betrübt auf dem Zimmer.“
„Dann geh doch du mal alleine raus, und wenn du dich nur mit einem Buch ins Café setzt. Du kannst nicht immer nur alles Robbi recht machen.“
Aber Teresa glaubte nicht, dass es ihr irgendwie gut gehen konnte, solange es ihm schlecht ging.
Der Fußball gestattete ihm eine kurze Flucht vor der Furcht. Er durfte mitten aus Benficas Trainingslager im Salzburger Land abreisen, um mit der deutschen Nationalmannschaft zum Konföderationenpokal nach Mexiko zu fliegen. Zum ersten Mal war er in die A-Nationalelf eingeladen worden. Die Umstände waren wenig feierlich. Das Turnier in Mexiko war von sportlich zweifelhaftem Wert, der Termin Ende Juli ein kruder Scherz, unmittelbar vor dem Start der Vereinssaison, weshalb die etablierten Nationaltorhüter Oliver Kahn und Hans Jörg Butt die Mexikoexpedition abgesagt hatten. Robert Enke war als Ersatztorwart nachgerutscht. Niemand im deutschen Fußball wusste von seinem inneren Kampf. Viele verstanden die Nominierung als logische Folge: Diesem Torhüter würde die Zukunft gehören.
Ohne in einem einzigen Spiel eingesetzt zu werden, verbrachte er 14 flimmernd heiße Tage in Mexiko, nachts konnte er nicht schlafen vor Hitze und Jetlag, tagsüber sah er zu, wie eine in engen Grenzen motivierte deutsche Elf Brasilien 0:4 und den USA 0:2 unterlag. Dafür hatte er seine Position bei Benfica nicht gerade verbessert, weil er zwei Wochen der Saisonvorbereitung verpasste. Doch so sah er es nicht. Zwei Wochen lang hatte er im fernen Mexiko wieder zu Hause sein dürfen; in einer deutschen Fußballelf.
Bei seiner Rückkehr nach Lissabon konnte er der Wirklichkeit nicht mehr ausweichen. Er lebte jetzt hier. Er ging mit Teresa auf Haussuche. Sogar einen Palast zeigte ihnen der Immobilienmakler. Am Hang des Pinienparks Monsanto, abgetrennt vom Lärm der Stadt, lag der Palácio dos Marqueses de la Fronteira. Das ehemalige Gästehaus hinter dem Palast sei zu vermieten. Aha, sagte Robert Enke und grinste bei der Vorstellung, hier zu wohnen. Nun aber weiter, sagte der Makler, er werde ihnen noch etliche spektakuläre Häuser zeigen, da würden sie Tage brauchen, um sich zu entscheiden.
Am 10.August1999 bestritt Benfica ein Testspiel gegen Bayern München im Stadion des Lichts. Portugiesen nennen das Stadion oft nur A Luz. Das Licht. Die neue Elf, das Benfica von Jupp Heynckes, präsentierte sich, und 60000 füllten die Arena unter dem Licht, denn nichts ist am Fußball betörender als das immer wiederkehrende Versprechen vor einer neuen Saison, jetzt werde alles anders, besser. Zum ersten Mal würde der neue Trainer seine Wunschelf zeigen, mit Nuno Gomes im Sturm, Karel Poborsk? auf dem Flügel und João Pinto, dessen Fuß einen Ball streicheln konnte, als Maestro. Im Tor stand Carlos Bossio. „Er war eingeplant, die Nummer eins zu sein“, sagt Walter Junghans.
Bayern gewann den Test 2:1. Das gleißende Licht richtete sich gegen Bossio. 60000 pfiffen und buhten ihn zornig aus. Er hatte bei beiden Münchner Toren keine glückliche Figur gemacht.
Es war nur ein Testspiel, das Ergebnis schon im Moment des Schlusspfiffs bedeutungslos. Keiner redet von solchen Abenden, wenn in Fußballkarrieren Bilanz gezogen wird; denn niemand mag glauben, dass es wirklich solche unbedeutenden Augenblicke sind, die über Karrieren entscheiden.
Zehn Tage später, unmittelbar vor dem Start der portugiesischen Meisterschaft, entzog der Weltfußballverband FIFA Bossio einstweilig die Spielberechtigung für Benfica. Sein vorheriger Klub, Estudiantes de la Plata, hatte Benfica bei der FIFA angezeigt. Die fällige Ablöse sei nicht bezahlt worden.
Die ganze Wahrheit, sagt Heynckes, kenne die Öffentlichkeit bis heute nicht: „Bossio war Benficas Präsidium nach seinem unglücklichen Spiel gegen Bayern nicht mehr gut genug. Benfica hat die Zahlungen an Estudiantes erheblich hinausgezögert.“
Carlos Bossio war gesperrt, Nuno Santos verletzt, Sergej Owtschinnikow mittlerweile an den Vorortserstligisten FC Alverca abgeschoben. Niemand außer Robert Enke konnte spielen.
Er überbrachte Teresa die Nachricht beiläufig, so wie er gute Neuigkeiten immer am liebsten weiterleitete. Er hatte eine große Freude daran, dann die Aufregung im Gesicht der anderen erwachen zu sehen.
„Ach, übrigens, am Samstag spiele ich.“
Sie saßen an einem Swimmingpool unter Palmen, mit Blick über einen im Stil der italienischen Renaissance angelegten Garten mit geometrisch geschnittenen Zierbäumen. Sie waren in das Gästehaus des Palácio Fronteira eingezogen.
In einer Stadt, deren Namen er schon vergaß, als er noch dort war, in einem Stadion, in dem hinter den Toren statt Tribünen Grashügel lagen, musste Robert Enke beweisen, dass er die Angst verdrängen konnte. Benfica begann die Saison der ersten portugiesischen Liga gegen den FC Rio Ave, einen Klub aus der Kleinstadt Vila da Conde im Niemandsland hinter Porto. Das Stadion fasste nur 12000 Menschen; damit war Platz für 60 Prozent der Einwohner des Orts. Der Grashügel hinter ihm wimmelte von Jugendlichen und Kindern, ihre Stimmen schwollen zu einem unangenehmen, konstanten Piepsen im Ohr an.
Zu Hause in Deutschland tigerte Jörg Neblung durch seine Wohnung. Der Flippi hatte entschieden, dass doch niemand von der Agentur zu diesem Spiel am Rande Europas reisen musste. „Aus heutiger Sicht war das grob fahrlässig, wenn man bedenkt, wie es Robert ging“, sagt Jörg Neblung. Im Satellitenfernsehen kamen zwar Snookerturniere oder Dartmeisterschaften, aber Fußballspiele aus Portugal dann doch nicht. Er ließ sich per SMS von Teresa aus Lissabon informieren.
Spiel aus. 1:1. Gut gehalten.
Jörg atmete aus.
Eine Woche später, nach dem ersten Heimspiel von Benfica, besetzte Robert Enke schon die Titelseiten der Sportzeitungen.
Voa Enke! Enke fliegt!, prangte auf Portugals meistverkaufter Zeitung A Bola.
In einem dieser Momente, wenn der Torwart nicht weiß, wie er es tut, hob er ab und parierte einen heftigen Kopfball aus fünf Metern. Paraden wie diese erlebte er in rauschhafter Langsamkeit. Schlagartig erreichte er eine höhere Stufe der Wahrnehmung, er sah auf einmal gestochen scharf, die Farben des Trikots, die Bewegungen des Stürmers. Andere erleben eine solche Grenzerfahrung allenfalls in traumatischen Schrecksituationen, wenn sie im Auto abrupt bremsen müssen oder vom Fahrrad stürzen. Hat er die Gefahr einmal gemeistert, wird ein Torwart süchtig nach diesen wunderschön schrecklichen Augenblicken im Spiel. Gegen Ende des ersten Heimspiels boxte Robert Enke noch einen Querschläger um den Pfosten und rettete Benficas 1:0-Sieg über Salgueiros. A Luz, das Licht, strahlte. „Enke schon Publikumsliebling in Lissabon“, meldeten in Deutschland die Nachrichtenagenturen, denen nie etwas schnell genug gehen kann.
Die Sportreporter wollten wissen, ob die Lage bei Benfica mit nur noch einem gestandenen Profitorwart im Aufgebot nicht bedenklich sei, auch für ihn, so ganz ohne Rivalen, der ihn im Training pusche. Druck machen, Druck kriegen schien offenbar auch im portugiesischen Fußball eine populäre Methode. „Mir gefällt die Situation“, entgegnete Robert Enke. „Ich brauche keine Konkurrenz.“
Ein 17-jähriger Junge aus dem B-Team war sein neuer Trainingspartner und Ersatzmann, José Moreira. „Das Erste, was mir auffiel, war sein Gesicht“, sagt Moreira. „Sein Gesicht während eines Spiels war das Gesicht von Oliver Kahn! Da bewegte sich nichts, keine Geste, keine Regung, nichts lenkte ihn ab, nichts brachte ihn aus der Konzentration.“
Robert Enke merkte, wie der Junge jede Bewegung von ihm aufsaugte, wie Moreira begann, ihn zu imitieren. „Wenn du mich ansiehst“, sagt Moreira elf Jahre später und kann den Stolz nicht verstecken, „wirst du einiges von Robert wiedererkennen.“
In der Kathedrale des Biers, wie der Bereich für die besonders wichtig genommenen Gäste im Stadion des Lichts heißt, schwingt sich Moreira vom Barhocker. Vor ihm speisen Geschäftsleute in Anzug und Krawatte, und Moreira, in weiter Jeans und schlabbrigem schwarzem T-Shirt, ignoriert, dass er ein Publikum hat. Er geht in die Hocke, fast ins Spagat, das rechte Bein ausgestreckt, das linke Knie abgewinkelt, den Oberkörper kerzengerade, die Arme ausgebreitet, alle zehn Finger gespreizt. „So stand Robert in Eins-gegen-eins-Situationen, wenn der Stürmer vor ihm auftauchte“, Moreiras Stimme ist nun hell und laut vor Enthusiasmus, „er machte sich so breit, und er war so beweglich und schnell, er konnte diese Position aus dem Nichts einnehmen und sofort wieder aus dem Spagat springen. Kein anderer Torwart beherrschte diese Haltung.“
Moreira fragte Robert Enke, warum nimmst du diese Spagathaltung ein, warum eilst du bei Flanken nicht öfter aus dem Tor, in deinen Handschuhen ist ja auch innen Latex, wieso das denn? Und Robert Enke, der sich einredete, ihm sei es egal, was andere Leute von ihm hielten, blühte auf, seit er keinen Druckmacher mehr neben sich hatte, sondern einen wissbegierigen Schüler, der ihn bewunderte.
An Abenden vor den Spielen teilten sie sich das Hotelzimmer. Sie sprachen ihr eigenes Portugiesisch-Englisch miteinander.
„Moreira, in drei Monaten will ich Portugiesisch können. Du bist jetzt mein Lehrer. Wie spricht man das aus: aipo hortense?“
„Robert, da ist ein R in hortense, man hört dein R nicht. Du sprichst es aus, als hättest du eine heiße Kartoffel im Mund.“
„Egal, in drei Monaten kann ich das, Moreira. Aber du musst auch Deutsch lernen. Bring mir Wasser! Das ist der wichtigste Satz, den du als mein Ersatztorwart verstehen musst, hast du verstanden: Bring mir Wasser!“
Moreira beherrscht den Satz noch heute und auch so einiges anderes, wie bei unserer Begrüßung am Stadion des Lichts deutlich wird. Wir treffen uns um 14Uhr. „Gute Nacht!“, grüßt Moreira auf Deutsch.
„Moreira, jetzt schauen wir die Bundesliga im deutschen Fernsehen“, sagte Robert Enke samstagabends auf dem Hotelzimmer.
»Aber wir können die Tore doch auch auf Eurosport mit englischem Kommentator anschauen, dann verstehe ich auch etwas.«
„Ach, nein. Es ist besser, wenn wir das auf Deutsch schauen.“
„Besser?“
„Ja, ja. Oh, Moreira, danach kommt noch ein guter Film mit Eddie Murphy im ZDF.“
„Aber da gibt es ja noch nicht einmal Untertitel!“, merkte Moreira, als der Film lief. „Eddie Murphy spricht Deutsch!“
„Macht nichts, Moreira, das ist schon gut so.“
»Aber Robert, wir könnten portugiesisches Fernsehen schauen, da kommen die Spielfilme auf Englisch mit portugiesischen Untertiteln.«
„Er hat sich immer durchgesetzt“, sagt Moreira voller Zuneigung, „und ich habe nie so viel geschlafen wie mit ihm auf dem Zimmer, weil mir die deutschen Filme zu langweilig wurden.“
Heute mit 28 trägt Moreira die Haare bis zur Schulter, sie rahmen ein weiches Gesicht ein, doch wie bei praktisch allen Torhütern ist auch sein Gesicht gezeichnet vom Zusammenprall mit den Stürmern. Eine Schürfwunde klafft unter dem rechten Auge. Er ist Benfica elf Jahre treu geblieben, auch wenn der Klub ihn als Inventar behandelt, mal spielt er, meistens nicht, weil die anderen Torhüter, die Benfica teuer einkaufte, wegen ihrer Ablöse fälschlicherweise als gewichtiger gelten.
„Hast du Moreira letztens spielen sehen?“, fragte Robert Enke mit Sicherheit jedes Mal, wenn wir in späteren Jahren auf große Torhüter zu sprechen kamen.
„Robbi, ich schaue mir doch nicht auch noch portugiesischen Fußball an!“
„Du musst dir Moreira anschauen.“
Robert Enkes Augen lachten, wenn er von Moreira redete, dem Torwart, der von ihm lernte, der ihm eine nie geahnte Unbeschwertheit beim Training schenkte; der sein Komplize und nicht Rivale war.
Im Palast Fronteira konnte man sich wie der Marquis fühlen, auch wenn man nur im Gästehaus wohnte. Es gab mehr Bäder als in ihrer Mönchengladbacher Wohnung Zimmer; sechs. Die Gartenmauern waren mit blauweißen azulejos gekachelt, die Motive kündeten von Ritterschlachten und trompetenden Affen.
Anrufe aus Deutschland wurden zu Teresas und Roberts Triumphen.
„Oh, Mann, hier regnet es schon wieder.“
„Ach, so? Wir sitzen im T-Shirt im Garten.“
Sie erkundeten die Stadt, die Festung San Jorge und das Museum Gulbenkian, das Eleven und das Blues Café, sie machten erste Bekanntschaften unter den Profis bei Benfica. Manchmal saßen sie im Garten und betrachteten das Licht Lissabons, golden am Nachmittag, milchig zur Dämmerung.
Teresas Gewissensbisse, dass sie ihr Studium aufgegeben hatte, verblichen. „Die Wahrheit ist, dass ich es genoss, nicht arbeiten oder lernen zu müssen.“ Wenn Robert beim Training war, lag sie im Garten und las Kriminalromane. Absätze mit reinen Beschreibungen von Orten oder gar dem Licht übersprang sie genervt. Es musste schon etwas passieren in Büchern.
Eines Vormittags klebte sie Fotos vom Sommerurlaub in Südholland in ihr Album, Robert mit Schlapphut in den Dünen, lächelnd. „Eine schwarze Zeit stand uns bevor“, schrieb sie darunter, es schrieb sich so leicht. Es schien so vergangen.
„Ich glaube, Robert bekommt nie mehr eine Angstattacke“, sagte sie seinem Vater, als er sie in Lissabon besuchte.
„Da wäre ich mir leider nicht so sicher“, sagte der Vater.
Teresa schauderte kurz und schüttelte den Gedanken locker ab.
Robert Enke flog weiter. Als Benfica Ende Oktober den FC Gil Vicente 2:0 besiegte, war die Elf nach sieben Spieltagen weiter ungeschlagen. Robert Enke hatte seit dem 1:1 gegen Rio Ave zum Auftakt kein einziges Tor mehr hingenommen. „Enke ist der Teufelsaustreiber“, dichtete der Record.
Die Besuche aus Deutschland nahmen zu. Teresas Mutter war die Nächste. Das Herbstlicht färbte den Garten heller, milder. Die Anrufer aus Deutschland erzählten, sie hätten gestern Abend zum ersten Mal die Heizung eingeschaltet, und sie schwammen im Palastgarten in ihrem Swimmingpool.
„Ist das herrlich hier“, sagte Teresas Mutter.
„Und ich kenne jemanden, der wollte gar nicht nach Lissabon“, rief Robert aus dem Schwimmbecken und wandte sich lächelnd Teresa zu: „Warum noch mal wolltest du eigentlich nicht nach Lissabon?“