

Schlaf, Engelchen, schlaf (Alexander-Gerlach-Reihe 13) Schlaf, Engelchen, schlaf (Alexander-Gerlach-Reihe 13) - eBook-Ausgabe
Ein Fall für Alexander Gerlach
— Packender Heidelberg-Krimi„So schreibt man Krimis!“ - Badische Neueste Nachrichten
Schlaf, Engelchen, schlaf (Alexander-Gerlach-Reihe 13) — Inhalt
Der 13. Fall für Kommissar Alexander Gerlach im Taschenbuch
Händeringend bittet Professor Henecka um Hilfe, da er – ein unbescholtener Bürger – mit Drohmails überschüttet wird. Bei seiner Recherche stößt Kripochef Gerlach jedoch bald auf einen alten Fall, in den Henecka verwickelt war. Die beste Freundin seiner Tochter ist nach einer Geburtstagsparty nie zu Hause angekommen. Im nahe gelegenen Wald fand die Polizei nur eine blutverschmierte Papierkrone – von Lisa fehlt bis heute jede Spur. Als Gerlach dann auch noch feststellt, dass Heneckas Frau ebenfalls verschwand, ist er sich sicher, dass der Professor nicht ganz so unschuldig ist, wie er behauptet ...
„Gerlach ist der sympathischste Beamte, den je ein Autor erfunden hat!“ Rhein-Neckar-Zeitung
Preisgekrönte Spannung in Krimiserie!
Mit „Heidelberger Requiem“ legte Wolfgang Burger 2005 ein fulminantes Krimi-Debüt vor, das sich aus dem Stand zur neuen Obsession der Fans des Ermittlerkrimis mauserte. Seine Bücher waren bereits mehrfach für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, so auch der achtzehnte Band „Am Ende des Zorns“.
Leseprobe zu „Schlaf, Engelchen, schlaf (Alexander-Gerlach-Reihe 13)“
1
Wenn ich etwas hasse auf dieser Welt, dann ist es Scheinwerferlicht. Grelles Licht, das auf mich gerichtet ist wie eine Waffe. Das mir den Schweiß aus den Poren treibt, mich quält und demütigt wie das Opfer eines Folterverhörs. Es verhindert, dass ich den Menschen hinter der blendenden Mauer ins Gesicht sehen kann. Den Menschen, die mich gleich anschreien, mir ihre drängenden, gemeinen Fragen zurufen werden. Fragen, die alle nur das eine Ziel haben: mich bloßzustellen, mich zu erniedrigen, mir Schmerzen zuzufügen, die ich nicht verdient habe. Fragen, [...]
1
Wenn ich etwas hasse auf dieser Welt, dann ist es Scheinwerferlicht. Grelles Licht, das auf mich gerichtet ist wie eine Waffe. Das mir den Schweiß aus den Poren treibt, mich quält und demütigt wie das Opfer eines Folterverhörs. Es verhindert, dass ich den Menschen hinter der blendenden Mauer ins Gesicht sehen kann. Den Menschen, die mich gleich anschreien, mir ihre drängenden, gemeinen Fragen zurufen werden. Fragen, die alle nur das eine Ziel haben: mich bloßzustellen, mich zu erniedrigen, mir Schmerzen zuzufügen, die ich nicht verdient habe. Fragen, die ungerecht sind und feige, weil sie gestellt werden von Leuten, die hinter diesem gemeinen Licht sitzen, in der wohligen Sicherheit der Masse. Sie sind viele, während ich allein bin. Sie sind anonym, während meinen Namen und mein Gesicht jeder in diesem großen und schon jetzt stickigen Raum kennt, der viel zu klein ist für den überwältigenden Andrang. Geil vor Ehrgeiz werden sie sich zu Wort melden und sich an meinem Elend weiden.
Aber noch kümmert sich niemand um mich. Noch werden Stühle gerückt, Witze gerissen, Kollegen lautstark über viele Reihen hinweg begrüßt. Links neben mir sitzt Kaltenbach, der sich mit eisiger Miene auf meine Vernichtung freut, rechts die Chefin der Staatsanwaltschaft, Frau Dr. Steinbeißer, von der ebenfalls keine Rettung zu erhoffen ist. Mein Mikrofon ist noch aus.
Drei Menschen sind gestorben, und ein weiterer ist gerade noch dem Tode entronnen – das sind Tatsachen. Und bei dreien dieser Ereignisse war ich irgendwie beteiligt oder zumindest in der Nähe des Tatorts. Aber dennoch trifft mich keine Schuld. Zugegeben, ich habe mich vielleicht nicht immer exakt an die Buchstaben des Gesetzes gehalten, vielleicht die eine oder andere Vorschrift ein wenig zu kreativ ausgelegt oder auch mal ganz ignoriert, aber im Grunde kann ich mir wirklich nichts vorwerfen. Leider bin ich vermutlich der Einzige in diesem lärmerfüllten, fensterlosen Raum, der das so sieht.
„Wieso haben Sie nicht wenigstens den letzten Mord verhindert?“, werden sie fragen. „Sie haben den Mörder doch kommen sehen, oder streiten Sie das etwa auch ab?“ Und ich werde antworten: „Weil Mörder nun mal nicht mit einer blinkenden Leuchtschrift auf der Stirn daherkommen, die ihre Absicht ankündigt.“
Als ich die Waffe in seiner Hand sah, war es längst zu spät, um noch irgendetwas zu tun. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Außerdem dachte ich zu diesem Zeitpunkt ja, verflucht noch eins, es sei schon alles gut. Nein, natürlich nicht gut. Aber immerhin zu Ende.
Nach wie vor herrscht großes Stühlerücken dort unten, hinter dem Licht. Ich höre das Gekrächze und Gegacker der Geier, die sich auf ihr Festmahl freuen. Ein weiterer Scheinwerfer flammt auf. Theaterschauspieler müssen das jeden Abend aushalten, denke ich, als ich mich zurücklehne und zwinge, ruhig zu atmen. Aber die werden dafür bezahlt, es zu ertragen, und am Ende mit Applaus belohnt. Für mich wird es heute keinen Applaus geben, sondern nur Anschuldigungen, öffentliche Demontage und Erniedrigung. Und ich werde mich glücklich schätzen können, wenn ich die Heidelberger Polizeidirektion morgen noch betreten darf.
Kaltenbach hüstelt in sein Mikrofon. „Meine sehr verehrten Damen und Herren“, beginnt er, während die Leitende Oberstaatsanwältin weiter mit verkniffener Miene ihre Unterlagen sortiert oder zumindest so tut, als ob.
Jetzt leuchtet auch an meinem Mikrofon das rote Lichtlein auf. Nur sehr allmählich kehrt Ruhe ein. Hüsteln, Rascheln, Füßescharren, etwas Schweres poltert zu Boden, eine Frau schimpft und lacht in einem. Dann wird es still. Bedrohlich still.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren“, wiederholt Kaltenbach in kühlem, überlegenem Ton seine Begrüßung. „Ich darf Sie zu dieser zugegebenermaßen etwas kurzfristig anberaumten Pressekonferenz herzlich begrüßen, bei der wir Herrn Gerlach, der hier neben mir sitzt und einer der fähigsten Polizisten ist, die wir in Heidelberg haben …“
Habe ich richtig gehört, oder leide ich nun auch schon an Halluzinationen? Sollte meine Rolle hier etwa nicht nur die des Bauernopfers sein? Die des Trottels aus dem zweiten Glied, den man auf der Flucht zurücklässt, um die Hunde von sich selbst abzulenken?
„… Gelegenheit geben, manches richtigzustellen, das in den vergangenen Tagen die Öffentlichkeit aus Unkenntnis und teilweise leider auch auf Basis falscher Informationen beunruhigt hat.“
Das war zwar grammatikalisch nicht ganz richtig, aber es hört sich dennoch außerordentlich gut an. Der Leitende Polizeidirektor Kaltenbach sieht mich an, nickt mir aufmunternd zu, lächelt sogar ein winziges bisschen. „Lieber Herr Gerlach – Ihr Publikum.“
Jetzt ist es totenstill dort unten. Die Meute hält den Atem an.
Mein Räuspern tönt überlaut durch den Raum. Das rote Lichtlein am Mikrofon leuchtet unbeirrt. Ich habe das Wort.
„Wie Herr Kaltenbach eben schon sagte, hat es in den vergangenen Tagen einige Missverständnisse gegeben.“ Meine Stimme funktioniert. Sie ist ein wenig rau, aber sie klingt sicher und vielleicht sogar selbstbewusst. „Die Art und Weise, wie diese Missverständnisse zustande gekommen sind, will ich nicht kommentieren. Aber erlauben Sie mir bitte, manches geradezurücken, was falsch oder verfälscht kommuniziert wurde. Ich will Ihnen die ganze Geschichte erzählen, und es wird ein wenig dauern, wofür ich Sie schon jetzt um Verzeihung bitte. Aber Sie sind ja hoffentlich hier, um die Wahrheit zu hören.“ Plötzlich durchdringt mich ein Gefühl der Hoffnung, es könnte wider Erwarten gut gehen. Ich könnte am Ende dieser Veranstaltung doch nicht arbeitslos sein. „Es war nämlich so …“
2
Begonnen hatte alles – ja, wann eigentlich? Als ich am achtzehnten Mai, einem Montag, abends aus dem Intercity stieg und Zeuge des Überfalls auf den kleinen, dunkelhäutigen Mann wurde? Oder erst mit Professor Heneckas Anruf anderthalb Stunden später? Oder am nächsten Abend, als wir uns trafen und ich am Ende seinen tausendmal verfluchten braunen Umschlag einsteckte, dem ich den ganzen Stress und Ärger verdanke?
Nach jenen nächtlichen Ereignissen Anfang Mai in Kirchheim – noch heute muss ich schlucken, wenn ich daran denke – war ich krankgeschrieben. Ich war nicht körperlich krank. Körperlich ging es mir, abgesehen von der kleinen Schnittwunde am Hals und einer leichten Gehirnerschütterung, gut. Die lästigen Kopfschmerzen waren schon nach wenigen Tagen abgeklungen. Die Gehirnerschütterung war bei Weitem nicht so heftig gewesen wie beim letzten Mal, als ich beim Radfahren so helmlos wie folgenreich auf den Kopf gefallen war.
Es war meine Seele, die litt. Nachts konnte ich nicht richtig schlafen, schreckte im Halbstundentakt aus irgendwelchen Horrorträumen auf, tagsüber war ich zugleich müde und übernervös, neigte zu Wutausbrüchen wegen Nichtigkeiten, ging mir selbst und meinen Mitmenschen auf die Nerven.
Die Tage vertrieb ich mir mit Bewegung. Bewegung tat mir gut, hatte ich bald festgestellt. So machte ich lange Spaziergänge, oft ohne hinterher sagen zu können, wo ich gewesen war. Ich joggte, als gälte es mein Leben, um diese elende Angst auszuschwitzen, die mein Herz im eiskalten Griff hielt. Ich joggte gegen die Einsamkeit an, die kein Besuch, keine Zärtlichkeit, kein noch so einfühlsames Gespräch zu lindern vermochte. Ich rannte mit zunehmender Verbissenheit vor mir selbst davon, und schon nach wenigen Tagen stellte ich fest, dass mein Körper regelrecht aufblühte. Die Strecke, die ich laufen konnte, bis mir die Puste ausging, wurde länger und länger, und die Waage im Bad zeigte jeden Morgen erfreulichere Zahlen an. Das beste Mittel gegen überflüssige Pfunde, stellte ich fest, ist unglücklich sein.
Außerdem nutzte ich die geschenkte Freizeit, um Dinge zu tun, für die mir sonst die Zeit fehlte. Ich besuchte die Museen Heidelbergs, auch die Mannheimer Kunsthalle, fuhr schließlich sogar nach Frankfurt, um mir im Städel Museum eine Ausstellung über post- und neoimpressionistische Malerei anzusehen. Da mein alter Peugeot immer noch in der Werkstatt stand, nahm ich den Zug.
Die Ausstellung in Frankfurt war vor allem eines: sehr gut besucht. Ich schlenderte herum, blieb als vollkommener Kunstbanause einfach vor solchen Bildern stehen, die mich in irgendeiner Weise ansprachen, ohne mir Gedanken zu machen, was daran das Besondere war. Schon nach zehn Minuten kam mir der Verdacht, am falschen Ort zu sein in diesem kulturbeflissenen Gedränge und aufgeregten Getue.
Erst im vorletzten Raum, als ich mich schon darauf freute, das überfüllte Gebäude bald wieder verlassen zu dürfen, sprang mich ein Bild an, als hätte es seit hundertfünfundzwanzig Jahren nur auf mich gewartet: van Goghs Weizenfeld mit Krähen. Ein dunkler, gewittriger Himmel hing bleischwer über einem wogenden, überreifen Weizenfeld. Und vom Horizont her, der noch ein wenig heller war, es aber bald nicht mehr sein würde, schwebte im Tiefflug ein Schwarm Krähen auf den Betrachter zu, wie Todesvögel.
Mir blieb die Luft weg, keinen Schritt konnte ich näher an das Bild herantreten. Kein Zweifel, van Gogh hatte gewusst, was Angst war. Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, um mich von dem Anblick zu lösen. Wurde angerempelt, einmal auf Französisch beschimpft, weil ich im Weg stand. Aber all das interessierte mich in diesen Minuten nicht. Ich konnte es nicht erklären, ich konnte es nicht verstehen, aber es gab ganz offenbar eine geheime Verbindung zwischen diesem Gemälde und mir.
Den Rest der Ausstellung schenkte ich mir. Nach diesem Bild, nach diesem Erlebnis hätte es ohnehin nichts Interessantes mehr geben können.
Während der abendlichen Rückfahrt war der Intercity proppenvoll, den ich auf der Hinfahrt noch fast für mich allein gehabt hatte. Nahezu jeder Platz war besetzt mit schläfrigen oder geschwätzigen oder konzentriert lesenden Pendlern, die auf dem Weg zu ihren Familien waren oder zu einem Feierabendbier mit Freunden oder zu einem faulen Fernsehabend mit hochgelegten Füßen und Paprikachips. Bei jedem Halt leerte sich der Zug ein wenig – um sich gleich wieder zu füllen. Auch als ich in Heidelberg ausstieg, wogte eine drängende Menschenmenge um mich herum.
Plötzlich hörte ich Gejohle und Gebrüll. Ich vermutete eine Horde Angetrunkener, die von einem Fußballspiel zurückkehrten oder von einem Match der Mannheimer Adler in der SAP-Arena. Menschen vor mir blieben stehen, sahen sich irritiert nach der Quelle des Lärms um, wichen zurück, um eine Gruppe rücksichtslos rennender junger Kerle durchzulassen, vermutlich die Verursacher des Tumults. Wie eine Art Uniform trugen alle Hoodies, zerschlissene Jeans und Sneakers.
Erst als die vier oder fünf Burschen schon auf der Treppe zum Bahnhofsgebäude hinauf waren, nahm ich auch hinter mir Unruhe wahr, andere, leisere Stimmen, empört, erschrocken. Ich erblickte einen Mann am Boden, von dem ich anfangs dachte, es handle sich um ein Kind, so klein und mager war er.
Eine junge Frau mit hellgrünem Haar rüttelte vorsichtig an seiner Schulter, rief: „Hallo!“ und: „Geht’s Ihnen gut?“
Dabei sah ein Blinder, dass es dem schmächtigen Mann, der in einem heruntergekommenen braunen Anzug und abgetretenen, ebenfalls braunen Schnürschuhen steckte, ganz und gar nicht gut ging. Mit wenigen Schritten war ich bei dem Bewusstlosen – das Geschiebe auf dem Bahnsteig hatte zum Glück schon ein wenig nachgelassen – und ging neben ihm in die Hocke.
„Rufen Sie einen Krankenwagen und die Polizei“, sagte ich in vielleicht etwas zu schroffem Ton zu der nervösen Grünhaarigen, die ihr Handy schon in der Hand hielt. In solchen Situationen sind Höflichkeit und freundliche Bitten fehl am Platz.
Immerhin, er atmete. Äußerliche Verletzungen waren nicht zu sehen. Auch kein Blut, keine seltsam verrenkten Gliedmaßen. Nach der Hautfarbe zu schließen, stammte er aus Asien. Aus einem dieser hoffnungslosen Länder, über die man wenig weiß.
„Malaie“, meinte ein älterer weißhaariger Herr mit beeindruckendem Bauch. „Oder Singapur. Bin ich schon öfter gewesen. So sehen die Leute da aus.“
„Kommen von da jetzt auch schon Flüchtlinge?“, wollte eine resolute Dame in feinem dunkelblauem Kostüm wissen. Sie war über vierzig, nicht unattraktiv und trug ein sandfarbenes Aktenköfferchen in der Rechten und Gold am Hals. „Ich würde sagen, Eritrea, Sudan, irgendwas in der Ecke.“
„Was ist hier eigentlich passiert?“ Ich blickte in die Runde und achtete darauf, dass keine Augenzeugen sich aus dem Staub machten. „Hat jemand was gesehen?“
Mit eiligem Schritt näherten sich zwei Kollegen in den schwarzen Uniformen der Bundespolizei, einer schon mit dem Funkgerät am Ohr, und übernahmen den Fall. Ich blieb noch ein wenig stehen. Vielleicht, um zu helfen, vielleicht auch, weil Neugier sozusagen mein Beruf ist.
Niemand hatte etwas gesehen, stellte sich rasch heraus. Obwohl zig Menschen in unmittelbarer Nähe gewesen waren, konnte keiner sagen, was sich hier vor kaum mehr als einer Minute zugetragen hatte. Gedränge hatte es gegeben, jemand war grob geschubst worden, und auf einmal hatte der kleine Mann am Boden gelegen, und ein paar kräftig gebaute Kerle hatten sich grölend und lachend aus dem Staub gemacht.
„Glatzen, todsicher Nazis“, behauptete die Grünhaarige mit großen, zornblitzenden Augen. „Vorhin im Zug …“ Sie deutete auf das Bündel Mensch am Boden. „Hat er da nicht einen Rucksack gehabt? Rot ist er gewesen, glaub ich, der Rucksack, dunkelrot mit Schwarz dran.“
Der jetzt verschwunden war. Unschwer zu erraten, was daraus geworden war. Die Kollegen wollten natürlich auch meinen Namen wissen. Ich überreichte ihnen eine dienstliche Visitenkarte. Einer drallen Frau jenseits der fünfzig fiel jetzt erst ein, die Hooligans hätten ihr Opfer schon im Zug drangsaliert. Aber niemand sonst konnte oder wollte dies bezeugen. Einen Ausweis oder andere Papiere konnten die Kollegen bei dem Opfer nicht finden. Die steckten vermutlich in dem verschwundenen Rucksack.
„Nichts als Ärger mit dem Pack“, sagte ein Mann, der direkt neben mir stand, leise zu seiner Frau.
„Meinen Sie den Verletzten oder die, die ihn ausgeraubt haben?“, fragte ich wütend. Anstelle einer Antwort erntete ich böse Blicke aus vier Augen.
Als der Notarzt kam, war der kleine Mann aus Afrika oder Malaysia oder Singapur schon wieder bei Bewusstsein, konnte ohne fremde Hilfe aufstehen, murmelte, immer noch benommen, krauses Zeug, das niemand verstand. Der Arzt erklärte nach kurzer Untersuchung, er werde den Patienten zur Beobachtung für eine Nacht in eine Klinik bringen lassen. Er werde aber bald wieder auf den Beinen sein.
Die Krankschreibung lautete „bis auf Weiteres“. Nach jenen Ereignissen, an die ich nicht denken wollte, was natürlich ganz falsch war, ich sah es ja ein, hatte mein Hausarzt mir eine Traumatherapie empfohlen. Diese hatte ich jedoch schon nach dem ersten Termin beendet, weil mir die Therapeutin den Nerv tötete mit ihren geduldigen Fragen zum immer gleichen Thema, ihrem weltumspannenden Verständnis für alles und jeden.
Seither ging es aufwärts mit mir. Meine selbst verordnete Bewegungstherapie wirkte tausendmal besser als das endlose Gequatsche in der puristisch eingerichteten Praxis. Von Tag zu Tag wurde ich ruhiger, das Pflaster am Hals trug ich fast nur noch aus Gewohnheit, Schmerztabletten brauchte ich längst nicht mehr, und auch meine Schlafphasen wurden länger und erholsamer. Immer seltener überfiel mich die Erinnerung an die scharfe Klinge an meiner Kehle, an das viele Blut, Claudias Blut, die erstickende Angst, das Gefühl der absoluten, der endgültigen Hilflosigkeit. An jenen kurzen Moment, als ich begriff, dass es aus war. Dass es keine Fortsetzung gab. Dass ich niemals wieder die Sonne sehen würde.
All das lag nun schon zwei Wochen zurück, und mit jedem neuen Tag rückte es ein wenig weiter in die Vergangenheit. Allmählich begann ich mich sogar schon wieder nach meiner Arbeit zu sehnen, nach meinem vertrauten Büro, dem Schreibtisch, auf dem sich bestimmt die unerledigten Akten türmten, nach Sönnchen, meiner treuen Sekretärin, die mich täglich anrief und sich mit bewundernswerter Sturheit weigerte, mir irgendetwas zu erzählen, das mit Verbrechen oder Polizeidienst zu tun hatte.
Es war derselbe Montagabend, an dem ich fast Augenzeuge des Überfalls am Bahnhof wurde, als um zwanzig vor acht mein Telefon zu trillern begann. Die angezeigte Handynummer kannten weder mein Telefon noch ich.
Ich war gerade dabei, mich anzukleiden, um die Wohnung zu verlassen, und meldete mich mit einem nicht gerade höflichen: „Ja?“
„Spreche ich mit Herrn Gerlach? Kriminaloberrat Gerlach?“
„Mit wem spreche ich denn?“
„Entschuldigen Sie, Henecka ist mein Name.“ Der Mann räusperte sich, lachte verlegen. „Jan-Armin Henecka.“
Auch der Name war mir unbekannt. Der Anrufer hatte eine ruhige, fürs Ohr angenehme, für einen Mann vielleicht ein wenig zu hohe und weiche Stimme. Er klang kultiviert, weltgewandt, freundlich. Und im Moment ein wenig verunsichert.
„Und was verschafft mir die Ehre Ihres Anrufs?“
„Eine Sache, die ich ungern am Telefon besprechen möchte.“
Irgendetwas an seinem Ton gefiel mir nicht. Da schwang etwas mit, das über Unsicherheit und Verlegenheit hinausging. Stress, Verwirrung, vielleicht sogar Angst.
„Aha“, sagte ich nur.
„Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes für Sie, meine ich. Aber … könnten wir uns vielleicht treffen? Ich komme, wohin Sie wollen und wann Sie wollen.“
„Ich wüsste eigentlich nicht …“
„Es wird Ihr Schaden nicht sein, Herr Gerlach, bitte! Ich habe erfahren, dass Sie krankgeschrieben sind. Und da ist Ihnen doch bestimmt langweilig als der Tatmensch, als den man Sie mir beschrieben hat.“
„Ich bin zurzeit nicht im Dienst, das ist richtig. Aber langweilig ist mir ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich …“
Ich brach ab. Was ging es diesen komischen Vogel an, wie ich mich fühlte?
„Es ist nämlich so. Ich …“ Noch einmal räusperte er sich. „Ich werde bedroht.“
„Dann wenden Sie sich an die Polizei. Dafür ist sie da.“
„Ja, natürlich.“ Ich meinte, einen unterdrückten Seufzer zu hören. „Das habe ich natürlich als Erstes getan. Aber Ihre geschätzten Kollegen haben die Angelegenheit leider nicht gerade ernst genommen, um es vorsichtig zu formulieren. Ich muss wohl dankbar sein, dass man erst gelacht hat, als ich wieder weg war.“
„In welcher Form werden Sie denn bedroht?“, fragte ich nach einigen rat- und wortlosen Sekunden. „Körperlich? Mit Anrufen?“
„Mails“, erwiderte der Mann gequält, dessen Name mir schon wieder entfallen war. „Jemand bombardiert mich seit Wochen mit bösen Mails.“
„Löschen Sie sie. Blockieren Sie die Mailadresse über Ihren Spamfilter. Versuchen Sie herauszufinden, wer er ist. Beauftragen Sie einen Privatdetektiv, der Ihnen den Kerl vom Hals schafft. Oder handelt es sich um eine Frau?“
„Das weiß ich nicht. In den letzten Tagen hat auch öfter das Telefon geklingelt, aber es war nie jemand dran. Oder vielmehr, jemand hat geatmet, aber nichts gesagt. Oder doch. Einmal hat er geflüstert: ›Du Schwein‹.“
„Lassen Sie für ein paar Tage jemand anders das Telefon abnehmen.“
Wieder herrschte für kurze Zeit betretene Stille. Dann verlegte er sich aufs Jammern: „Herr Gerlach, ich bitte Sie! An einen Privatdetektiv habe ich auch schon gedacht. Aber Sie als Polizist, Sie haben doch ganz andere Möglichkeiten.“
„Zurzeit habe ich nicht mehr Möglichkeiten als Sie.“
„Aber doch. Sie haben Erfahrung. Sie haben Kontakte. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, verzeihen Sie. Nennen Sie mir Ihren Preis. Ich bin kein Millionär, aber ich bin auch nicht arm. Wir werden uns mit Sicherheit einig werden.“
„Kein Interesse“, sagte ich kalt und leider nicht mit der Souveränität, die ich mir gewünscht hatte, und legte auf. Wenn die Kollegen den Fall nicht ernst nahmen, dann würden sie ihre Gründe haben. Jedes Polizeirevier kann im gemischten Chor strophenreiche Lieder singen von diesen Schauergeschichten: Mein Nachbar versucht mich umzubringen. Meine Ex hat schon zum dritten Mal meine Katze vergiftet. Meine Kollegin tut mir etwas in den Kaffee, das mich impotent macht. Mein Vermieter macht mit irgendwelchen Strahlen, dass ich ständig Hunger habe und immer dicker werde …
Mit großer Wahrscheinlichkeit war der Anrufer ein Neurotiker. Oder er hatte jemandem die Frau ausgespannt und erhielt nun die Quittung dafür.
Es gab noch einen zweiten Grund, weshalb ich das Gespräch so abrupt beendet hatte, und dieser Grund hieß Theresa. Wir hatten uns für diesen Abend verabredet, und inzwischen war es schon zehn vor acht. Ich würde mich verspäten wegen des blöden Herrn Henecka. Jetzt war mir der Name doch wieder eingefallen.
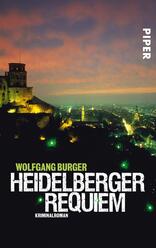


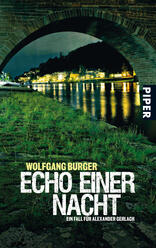


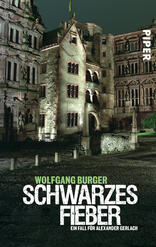

















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.