
Schlangensaat (Alexander Kilian 5) - eBook-Ausgabe
Kriminalroman
Spannender, interessanter, farbiger können Krimis kaum sein. - www.krimi-forum.de
Schlangensaat (Alexander Kilian 5) — Inhalt
Spätabends kommt Professor Alexander Kilian in sein Institut an der Freiburger Universität, um sich mit der Studentin Xenia Elytis zu treffen, doch zu seinem Entsetzen findet er sie in einem Labor tot am Boden liegend. Im Gegensatz zur Polizei ist er fest davon überzeugt, dass sie umgebracht wurde. Zu seinem eigenen Schutz verschweigt er, was ihn wirklich mit der attraktiven jungen Frau verband, und beginnt die Suche nach ihrem Mörder. Dabei zieht sich das Netz aus Lügen und Intrigen, in das sich Kilian verstrickt hat, immer weiter zu, bis auch sein eigenes Leben auf dem Spiel steht …
Leseprobe zu „Schlangensaat (Alexander Kilian 5)“
Warum er? Warum musste ausgerechnet er die Tote finden? Diese Tote. Hier in seinem Institut, wo er sie nicht einmal zu Lebzeiten hatte sehen wollen.
Alexander Kilian starrte in das leblose Gesicht. Er brauchte die Frau nicht zu berühren, um zu wissen, dass er ihr nicht mehr helfen konnte.
Sie lag auf dem Rücken vor der großen Beckmann-Ultrazentrifuge auf dem gefliesten Boden des Zelllabors, den Kopf leicht zur Seite gedreht. Der Mund war geöffnet und der Unterkiefer der Schwerkraft folgend zur Seite abgesunken. Die halb geschlossenen dunklen Augen gaben [...]
Warum er? Warum musste ausgerechnet er die Tote finden? Diese Tote. Hier in seinem Institut, wo er sie nicht einmal zu Lebzeiten hatte sehen wollen.
Alexander Kilian starrte in das leblose Gesicht. Er brauchte die Frau nicht zu berühren, um zu wissen, dass er ihr nicht mehr helfen konnte.
Sie lag auf dem Rücken vor der großen Beckmann-Ultrazentrifuge auf dem gefliesten Boden des Zelllabors, den Kopf leicht zur Seite gedreht. Der Mund war geöffnet und der Unterkiefer der Schwerkraft folgend zur Seite abgesunken. Die halb geschlossenen dunklen Augen gaben der Toten den schläfrig-sinnlichen Ausdruck, der ihn an der Lebenden gleichermaßen fasziniert wie abgestoßen hatte. Sie war sehr blass. Wie Wachs, dachte er, wie weiße Kerzen auf einem Altar, und er fragte sich, ob Tote immer so aussahen. Oder war das, was sie zu Boden geworfen hatte, doch nur eine Ohnmacht, aus der es ein Erwachen gab? Er war Mediziner, aber Wissenschaftler, und als Professor für Molekulargenetik sah er keine Toten.
Alexander Kilian beugte sich zu dem reglosen Körper herunter, berührte neben dem Kragen der engen Bluse den Hals, der noch warm war, suchte den Puls, aber da war kein Herzschlag zu fühlen, gar nichts war da mehr.
Als er sich wieder aufrichtete, stand Schweiß auf seiner Stirn. Er sank auf einen Laborschemel, stützte die Ellenbogen auf den Arbeitstisch und vergrub den Kopf in den Händen. Er musste an einen steilen Hang denken, den er immer weiter hinuntertaumelte, mit jedem Schritt, den er tat, tiefer hinab in den Abgrund, ohne Hoffnung, sich jemals wieder daraus zu befreien. Der Abgrund tat sich immer auf, wenn er an das Geheimnis dachte, das ihn mit dieser Frau verband. Er hatte sich schon aufgetan, als sie noch lebte.
Die Polizei, dachte er, aber er ging nicht zum Telefon, noch nicht. Er ließ sich neben der Toten auf die Knie sinken und strich ihr ganz sanft über das dunkle, schulterlange Haar. Er betrachtete sie lange. Entsetzen, Verzweiflung oder Trauer? Er wusste nicht genau, welches Gefühl am stärksten war. Angst? – Ja. Er hatte Angst, weil diese Frau nicht mehr lebte. Vor allem Angst.
Ein Geräusch erschreckte ihn, und er fuhr zusammen, als hätte ihn jemand bei etwas Verbotenem ertappt. Doch niemand beobachtete ihn, niemand war zu dieser späten Stunde im Labor, nur der große Kühlschrank neben der Tür war angesprungen. Er stand auf, zu hastig, denn das Zimmer fing an, sich um ihn zu drehen. Schwankend und unsicher sank er wieder auf den Laborschemel. Er fühlte sich plötzlich schlecht, als hätte er mit der zarten Berührung der Haare eine unzüchtige Handlung an der Toten vorgenommen.
Endlich hob er den Hörer ab und rief die Polizei. Dann wartete er. Er war froh über die Minuten, die ihm blieben. Er brauchte sie, um sich Antworten auf die Fragen zurechtzulegen, die man ihm stellen würde. Wie gut kannte er die Tote? Er konnte nicht leugnen, sie überhaupt gekannt zu haben. Xenia Elytis. Frau Brändle hatte ein gutes Gedächtnis. Seine Sekretärin würde sich erinnern, dass sich die Tote wegen einer Doktorarbeit bei ihm beworben hatte. Er hatte abgelehnt, weil er Verwicklungen befürchtete, schon damals. Sieben oder acht Monate lag ihr erster Auftritt in seinem Institut zurück. Und seither? Er würde zugeben müssen, dass es nicht bei dieser einen Begegnung geblieben war.
Aber was auch immer ihn mit dieser Frau verband, mit ihrem Tod hatte er nichts zu tun. Gar nichts. Die Polizei würde ihm glauben und ihn nicht mit unangenehmen Fragen in die Enge treiben. Nicht in dieser Sache. Er war ja nicht einmal da gewesen, als sie noch lebte, noch viel weniger im Augenblick ihres Todes.
Dieses bleiche Gesicht! Er hatte nicht die geringste Ahnung, woran sie gestorben sein konnte. Plötzlicher Herztod bei einer so jungen Frau? Oder ein Verbrechen? Mord? In ihrem Alter hörte man nicht einfach auf zu leben. Er hatte keinen Augenblick gezögert, gleich die Polizei anzurufen und nicht den Notarzt. Weil er gar nichts anderes in Erwägung gezogen hatte als ein Verbrechen? Gift vielleicht? Sah man so aus, wenn man vergiftet worden war?
Eine Sektflasche und eine fast volle Flasche Orangensaft standen unter der Spüle neben dem Papierkorb auf dem Boden, vier leere Gläser auf den Arbeitstischen, ein noch halb gefülltes auf einem Photometer. Daneben lag eine aufgerissene Tüte mit Kartoffelchips. In den Laborräumen war Essen und Trinken verboten, aber offenbar kümmerte sich niemand darum, wenn er nicht im Haus war. Nein, nicht einmal dann, wenn er anwesend war. Nicht einmal er kümmerte sich immer darum.
Er stand auf und hob die Sektflasche hoch. Sie war leer. Als er sie zurückstellte, wurde ihm bewusst, dass er seine Fingerabdrücke auf dem Glas hinterlassen hatte. Wie dumm war er eigentlich, sich auf diese Weise in das Geschehen hineinziehen zu lassen? Er nahm sein Taschentuch und wischte die Flasche ab, wo er sie eben berührt hatte. Den Rest ließ er unverändert.
Plötzlich hatte er das Bedürfnis, sich die Hände zu waschen. Er machte einen Bogen um das Waschbecken im Labor und ging zur Toilette, um nicht noch mehr Spuren in dem Raum zu hinterlassen, wo er die Tote gefunden hatte. Minutenlang ließ er warmes Wasser über seine Hände laufen. Ein schmales Gesicht sah ihm im Spiegel dabei zu. Im Neonlicht erschien ihm sein Gesicht wie das eines Fremden. Bei dieser Beleuchtung wirkte es wie aus Wachs, geradeso wie das der Toten. Ein ebenmäßiges Gesicht unter vollen grauen Haaren, aber wie künstlich schien es ihm, dabei älter, als er es in Erinnerung hatte, und mit einem bläulichen Schimmer auf der fahlen Haut. Sechsundfünfzig Jahre war er vor Kurzem geworden, dreißig Jahre älter als die Tote. Unzufrieden zeigte er seinem Ebenbild die Zähne. Es drohte mit der gleichen abstoßenden Gebärde zurück. Er wandte sich ab von dem alternden Mann, der er selbst sein sollte.
Als Alexander Kilian ins Labor zurückkehrte, hörte er in der Ferne ein Martinshorn. Es näherte sich rasch und verstummte.
Warum war er hier, jetzt, eine halbe Stunde vor Mitternacht? Was würde er der Polizei sagen? Dank moderner Technik war heute so vieles offensichtlich und überprüfbar. Die SMS von Xenia hatte er sofort gelöscht, weil er jede Nachricht löschte, nachdem er sie gelesen hatte. Das würde er jedenfalls behaupten, wenn sie ihn danach fragten. Ob auf dem Handy der Toten noch zu lesen war, was sie ihm geschrieben hatte? Er würde nicht umhin kommen, bei der Wahrheit zu bleiben, wenn sie ihn fragten.
Sphinx. Dieses Wort war ihm schon durch den Kopf gegangen, als sie zum ersten Mal in seinem Arbeitszimmer vor ihm stand. Ohne Ankündigung, ohne den Umweg über seine Sekretärin, ohne Termin hatte sie an seiner Tür geklopft und war eingetreten wie eine Vertraute, die jederzeit willkommen ist. Er wusste damals ihren Namen nicht, aber er kannte sie vom Sehen: eine der Studentinnen aus der ersten Reihe des Hörsaals, wenn er seine Vorlesung hielt, eine von denen, die jedes seiner Worte mitschrieben, egal, wie unbedeutend es war. Eine von denen, die sich hoffnungslos zu ihm hingezogen fühlten, schon deswegen, weil er eine Berühmtheit war. Das war jedenfalls seine Einschätzung gewesen. Aber sie sah nicht aus wie eine besonders eifrige Studentin, und sie trat auch nicht so auf. Sie war auf eine geradezu unverschämte Weise anders, als sie ihm in seinem Arbeitszimmer gegenüberstand: sie fragte nicht, sie bat nicht, sie forderte, auch wenn sie ihr Ansinnen in einen Wunsch kleidete. Kein verlegenes Lächeln, als sie ihr Anliegen vorbrachte, kein ängstlich forschender Blick, kein Erröten, als er sie viel zu lange wortlos ansah.
Sie hatte ihren Namen gesagt, Xenia Elytis. Und gleich im nächsten Satz: „Ich möchte bei Ihnen promovieren.“
Er hatte kaum zugehört, hatte nur Blicke für dieses rätselhafte Gesicht mit den großen dunklen Augen unter den halb geschlossenen Lidern gehabt. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte er gewusst, dass diese Frau in sein Leben eingreifen würde wie kaum eine andere. Sie war überhaupt nicht schön in diesem ersten Augenblick, jedenfalls hatte sie nichts von dem, was man landläufig als schön bezeichnet. Die Nase war groß und etwas zu breit in dem schmalen Gesicht, auch der Mund schien groß, die Oberlippe sehr voll und stark geschwungen. Xenia Elytis – eine Griechin? Jedenfalls ein Gesicht wie aus der griechischen Antike. Eine Sphinx, wenn da nicht die schläfrigen Augen gewesen wären. Aber keine ägyptische, wie die gewaltige in Stein gehauene Große Sphinx von Gizeh. Wie eine griechische Sphinx sah sie aus, wie eine Schwester der neunköpfigen Wasserschlange Hydra und des Höllenhundes Kerberos. Wie jene Männer verschlingende Todesdämonin, die der junge Ödipus besiegte. Als Lohn dafür hatte der seine leibliche Mutter Iokaste zur Gemahlin bekommen.
Als Alexander Kilian lange genug dieses Gesicht betrachtet hatte, war sein Blick auf die enge Bluse gefallen, deren oberste Knöpfe geöffnet waren, auf den Ansatz ihrer großen Brüste. Um seine Augen von der aufreizenden Wölbung loszureißen, hatte er seinen Blick weiter gesenkt und war an ihrer Taille hängen geblieben. Lang und schmal war sie, als habe jemand den biegsamen Körper in der Mitte in die Länge gezogen. Nur Busen und Po, den er mehr ahnte als sah, hatten die runden Formen bewahrt.
Hatte er gesprochen, während er sie so lange anstarrte? Er wusste es nicht. Sie stand viel zu dicht vor ihm und schaute ihn an, ohne Lächeln, ohne Flirt, sondern mit einem großen Ernst und einer anmaßenden Direktheit. Er wusste, dass alles entschieden wäre, wenn er die Hand ergriff, die sie nach ihm ausstreckte. Sie wollte ihn. Deshalb war sie hier.
„Alle Doktorandenstellen sind vergeben“, sagte er. „Vielleicht im nächsten Semester, aber ich kann Ihnen nichts versprechen.“ Er trat zwei Schritte zurück, sah auf die blühenden Kastanien vor dem Fenster und fühlte sich etwas sicherer. Das nächste Semester war noch weit.
„Ich brauche keine bezahlte Stelle. Ich brauche nur einen Platz, an dem ich arbeiten kann, in einem Institut, wo ich auf die wichtigsten Zeitschriften zugreifen kann, und einen Professor, der meine Arbeit zulässt. Ich brauche nicht einmal ein Thema von Ihnen.“
Sie fragte nicht, sie kündigte vielmehr an, dass sie ihre Arbeit an seinem Institut schreiben würde, jetzt und nicht im nächsten Semester, und die ihm zugedachte Rolle war die eines willenlosen Zuschauers.
„Es tut mir wirklich leid“, begann er wieder und sprach von den vielen, die nach einer Doktorarbeit fragten – fast jede Woche komme jemand zu ihm, zeitweilig habe er sogar eine Warteliste geführt. Und während er sich in Gedanken verzweifelt an seine Ina und ihr gemeinsames Glück klammerte, das er nicht von dieser Sphinx stören lassen wollte, erfand er immer neue Begründungen. Er machte mehr Worte, als es seiner Glaubwürdigkeit zuträglich war, redete immer mehr, nur um diese Würgegöttin loszuwerden. „Tut mir leid“, beteuerte er. „Wirklich. Es tut mir sehr leid.“
Er ging zur Tür, ehe sie noch etwas erwidert hatte, drückte auf die Klinke und hielt ihr die Tür auf. Sie sah ihn unter den schweren Lidern ohne erkennbare Regung an – sehr lange, sehr sicher, dann drehte sie sich wortlos um, ein angedeutetes Nicken zum Abschied, und schritt hoch erhobenen Hauptes an ihm vorbei aus dem Zimmer. Nicht als Verliererin, sondern als Siegerin, die weiß, dass ihre Stunde noch kommen wird.
„Vielleicht später“, rief er ihr nach und warf die Tür ins Schloss. Am liebsten hätte er noch einen Riegel vorgeschoben. Diese Frau machte ihm Angst. Er blieb mitten im Zimmer stehen und fühlte sich erschöpft, als habe er sich mit größter Not und unter Aufbietung all seiner Kräfte im letzten Augenblick aus dem Schlund der Hölle befreit.
Am nächsten Tag erzählte er Frau Brändle von Xenias Bewerbung um eine Doktorandenstelle, als sei sie eine Studentin wie jede andere, und bat sie, im Studierendensekretariat deren Werdegang zu erfragen. Er habe dies vergessen. Xenia hatte bereits ein Medizinstudium abgeschlossen, erfuhr er wenig später, und studierte jetzt in Freiburg, Straßburg und Basel Biotechnologie.
Nach der Begegnung in seinem Arbeitszimmer war Xenia nicht mehr in seine Vorlesung gekommen. Wochenlang hatten seine Augen nach dem blassen Gesicht und den dunklen Augen gesucht, aber irgendwann vergaß er sie. Oder redete sich das zumindest ein. Nur von Zeit zu Zeit und in den unpassendsten Situationen tauchte ein Gesicht vor ihm auf, das nur Xenias sein konnte.
Schritte auf der steinernen Treppe der alten Jugendstilvilla, in die das Institut für Molekulargenetik vor Jahren eingezogen war, rissen ihn aus seinen Gedanken. Sie kamen.
Er blieb auf seinem Schemel sitzen. Es gab keinen Grund, irgendetwas zu beschleunigen. Sie würden ihn finden, und dann würden die Dinge ihren Lauf nehmen. Da musste er jetzt durch, irgendwie und ohne selbst Schaden zu nehmen. Wenn er sich nicht in Widersprüche verwickelte, würde niemand erfahren, welches Vergehen ihn mit dieser Frau verband. Tote reden nicht. Und wenn dieses Geheimnis, das er verschweigen wollte, der Grund für ihren Tod und die Spur zu ihrem Mörder war?
Draußen auf dem Flur war es laut geworden, Türen wurden geöffnet und wieder geschlossen, eine Männerstimme rief seinen Namen. Er erhob sich widerwillig und trat in den Flur. Ein paar Meter von ihm entfernt, halb verdeckt durch die hohen Kühlschränke an der Wand des Labortraktes, standen zwei Beamte in Uniform: ein Mann, den er von hinten sah, und eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz, die ihm jetzt ein ratloses und verzagtes Gesicht zuwandte. Ein Kindergesicht, dachte er. Immer öfter erschienen ihm junge Erwachsene wie halbe Kinder. Das musste an seinem fortschreitenden Alter liegen.
Er begrüßte die Beamten. Die Jugend der beiden und ihre offensichtliche Unsicherheit stimmten ihn zuversichtlich, was seine eigene Rolle betraf, aber sie waren nicht von der Kripo, sie waren nur die Vorhut von der Schutzpolizei.
„Ich führe Sie jetzt zur Toten.“ Alexander ging voran, und für einen kurzen Augenblick hatte er den verrückten Gedanken, das Labor wäre leer. Keine Leiche, die Tote wäre nur in seinem Kopf gewesen. Natürlich lag sie noch so da, wie er sie verlassen hatte.
Die junge Polizistin beugte sich über die leblose Frau, die kaum älter war als sie selbst. Große, erschreckte Kulleraugen, das völlige Gegenteil des verhangenen Blicks seiner Sphinx. Er konnte den Anblick des reglosen Gesichtes nicht länger ertragen und sah aus dem Fenster. Unten auf der Straße blitzten in regelmäßigen Abständen die blau-weißen Lichter des Notarztwagens. Ihr Stroboskoplicht warf flackernde blaue Bilder in die Nacht, blaue Äste an unsichtbaren Bäumen, blaue Dachrinnen, wo er keine Häuser sah, ein Arzt in blau aufblitzendem Kittel, zwei Sanitäter, die sich so ruckartig bewegten, als seien sie in einen alten Stummfilm geraten.
Der Polizist, ebenso erschrocken und hilflos angesichts des Todes eines jungen Menschen wie seine Kollegin, verließ eilig das Labor und ging dem Arzt entgegen. Es war wie die Flucht vor etwas, dem er doch nicht entkommen konnte. Als er zurückkam, war sein Gesicht zuversichtlicher. Der Arzt an seiner Seite schien ihm Mut zu machen, doch auch der konnte nichts anders tun, als den Tod festzustellen.
Als draußen zwei unauffällige Limousinen vorfuhren, zog sich Alexander in das Nebenzimmer des Labors zurück, wo neben einem Spülbecken zwei große Autoklaven aufgestellt waren. Ohne das Licht einzuschalten, sank er wieder auf einen der drehbaren Schemel, die überall standen, und harrte mit hängendem Kopf darauf, dass die Kripo ihn finden würde. Er brauchte nicht lange zu warten.
„Herr Kilian?“
Alexander Kilian hob den Kopf. Ein Mann in Zivil war in den Rahmen der offenen Tür getreten und verdunkelte den kleinen Raum. Wie ein Scherenschnitt stand die massige Gestalt vor dem Neonlicht des angrenzenden Labors. Der Mann ohne Gesicht stellte sich vor – Hauptkommissar Mauer oder Lauer, so genau hatte er den Namen nicht verstanden. Er fragte nicht nach. Er hoffte, dass dieser Beamte genauso schnell wieder aus seinem Leben verschwinden würde, wie er darin eingedrungen war.
Mauer oder Lauer oder wie er sonst hieß tat einen Schritt in den Raum hinein und wandte sich dem immer noch Sitzenden zu. Jetzt beleuchtete das Neonlicht das runde Gesicht von der Seite. Es sah auf Alexander herunter, irgendwie mitleidig, nicht fordernd oder forschend, wie der es erwartet hatte.
„Sie haben die Tote gefunden?“
Er nickte.
„Wer ist sie?“
„Xenia Elytis.“
„Hat sie hier gearbeitet?“
Alexander schüttelte den Kopf. Reden, dachte er, er musste reden, das konnte ihn vor Fragen bewahren, die er nicht beantworten wollte. Doch ihm fiel nichts ein.
„Woher kannten Sie die Frau?“
„Sie saß als Studentin in meiner Vorlesung und hat sich vergeblich um eine Doktorarbeit hier am Institut beworben.“
„Warum vergeblich?“
Alexander stockte. Über ihm schwebte das runde Gesicht, die eine Hälfte dunkel, die andere im Licht mit einem beleuchteten Auge über einer fleischigen Wange, einer halben Nase, einem halben Doppelkinn, einem halben Kehlkopf und darüber ein paar Bartstoppeln, die kein Rasierapparat erreichte.
„Ja warum?“, wiederholte er nachdenklich. „Wissen Sie, bei mir bewerben sich so viele Studenten und Absolventen um eine Doktorarbeit, dass ich weder alle annehmen kann noch im Einzelfall behalte, warum ich jemanden abgelehnt habe. In der Regel ist schlichtweg kein Platz frei.“ Reden, dachte er wieder, noch mehr reden um jeden Preis, aber seine Gedanken waren bei der toten Sphinx, die ein paar Meter von ihm entfernt am Boden lag und nie wieder aufstehen würde. Noch hatte der Kommissar nicht gefragt, warum er zu dieser späten Stunde hierhergekommen war.
„Und dann war Frau Elytis ganz allein in diesem Haus, obwohl sie nicht hier arbeitet?“
„Scheint so. Ich kam ins Institut, um meinen vergessenen Laptop zu holen und …“
„Und da haben Sie die Tote zufällig im Labor entdeckt?“, setzte der Kommissar den Satz fort.
Alexander Kilian zögerte wieder, vielleicht eine Spur zu lange, um kein Misstrauen zu erwecken.
„Ja. Ich sah Licht brennen und habe nachgesehen, ob noch jemand arbeitet. Da habe ich die Tote gefunden, zufällig, wenn Sie so wollen.“
Er kniff unzufrieden die Lippen zusammen. Selbstverständlich hatte er die Tote zufällig gefunden, das entsprach der Wahrheit. Er hatte eine Lebende erwartet, keine Tote. Es war nicht seine Schuld, dass er nur die halbe Wahrheit sagte. Der Kommissar drängte ihn mit seiner Frage förmlich in diese Richtung. Natürlich hätte er sonst erzählt, dass er hier war, weil Xenia ihn darum gebeten hatte. Aber Xenias SMS hatte er ohnehin nur zufällig gelesen.
Durch Zufall, das war so gut wie gar nicht, und doch hatte diese unberechenbare Macht wieder einmal die Weichen gestellt. Nur der Zufall hatte ihn hineingezogen in den Dunstkreis des Todes und der Verdächtigungen. Sein Handy war zu Boden gefallen, als er heute Abend in seiner Wohnung seinen Mantel achtlos über einen Stuhl geworfen hatte, das war der verhängnisvolle Zufall, dem er diese Katastrophe verdankte. Als er den Apparat aufhob, war ihm die Nachricht von Xenia aufgefallen. Geschrieben war sie um 21.22 Uhr, gegen 23 Uhr hatte er sie gelesen. Ohne seinen zufälligen Blick auf das Handy hätte jemand anders die Tote gefunden und niemand ihn mit dieser Frau und ihrem Tod in Verbindung gebracht. Und alles nur, weil er seinen Mantel nicht an die Garderobe gehängt hatte!
Plötzlich drehten sich seine Gedanken nur noch um diesen Mantel, den er nie ordentlich aufhängte, jedenfalls nicht in seiner eigenen Wohnung, wo er sowieso immer alles irgendwo stranden ließ, was er bei sich trug. Das war seine Art, die er sich von niemandem austreiben lassen wollte, ein kleines bisschen Freiheit, wenigstens in seinen eigenen vier Wänden. Und schließlich sammelte er die Dinge selbst irgendwann wieder auf, wenn ihm danach zumute war oder wenn die Putzfrau auf dem Weg zu ihm war. Ina war da ganz anders mit ihrer Ordnungsliebe. „Warum hängst du deinen Mantel nicht an die Garderobe? Das ist doch keine Mühe!“ Hätte er doch bloß wenigstens dieses eine Mal getan, was Ina sagte!
Zwei Stunden nachdem Xenia ihn per SMS darum gebeten hatte, war er im Institut gewesen. Sie hatte keine Andeutungen gemacht, warum er kommen sollte, nur geschrieben, dass es sehr wichtig sei. Hatte sie noch immer Angst wie bei ihrer Begegnung am Flughafen zwei Wochen zuvor? Fürchtete sie sich wieder vor dem großen Mann, von dem sie sich verfolgt gefühlt hatte? Oder wollte sie ihm etwas geben, wie sie es vor ein paar Tagen angedeutet hatte? Eine Nachricht? Oder etwas ganz anderes? Aber warum und vor allem wie war sie ins Institut gekommen? Hatte sie gewusst, dass die anderen dort feierten? Wenigstens auf diese Frage würde er bald die Antwort wissen.
„Es sieht so aus, als habe hier eine kleine Feier stattgefunden“, sagte der Kommissar, als habe er Kilians Gedanken erraten.
„Ja, so sieht es aus.“
„Wissen Sie, wer hier war?“
Alexander zuckte mit den Schultern. „Vermutlich die Mitarbeiter, die normalerweise in diesem Raum arbeiten.“
„Und wer ist das?“
Der Professor nannte ein paar Namen, und der Kommissar angelte ein schwarzes Büchlein und einen Kugelschreiber aus einer der ausgebeulten Taschen seiner bieder-dunkelblauen Winterjacke.
Das Licht, das durch die offene Tür fiel, reichte nicht zum Schreiben, und der Beamte suchte nach einem Lichtschalter. Beim Aufflammen des kalten, weißen Neonlichts schloss Alexander für einen Augenblick die Augen. Als er sie wieder öffnete, war aus dem halben Gesicht ein ganzes geworden, rund wie ein Vollmond, aber nicht kalt und weiß, sondern unter dem fast kahlen Schädel so rosig, dass Alexander seine Wärme zu spüren meinte. Es war ein gutmütiges Gesicht, väterlich wohlwollend geradezu. Trotzdem fühlte er sich unwohl in der grellen Beleuchtung, als könne er im Halbdunkel leichter verbergen, was er nicht offenbaren wollte. Alexander hätte das Licht gern wieder gelöscht, nachdem der Kommissar das Notizbuch wieder eingesteckt hatte, aber er fürchtete, dass er damit dessen Argwohn wecken würde.
„Wann haben Sie Frau Elytis zum letzten Mal lebend gesehen?“
Vielleicht lag es am hellen Licht, vielleicht an seinem schlechten Gewissen, dass Alexander in der Stimme des Kommissars plötzlich einen lauernden Unterton zu hören glaubte.
„Zuletzt sind wir uns zufällig am Zürcher Flughafen begegnet. Ich war auf dem Weg zu einem Kongress in London. Frau Elytis wollte zu ihrer Halbschwester nach Argentinien fliegen, weil ihr Vater dort kurz zuvor bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war.“
„Wann war das?“
„Vor einer Woche vielleicht“, sagte er zögernd, korrigierte sich dann: „Nein, ich bin am Freitag vor zwei Wochen nach London geflogen.“
Warum blickte ihn der Beamte so forschend an? Warum wurde aus dem wohlwollenden Vater plötzlich ein argwöhnischer? Oder bildete er sich das nur ein? Die Begegnung mit Xenia am Flughafen war wirklich Zufall gewesen, nichts sonst. Aber sie war nicht die letzte gewesen.
Der Professor spürte, wie sein Herz unter dem Blick des Kommissars zu rasen begann, trotzdem erwiderte er ihn so gleichmütig, wie es ihm möglich war. – Da war er wieder, dieser Abgrund! Nur der kleinste falsche Schritt, und die bodenlose Tiefe würde ihn unweigerlich verschlingen. Wie hätte er denn wissen sollen, wohin sich das alles entwickelte?
Diese Begegnung am Flughafen! Eine kleine künstliche Felswand hatte seine Blicke angezogen, kaum drei Meter hoch, aus Gips oder Pappmaschee, kein Vergleich mit einer echten Schweizer Felswand, auch das Restaurant im Stil eines Schweizer Chalets am einen Ende der Felswand wirkte wie eine misslungene Karikatur, nicht besser als die Kuhglocken, Kuckucksuhren und Fahnen im „Edelweiß Shop“ am anderen Ende. Direkt vor der Felswand war eine Bar, nichts Besonderes bis auf den großen Hackklotz mit eingeschlagener Axt über den Weinflaschen und Spirituosen, wie die Felswand ein unpassender Fremdkörper in der weitläufigen Architektur des Zürcher Flughafens.
Die Frau mit Xenias Gesicht, die an der Bar saß, war eine Fremde, trotzdem blieb er stehen, um sie verstohlen zu mustern. So schräg von vorn betrachtet, erschien ihm ihr Körper noch schlanker, noch zerbrechlicher, als er ihn in Erinnerung hatte. Ihre Augen waren mit dunklem Kajal umrahmt und die Wangen in einer kränklichen Totenblässe übermäßig geschminkt. Sie klammerte sich an ein Glas mit roter Flüssigkeit und sah reglos geradeaus. Alexander blickte auf die Uhr. Höchstens zehn Minuten blieben ihm noch, bis er am Flugsteig sein musste, und er wusste nicht, wie lange er bis dorthin brauchen würde. Trotzdem ging er auf die Bar zu und blieb hinter der Frau stehen.
„Xenia.“
Sie zuckte heftig zusammen und sah sich um, als er leise ihren Namen sagte. Aber diese Frau, die ihn aus aufgerissenen Augen ansah, war nicht seine Xenia, sondern ein furchtsames, bedrücktes Wesen, das jede Ähnlichkeit mit der selbstsicheren Sphinx verloren hatte.
„Willst du verreisen?“
Er versuchte seine Stimme unbefangen klingen zu lassen, aber es gelang ihm nicht. Ihr Anblick lähmte ihn. Sie saß stocksteif da, als wäre sie aus Holz geschnitzt. Als sie endlich antwortete, war ihre Stimme so leise, dass er sie kaum verstehen konnte.
„Ich muss.“
„Warum musst du verreisen?“
„Mein Vater ist tot.“
Vier Worte, fast tonlos hervorgebracht, aber Alexander erschrak, als könne er selbst schuld sein an dem Tod dieses Mannes, dem er nie begegnet war. „Das tut mir leid“, brachte er nur hervor, ohne sich seine Bestürzung anmerken zu lassen.
Er stand noch immer hinter ihr, während sie wieder geradeaus starrte, das Glas nach wie vor zwischen den Händen wie einen rettenden Halt. Sie schwiegen beide.
„Eine Krankheit?“, fragte er endlich und ahnte, dass die Antwort Nein sein würde.
Xenia schüttelte mit einer langsamen und kaum sichtbaren Bewegung den Kopf, ohne Alexander anzusehen.
Er erklomm den Barhocker neben ihr, bestellte bei dem mit einem roten Bauernkittel verkleideten Barkeeper ein Pils, überlegte es sich dann aber anders. Die Zeit, die ihm blieb, würde nicht einmal reichen, um ein brauchbares Bier zu zapfen.
Er wartete, ob Xenia noch mehr erzählte, aber sie schwieg. Stumm und reglos wie eine Schaufensterpuppe saß sie neben ihm, als hätte sie seine Anwesenheit längst vergessen. Der bäuerliche Barkeeper mit dem Gesicht und den Haaren eines eleganten Südeuropäers war in ihrer Nähe stehen geblieben und sah Xenia mit unverhohlener Neugierde an.
Alexander schluckte die böse Bemerkung hinunter, die ihm auf der Zunge lag.
„Ein Unfall?“, fragte er leise.
Wieder eine kaum merkliche Bewegung des Kopfes, dieses Mal ein Nicken.
Als Xenia das Glas zum Mund führte, zitterte ihre Hand so heftig, dass sie etwas von der Flüssigkeit verschüttete. Sie stellte das Glas ab, ohne zu trinken. „Ein Flugzeugabsturz.“
Sie sprach weiter, ehe Alexander noch ein Wort des Bedauerns oder Entsetzens gefunden hatte. Es klang abgehackt und atemlos wie bei einer großen Anstrengung. „Er war auf dem Flug von seiner Farm in der Provinz Corrientes nach Córdoba. Kurz nach dem Start passierte es.“ Für einen Augenblick hielt sie inne. „Mein Vater war mit dem Piloten allein in der Maschine. Sie verlor plötzlich immer mehr an Höhe und ist dann fast senkrecht vom Himmel gefallen.“ Xenias Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. „Sie ist aufgeschlagen wie ein Stein.“
„Und die Ursache?“
„Ist noch nicht bekannt.“
Sie kramte in ihrer Handtasche, fand ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug und legte beides mit zitternden Händen auf die Theke.
„Sie dürfen hier nicht rauchen.“
Xenia blickte erst auf den roten Kittel mit den bunten Borten, fand schließlich darüber das Gesicht und sah es an, als verstünde sie die Worte nicht. Sie zog eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie in den Mund, ohne sie anzuzünden, und sog daran. Im Edelweiß-Shop nebenan drängelte sich eine Gruppe Japaner. Ein Kuckuck rief aus einer Uhr, ein zweiter fiel ein, wurde übertönt vom Muhen einer Kuh und dem Klang eines Alphorns. Aus dem Lautsprecher der Bar erklang leise die Stimme von Dean Martin: „You’re nobody till somebody loves you …“
Alexander suchte mit den Augen nach einer Uhr. Er fand keine, aber sein Blick kreuzte sich mit dem eines Mannes vor der künstlichen Felswand. Der Mann war ungewöhnlich groß. Er trug einen eleganten dunkelgrauen Mantel und darüber einen langen hellgrauen Schal, den er kunstvoll gebunden hatte. Über seiner rechten Schulter hing an einem schmalen Riemen eine kleine Herrentasche: Thorsten Schneider, einer der Kollegen, die auf dem besten Wege waren, ihre Erfahrung mit einer eigenen Firma zu Geld zu machen. Alexander wusste nicht, wie lange er schon zu ihnen herübergestarrt hatte. Schneider grüßte mit einem kurzen Nicken und ging rasch weiter.
Es war schon das zweite Mal, dass der ihn mit Xenia antraf. Ob sich Schneider noch daran erinnerte, wie er mit ihr Wochen vor dieser Begegnung auf einer Bank im Stadtgarten gesessen hatte?
Xenia schien ihn gar nicht zu bemerken. Die Tränen in ihren Augen waren zu kleinen Seen geworden, die plötzlich über die Ufer traten und über ihre Wangen liefen.
„Ich habe Angst.“ Sie sagte das so leise, dass er sich nicht sicher war, ob er sie richtig verstanden hatte.
„Angst?“
Sie fuhr mit dem Handrücken über ihr Gesicht, verwischte die Tränen, ohne sie zu trocknen, und schwieg.
Alexander griff nach ihrer Hand. „Wovor hast du Angst?“
Er bekam keine Antwort.
Er gab seiner Stimme den mitfühlenden Klang, den man Kindern gegenüber anschlägt, denen etwas Böses widerfahren ist. „Wovor hast du Angst?“, fragte er noch einmal.
Sie schüttelte wortlos den Kopf, und er dachte an das, was er über ihren Vater wusste.
„Hast du Angst, weil dein Vater Dinge erfahren hatte, die ihm gefährlich werden konnten? Hast du Angst, dass er deswegen sterben musste?“
Sie sah geradeaus. Nicht die kleinste Spur einer Antwort, nicht einmal ein Kopfschütteln oder Nicken, als wäre sie plötzlich zu einer Statue erstarrt.
„Hast du Angst um dich?“
Xenia rührte sich nicht.
Ich habe Angst: Einmal mehr gab sie ihm ein Rätsel auf, ohne es zu lösen. Bei allem Mitleid und aller Sorge, die er angesichts des Todes ihres Vaters empfand, flammte plötzlich Zorn in ihm auf. Nein, die Trauer hatte sie nicht verändert. Sie war, wie sie immer gewesen war: rätselhaft. Nicht nur das. Rätselhaft abweisend war sie.
Ein allerletzter Versuch, dachte er. „Kann ich dir irgendwie helfen?“
Xenia verharrte reglos, wie tot, wenn da nicht das Zittern ihrer Hände gewesen wäre.
Die Frau, die hier saß, war ihm fremd geworden und schien alles, was ihn einmal mit ihr verbunden hatte, auslöschen zu wollen. Er stellte noch ein paar Fragen zu dem Unglück, aber sie hatte offenbar nicht die Absicht, mehr über den Tod des Vaters oder über ihre Angst preiszugeben.
„Wie lange bleibst du fort?“
Endlich antwortete sie. „Fünf Tage.“
Xenia hatte ihm nicht viel über ihre Familie erzählt, nur dass sie elternlos aufgewachsen war, das verband ihr Schicksal mit seinem: Er selbst war acht Jahre alt gewesen, als er seine Eltern bei einem Verkehrsunfall verlor. Xenias Mutter hatte ein Biologie- und Germanistikstudium abgebrochen, um ihre Tochter ohne den Erzeuger großzuziehen, den sie kaum gekannt hatte. Sie starb, als sie bei einem Horrortrip unter LSD vor ein Auto lief. Xenia war damals vier Jahre alt. Eine Freundin der Toten nahm Xenia zu sich.
Es gab noch eine Halbschwester, ein Jahr jünger als Xenia. Despina war das einzige Kind aus der kurzen Ehe von Xenias Vater. Auch Despinas Mutter starb früh – es war von einer Krebserkrankung die Rede gewesen. Despina wuchs bei einer Großtante auf. Nach dem Tod von Despinas Mutter war der Vater nach Argentinien gegangen und hatte am Rande der Gran-Chaco-Region neben einem subtropischen Schwemmgebiet des Río Paraná große Ländereien gekauft. Xenia und ihre Halbschwester waren noch Kinder gewesen, als er Deutschland verließ. Vor zwei oder drei Jahren war Despina dann ihrem Vater in dessen Wahlheimat gefolgt, doch wo Despina die Zeichen der Zeit sah – Eukalyptusplantagen für Zellulose und Sojaanbau im großen Stil mit gentechnisch veränderten Pflanzen –, da prangerte der Vater Verbrechen an den Ärmsten der einheimischen Bevölkerung und der Natur an.
Nun also war auch der Mann tot, von dem Xenia zu seiner Verwunderung voller Verehrung als ihrem Vater gesprochen hatte. Und das, obwohl der sich jahrelang gesträubt hatte, sie als sein Kind anzuerkennen. Xenia hatte ihn kaum gekannt, bis er sie im Kampf gegen den Einfluss der mächtigen Agrarkonzerne zu seiner Verbündeten machte.
„Der Passagier Alexander Kilian, abfliegend nach London, wird dringend gebeten, zum Ausgang E 43 zu kommen.“ Gleich darauf die Ansage auf Englisch: „Passenger Alexander Kilian …“ Die fünf Minuten, die er hatte bleiben wollen, mussten längst vorbei sein.
„Entschuldige, ich muss gehen.“
Er erhob sich ein wenig zu hastig und strich ihr mit einer unsicheren Bewegung über das Haar. Wie ein Onkel, dachte er, wie ein Onkel, der seiner kleinen Nichte pflichtschuldig über das Haar streicht.
„Ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommen wird.“
„Was meinst du damit?“
Jetzt schwieg Xenia wieder. Sie schüttelte nur den Kopf, und er wusste nicht, ob sie gehört hatte, dass der Aufruf ihm gegolten hatte.
„Entschuldige, aber ich muss gehen“, sagte er noch einmal und eilte davon.
Zwanzig Minuten bis Gate E! Das Schild sah er jetzt zum ersten Mal. Zwanzig Minuten! Das hätte man ihm doch sagen müssen! Nicht sein chronisch schlechtes Zeitgefühl war schuld, wenn er zu spät kam, sondern die Dame am Check-in. Bis er Gate E erreicht hätte, wäre der Flieger längst gestartet. Drei, vier Schritte lief er schneller, ein unüberlegter Reflex, dann verlangsamte er sein Tempo. Dem Schicksal seinen Lauf lassen, dachte er, langsam weitergehen, ganz langsam, nicht ankommen, bis die Maschine abgehoben hat. Zu Xenia zurückkehren, sie trösten. Keine Fragen stellen, sie einfach nur in den Arm nehmen. Vielleicht würde sie dann über ihre Angst sprechen. Und sein Koffer im Flugzeug? – Egal. Der Kongress? Der würde auch ohne ihn stattfinden. Sein Vortrag? Sein wichtiger Beitrag zu diesem internationalen Symposium über die sensationelle Entdeckung eines lebensverlängernden Gens in einem Fadenwurm? Er ging wieder schneller. Noch fünfzehn Minuten bis zum Ziel, signalisierte ihm ein Schild.
„Passenger Alexander Kilian, Passenger Alexander Kilian …“
In seiner Eile musste er irgendwo den falschen Weg genommen haben, er las nur noch Hinweise auf Gate A und B. Er lief ein Stück zurück, fand eine Rolltreppe in die Tiefe, die er vorher verfehlt haben musste, noch eine zweite – immerhin war er hier richtig, auch wenn sein Weg in den Keller führte – dann Gleise vor ihm, ein Zug, in den er einstieg, was hätte er sonst tun sollen? Er war nicht der einzige Fahrgast, das beruhigte ihn. Wenig später fuhr der Zug los – begleitet vom Muhen einer Kuh und dem Klang eines Alphorns – und war gleich darauf auch schon am Ziel.
„Letzter und dringender Aufruf. Passagier Alexander Kilian …“. Ein paar Minuten später erreichte er die Flugsteige mit dem Buchstaben E. Eine große Halle und darin, er hielt es kaum noch für möglich, Gate E 43. Doch hier war niemand mehr. Gähnende Leere. Da draußen stand sein Flugzeug, keine fünfzig Meter von ihm entfernt. Mit seinem Koffer. Sogar der unförmige Rüssel mit der Gangway, der die mittlere Tür des Flugzeugs mit dem Gebäude verband, war noch nicht zurückgezogen. Doch der Zugang war versperrt. Zu spät, und auch für Xenia war es zu spät. Er würde sie nicht mehr finden.
Und jetzt? Vor Wut schreien? Oder mit dem Fuß aufstampfen?
„Herr Kilian?“ Er hatte die Dame nicht kommen sehen. Sie schien nicht einmal richtig böse zu sein. Er murmelte eine Entschuldigung und zeigte ihr seine Bordkarte. Dann stürmte er zum Flugzeug und an den vorwurfsvollen Blicken der anderen Passagiere vorbei auf seinen Platz in der Business Class. Minuten später versank unter ihm das wintergraue Zürich im Wolkenmeer.
Er schloss die Augen. Xenia! Woher kam ihre lähmende Angst? Wovor fürchtete sie sich? Vor dem Flug, weil das Flugzeug ihres Vaters abgestürzt war? Vor José Bustelo und der Auseinandersetzung mit der Saatgutfirma Argigen, in die sich ihr Vater verstrickt hatte? Fürchtete sie Bustelos Rache? Oder war es etwas ganz anderes, wovon er nichts wusste?
„Nach dieser zufälligen Begegnung am Flughafen haben Sie Frau Elytis nicht mehr gesehen?“
Der Professor erschrak. Er brauchte eine Weile, um seine Gedanken in die Gegenwart und zum Kommissar zurückzuholen.
„Nein, weder gesprochen noch gesehen, bis zu dem Augenblick, als ich sie hier gefunden habe.“
Der Kommissar sah ihn unverwandt an. Seine Augen schlossen sich etwas, aber das Lauernde, das Alexander darin zu entdecken glaubte, blieb. Alexander hielt dem Blick stand, doch er fühlte sich plötzlich so schwach wie vor dem Ausbruch einer schweren Krankheit. Seine Antwort war eine Lüge.
Es war so ein Tag gewesen, an dem er schon am Morgen wusste, dass etwas passieren würde. Etwas Unangenehmes, vielleicht sogar etwas Fürchterliches. Seit vier Tagen sollte Xenia aus Argentinien zurück sein, aber er hatte nichts von ihr gehört. Ihr Schweigen, das er sich nicht erklären konnte, und ihr ausgeschaltetes Handy hatten ihn beunruhigt. Vier Tage nur, aber sie kamen ihm vor wie eine Ewigkeit.
Früher als gewöhnlich hatte er an diesem Tag das Institut verlassen. Er wollte vor Einbruch der Dunkelheit in Neuf Brisach sein, wo Xenia seit ein paar Wochen wohnte, ohne dort gemeldet zu sein. Aus Furcht vor einer finsteren, angeblich riesenhaften Gestalt, von der sie sich verfolgt gefühlt hatte, solange sie noch in Lehen wohnte.
Als er bei Breisach den Rhein überquerte, lag das französische Ufer trostlos im Dezembergrau vor ihm, und statt Bäumen ragte der gewohnte Wald aus hässlichen Hochspannungsmasten in den wolkenverhangenen Himmel. Ein paar Minuten später fuhr er zwischen den äußeren Wallanlagen auf die hoch aufragende Stadtmauer aus roten Sandsteinquadern zu. Als achteckiger Stern umgab sie seit drei Jahrhunderten die alte Festungsstadt wie eine chinesische Mauer, deren Mauerkrone unter Gras und Gestrüpp verschwunden war.
Alexander überwand das alte Bollwerk an der Porte de Bâle, die längst zu einem breiten Durchlass geworden war, und parkte seinen Wagen auf einem mit Schlaglöchern übersäten Parkplatz. Er ging ein Stück zwischen den Häusern und dem Wall entlang, dessen Krone sich mit der Stadtmauer vereinigte, kehrte wieder um, war sich in der Dämmerung nicht mehr sicher, was den Weg betraf, und ging dann doch wieder in die erste Richtung. Hier hinter dem inneren Wall duckten sich die niedrigen Häuser: ehemalige Pferdeställe, Kasernen und was das Militär sonst noch brauchte, auch Bürgerhäuser, alles einander ähnlich, aber wie ausgestorben. Von vielen Fassaden blätterte die Farbe und bröckelte der Putz. Ärmliches, verlassenes Weltkulturerbe, geradezu gespenstisch. Kein Mensch war an diesem Tag auf der Straße, nur ein paar Autos fuhren.
Er folgte immer weiter dem Weg am Wall, der hier wie ein hoher Bahndamm hintern den Häusern emporragte, und stieß schließlich auf das alte verfallene Haus, in dem Xenia nun wohnte. Es war eines der wenigen höheren Häuser, eine ehemalige Kaserne vielleicht. Die schiefen, einst grünen Fensterläden waren überall geschlossen, und auch dort, wo Latten fehlten, drang kein Licht in die Dämmerung. Klingelschilder gab es nicht, nur die Reklametafel eines Architekten hing an einem der mit verwittertem Sandstein eingefassten Fenster. Von der auf dem Schild angekündigten Sanierung sah man noch nichts. Im Treppenhaus war eine Fensterscheibe eingeschlagen und auf der Wetterseite des Hauses der Putz vom Backsteinmauerwerk abgefallen. Als er vor ein paar Wochen zum ersten Mal hier war, hatte noch eine albanische Familie im ersten Stock gehaust. Jetzt schien Xenia die einzige Bewohnerin zu sein.
Er bediente den Klingelknopf, der nach seiner Erinnerung zu Xenias Wohnung gehörte, dann den daneben, versuchte einen Knopf nach dem andern, aber alles blieb totenstill und dunkel. Das Haus schien völlig menschenleer zu sein. Er drückte gegen die Haustür, die so grün und verrottet war wie die Fensterläden. Sie öffnete sich knarrend und gab den Weg frei.
Im Flur hing der Geruch von Nässe und Moder, und auch heute funktionierte das Licht nicht. Nur eine Straßenlaterne tauchte das Treppenhaus in mattgraues Licht.
Vorsichtig tastete er sich die Stufen empor, die unter seinem Gewicht beängstigend knackten. Im zweiten Stock drückte er auf den Klingelknopf neben Xenias Wohnungstür. Er lauschte auf das hässliche Scheppern der Klingel, aber nichts rührte sich, bis auf sein Herz, das immer heftiger schlug. Er klingelte noch einmal, wartete. Stille. Ob Xenia gar nicht aus Argentinien zurückgekehrt war? Oder ob ihr hier etwas zugestoßen war, allein in diesem verwahrlosten Haus? Meldete sie sich nicht mehr, weil sie sich nicht mehr melden konnte? Plötzlich hatte er Angst um sie. Er hatte sich schon damals Sorgen gemacht, als er zum ersten Mal dieses schreckliche Haus betreten hatte.
„Unsinn“, sagte er laut. Xenia öffnete nicht, weil sie aus irgendeinem alltäglichen Grund nicht zu Hause war.
Als er sich wieder zur Treppe zurücktastete, glaubte er, Stimmen zu vernehmen. Oder war es nur das Knarren der Dielen gewesen? Er kehrte um, klingelte noch einmal. Nichts war zu hören. Er bückte sich zum Briefkastenschlitz, hob die Klappe und spähte in die Wohnung. Erst dachte er, der schwache Lichtschein, den er im Flur zu erkennen glaubte, müsse eine Täuschung sein. Aber nein. Unter einer schiefen Tür leuchtete ein schmales Lichtband.
„Xenia!“ Er lauschte, rief noch einmal. Kein Lebenszeichen. Die Wohnungstür war verschlossen. Und wenn Xenia nicht öffnete, weil sie nicht allein war? Das Fenster des Zimmers, aus dem das Licht in den Flur drang, musste zum Wall hinüberweisen.
Viel schneller, als er sich im schwachen Licht die Stufen hinaufgetastet hatte, stolperte er sie jetzt hinunter. Unten versuchte er, von der Rückseite des Hauses einen Blick auf Xenias Wohnung zu werfen, doch ein halb zerfallener Bretterzaun versperrte den Durchgang am Wall entlang. Trotzdem glaubte er im zweiten Stock einen Lichtschein hinter einem der Fenster zu erkennen. Neben dem Haus war der Wall mit undurchdringlichem Gestrüpp bewachsen. Hier kam er nicht hinauf. Er lief weiter und fand nach hundert Metern eine schmale, halb vom Erdreich verschüttete Steintreppe, die zu einem schweren, verrosteten Stahltor in einem aus groben Steinen gemauerten Abschnitt im Wall führte. Ein Bunker? Ein Munitionsdepot? Oder Kasematten? Solche Gemäuer mit Stahltoren gab es hier überall. Der Wall schien durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Auf einer mit Unrat bedeckten Trittspur kletterte er noch höher hinauf, bis er die Krone des Walls erreicht hatte. Sie war viel schmaler, als er von unten gedacht hatte. Zwei oder drei Meter hinter ihm war die fast senkrechte Mauer, viele Meter tiefer ein menschenleerer Fußweg, dahinter der nächste Wall und noch ein weiterer, in der rasch hereinbrechenden Dunkelheit kaum zu erkennen. Er kam nur langsam voran. Er stolperte über Brombeerranken, die tiefe Kuhlen überwucherten, und über Betondeckel, die irgendetwas verdeckten, was sich unter ihm im Wall verbarg.
Das Haus, in dem Xenia wohnte, war wegen seiner Höhe nicht mit anderen zu verwechseln. Hier oben war er fast auf derselben Höhe wie die Fenster von Xenias Wohnung, und für jemanden, der von dort herübersah, musste sich seine Silhouette wie ein Scherenschnitt vor dem dunkler werdenden Himmel abzeichnen. Alexander verbarg sich hinter dem Stamm eines wilden Kirschbaums, ohne recht zu wissen, vor wem er sich versteckte, und sah hinüber. Nur einen Steinwurf entfernt war ein Fenster in Xenias Wohnung erleuchtet.
Bei dem Fenster, hinter dem das Licht brannte, fehlten auf einer Seite am Fensterladen zwei Latten. Durch die Lücke erkannte er Xenias Schlafzimmer. Alexander hielt den Atem an. Eine Gestalt bewegte sich in dem Raum, vielleicht Xenia, vielleicht jemand anders. Er sah nur einen Ausschnitt, den Querstreifen eines Menschen von den Schultern bis zu der Höhe, auf der bei einer Frau die Brüste beginnen würden. Es war eine Frau, dessen war er sich sicher, auch wenn er nichts erkennen konnte, was typisch weiblich war. Xenia! Er atmete auf. Das musste Xenia sein. Sie schien es eilig zu haben. Jede ihrer Bewegungen war heftig und ungeduldig. Offensichtlich suchte sie etwas. Aber sie war nicht allein! Der andere Streifen eines Menschen hinter der Lücke im Fensterladen gehörte zu einem Mann. Er schien nicht größer als Xenia zu sein, aber viel breiter. Oder war es ein großes, dickes Kind? Nein, es war ein Mann und wohl der Grund dafür, dass Xenia nicht geöffnet hatte. Alexander wandte den Blick ab. Und jetzt? Verschwinden? Oder als Spanner hinter einem Kirschbaum lauern und beobachten, was die beiden in Xenias Schlafzimmer trieben? Eines war sicher: Der Mann in Xenias Wohnung war nicht die geheimnisvolle Gestalt, vor der sich Xenia in Neuf Brisach verkrochen hatte. Diese Gestalt war weder dick noch klein gewesen.
Er blickte wieder hinüber, sah eine Hand, die sich nach Xenia ausstreckte, einen Arm. Er hätte besser wegsehen sollen! Gleich würde er wegsehen! Der Mann kam nun wieder weiter ins Blickfeld, er griff nach Xenias Schulter, hielt sie fest. Was Alexander dann sah, geschah ganz langsam, fast wie in Zeitlupe. Der Mann zog Xenia, die sich sträubte, dichter an sich heran, dann schlug er zu. Es war kein wütender Schlag, sondern er schlug wie jemand, der weiß, was er tut. Xenia duckte sich vor dem nächsten Angriff, und für einen Augenblick erblickte er einen Ausschnitt von ihrem Gesicht. Dann sah er nur noch einen Streifen ihres Rückens vor dem Fenster und daneben den Mann, der näher kam, vielleicht um sie zu schlagen, vielleicht um sie zu würgen, jedenfalls um ihr irgendwie Gewalt anzutun.
Alexanders Herz raste. Es war furchtbar, als tatenloser Zuschauer diesem lautlosen Kampf zuzusehen, und er stürzte davon. Er wusste nicht, wie lange er oben auf dem unwegsamen Wall bleiben musste, bis er zur Trittspur kam, die abwärts zum verrosteten Stahltor im Mauerwerk führte, und von dort hinunter auf den Weg. Er kam nur langsam voran. Hier oben musste er vorsichtig sein. Ein Sturz von der Mauer auf der Außenseite des Walles konnte tödlich sein. Er fand den Pfad abwärts nicht mehr, viel zu lange kämpfte er sich schon durch das unwegsame Gelände. Plötzlich endete vor ihm der Wall in einer senkrechten Mauer, tief unter ihm eine gepflasterte Straße, die in die Stadt hineinführte. Hier gab es keine Möglichkeit hinunterzukommen. Er musste umkehren. Ohne Weg kämpfte er sich abwärts durch das Gestrüpp, das ihm vorhin undurchdringlich erschienen war, kam tatsächlich zu dem rätselhaften Tor, fand die halb verschüttete Treppe zum Fahrweg und rannte das letzte Stück zu dem verfallenen Haus.
Hätte er Lauer nicht doch von dieser Beobachtung erzählen müssen? Der Mann in Xenias Wohnung hatte ihr Gewalt angetan, und vielleicht war er selbst der einzige Mitwisser des Angriffs. Nein, er konnte nichts tun, ohne selbst in den Abgrund zu stürzen, den aufzutun Xenia ihn verleitet hatte. Was geschehen war, konnte kein Geständnis der Welt wieder rückgängig machen.
Als er damals endlich wieder vor Xenias Haus gestanden hatte, war es von dieser Seite so finster wie zuvor. Totenstille, wie in einer Geisterstadt. Kein Mensch. Kein Licht in den Häusern. Doch, es gab Menschen. Er hörte ein Auto. Der Wagen fuhr in Richtung der Porte de Bâle, vielleicht zu dem Parkplatz, auf dem sein eigener Wagen stand, und hielt direkt auf ihn zu. Erst im letzten Moment schien ihn der Fahrer zu bemerken, denn er bremste scharf und stoppte neben ihm. Es war ein dunkelhaariger Mann – Südeuropäer oder Araber vielleicht – mit rundem Gesicht und kurzem Hals. Für den Bruchteil einer Sekunde schienen sich in der Dunkelheit ihre Blicke zu begegnen, dann flammte ein Suchscheinwerfer auf dem Armaturenbrett auf und blendete ihn. Ohne Licht fuhr der Wagen mit viel zu hoher Geschwindigkeit davon. Nur für einen Augenblick hatte Alexander im Licht der Straßenlaterne gesehen, dass der Fahrer nicht allein war. Auf dem Rücksitz saß eine Frau, von der er nichts sah als eine gerade Nase und ein Tuch, das einen Teil ihrer vollen dunklen Haare verdeckte. Aus irgendeinem Grund erinnerte sie ihn an Jackie Kennedy, vielleicht an ein Foto, auf dem diese so halb verborgen unter einem schwarzen Tuch auf dem Polster einer dunklen Limousine gesessen hatte. Konnte das jetzt Xenia gewesen sein? Nein. Sicher nicht.
Alexander wartete einen Augenblick, dann drückte er wieder die Haustür auf und tastete sich die Treppen empor. Zehn oder fünfzehn Minuten mochten vergangen sein, seit er seinen Platz hinter dem Kirschbaum auf dem Wall verlassen hatte. Oben an Xenias Wohnung ließ er noch einmal die Türglocke scheppern, dann stieß er gegen die Tür. Zu seiner Überraschung war sie nur angelehnt, und er erschrak, als sie fast ohne Widerstand aufsprang. Er trat rasch ein und zog die Tür hinter sich zu. Im Wohnungsflur war es so dunkel, dass er nichts erkennen konnte. Er rief ein paarmal Xenias Namen. Als sich nichts rührte, tastete er nach dem Lichtschalter: ein Lichtblitz, ein dumpfer Knall, dann wieder Finsternis.
Das schmale Lichtband, das durch die Schlafzimmertür fiel, wurde plötzlich breiter. Alexander erstarrte. Eine getigerte Katze zwängte sich durch den Türspalt und strich ihm laut und klagend um die Beine. Er war auf das Schlimmste gefasst, als er die Tür weiter öffnete. Eine nackte Glühbirne leuchtete unter der Decke, aber auf den ersten Blick war der Raum leer. Ebenso auf den zweiten.
Er verließ das Zimmer wieder, betrat den kahlen Raum, der das Wohnzimmer hätte sein sollen und in dem nur ein paar Kissen auf den staubigen Dielen lagen. Der stinkende Ölofen hinter der Tür war warm. Er ging in die Küche. Die Katze begleitete ihn, miauend und mit verdrehtem Kopf, um ihn keinen Moment aus den Augen zu verlieren. Auch in der Küche war niemand. Ein Bad gab es nicht, eine Toilette nur auf halber Treppe im Treppenhaus. Allmählich schwand Alexanders Furcht, in Xenias Wohnung auf etwas Entsetzliches zu stoßen. Nur ein Zimmer hatte er noch nicht betreten. Er drückte auf die Klinke, stieß die Tür auf und drückte auf den Lichtschalter. Der Raum blieb dunkel. In der Küche fand er Streichhölzer und eine Kerze. Aber auch der letzte Raum war leer.
Alexander kehrte in Xenias Schlafzimmer zurück. Die Spuren der Auseinandersetzung waren unübersehbar. Vor einem abgestoßenen Tisch, auf dem sonst Xenias Laptop stand, war der Stuhl umgestürzt, und auf dem Boden waren Wäsche und Papiere verstreut. Er hob die Schriftstücke auf: Unterlagen von der Krankenkasse, Rechnungen, Urkunden, Zeugnisse – auch das von Xenias medizinischem Staatsexamen war darunter –, ausgedruckte Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Auszüge eines überzogenen Kontos, eine Stromrechnung für ihre Wohnung in Lehen. Xenias Laptop lag zugeklappt auf der Matratze, die sie als Bett benutzte.
Alexander richtete sich auf. Irgendetwas hatte ihn irritiert. Er hielt den Atem an und lauschte. Ein Luftzug! Irgendwo musste eine Tür geöffnet worden sein, und jetzt zog es durch die undichten Fenster. Plötzlich spürte er eine Bewegung direkt hinter sich. Er fuhr herum. Es war die Tür, die sich langsam öffnete.
In der Tür stand Xenia.
Alexander fasste sich schnell. „Wo kommst du denn her?“
„Von der Toilette“, sagte sie, und er merkte an ihrer Stimme, wie überrascht sie war, ihn hier zu sehen. Sie war bleich, und die Schatten unter ihren Augen waren dunkler als sonst. Offenbar hatte sie geweint.
„Und was tust du hier in meiner Wohnung?“ In Xenias Stimme war plötzlich eine Schärfe, die er noch nie bei ihr gehört hatte.
„Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich dich seit Tagen nicht erreichen konnte.“
Sie starrte ihn an, eine Rachegöttin, schön und bedrohlich gleichermaßen. „Das ist kein Grund, hier heimlich einzudringen.“
Alexander machte einen Schritt auf sie zu. „Was wollte der Mann von dir?“
„Welcher Mann? Hier ist kein Mann.“
„Und das hier?“ Er zeigte auf die Unordnung im Zimmer.
„Ich habe etwas gesucht und war in Eile.“
Er sah sie nur an. Ihr zu sagen, dass er vom Wall aus in ihr Schlafzimmer geblickt hatte, war unmöglich. Er fragte auch nichts weiter. Irgendetwas beunruhigte Xenia. Er sah es an ihrem unsteten Blick. Fürchtete sie, dass der Dunkelhaarige zurückkommen würde? Alexander folgte mit seinen Augen ihrem Blick, der zu der Unordnung vor dem Schrank wanderte, dann zum Schreibtisch, aber er konnte nichts entdecken, was ihre Augen suchen mochten. Oder doch? Was waren das für vier flache Päckchen, die dort lagen und die er vorhin übersehen hatte?
Xenia bemerkte, woran sein Blick hängen geblieben war. „Bitte geh!“, sagte sie mit einer Entschlossenheit, die keinen Widerspruch duldete.
Alexander öffnete den Mund, um etwas zu sagen.
„Geh sofort!“
„Verstehst du denn nicht, dass ich mir Sorgen …“
„Ich will nichts verstehen.“
Er wandte sich wortlos zur Tür und trat in den dunkeln Flur. Plötzlich war Xenia dicht hinter ihm, und als er sich noch einmal umdrehte, schlang sie ihre Arme um seinen Hals, presste ihren Körper heftig an seinen und küsste ihn so überraschend, wie sie es Wochen zuvor am Schlossberg getan hatte. Dann ließ sie ihn abrupt los und kehrte in ihr verwüstetes Schlafzimmer zurück.
Mit hängenden Armen blieb Alexander im Flur zurück. Warum dieser heftige Kuss? Wollte Xenia ihn beschwichtigen, nachdem sie so abweisend gewesen war? Wollte sie ihn verrückt machen? Wollte sie mit ihm schlafen? Jetzt? – Nein. Letzteres bestimmt nicht. Dafür hätte sie ihn nicht allein im dunklen Flur stehen lassen. Xenia, die Schlange. Er tastete sich zur Wohnungstür, ging hinaus und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Lauter, als er es gewollt hatte.
Zehn Minuten später überquerte Alexander wieder den Rhein. Hinter der letzten Brücke hielt er an. Er brauchte Abstand zu dem, was gerade geschehen war, am besten einen Kaffee irgendwo, wo niemand mit ihm redete. Da war ihm McDonald’s gerade recht. Er reihte sich hinter einer französischen Großfamilie ein und bestellte einen großen Kaffee. Als die braune Brühe im Pappbecher nach fünf Minuten immer noch zu heiß war, ließ er den Becher stehen und fuhr weiter.
Nein, er würde nicht mit dem Kommissar darüber sprechen, was er an jenem trüben Dezembertag in Neuf Brisach gesehen hatte.
Es klopfte, ein uniformierter Polizist erschien in der Tür.
„Herr Lauer?“
Alexander atmete auf. Offenbar wurde der Kommissar, der tatsächlich Lauer hieß, anderweitig gebraucht. Alexander sah dem Beamten nach, wie er den Raum verließ und die Tür hinter sich schloss, machte aber keine Anstalten aufzustehen. Er bohrte wieder die Ellenbogen in die Arbeitsplatte und versenkte den Kopf zwischen seinen Händen. Xenia ist tot, dachte er. Drei Worte, er konnte sie denken, er konnte sie aussprechen, er hätte sie schreiben können, aber sie zu begreifen, davon war er weit entfernt. Ganz langsam kroch das Entsetzen deutlicher in sein Bewusstsein. Xenia war tot.
War es erst gestern gewesen, dass ihm Xenia eine SMS geschickt hatte, die genauso knapp war, wie die, mit der sie ihn heute ins Institut gelotst hatte? Nein, vorgestern war das, zwei Tage nach dem bedrückenden Zusammentreffen in Neuf Brisach und sechs Tage nach ihrer Rückkehr aus Argentinien. „Bitte komm um 18 Uhr ins Kagan. Ich habe etwas für dich. Es ist sehr wichtig. Xenia.“
Das war alles gewesen. Zur selben Zeit hatte Alexander bei Ina und ihrer gemeinsamen Tochter Corinna sein wollen. Er redete sich ein, keine andere Wahl zu haben, und entschied sich für Xenia. Ina vertröstete er mit einer Ausrede auf acht Uhr und ging frierend und irritiert quer durch die Altstadt zu dem gläsernen Hochhaus, das neben dem Bahnhof wie ein deplatziertes Gebäude aus einer anderen Stadt in den Freiburger Himmel ragte.
Als er den Colombipark erreichte, hörte er irgendwo hinter sich eine Kirchturmglocke schlagen. Es war genau 18 Uhr. Jetzt sah er das schummerige Licht oben in dem gläsernen Turm. Bislang hatte er einen großen Bogen um das Café und die Bar gemacht, in der sich abends die Möchtegern-Schickeria von Freiburg versammelte, jetzt ließ ihn der Gedanke, dass Xenia dort oben auf ihn wartete, unwillkürlich schneller gehen. Er spürte sein Herz heftiger schlagen mit jedem Meter, den er dem Hochhaus näher kam, aber statt Freude beherrschten ihn eine dunkle Furcht und die Erwartung eines Unglücks, von dem er noch nichts wusste. Genau um 18.04 Uhr stieg er in den Fahrstuhl, der ihn fast ohne Ruck gespenstisch schnell ins siebzehnte Stockwerk brachte.
Er trat in das Café und hatte das Gefühl, wieder im Freien zu stehen: raumhohe Glaswände und dahinter ein Ausblick wie beim Landeanflug auf eine fremde Stadt, Freiburg zu seinen Füßen, ein Lichtermeer, geradezu großstädtisch anzusehen, Autos in Zweierreihen auf der Bismarckallee, Geschäftshäuser mit Leuchtreklame, hell erleuchtete Straßen, die sich in der Ferne verloren. Alles lag tief unter ihm, sogar die im Licht von Scheinwerfern erstrahlende Herz-Jesu-Kirche im Stühlinger jenseits der Bahngleise war in die Tiefe gesunken, allein der Münsterturm ragte noch höher in den dunklen Himmel als das Hochhaus.
Xenia war nicht da, er sah es sofort, als er seinen Blick über die cremefarbenen Ledersessel gleiten ließ. Außer den beiden dunkel gekleideten Männern hinter der Bar hielten sich fünf Menschen in dem großen Raum auf: ein jüngeres Pärchen hinter einem aufgeklappten Laptop und drei Frauen im selben fortgeschrittenen Alter wie er, die in diesem Augenblick die Rechnung verlangten. Die hohen Schemel an der Bar waren leer. Er kannte hier niemanden, und doch wandten sich ihm bei seinem Eintreten alle Gesichter zu wie von unsichtbaren Fäden bewegt. Er fühlte sich unwohl in dem übersichtlichen Lokal und setzte sich mit dem Rücken zum Raum und dem Blick zur Glaswand. Er wollte nicht erkannt werden, wenn das nicht schon längst der Fall war. Als er sich nach wenigen Augenblicken umdrehte, wurde ihm bewusst, dass er von seinem Platz aus die Tür nicht im Blick hatte.
Er bestellte einen Kagan Caipino, einfach, weil ihm der Name gefiel. Es war ein Cocktail mit Blue Curaçao, den hatte er noch nie getrunken, und „mit Limetten“ klang verheißungsvoll. Dann starrte er auf die blauen Flaschen über der Bar, ließ nach angemessen langer Zeit seinen Blick weiter auf die chromglänzende Säule neben sich und von dort auf die großen Ventilatoren an der Decke schweifen, die sich am Stillstand im Raum beteiligten.
Ein Mann in Schwarz brachte ihm den blauen Cocktail. Alexander beschloss, ihn erst anzurühren, wenn Xenia da war.
Sechzig Meter unter ihm, bei der Straßenbahnbrücke, schaltete eine Ampel auf Rot, dann auf Grün und wieder auf Rot. Alexander atmete tief ein und versuchte sich einzureden, dass sich Xenia nur ein wenig verspätete. Das Gedudel von der Bar machte ihn verrückt. Er sah sich nicht mehr um. Er tat einfach so, als würde er gar nicht warten. Das musste doch die Chance erhöhen, dass Xenia plötzlich hinter ihm stand!
Die Ampel schaltete auf Rot, schaltete auf Grün. Xenia stand nicht hinter ihm. Zehn Mal wollte er die rote Phase noch abwarten, dann sollte endgültig Schluss sein mit dem Warten. Sieben Mal rot … Hinter sich hörte er eine leise Frauenstimme, die nicht der Frau gehörte, die mit ihrem Laptop beschäftigt war. Nun sah er sich doch um, aber es war nicht Xenia. Unten zeigte die Ampel Rot, er begann wieder bei eins. Die Ampel bei der Straßenbahnbrücke schaltete zum zwölften Mal, als er um halb sieben noch immer allein auf dem Sofa saß. Er holte sein Handy heraus und entdeckte Xenias Nachricht.
„Kann nicht kommen, meine Schwester ist bei mir. Ich muss dich sehen. Es ist sehr wichtig. Ich habe etwas für dich! Xenia.“ Geschrieben war die Nachricht um 18.20 Uhr.
Er ließ sein immer noch volles Glas stehen, warf zehn Euro auf die Theke und ging, enttäuscht, zornig und beunruhigt zugleich. Hatte der Tod ihres Vaters Xenia so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass sie ihm erst, als er schon zwanzig Minuten wartete, eine Nachricht schrieb? Oder war der Grund ein anderer, tatsächlich ihre Schwester? Oder spielte sie schlichtweg Katz und Maus mit ihm? Kurz bevor er die Tür erreicht hatte, blieb er abrupt stehen. Er roch Xenia. Er sah sich suchend um. Neben dem Ausgang standen in einer Reihe hohe gläserne Vasen mit langstieligen weißen Lilien und verbreiteten einen betörenden Duft. Keine Xenia. Seine Stimmung sank noch tiefer mit jedem Meter, den ihn der Fahrstuhl den Lichtern am Boden näher brachte. Wie Xenia mit ihm umsprang, war schlichtweg beleidigend.
Draußen fegte ein schneidend kalter Wind an der langen Häuserfront entlang, und auf dem Radweg glitzerte der Raureif im Licht der Scheinwerfer. Im vergangenen Jahr hatten in der Konviktstraße kurz vor Weihnachten noch die Geranien dem kommenden Frost entgegengeblüht – leuchtendes Rot zwischen Weihnachtsdekorationen –, und die Glyzinien an den Häusern hatten ihre Blätter noch nicht verloren. Damals hatte es noch keine Sphinx in seinem Leben gegeben.
Er wählte die Nummer von Xenias Handy. Wie erwartet meldete sich nur die Mailbox. Er hinterließ keine Nachricht. Einen Festnetzanschluss hatte Xenia nicht mehr, oder wenn doch, dann hielt sie ihn vor ihm geheim.
Dieser eisige Ostwind! An einem warmen Abend wäre ein vergeblicher Weg durch die Stadt leichter zu ertragen gewesen. Das widerliche Gefühl, umsonst gewartet zu haben, diese ihm wohlbekannte Mischung aus Ärger, Sorge und Verwirrung machte alles zunichte, was er gerade noch gedacht und geplant hatte. Jetzt war die Eiseskälte nicht nur draußen. Alles in ihm war eingefroren wie seine Gefühle für Xenia. Diese Schlange wollte er niemals wieder treffen!
Aber was wollte sie ihm geben? Etwas Verräterisches? Hatte es mit ihrem Geheimnis zu tun?
Alexander lauschte. Jetzt erst fiel ihm das Stimmengewirr im Flur auf. Von Zeit zu Zeit hörte er Lauers Stimme. Er stand auf und trat neben die Tür, aber auch von hier konnte er nicht verstehen, was draußen gesprochen wurde. Er ließ sich wieder auf den Schemel fallen und hing seinen Gedanken nach.
Durch seinen frühen Aufbruch aus dem Kagan hatte Alexander eine Stunde vor der mit Ina verabredeten Zeit vor dem Jugendstilhaus in der Türkenlouisstraße am Rand der Wiehre gestanden, dort, wo sich die Vorberge des Schauinsland bis zur Stadt hinunter erstrecken. Die hohen Sträucher und alten Bäume, die das Haus umgaben, waren jetzt im Winter kahl und gaben den Blick frei auf Inas dunklen Holzbalkon und einen fachwerkgeschmückten Erker. Ganz langsam, als sei er zu matt für schnelle Bewegungen, schlich er die ausgetretenen Holzstufen hinauf. Die Enttäuschung und die Kränkung des vergeblichen Wartens im Kagan machten ihm zu schaffen. Im zweiten Stock klingelte er kurz bei I. Kaltenbach und öffnete dann die Tür mit seinem Schlüssel. Ina und Corinna waren nicht allein. Er merkte es sofort, er roch es, noch ehe er es sah. Es war die Männerjacke im Flur, die den Geruch von Leder und fremder Wohnung verbreitete. Jörg Gesslers Jacke. Die Jacke seines Freundes, jetzt, wo er eine Stunde zu früh hier erschien!
Ina kam ihm im Flur entgegen. Sie sah anders aus. Ihr schulterlanges braunes Haar war kurz geschnitten, und den hautengen petrolgrünen Pullover hatte er noch nie gesehen, auch nicht die kurze schwarze Jacke, die sie darüber trug. Der Kuss, mit dem sie ihn begrüßte, schien ihm heute viel flüchtiger und pflichtschuldiger als an anderen Tagen. Sie drehte sich kokett. „Gefalle ich dir? Jörg meint, die kurzen Haare würden mir viel besser stehen als die langen.“
Jetzt hätte er etwas Nettes über Inas Aussehen sagen sollen, sie sah wirklich sehr hübsch aus, aber die Worte kamen nicht über seine Lippen. Verliebte Frauen sahen immer besonders hübsch aus, und das Strahlen, das sich in ihren Augen eingenistet hatte, galt vermutlich nicht ihm.
„Hat Jörg gesagt, dass du die Haare kürzer tragen sollst?“
Der zornige Unterton entging weder ihm selbst noch Ina, die ihn erst verwundert ansah, dann aber lächelte und ihm einen Kuss gab. „Soviel ich weiß, steht Jörg normalerweise auf langhaarige Frauen.“
„Warum ist Jörg überhaupt hier?“ Auch jetzt war sein Ton nicht besser.
Ina sah ihn mit einem verwunderten Lächeln an. „Bist du plötzlich eifersüchtig? Oder hat dich jemand geärgert?“
Alexander brummte etwas, was nicht zu verstehen war. Natürlich hatte Ina recht mit ihren Vermutungen. Er ging ins Wohnzimmer. Da saß sein Freund, sein einziger, wenn er ehrlich war. Er hatte den Hauptkommissar der Freiburger Kriminalpolizei vor vielen Jahren im Wallis während einer Bergtour auf den viereinhalbtausend Meter hohen Dom kennengelernt. Damals hatte Jörg ihm und seinem Begleiter sein längeres Seil angeboten, mit dem sie sich über eine Felswand abseilen konnten. Das hatte ihnen einen Umweg von anderthalb Stunden erspart.
Der Kommissar hatte die Schuhe ausgezogen und die Füße auf den niedrigen Tisch vor dem Sofa gelegt. Vor ihm standen ein halb volles Bierglas und eine leere Flasche. Wie immer fielen seine graublonden Haare ungekämmt bis über die Ohren, und der farblose Schnurrbart hing bis auf die Unterlippe. Auch die Stoppeln eines grauen Dreitagebartes auf den wettergegerbten, von roten Äderchen durchzogenen Wangen machten ihn für Alexanders Geschmack nicht attraktiver. Nur die lebhaften grauen Augen unter den buschigen Augenbrauen wirkten anziehend wie immer. Obwohl Jörg Gessler erst Mitte fünfzig war, zogen sich tiefe Lachfalten wie bei einem alten Mann von den Augenwinkeln zur Schläfe.
Alexander begriff nicht, was die Frauen an dieser ungehobelten Gestalt fanden, und ebenso wenig wusste er, warum dieser Mann ihm selbst so wichtig war.
„Du scheinst dich ja hier wie zu Hause zu fühlen.“
Jörg Gessler nahm die Füße vom Tisch und blickte Alexander prüfend an. „Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?“
Xenia, die Laus … Alexander Kilian schwieg und sah sich im Zimmer um. Auf dem Esstisch vor dem Fenster standen drei benutzte Teller vom Abendbrot. Sein Freund war also schon zum Essen hier gewesen.
„Wo ist Corinna?“
„In ihrem Zimmer.“
Die Tür von Corinnas Zimmer war nur angelehnt, und er öffnete sie so leise, dass Corinna ihn nicht bemerkte. Sie saß am Boden und hatte alle ihre Stofftiere vor sich aufgebaut. Da saßen sie einträchtig im Kreis, Olga da Polga das Meerschweinchen, Jochen der Bär, Affe und Hund, die keinen Namen hatten, Skippy das Känguru und wie sie sonst noch hießen. Einträchtig? Er musste sich geirrt haben. „Schwabbel dich nicht so auf“, hörte er seine Tochter, „Affe braucht auch Platz.“ Sie stellte das Känguru auf, es fiel wieder um. „Menno, bist du beknattert!“
Immerhin meinte sie nicht ihn.
„Hallo Corinna!“
„Hallo“, sagte sie, ohne sich umzusehen.
„Was ist denn ›beknattert‹?“
Corinna seufzte, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. „Ach Papa, das checkt doch jeder, was das heißt! Voll blöd, natürlich.“
„Aha“, sagte er. Gerade wollte er sie über den richtigen Umgang mit dem Kulturgut Sprache belehren, als er Ina hinter sich bemerkte. Er wandte sich um und versuchte, sie nicht schon wieder vorwurfsvoll anzusehen. „Warum spricht unsere Tochter so seltsam?“
„Weil ihre beste Freundin eine vierzehnjährige Schwester hat, vermute ich.“
„Aha“, sagte er wieder und versuchte die Zornesfalte auf seiner Stirn etwas zu glätten. „Muss Corinna heute nicht ins Bett?“
„Doch. Deswegen bin ich gekommen.“ Ina sah ihn mit jenem zärtlichen Blick an, mit dem sie diejenigen Bitten vorzubringen pflegte, die er in der Regel ohne Murren erfüllte. „Oder bringst du sie ins Bett?“
„Corinna, soll ich dich ins Bett bringen?“
Endlich sah seine Tochter ihn an. „Ja, aber jetzt noch nicht.“
„Doch, jetzt“, sagte Ina bestimmt.
Corinna murmelte etwas, was beim besten Willen nicht zu verstehen war, und erhob sich in staunenswerter Langsamkeit vom Boden.
„Vergiss das Zähneputzen nicht.“
Corinna schlich demonstrativ gemächlich davon. Auf dem Schreibtisch, halb vergraben unter Schulheften, fand Alexander das Buch, aus dem er Corinna heute vorlesen wollte. Es war „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler in einer völlig zerfledderten Ausgabe. Seine Mutter hatte ihm daraus vorgelesen, eine Frau, an die er sich kaum erinnerte und die wie ein unergründlicher Schemen durch die Bilder seiner Kindheit geisterte. Damals, als seine Eltern starben, war er genauso alt gewesen wie Corinna jetzt. Seine Tochter hatte das Buch vor ein paar Tagen in einem Karton mit alten Kinderbüchern entdeckt.
Corinna kam zurück, und ein paar Minuten später verschwand sie in ihrem viel zu langen Nachthemd unter der Bettdecke.
Die Tür ging auf. „Hast du deine Hausis eingepackt?“
Er sah Ina entsetzt an. Hausis! Kein Wunder, dass Corinna so seltsam redete, wenn selbst ihre Mutter nicht davor zurückschreckte. Und das, obwohl sie ihr Geld mit Übersetzungen in die deutsche Sprache verdiente!
„Voll easy“, gab Corinna zurück.
Er sah Ina fragend an. „Hat sie oder hat sie nicht?“
„Sie hat. Hat sie doch gerade gesagt.“
„Papa, liest du mir jetzt was vor?“
Er zog einen Stuhl neben Corinnas Bett und begann im spärlichen Licht eines leuchtenden Bären an der Wand zu lesen: „Es war einmal eine kleine Hexe, die war erst einhundertsiebenundzwanzig Jahre alt, und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter.“
Corinna lächelte leise, und in ihrem Gesicht erschien etwas von der Andacht, mit der sie schon als kleines Kind seinen Gutenachtgeschichten gelauscht hatte. Er las weiter und staunte darüber, wie das zusammenpasste, die kleine Hexe, die böse Rumpumpel, der Maronimann mit den kalten Händen und seine Corinna, die mit ihrer Sprache pubertierenden Teenagern nacheiferte. In ihrem Herzen war sie doch noch ein kleines Mädchen, in dessen Phantasie Hexen, Zwerge und Gespenster in einem verborgenen Winkel überdauert hatten.
Alexander ließ sich Zeit. Es tat ihm gut, sich in eine Welt zu versenken, in der es eine kleine harmlose Hexe, aber keine Xenia gab. Er las, bis Corinna eingeschlafen war. Als er schwieg, hörte er Ina im Wohnzimmer lachen, laut und herzlich. Ihre Ausgelassenheit versetzte ihm einen Stich. Er konnte sich nicht erinnern, wann sie in seiner Gegenwart zuletzt so guter Laune gewesen war.
Er drückte auf den Lichtschalter neben dem Bett, und der leuchtende Bär erlosch.
Alexander blieb noch sitzen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, und aus der Schwärze traten die Gestalten hervor, vor denen sich Corinna früher gefürchtet hatte, die weiße Frau, wo die helle Gardine hing, und der Totenkopf, wo tagsüber der runde Krebs mit dem Spiegel in der Mitte baumelte. Vor Abgründen hatte sie keine Angst gehabt, nicht vor solchen, wie er sie fürchtete und in deren Tiefe er die Namen Xenia Elytis und José Bustelo las.
Es gab noch eine andere Erscheinung, die ihn beunruhigte, und die war real: Thorsten Schneider, der am Flughafen Zürich zu ihnen herübergestarrt hatte. Zufall, redete er sich ein, aber es gelang ihm nicht, sich restlos davon zu überzeugen. Schließlich war es nicht das erste Mal gewesen, dass der ihn mit Xenia beobachtete. Ein weiterer Gedanke drängte in sein Bewusstsein. Vielleicht war Xenia aus einem anderen Grund nicht ins Kagan gekommen, als wegen dieser angeblich aufgetauchten Halbschwester. Aber aus welchem Grund dann? Er wusste es nicht.
Auf dem Wohnzimmertisch standen inzwischen eine Flasche Riesling und drei Gläser. Die Teller und die Bierflasche waren abgeräumt. Jörg Gessler saß in dem Sessel, der seit Langem Alexanders Platz war. Alexander blieb wortlos mitten im Raum stehen. Diese Inbesitznahme war eine bodenlose Frechheit! Von dort war es nur noch ein kleiner Schritt, dann würde Jörg seinen Platz in Inas Bett einnehmen. Wenn er das nicht schon längst getan hatte!
„Sitze ich in deinem Sessel?“
Alexander antwortete nicht. Diese scheinheilige Frage! Als wenn Jörg das nicht wüsste. Er beschloss stumm bis fünf zu zählen und dann den Freund mit Gewalt aus seinem Sessel zu entfernen. Er kam bis drei, da räumte Jörg den Platz freiwillig.
„Möchtest du etwas essen?“ Ina saß auf ihrem knallroten Lieblingssofa und hatte die Füße auf einen Sessel gelegt. Sie sah nicht aus, als wenn sie gleich wieder aufstehen wollte.
„Vielleicht später“, antwortete Alexander.
„Etwas trinken?“
Alexander nickte. Ehe Ina sich anschickte, ihre bequeme Position aufzugeben, goss er sich selbst ein. Er nahm sein Glas, leerte es, ohne abzusetzen, und füllte es wieder. Eine Weile blieb es still. Er schien zu stören bei dem Thema, über das Ina vor seinem Erscheinen so herzhaft gelacht hatte.
Die Pause dauerte schon viel zu lange, als Jörg Gessler schließlich von einem Vierzehnjährigen zu erzählen begann, der auf einer Baustelle einen Radlader gestohlen hatte. „Wisst ihr, was der zur Polizei gesagt hat, als man ihn anhielt?“
Alexander sah geradeaus, ohne eine Miene zu verziehen, und Ina schüttelte den Kopf.
„Er müsse für den Führerschein trainieren.“
Alexander gähnte, ohne die Hand vor den Mund zu halten. Er verstand nicht, warum Ina über diese banale Geschichte so lachen konnte. Ihm war nicht zum Lachen, nein, ihm war nicht einmal zum Gähnen zumute. Er tat es trotzdem ein zweites Mal.
Jörg Gessler erzählte unbeirrt weiter. Von einer jungen Frau, die ihre Mutter wegen Körperverletzung angezeigt hatte, weil sie ihrem sechsjährigen Enkelsohn den Irokesen-Haarschnitt gewaschen und ein paar Zentimeter gestutzt hatte. Auch dieses Mal lachte nur Ina.
Alexanders Glas war wieder leer.
Warum war Xenia plötzlich so seltsam? Warum ließ sie ihn vergeblich warten? Was hatte es auf sich mit ihrer Angst und was mit dem Kuss zur Unzeit im Flur? Das waren die Fragen, die ihn beschäftigten. Er goss sich erneut ein und ignorierte Inas besorgten Blick. Der Wein machte ihn benommen, und das war gut so.
Als Jörg sich anschickte, die nächste Geschichte zu erzählen, gähnte Alexander zum dritten Mal.
„Du meinst wohl, ich soll gehen?“
„Einem Kriminalbeamten entgeht doch nichts.“
Alexander führte sein Glas abermals zum Mund, merkte jedoch, dass es leer war, und stellte es wieder hin.
Jörg Gessler warf seinem Freund einen langen Blick zu – eher mitleidig als beleidigt – und stand auf. Im Gehen legte er ihm kurz die Hand auf die Schulter und nickte ihm zu, als wolle er ihm Mut machen.
Ina, die geschwiegen hatte, erhob sich ebenfalls und begleitete Jörg zur Tür. Alexander blieb allein zurück. Er hörte die Stimmen der beiden, ohne etwas zu verstehen, und ärgerte sich über sich selbst. Jetzt war er wieder der Außenseiter, den die anderen zurückließen, während sie gemeinsam etwas ausheckten. Es war ein schmerzhaftes, altbekanntes Gefühl aus Kindertagen, eine Kränkung, die er längst überwunden zu haben glaubte. Er war froh, als Ina nach ein paar Augenblicken zu ihm zurückkehrte.
„Die Geschichte muss ich dir noch erzählen“, begann Ina, noch bevor sie sich gesetzt hatte. „Auch von Jörg, ehe du kamst.“ Alexander schüttelte unwillig den Kopf, aber Ina schien es nicht zu sehen. „Da hat doch tatsächlich eine Neunzigjährige zwei Jugendliche mit ihrem Stock in die Flucht geschlagen, als sie ihr an der Bushaltestelle die Handtasche klauen wollten.“
„Beachtlich“, sagte er, aber auch diese Geschichte interessierte ihn nicht. Er führte sein Glas zum Mund. Es war immer noch leer. Als er sich nachschenken wollte, nahm ihm Ina die Flasche aus der Hand. Er ließ es geschehen.
Ina erzählte weiter, und er nickte ein paar Mal, ohne darauf zu achten, was sie sagte. Auf seine Schweigsamkeit ging sie nicht ein. Offenbar wollte sie etwas überspielen. Er ahnte auch was: Ihre große Vertrautheit mit Jörg, die es so früher nicht gegeben hatte. Wahrscheinlich hatten die beiden sogar darauf gehofft, dass er gar nicht käme. Jörg, der Freund, für den er ohne zu zögern ein Gedeck mehr auf den Tisch legte, wenn er überraschend kam, der einzige Fremde, der niemals das Gefühl haben musste, dass er ihn störte. Und jetzt nistete er sich bei Ina ein, nutzte seine Abwesenheit aus und setzte sich in den Sessel, von dem er wusste, dass es der angestammte Platz des Hausherrn war. Alexander holte tief Luft. Die Eifersucht, dieses Gift! Irgendwo hatte er gelesen, dass vor allem die Menschen eifersüchtig sind, die selbst Anlass zur Eifersucht liefern. Früher hatte er das für Unsinn gehalten.
Ina schwieg jetzt und sah in seine Richtung. Vielleicht schaute sie ihn an, vielleicht auch durch ihn hindurch oder scharf an ihm vorbei, so genau konnte er das in dem schummerigen Licht nicht erkennen.
„Wie findest du mich eigentlich?“, fragte er.
Offenbar hatte Ina durch ihn hindurchgesehen, denn bei seinen Worten ruckten ihre Augen ein wenig, und ihre Blicke trafen sich.
„Hm?“
„Wie findest du mich?“
Ina öffnete den Mund und schloss ihn wieder.
„Ich meine … Ich meine, ob du mich alt findest.“
„Warum fragst du das?“
„Ich meine nur, weil …“
Um Inas Mundwinkel zuckte etwas. Spott vermutlich.
„Schon gut. Du brauchst nichts zu sagen“, kam er ihrer Antwort zuvor.
Er nahm die „Süddeutsche Zeitung“, die Ina von Zeit zu Zeit kaufte, und tat, als würde er lesen. Das Blatt war dick genug, um den Rest des Abends damit zu verbringen. Als er einmal aufschaute, sah er ihr versonnenes Lächeln. Er versenkte seinen Blick wieder in der Zeitung und blätterte sie durch, ohne noch einmal aufzusehen. Er blieb auch noch sitzen, als Ina zu Bett ging. Erst als er sich sicher war, dass sie schlief, folgte er ihr. Er lauschte ihren ruhigen Atemzügen und fühlte sich sehr allein.
Eigentlich hatte er sein elendes Handy gleich nach Xenias Absage im Kagan ausschalten wollen, und zwar für den Rest der Woche. Sollte sie ihm doch so viele Botschaften schicken, wie sie es für richtig hielt, er würde sie nicht zur Kenntnis nehmen! Er ärgerte sich noch immer, dass sie ihn mit irgendwelchen Andeutungen zu diesem obskuren Ort bestellt hatte und selbst nicht erschienen war.
Aus irgendwelchen Gründen hatte er das Ausschalten versäumt. Als er am nächsten Morgen im Institut wieder einen Blick auf das Display warf, entdeckte er eine neue SMS: „Ich habe etwas für dich. Ich muss dich sehen! Dringend! Bitte melde dich. Xenia.“
„Lass mich in Ruhe“, murmelte er so leise, dass es Frau Brändle im Nebenzimmer trotz ihrer guten Ohren nicht hören konnte. „Verschwinde aus meinem Leben!“
Er wusste, dass er sich mit diesen Sätzen selbst betrog. Kaum meldete sich Xenia ein paar Tage lang nicht, wurde er unruhig. Sogar zu ihrer Wohnung in Neuf Brisach war er gefahren, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Aber dieses Mal würde er sich nicht melden, auch am nächsten Tag nicht. Tagelang würde er sie warten lassen. Er hatte schon genug für sie getan. Er löschte die Nachricht, schaltete das Handy allerdings nicht aus.
Er hatte sich an seine Vorsätze gehalten, bis ihm das Handy aus der Manteltasche auf den Boden gefallen war und er nicht anders konnte, als Xenias neue SMS zu lesen. Natürlich war er daraufhin ins Institut gefahren, jeder in seiner Situation hätte das getan.
Die Tür ging auf, und Alexander fuhr so heftig zusammen, dass es dem eintretenden Kommissar nicht entgehen konnte.
„Woran denken Sie gerade?“
Alexander merkte selbst, wie erschrocken er Lauer ansah, und bemühte sich vergeblich, ein gleichmütiges Gesicht aufzusetzen.
„An die Tote“, brachte er schließlich heraus. „Und daran, was es bedeutet, dass sie hier gefunden wurde.“
„Was meinen Sie damit?“
Er nahm sich Zeit zum Überlegen. „Wie werden die Mitarbeiter reagieren?“, sagte er bedächtig. „Wann werden sie bereit sein, diesen Raum wieder zu betreten? Wann werden sie es überhaupt dürfen?“
„Verstehe“, unterbrach ihn der Kommissar, noch ehe Alexander alles ausgesprochen hatte, was ihm in den Sinn kam. „Verstehe“, sagte er noch einmal, und Alexander wartete schon auf die nächste Frage, aber dazu kam es nicht, denn der uniformierte Polizist erschien schon wieder in der Tür, und Lauer ließ ihn mit seinen Gedanken allein.
Wie lange lag es zurück, dass Xenia zum zweiten Mal zu ihm gekommen war, unangemeldet wie bei ihrem ersten Besuch in seinem Arbeitszimmer? Nur zwei Monate? Eine ganze Ewigkeit schienen zwischen dieser zweiten Begegnung und ihrem Tod zu liegen. Eine Ewigkeit, in der Dinge geschehen waren, die er vergeblich zu vergessen versuchte.
Es war Mitte Oktober gewesen. Die Temperaturen waren innerhalb weniger Tage von über dreißig Grad auf winterliche Werte abgestürzt und hatten die unverhofft wiedererwachten sommerlichen Gefühle für dieses Jahr ausgelöscht.
Alexander war gerade aus dem Hörsaal zurückgekommen und in Gedanken noch bei seiner Vorlesung, da stand sie plötzlich in seinem Zimmer und sah unter den schläfrigen Lidern wieder so unglaublich unnahbar und gleichzeitig verlockend aus wie bei ihrer ersten Begegnung. Obwohl es draußen so kalt war, trug sie ein weit ausgeschnittenes enges T-Shirt. Zwischen dem kurzen Oberteil und der auf den Hüften sitzenden Jeans blieb ein breiter Streifen Haut unbedeckt, bräunliche Haut, die in einem auffallenden Kontrast zu ihrem blassen Gesicht stand. Bei den winterlichen Temperaturen draußen wirkte ihre Kleidung noch freizügiger und einladender als im Sommer, wenn sich die jungen Frauen mit ihrer Nacktheit gegenseitig überboten.
„Ich komme wegen meiner Promotion“, sagte sie. „Ich solle im nächsten Semester wiederkommen, hatten Sie gesagt.“
Er löste mühsam seinen Blick von der gebräunten Haut ihres Bauches und sah zu den Kastanienbäumen vor dem Fenster hinüber. Als Xenia das erste Mal vor ihm stand, hatten die Bäume geblüht, jetzt waren die Blätter braun, und die dicken, glänzenden Kastanien platzten aus ihren Hüllen. Das nächste Semester, das ihm damals so fern erschienen war, hatte bereits begonnen.
„Wann kann ich anfangen?“, fragte Xenia und blickte ihn dabei mit demselben rätselhaften Gesichtsausdruck an, der ihn schon bei ihrer ersten Begegnung aus dem Gleichgewicht gebracht hatte.
In diesem Augenblick fand er sie zum ersten Mal schön.
„Warum kommen Sie ausgerechnet zu mir? Es gibt so viele Kollegen, die Ihnen sicher gern ein Thema für eine Doktorarbeit geben und Sie betreuen würden.“ Er nannte die Namen von ein paar Professoren, die regelmäßig Doktoranden suchten, und überlegte, ob er ihr einen Stuhl oder vielleicht einen Stift und Papier zum Schreiben anbieten sollte.
Sie sah ihn wortlos an und schüttelte den Kopf. „Ich brauche kein Thema, und ich brauche nicht irgendeinen Doktorvater, der mich betreut. Ich brauche Sie.“
Schweigen. Ich brauche Sie – der Satz verschlug ihm erst einmal die Sprache. Und dann noch für weitere lange Augenblicke. Ihn. Ihn als Mann? Er hatte das gleich bei ihrer ersten Begegnung geahnt! Es gelang ihm nicht, seine Gedanken auf eine andere Ebene zu lenken.
Xenia stand eine Armlänge von ihm entfernt, halb geschlossene Augen, Sphinx-Gesicht, unnahbar und rätselhaft. Aufreizend. Verwirrend. Und sie brauchte ihn! Glücklicherweise war Frau Brändle bereits gegangen. Schon bei der Vorstellung, dass seine wachsame Sekretärin Xenias Auftritt hätte beobachten können, bekam er Bauchschmerzen. Bis ans Ende ihrer Tage hätte sie diese Begegnung im Gedächtnis behalten und jede junge Stimme mit dieser Schlange in Verbindung gebracht. Er bemühte sich um ein neutrales Gesicht, einen sachlichen Tonfall. Diese Frau musste längst gemerkt haben, woran er dachte. Jeder Mann dachte daran, wenn sie so auftrat, das musste sie aus Erfahrung wissen. Er hatte sie schon viel zu lange angestarrt.
„Ich verstehe nicht, warum ich der Einzige sein soll, der für Sie infrage kommt. Hoffen Sie auf eine Veröffentlichung in einer renommierten Zeitschrift, wobei mein Name hilfreich wäre?“
„Darum geht es mir nicht.“
Er wartete. Natürlich würde sie nicht sagen, worum es ihr wirklich ging. Das taten Frauen sowieso nicht, und eine mit einem so rätselhaften Gesicht wie sie schon gar nicht. Die ganze Frau war ein Rätsel, und er war sich sicher, dass sie genau um ihre Wirkung wusste.
„Ich brauche jemanden, der unabhängig ist.“
„Was meinen Sie mit unabhängig?“
„Ich glaube, dass Sie nicht käuflich sind.“
Er dachte an käufliche Liebe, er konnte nicht anders.
„Eben“, sagte er.
Ihre halb geschlossenen Lider hoben sich ein wenig, und für einen Augenblick sah sie verwundert aus. Aber sie hielt nicht länger an ihrem Erstaunen fest und fragte nicht nach, was er mit „eben“ gemeint hatte. Es wäre ihm auch schwer gefallen, es ihr zu erklären.
„Es gibt viel Unrecht auf dieser Welt“, stellte sie fest.
Er lächelte milde und merkte, wie er Zentimeter für Zentimeter vor Xenia zurückgewichen war. „Planen Sie etwa eine Doktorarbeit über das Unrecht auf dieser Welt? Ist das Thema nicht etwas weit gefasst?“
Noch zwanzig Zentimeter bis zum Schreibtisch. Er machte einen weiteren kleinen Schritt zurück und lehnte sich an die Tischplatte. Das vertraute Möbelstück gab ihm Halt.
Xenia blieb sehr ernst. „Ich meine nicht irgendein Unrecht. Ich meine das Unrecht, das große Firmen unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Fortschritts unter die Menschen bringen. Nehmen Sie Indien. Dort haben sich allein im Jahr 2007 mehr als sechzehntausend Bauern umgebracht, weil sie sich für teures gentechnisch verändertes Baumwoll-Saatgut bei dem Biotech-Konzern Mahayco-Monsanto verschuldet haben und ihre Familien nicht mehr ernähren konnten.“
„Das ist zwar furchtbar, aber es taugt nicht für eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit.“
Xenia schien seinen Einwand nicht zu hören und sah ihn jetzt mit einer geradezu grimmigen Entschlossenheit an. „Oder nehmen Sie Argentinien, wo mein Vater lebt. Seine Farm ist umzingelt vom Einfluss der großen Konzerne. Die schöpfen den Gewinn ab und treiben die verarmten Bauern in eine fatale Abhängigkeit. Rücksichtslos wird zerstört, was sich in Jahrhunderten entwickelt hat, und wo einmal Kleinbauern ihr Auskommen fanden, erstrecken sich jetzt sterile Sojawüsten. Haben Sie schon einmal den Namen Roundup gehört?“
Er nickte. Natürlich hatte er das. Er war ja nicht taub. Und auch nicht blind. Roundup-ready-Soja, Roundup-ready-Raps, Roundup-ready-Baumwolle: Nur Pflanzen, die mit einem Resistenzgen ausgestattet waren, überlebten das Unkrautvernichtungsmittel. Der Rest ging im Roundup-Totschlag unter.
Er seufzte angestrengt.
„Liebe Frau Elytis, das ist mir selbstverständlich bekannt. Es ist natürlich eine Katastrophe, was in Ländern wie Argentinien geschieht, und unsere Hilflosigkeit gegenüber den mächtigen Konzernen ist deprimierend, aber wir hier in Europa können diese Entwicklung nicht stoppen.“
„In Europa sitzen genau wie in Amerika von der Industrie bezahlte Wissenschaftler in den Gremien, die den Politikern zuarbeiten.“
Ihre Haltung veränderte sich, und sie baute sich vor ihm auf wie jemand, der eine Rede halten will: leicht breitbeinig, den Kopf ein klein wenig in den Nacken gelegt, den Blick in die Runde eines imaginären Publikums gerichtet.
„Genpflanzen sind sicher für Mensch und Tier. Sie bedeuten keine Gefahr für die Umwelt.“
Nun begriff er überhaupt nichts mehr.
„Regierungen und Nicht-Regierungsorganisationen müssen ihre Kampagnen gegen die grüne Gentechnik einstellen“, fuhr sie mit übertrieben lauter Stimme fort. „Diese sind unverantwortlich, weil sich die skeptische Haltung der Europäer auf die Entwicklungsländer überträgt.“
„Warum sagen Sie mir das?“, unterbrach er sie ärgerlich. „Ich sitze weder mit den uneingeschränkten Befürwortern noch mit den absoluten Gegnern in einem Boot.“
„Aber Wissenschaftler wie Sie schweigen zu dem, was geschieht.“
Xenia gab ihre Haltung auf und senkte ihre Stimme ein wenig. „Diese Sätze habe ich nicht aus der Pressemitteilung eines Herstellers gentechnisch veränderten Saatgutes. Sie stammen aus der Feder einer Arbeitsgruppe der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften!“
Er sah sie an wie ein Fabeltier.
„Wissen Sie etwa nicht, was das ist?“ Ihre Stimme klang angriffslustig.
„Selbstverständlich weiß ich das. Es ist der Zusammenschluss der acht deutschen Akademien der Wissenschaften von Berlin, Göttingen, München, Leipzig, Heidelberg, Mainz, Düsseldorf und neuerdings auch Hamburg.“
„Richtig.“
„Ich habe nichts damit zu tun, was diese Union veröffentlicht.“
Er ärgerte sich über ihren Ton und überlegte, ob er sie jetzt rausschmeißen sollte. Er hatte es doch gewusst: Sie suchte nach einem Vorwand, der sie in seine Nähe bringen sollte, aber wie sie das anstellte, war völlig abwegig. Kein Mann ließ sich mit Vorwürfen umgarnen. Wahrscheinlich wusste sie nicht einmal, womit er sich als Wissenschaftler tatsächlich beschäftigte. Und ein Thema für eine Doktorarbeit konnte er in ihren Äußerungen auch nicht entdecken.
„Sie sind wegen einer Promotionsarbeit gekommen. Ich habe Nein gesagt, und jetzt überschütten Sie mich mit ungerechtfertigten Vorwürfen.“
Sie schwieg, als würde ihr erst jetzt bewusst, dass er sich angegriffen fühlte. „Entschuldigen Sie. Ich meine nicht Sie persönlich, ich meine das System.“
Alexander Kilian verzog keine Miene. Was sie über Sojawüsten und das Leid von Kleinbauern gesagt hatte, war nicht absurd, ganz im Gegenteil, aber wenn er ihr jetzt auch nur ein bisschen zustimmte, wäre er schon in ihren Fängen.
„Menschen, die sich mit allen Mitteln gegen Gentechnik in der Landwirtschaft wehren, gibt es viele in Europa, nur“, er zog bedauernd die Schultern hoch, „ihre Argumente sind nicht immer überzeugend.“
„Es gibt genügend Studien, die beweisen, wie gefährlich die Gentechnik für Mensch und Umwelt ist.“
„Es gibt leider überhaupt keine Studien auf diesem Gebiet, die wirklich weiterhelfen“, unterbrach er sie. „Jede Studie ist von irgendjemandem bezahlt, der erwartet, dass durch die Ergebnisse seine Position gestärkt wird, egal ob Befürworter oder Gegner der Gentechnik. Das macht es so schwer, ein klares Urteil zu fällen.“ Er sah seine Finger an, die ohne sein Zutun begonnen hatten, einen unregelmäßigen Rhythmus auf die Schreibtischplatte zu klopfen. Xenia sah sie auch an. Er stoppte seine Finger.
„Sogar die Amerikanische Akademie für Umweltmedizin hat erklärt, dass gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen“, fuhr Xenia fort. Sie sprach jetzt schneller, als fürchte sie, er würde sie nicht ausreden lassen. „In verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass Gesundheitsrisiken im Bereich der Toxikologie, Allergie und Immunfunktion, der Fortpflanzung und des Stoffwechsels, der physiologischen und genetischen Gesundheit bestehen.“ Der Satz klang als habe sie ihn auswendig gelernt, wie er es selbst vor langer Zeit mit seinen ersten Vorträgen getan hatte.
„Studien an Menschen?“
„An Tieren.“
Er bemühte sich um einen verständnisvollen Blick. „Die Aussagekraft solcher Studien wird sehr unterschiedlich bewertet.“
In der Tat war ihm keine einzige Studie über die Gefahren durch gentechnisch veränderte Organismen bekannt, die ihn wirklich überzeugte, doch die erste völlig unvorhersehbare Katastrophe hatte sich schon vor rund zwanzig Jahren ereignet. Sie hatte nahezu vierzig Menschen den Tod gebracht und die Gesundheit von mehr als zehntausend ruiniert. Alle Betroffenen hatten die Aminosäure L-Tryptophan eines japanischen Herstellers als Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Kurz vorher hatte diese Firma begonnen, die Aminosäure mit genmanipulierten Bakterienstämmen zu produzieren. Der Zusammenhang zwischen den Todesfällen und der gentechnischen Herstellung der Aminosäure wurde nie bezweifelt.
Er ignorierte Xenias zorniges Gesicht und die Zweifel an seinen eigenen Worten. „Außerdem habe ich immer noch nicht verstanden, warum Sie mit diesem zugegebenermaßen wichtigen Thema ausgerechnet zu mir kommen. Ich bin Grundlagenforscher.“
Keinen Zentimeter von seiner ohnehin schon dürftigen Überlegenheit durfte er aufgeben. Also lächeln mit diesem wissenden, wohlwollenden Professorenlächeln, das geeignet war, jeder Art von Niederlage vorzubeugen.
„Und als solcher sind Sie unabhängiger von der Industrie als viele andere“, setzte sie seinen Satz fort.
Auch mit dieser Aussage hatte sie zweifellos recht. Grundlagenforschung betreiben bedeutete, Wissen zu sammeln. Das Ausbeuten unter merkantilen Gesichtspunkten besorgten in der Regel andere, und die waren naturgemäß eher bereit, jeden kritischen Gedanken schon im Keim zu ersticken. Er sprach seine Gedanken nicht aus. „Sie wollen doch nicht behaupten, meine Kollegen an den Universitäten ließen sich von der Industrie kaufen!“ Seine Entrüstung klang zu seiner Überraschung sogar echt.
„Glauben Sie etwa, dass es heute noch viele bedeutende Wissenschaftler gibt, die nicht durch gute Kontakte mit der Industrie verbunden sind?“
Nein. Auch er glaubte das nicht, trotzdem rang er sich nur ein zögerndes Kopfschütteln ab. Seit es als besonderes Verdienst eines Wissenschaftlers galt, möglichst viele Drittmittel einzuwerben – und zwar nicht nur öffentliche Forschungsgelder –, war es geradezu eine Pflicht geworden, den Interessen der Industrie Tür und Tor zu öffnen. In seinen Augen war das Eindringen wirtschaftlicher Interessen in die universitäre Forschung eine Katastrophe. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hingegen hatte sogar mehrmals die finanzielle Förderung von Projekten von der Zusammenarbeit der Wissenschaftler mit der Industrie abhängig gemacht. Mit dem Leverkusener Bayer-Konzern zum Beispiel. Der wiederum kooperierte unter anderem über Lizenzverträge mit der wegen ihrer Skrupellosigkeit verrufenen amerikanischen Firma Monsanto.
„Gute Verbindungen bedeuten ja nicht automatisch Bestechlichkeit“, beantwortete er endlich Xenias Frage.
Aber lag wirklich zwischen dem Annehmen von Geldern aus der Industrie und einem Einknicken vor deren Interessen ein so weiter Weg, wie gern behauptet wurde? Er glaubte es nicht. Der Bauch bestimmt das Handeln, nicht der Kopf, dachte er und merkte, wie sich sein Blick dabei in Xenias Bauchnabel verlor. Ihre nackten Hüften machten ihn nervös. Jeder hier im Institut musste bemerken, wie sie auftrat und wie sie sich kleidete. Sein nahezu unbefleckter Ruf, was Frauengeschichten betraf, wäre auf der Stelle ruiniert, wenn er sie mit diesem unausgegorenen Thema als Doktorandin annähme. Ganz abgesehen davon, dass ihm ihr Anliegen nichts als Ärger einbrächte.
„Nehmen Sie mich jetzt oder nicht?“
Er wusste, dass alles, was er in diesen Minuten sagte, aus Angst geschah, aus Angst vor der plötzlich so nahe liegenden Möglichkeit, dass ihm diese Sphinx täglich begegnen würde. Und dann? Ihre Anwesenheit wäre eine endlose Aneinanderreihung von Versuchungen. Und wenn er der Versuchung nachgab und ein paar schöne Stunden mit ihr verbrachte, was hätte er davon? Die Antwort war eindeutig: letztlich nur Verdruss. Xenia mochte Mitte zwanzig sein, also noch einmal zehn Jahre jünger als Ina. Er konnte sich vorstellen, was die dreißig Jahre bedeuten würden, die ihn von Xenia trennten. Ihre Jugend und ihre von keinen Endzeitahnungen begrenzte Zukunft würden ihn noch deutlicher spüren lassen, wie alt er war. Mit sechsundfünfzig stand der Herbst des Lebens vor der Tür, Xenia hatte sich noch nicht einmal vom Frühjahr verabschiedet. Außerdem liebte er Ina, und es gab keinen Grund, sie für eine andere Frau aufzugeben. Und seiner kleinen Corinna konnte er das schon gar nicht antun.
„Sie sind bei mir an der falschen Adresse. Ich habe mit diesen Dingen nichts zu tun.“
„Aber Sie haben die Kontakte.“
Jetzt ahnte er, worauf sie anspielte, und schüttelte vorsichtshalber den Kopf. In der Tat hatte er gute Kontakte zu Kollegen, die ihrerseits eng mit der Industrie verbunden waren, und auf seinem Schreibtisch lag die Einladung zu einer Tagung über Folgen der Gentechnik, bei der es von Wissenschaftlern mit guten Kontakten zur Industrie nur so wimmeln würde.
„Verstehen Sie mich doch bitte, ich kann Sie nicht nehmen.“
Dieser Blick unter den langen Wimpern!
„… aber falls ich Sie irgendwie unterstützen kann, tue ich es gerne“, fuhr er fort. Sein Blick hing schon wieder an ihrem Bauchnabel und an einer grünen tätowierten Schlange, die sich darüberwand.
Er zwang seinen Blick auf ihre Augenhöhe und fand wieder ihren Blick, in dem er nicht lesen konnte, was sie dachte und was sie plante. Ihre Lippen waren schmaler geworden, kein Lächeln, aber ihre Haltung war nicht weniger aufrecht als zuvor.
„Darf ich Sie anrufen?“
„Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen weiterhelfen kann, jederzeit.“
Das hatte er doch gar nicht sagen wollen! Sie sollte ihn jederzeit anrufen dürfen? Er wunderte sich über seine eigenen Worte, die sich an seinem inneren Zensor vorbeigeschmuggelt haben mussten. Schon als Kind hatte er schneller geredet als gedacht, und im Alter schien dieses Missverhältnis nicht geringer zu werden. Wahrscheinlich dachte er jetzt langsamer.
Xenia nickte mit einem zufriedenen Lächeln, als habe sie soeben einen bedeutsamen Vertrag zu ihren Gunsten abgeschlossen. „Ich danke Ihnen.“
Dann verschwand sie. Es war kein einfaches Hinausgehen, sie trat ab wie eine erfolgreiche Diva nach ihrer bejubelten Vorstellung, und er ahnte, dass er mit seinem Angebot einen Fehler gemacht hatte.
Er ging ans Fenster, um zu sehen, ob sie wenigstens auf der Straße Winterkleidung tragen würde, aber er entdeckte sie nirgends. Sie musste die Richtung eingeschlagen haben, die er nicht einsehen konnte.
Unausgegorenes Zeug, dachte er, an den Haaren herbeigezogene Gründe, um in seiner Nähe zu sein, und schon gar kein Thema für eine Doktorarbeit, so schlimm manche Entwicklungen auch in seinen Augen waren. Zum Beispiel an der Kölner Universität. Dort saß einer der größten deutschen Pharmakonzerne durch Kooperationsverträge schon fest im Sattel, und diese Verträge wurden strikt geheim gehalten. Alexander war nicht der Einzige, der vermutete, dass der Grund für die Geheimhaltung ein Maulkorb für die Wissenschaftler der Kölner Uni war: Studien, die den Interessen des Pharmakonzerns zuwiderliefen, durften nicht veröffentlicht werden. Sogar das Deutsche Ärzteblatt hatte kürzlich festgestellt, dass eine große Anzahl der von pharmazeutischen Unternehmen finanzierten Studien gar nicht veröffentlicht werde, diejenigen mit positiven Ergebnissen hingegen gern mehrmals. Sogar das Kunststück, ungünstige Ergebnisse als günstige darzustellen, gelang pharmafinanzierten Autoren.
Überall hatte sich dieser gefährliche Einfluss der Industrie eingenistet. Wie sollten etwa die Gremien der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die für die Ge-nehmigung und Markteinführung von gentechnisch veränderten Organismen zuständig war, unparteiisch gegenüber dem Druck der Industrie sein? Die Verbindungen mancher der an den Gutachten beteiligten Wissenschaftler zur Biotech-Industrie waren bedenklich eng, so eng, dass sie auf von solchen Firmen gesponserten Kongressen als Redner erschienen und einer sogar in einem Firmenvideo auftrat.
Andererseits: Warum hatte Xenia nicht längst promoviert? Die meisten Mediziner fertigten ihre Doktorarbeit während des Studiums an. Warum sie nicht? Kein Durchhaltevermögen? Ein gescheiterter Versuch mit einem anderen Thema? Oder ein Verhältnis mit ihrem Doktorvater, von dem dessen Ehefrau erfahren hatte? Er fand genügend Gründe, um sich über seine Ablehnung hinwegzutrösten. Wenn sie ihn wirklich anrufen sollte, würde er sie abwimmeln. Diese Frau würde sein Leben auf den Kopf stellen, wenn er ihr die Tür auch nur einen Spaltbreit öffnete. Er wusste das, und er war fest entschlossen, sich mit aller Entschiedenheit zur Wehr zu setzen. Damals noch.
Er setzte sich an den Computer und gab bei Google „Amerikanische Akademie für Umweltmedizin“ ein. Bald hatte er die Studie gefunden, von der Xenia gesprochen hatte. Wörtlich stand dort:
„Weiterhin hat sich ein präziser Zusammenhang zwischen gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln und bestimmten Krankheitsverläufen herausgestellt. Bei zahlreichen Studien an Tieren fand man eine erhebliche Entgleisung des Immunsystems, einschließlich einer Hochregelung von Zytokinen, was zu Asthma, Allergien und zu Entzündungen führen kann. Andere Tierstudien zeigten eine veränderte Struktur und Funktion der Leber, wie eine Veränderung des Fett- und Kohlehydratstoffwechsels sowie Zellveränderungen, die zu beschleunigter Alterung und möglicherweise zu einer Anhäufung von Sauerstoffradikalen führen könnten. Veränderungen in Niere, Bauchspeicheldrüse und Milz wurden ebenfalls beschrieben. Eine neuere Studie stellt eine Verbindung zwischen gentechnisch verändertem Mais und Unfruchtbarkeit her; es zeigte sich, dass die Würfe bei bestimmten Tieren mit der Zeit kleiner wurden, so waren bei mit GV-Mais gefütterten Mäusen die neugeborenen Jungtiere deutlich leichter. Bei dieser Studie wurde auch festgestellt, dass bei den mit GV-Mais gefütterten Mäusen über 400 Gene deutlich verändert waren. Dabei handelt es sich um Gene, von denen bekannt ist, dass sie die Protein-Synthese sowie die Zellkommunikation, die Cholesterin-Synthese und die Insulin-Steuerung regeln. Bei anderen Studien zeigten sich Schäden an den Gedärmen von mit GV-Mais gefütterten Tieren, darunter wucherndes Zellwachstum und eine Störung des Immunsystems des Darms.“
Er war sich nicht sicher, was er davon halten sollte, und druckte die Notiz aus. Seine Meinung stand ohnehin fest: Zumindest in Europa konnte er keinen Nutzen der grünen Gentechnik erkennen, der nicht auch mit herkömmlichen Mitteln erreichbar wäre.
Warum sollten er oder andere Menschen unter diesen Umständen für profitgierige Firmen als Versuchskaninchen für Experimente herhalten, deren Folgen sich vielleicht erst in zwanzig oder dreißig Jahren zeigten? Vermehrte Krebserkrankungen zum Beispiel. Gentechnik war schließlich nicht einfach Züchtung mit anderen Mitteln. Da wurden artfremde Gene eingefügt, die den gesamten Stoffwechsel des veränderten Organismus beeinflussten. Neue Eiweiße und andere Verbindungen entstanden, deren Wirkung auf den Menschen unbekannt war. Das Leben wurde vorwärts gelebt, die Folgen konnte man bestenfalls rückwärts verstehen. Was taugten die Argumente, die sich auf Amerika beriefen, wo seit vielen Jahren Gentechnik-Lebensmittel verzehrt wurden? Gar nichts! Kein Mensch würde merken, wenn dadurch das Krebsrisiko stiege oder Allergien zunähmen, weil dort niemand weiß, wer welche Gentech-Lebensmittel gegessen hat. Woher auch? In Amerika werden diese Nahrungsmittel nicht gekennzeichnet.
Nach dem zweiten Besuch in seinem Arbeitszimmer hatte ihn Xenia nicht mehr losgelassen. Sie hatte begonnen, ihn zu beherrschen, mit ihren Augen, mit ihrem Gesicht, mit ihrem ganzen Körper, auch wenn er ihr tagelang nicht begegnete. Überrascht hatte er festgestellt, dass er in Gedanken mehr bei ihr war als bei Ina. Und wenn er nachts Ina umarmte, dann verwandelte diese sich in Xenia. Er wehrte sich dagegen, aber es gelang ihm nicht, die Erinnerung an diese Frau einfach abzulegen wie ein aus der Mode gekommenes Kleidungsstück. Er konnte nichts dagegen tun, dass er sich mit seinen Gedanken immer tiefer in das Netz verstrickte, das sie ausgeworfen hatte. Und nicht nur mit seinen Gedanken. Am Ende stand eine Tat, die ihn seine Existenz kosten würde, wenn sie herauskäme. Er musste alles daran setzen, dass niemand davon erfuhr. Zwei Mitwisser waren tot und der dritte weit weg.
Alexander wusste nicht, wie lange er so gedankenverloren auf dem Schemel gesessen hatte, nachdem der Kommissar zum zweiten Mal in dieser Nacht gegangen war. Er stand auf und öffnete das Fenster. Die kalte Luft tat ihm gut. Draußen war es ganz still. Kein Auto fuhr, kein Radfahrer, nur eine dicke Katze huschte über die Straße und verschwand durch den Zaun eines Vorgartens.
Er verließ den Raum und trat in das Zelllabor, wo mehrere Männer in weißen Overalls mit der Spurensicherung begonnen hatten. Hauptkommissar Lauer lehnte weitab von der Zentrifuge, wo er Xenia gefunden hatte, an einem Arbeitstisch und sprach mit den beiden jungen Beamten von der Schutzpolizei. Als Alexander näher kam, unterbrachen sie ihr Gespräch. Aus Höflichkeit? Oder weil das, worüber sie sprachen, nicht für seine Ohren bestimmt war?
„Brauchen Sie mich noch?“
Wieder dieser lange forschende Blick des Kommissars, als ahne er, dass der Professor noch längst nicht alles gesagt hatte, was er wusste.
„Nein, im Augenblick werden Sie nicht mehr gebraucht.“
Alexander musste seine Telefonnummer und Adresse angeben, dann durfte er gehen. Auf der Treppe kehrte er noch einmal um. Er hatte den Laptop vergessen, dessentwegen er angeblich hergekommen war. Er ärgerte sich. Etwas Dümmeres als einen vergessenen Laptop als Erklärung für seinen nächtlichen Besuch im Institut hatte ihm gar nicht einfallen können. Was, bitte schön, hätte er um diese Zeit mit dem Ding in seiner Wohnung tun wollen? Pornos ansehen? Etwas Besseres fiel ihm nicht ein.
Eine Stunde nachdem er ins Institut gekommen war, stand er wieder auf der Straße. Diese eine Stunde! Und nichts war mehr wie vorher. Er hatte immer gewusst, dass jederzeit etwas Schreckliches in sein Leben eindringen konnte. Die schlimmen Dinge brachen immer überraschend herein, überall und jeden Tag, und niemand konnte sich davor schützen.
Die Nacht war kalt, vielleicht die kälteste dieses Winters. Alexander stand wie verloren vor der großen Villa aus der Gründerzeit. Dieses Haus in der Nähe des Stadtgartens und abseits der nüchternen Zweckbauten des Institutsviertels der Universität hatte er seit Jahren als sein zweites Zuhause betrachtet. Jetzt lag dort eine Tote. Mit einem Mal erschien ihm das Dach über dem dreigeschossigen Haupthaus zwischen den beiden schiefergedeckten Seitenflügeln wie der Deckel eines Sarges und das ganze Haus wie angefressen von Tod und Verfall. Die filigrane Steinbrüstung des Balkons in der Mitte des Gebäudes war mit den Jahren schwarz geworden, und von den geschwungenen und verzierten Konsolen und den Stuckquadern der Hauswand blätterte die Farbe ab. Vor den Fenstern des ersten Stockwerks, wo ein paar Räume durch weiße Neonröhren erleuchtet waren, bauschte sich der Nebel im Widerschein des Lichtes vor der dunklen Hauswand zu gespenstischen weißen Kissen. Hinter einem der Fenster lag Xenia.
Fröstelnd ging er den kurzen Weg zu seiner Wohnung. Er steckte den Schlüssel in die Tür, zog ihn aber wieder heraus, ohne ihn gedreht zu haben. Die Vorstellung der leeren Zimmer mit Xenias leblosem Gesicht vor Augen war fürchterlich. Er kehrte um und ging weiter bis zum Stadtgarten.
Raureif hatte Wiese und Wege überzogen, und der Nebel war erleuchtet vom warmen Licht der altertümlichen Laternen. Der Park wirkte heute viel heller als in anderen Nächten, geradezu tröstlich trotz der Kälte, und er wusste nicht, ob das am Raureif lag oder an den beleuchteten Nebelschwaden. Noch etwas war anders heute. Der Münsterturm, der sonst im rötlichen Licht der Scheinwerfer über den Häusern der Altstadt schwebte, war nicht zu sehen.
Um diese Zeit war er im Stadtgarten ganz allein. Er ging langsam bis zum runden Wasserbecken, das jetzt im Winter leer und leblos war. Im Geäst eines mächtigen Baumes am Weg hockten runde Schatten: Misteln, so groß wie Krähennester.
Er ging eine Runde durch den ausgestorbenen Park, dann eine zweite. Allmählich wurde er ruhiger. Die Kälte betäubte den Wust von Gefühlen, mit dem er das Institut verlassen hatte.
Er wäre gern zu Ina gefahren, aber jetzt, mitten in der Nacht, war es zu spät. Er musste über die tote Xenia sprechen, auch wenn er die lebende nie erwähnt hatte. Immerzu dachte er über die Frage nach, was er Ina über Xenia sagen sollte. Was wusste sie, was ahnte sie? Hatte er denn geglaubt, Ina wäre blind und taub und hätte überhaupt nichts wahrgenommen? Wie ein blinder Affe hatte er sich aufgeführt, ein Triebwesen, das alles um sich vergaß. Hatte Ina wirklich nichts davon gemerkt, dass es in seinem Leben eine Xenia gab, oder hatte sie geschwiegen, weil sie sicher war, das jede andere Frau eine unbedeutende Episode bleiben würde, wenn sie ihre Beziehung nicht durch Eifersuchtsszenen zerstörte? Oder war es ihr sogar recht, wenn seine Aufmerksamkeit einer anderen galt und sie sich unbehelligt mit einem Mann treffen konnte, den sie anziehender fand als ihn? Je länger er darüber nachdachte, umso wahrscheinlicher erschien ihm die letzte Erklärung. Es kam nur selten vor, dass er unangemeldet vor Inas Tür stand, zu selten, als dass sie eine Gefahr darin sehen musste. War Jörg dieser andere Mann?
Langsam ging er noch eine Runde, dann kehrte er zu seiner Wohnung zurück.
Die letzten Stunden dieser Nacht verbrachte er in einem Schwebezustand, in dem es ihm schien, als würde er keine Sekunde schlafen. Nur die bizarren Bilder, die ihn von Zeit zu Zeit verwirrten, verrieten ihm, dass er geträumt haben musste. Xenia war vorbeigegaukelt, und ihre großen dunkelbraunen Schmetterlingsflügel hatten sich in schwarz bewimperte Hälften einer Venusmuschel verwandelt, die langsam auf und zu klappten. Oder waren das Corinnas lange, dunkle Wimpern, die sich schläfrig bewegten?
Während die Stunden quälend langsam dem Ende der Nacht entgegenkrochen, überfiel ihn ein anderer Gedanke, der erschreckender war als alle anderen zuvor. Ich habe etwas für dich, hatte Xenia ihm geschrieben, und er hatte keine Ahnung, was sie gemeint haben könnte. Nicht weit von der Toten entfernt hatte ein schwarzer Lederrucksack auf dem Boden gestanden. Xenias Rucksack. Befand sich das, was für ihn bestimmt war, darin?
Pünktlich um acht Uhr, eine halbe Stunde früher als gewöhnlich, stand Alexander nach dieser schlimmen Nacht vor dem Institut. Die Zeitungen hatten noch nichts über die Tote berichtet, und er wusste nicht, ob die Polizei schon jemanden von den Mitarbeitern befragt hatte. Vielleicht war er der Einzige, der wusste, was geschehen war. Er stellte sich den Aufruhr vor, der oben gleich ausbrechen würde, und wäre am liebsten sofort wieder umgekehrt. Aber er war der Chef, und der konnte jetzt nicht einfach verschwinden. Was war seine Rolle in diesem Stück? Jeder Mensch spielte eine Rolle, ob er es wollte oder nicht. Noch blieb ihm Zeit, seine zu wählen: entsetzt und aufgelöst oder doch besser beherrscht und sachlich? Oder traurig? Nein. Nicht traurig. Alles, nur das nicht, und auch nicht das geringste Anzeichen eines schlechten Gewissens.
Mit einer entschlossenen Bewegung öffnete er die schwere Tür. Er hatte sich entschieden. Unten an der Treppe blieb er noch einmal stehen und nahm bewusst die aufrechte Haltung an, mit der er seinen Mitarbeitern entgegentreten würde. Mit nichts konnte er seine Gefühle so zuverlässig beeinflussen wie mit der passenden Körperhaltung.
Langsam, aber mit festen Schritten stieg er die Stufen zum zweiten Stockwerk hinauf. Da wartete sie schon, seine Frau Brändle. Ihr Gesicht und ihre ganze Gestalt zeigten den Ausdruck reinen Entsetzens. Ihr Körper, sonst geradlinig und ordentlich wie ihr ganzes Wesen, war von der Aufregung völlig verdreht und aus dem Lot geraten wie die Maria bei der Verkündigung von Hans Baldung Grien im Münster am Hochaltar. Bis in die Spitzen von Frau Brändles neuerdings kurzen Haaren hatte sich der Aufruhr ausgebreitet. Ihre Hände drehten und verwrangen sich fortwährend vor ihrer Brust, und ihr Gesicht war wie aufgerissen von einem stummen Schrei. Ernst, sehr ernst ging er auf seine Sekretärin zu. Die gute Seele, die schon bei geringeren Anlässen in Verzweiflung zerfloss, tat ihm leid. Es wird schon wieder werden, hätte er ihr am liebsten zugerufen, schon um sich selbst Mut zu machen, aber er beschränkte sich auf ein gefasstes: „Schrecklich, nicht wahr?“
Seine Sekretärin öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton heraus.
„Ist die Kripo im Haus?“
Beate Brändle nickte und wies mit einer stummen Geste nach unten. Er verzichtete darauf, in sein Zimmer zu gehen, und stieg die Treppe langsam wieder hinunter. Nach ein paar Schritten blieb er stehen und richtete sich erneut auf. Seine Rolle! Wie ein geschlagener Hund war er eben über die Treppe gekrochen, nicht wie ein souveräner Chef. Die restlichen Stufen nahm er, wie er es gewohnt war: sportlich, mit schnellen, lockeren Schritten. Gleich fühlte er sich etwas besser.
Im ersten Stock waren die Türen von drei Räumen geschlossen, was ungewöhnlich war. In diesem Stockwerk hatte er die tote Xenia gefunden. Er klopfte an eine der Türen und öffnete sie. An einem der Arbeitstische saß Lauer. Dieses Mal hatte sich der Kommissar offenbar auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Er trug eine randlose Lesebrille, und seine Biedermann-Jacke hing neben der Tür an einem Haken. Auf dem Stuhl schräg neben ihm war der schwabbelige Körper einer für Alexander bislang namenlosen Praktikantin in sich zusammengesunken. Mit seltsam verdrehtem Kopf sah sie den Kommissar an, schien aber nicht viel zur Klärung der gestrigen Ereignisse beitragen zu können. Ein paar Meter von den beiden entfernt saß ein dünner Mann mit schwarzem Dreitagebart hinter einem Laptop und tippte auf der Tastatur.
„Brauchen Sie mich?“
Lauer senkte den Kopf und betrachtete den Professor über seine Brille hinweg, als sähe er ihn zum ersten Mal. „Ja. Wenn Sie bitte einen Augenblick draußen warten würden.“
Alexander zog sich zurück und schloss die Tür. Draußen warten? Auf dem Flur, wie ein lästiger Besucher? Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, wenn er nicht unangenehm auffallen wollte. Er ging bis ans eine Ende des Ganges, warf einen Blick aus dem Fenster, ging zum anderen Ende und kehrte wieder um. Die Bilder und Zettel im Flur waren grauenvoll. Ausgerechnet jetzt, wo dieser Kommissar im Haus war, fiel ihm das auf. Dabei hingen die schon seit Jahren hier, vor allem das größte, schreiend bunte Plakat. Überschrift: ›Safer Sex‹, darunter übergroße Kondome in leuchtenden Farben und Mustern. Unübersehbar! Und dann die ausgedruckten Sprüche, die überall an die Türen geklebt waren: „Wer mit den Menschen auskommen will, darf nicht zu genau hinsehen“ oder: „Rauchen Sie nicht im Bett – die Asche, die übrig bleibt, könnte Ihre sein.“ Selbst an den Türen der Kühlschränke im Flur hingen solche Zettel: „Lieber hochschwanger als niederträchtig“ und daneben ein besonders geistloser Spruch: „Freiheit für Gummibärchen, nieder mit der Tüte.“
Einen Augenblick, hatte der Kommissar gesagt. Nach fünf Minuten hatte Alexander den Flur weitere drei Mal durchquert. Ihn warten zu lassen, war ein sicheres Mittel, ihm die bösesten Gedanken in den Kopf zu setzen. Wollte das der Kommissar? In dem Augenblick, als Alexander ohne Rücksicht auf gute Manieren in sein Arbeitszimmer zurückkehren wollte, öffnete sich die Tür.
„Herr Kilian, bitte.“
Die Praktikantin schob sich mit ihrer Körperfülle langsam an ihrem Chef vorbei, ohne ihn anzusehen. Er nahm auf dem Drehstuhl Platz, der noch die Wärme der jungen Frau gespeichert hatte. Es war wie eine unangenehme Berührung, und er stand wieder auf und zog einen anderen Stuhl heran. Den verwunderten Blick des Kommissars nahm er wortlos in Kauf.
Lauer räusperte sich, sagte aber nichts. Minutenlang saßen sie so nebeneinander, als hätten sie keine andere Absicht, als die Beständigkeit ihres Schweigens zu prüfen. Die angespannte Stille erinnerte Alexander an den Beginn der Sitzungen einer Selbsterfahrungsgruppe, an der er vor langen Jahren ein paarmal und mit niederschmetternden Rückmeldungen teilgenommen hatte. Er lehnte sich zurück und wartete. Der Kommissar starrte ihn unverwandt an und strich sich mit dem Mittelfinger der rechten Hand langsam über die Unterlippe. Er wiederholte die Bewegung mehrfach, dann legte er die Hand auf die Tischplatte.
Schweigen als Prüfung, dachte Alexander, Schweigen als Test, wie lange er es aushielt.
„Warum sagen Sie nichts?“
„Ich dachte, Sie wollten mich etwas fragen und würden noch überlegen, was.“
„Sehr rücksichtsvoll.“ Lauer lächelte ein wenig, und Alexander bemühte sich, etwas stärker zurückzulächeln.
Im nächsten Moment wurde der Kommissar wieder ernst. „Ist Ihnen noch etwas eingefallen, was für uns von Nutzen sein könnte?“
Wieder hatte Alexander dieses schlechte Gewissen. Vieles war ihm eingefallen, und manches davon würde er offenbaren müssen, aber es war ihm nicht gelungen, heute Nacht zu einer Entscheidung darüber zu kommen. Nur eines war sicher: Den Namen Bustelo musste er für sich behalten, wollte er nicht selbst in einem Abgrund versinken. José Bustelo war als einziger Mitwisser noch am Leben.
Er schüttelte den Kopf und versuchte, sich seine Unruhe nicht anmerken zu lassen. „Nein, nichts, was von Bedeutung sein könnte.“
„Dann erzählen Sie mir das Unbedeutende.“
„Das Unbedeutende?“, wiederholte Alexander und starrte auf die Finger des Kommissars, die begonnen hatten, auf der Tischplatte einen langsamen Takt zu klopfen.
Der Beamte mit dem schwarzen Dreitagebart im finsteren Gesicht hatte seine Augen vom Bildschirm gelöst und sah Alexander ausdruckslos an. Irgendwie erinnerte er ihn mit seiner zu großen Nase an den Räuber Hotzenplotz aus Corinnas Kinderbuch. Nur der Hut mit der Feder fehlte.
„Frau Elytis hatte offenbar Angst, als ich sie auf dem Flughafen traf, aber sie hat mir nicht gesagt, wovor.“
„Flugangst?“
„Möglich.“
„Oder etwas anderes?“
„Ich weiß es nicht. Sie habe Angst vor dem, was auf sie zukommen würde, sagte sie.“
„Haben Sie eine Vermutung?“
„Gar keine.“
Der Rhythmus der Finger war schneller geworden und brach plötzlich ab. „Haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen an mich?“
Ende der Leseprobe aus 256 Seiten
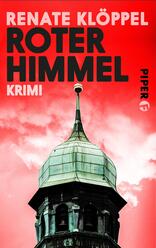












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.