

Schneegrab Schneegrab - eBook-Ausgabe
Roman
— Ein packender historischer Roman um ein Bergdrama im Himalaya„Auch mit ›Schneegrab‹ erschafft Michelle Paver wieder eine unglaublich atmosphärische Story, die nicht nur den Zeitgeist einfängt, sondern auch sonst beim Lesen für eine unbehagliche und zugleich einnehmende Unterhaltung sorgt.“ - letterheart_buecherblog
Schneegrab — Inhalt
Liegt ein Fluch auf diesem Berg?
Der Himalaya, 1935: Fünf Engländer brechen von Darjeeling aus auf, um den heiligen Gipfel des dritthöchsten Berges der Welt zu bezwingen. Je höher sie kommen, desto gespenstischer wird die Atmosphäre. Die Stimmung zwischen den Männern, vor allem zwischen den sehr ungleichen Brüdern Stephen und Kits, droht zu kippen. Immer klarer wird: Der Berg ist nicht ihr einziger Feind.
Während der Wind abflaut, wächst das Grauen. Gezeichnet von den Schrecken der extremen Höhe stoßen die Männer auf ein unheimliches Geheimnis aus der Vergangenheit, das nicht im Schnee begraben bleiben will …
Reinhold Messner über den Kangchenjunga als Romanschauplatz:
„Für einen spannenden, mystischen Berg-Roman gibt es keinen geeigneteren Achttausender im Himalaya als den Kangchenjunga – die fünf Schatzkammern des Schnees! Was für ein Berg!
Mehrfach scheiterten in den Dreißigerjahren Alpinisten bei diesem großen Vorhaben: an Höhenkrankheit, Höhenstürmen, durch Lawinentod.
Der Geist der verstorbenen Bergsteiger sowie der überlieferte Fluch des Berges sind nach wie vor eine großartige Basis für einen mitreißenden, packenden Berg-Roman.“
Leseprobe zu „Schneegrab“
1
Darjeeling, Westbengalen, April 1935
„Ach, hier sind Sie also, Dr. Pearce!“ Charles Tennants Tochter kommt, gefolgt von zwei englischen Springer-Spaniels, über den Rasen gehastet. „Dieser grässliche Nebel. Jetzt kriegen Sie den Berg gar nicht zu sehen, was jammerschade ist!“
„Vielleicht klart es ja noch auf“, erwidere ich und bücke mich, um die Hunde zu streicheln.
»Darauf dürfen wir leider nicht hoffen. Offenbar hat es sich endgültig zugezogen. Am besten kommen Sie wieder rein. Schließlich können wir es uns nicht erlauben, dass sich der Expeditionsarzt [...]
1
Darjeeling, Westbengalen, April 1935
„Ach, hier sind Sie also, Dr. Pearce!“ Charles Tennants Tochter kommt, gefolgt von zwei englischen Springer-Spaniels, über den Rasen gehastet. „Dieser grässliche Nebel. Jetzt kriegen Sie den Berg gar nicht zu sehen, was jammerschade ist!“
„Vielleicht klart es ja noch auf“, erwidere ich und bücke mich, um die Hunde zu streicheln.
„Darauf dürfen wir leider nicht hoffen. Offenbar hat es sich endgültig zugezogen. Am besten kommen Sie wieder rein. Schließlich können wir es uns nicht erlauben, dass sich der Expeditionsarzt eine Erkältung einfängt, bevor Sie überhaupt aufgebrochen sind.“
„Danke für Ihre Sorge. Einen Moment, ich rauche nur noch meine Zigarette zu Ende.“
„Wie Sie meinen“, entgegnet sie mit einem biestigen Lächeln.
Millicent Tennant ist über vierzig und in ihrem Tweedkostüm eine stattliche Erscheinung. Vom jahrelangen tadelnden Schürzen der Lippen haben sich in ihrem Gesicht tiefe Falten zwischen Mund und Kinn eingegraben, sodass sie an die Puppe eines Bauchredners erinnert. Außerdem scheint sie Freude daran zu haben, ihren Mitmenschen den Spaß zu verderben, und es gefällt ihr gar nicht, dass ich mich aus ihrem Teekränzchen verdrückt habe. Vielleicht befürchtet sie ja, ich könnte hinter ihrem Rücken zu ihrem Vater vordringen. Sie bewacht Charles Tennant nämlich wie eine Löwin ihr Junges und hat es sichtlich genossen, uns zu eröffnen, der alte Herr habe kurz vor unserem Eintreffen einen „Anfall“ erlitten und könne mindestens eine Woche lang weder uns noch sonst jemanden empfangen. „Und bis dahin sind Sie bereits unterwegs in der Wildnis, wirklich jammerschade.“
Während die anderen ziemlich enttäuscht waren, stört es mich nicht weiter. Ich bin einfach nur außer mir vor Glück, weil ich überhaupt hier bin. Noch immer kann ich es kaum fassen, dass ich nach der mehrwöchigen Anreise nun tatsächlich auf einer Kuppe des Himalaya stehe. Auf über zweitausend Metern Höhe, im Rosengarten von Charles Tennant. Charles Tennant, der letzte Überlebende der Lyell-Expedition.
Vielleicht liegt es ja am Schlafmangel, dass mir meine gesamte Umgebung auf so überwältigende Weise beeindruckend erscheint: der Duft der feuchten Rosen, der Ruf eines Vogels irgendwo im Dunst. Und die magische Anziehungskraft des Berges, den wir besteigen werden.
„Vorsicht, die Felskante, Dr. Pearce“, ruft Millicent Tennant aus. „Da geht es ziemlich weit nach unten.“
Als ich mich über die niedrige Steinmauer beuge, stockt mir der Atem. „Gütiger Himmel, wie recht Sie haben.“ Durch den Nebel kann ich in schwindelerregender Tiefe gerade noch die rötlich schimmernden Umrisse eines Dorfes ausmachen. Die Baumwipfel unter mir sind abweisend und reglos. Doch dort, beinahe in Reichweite, bewegt sich eine winzige, schemenhafte Gestalt auf einem Ast. Vielleicht einer der Makaken, vor denen man mich gewarnt hat.
Wie gerne würde ich einen Blick auf den Berg erhaschen. Als ich verspätet in Darjeeling eintraf, wurde ich im Planter’s Club von einer in überschwänglichen Worten abgefassten Nachricht von Kits erwartet, der mich zum „Tee mit Charles Tennant!!!“ einlud. Wer weiß, vielleicht gelingt es mir ja, ihn zu überreden, sein berühmtes Schweigen zu brechen!!! Doch als ich durchgerüttelt nach einer Fahrt in einem Pferdefuhrwerk, einer sogenannten tonga, über in Nebel gehüllte Teeplantagen das einstöckige Haus des alten Herrn erreicht hatte, konnten mir die anderen nur noch die „atemberaubende Aussicht“ schildern, die eine Stunde zuvor hier zu genießen gewesen war. Und als ich endlich aus dem Salon in den Garten zu entfliehen vermochte, waren dichte Wolken aufgezogen und hatten den Berg verschluckt.
Und das sind Wolken, wie sie im Buche stehen, die mich da von allen Seiten umwabern. Eine feuchte, stumme Invasion, die den Nachmittag viel zu früh verdunkelt.
„Habe ich schon erwähnt, dass ich die Familie Ihrer Verlobten kenne?“, fährt Millicent Tennant fort und weist das angebotene Zigarettenetui mit einem abermaligen verkniffenen Lächeln zurück. „Oder sollte ich besser Ex-Verlobte sagen?“
„Ach, wirklich?“, murmle ich. „Das ist mir völlig neu.“
„O ja, die arme, liebe Clare ist mein absoluter Liebling. Soweit mir bekannt ist, hat sie sich untadelig verhalten. Sie hat kein böses Wort über Sie verloren.“ Mit neugierig glitzernden Knopfaugen mustert sie mein Gesicht.
Die arme Clare, ganz richtig. Doch dass ich Millicent Tennant nun Abbitte leiste, kommt überhaupt nicht infrage. Ich habe mich in London genug entschuldigt.
„Kam ja schrecklich überraschend, dieser Schritt“, spricht sie weiter. „Nur knapp eine Woche vor dem großen Tag.“
„Ich fürchte, Sie haben recht. Doch Clare teilt meine Ansicht, dass es so das Beste ist.“ Und nein, nur über meine Leiche werde ich dir unter die Nase reiben, warum ich die Verlobung gelöst habe, damit du es in ganz Darjeeling herumtratschen kannst. Was soll ich auch sagen? Dass ich gerade noch rechtzeitig bemerkt habe, wie ich kurz davor war, mich in meinen Bruder zu verwandeln?
Die Stille dauert an. Die nachgezogenen Augenbrauen meiner Gastgeberin heben sich. „Tja“, meint sie mit aufgesetzter Fröhlichkeit. „Die anderen fragen sich sicher schon, wo Sie stecken. Ihr Bruder, der arme Junge, scheint ein wenig niedergeschlagen.“
Diese Untertreibung bringt mich zum Schmunzeln. Kits hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um sich eine Audienz bei Charles Tennant zu erschmeicheln. Sein Scheitern hat ihm gründlich die Laune verhagelt.
„Kits ist ein bisschen enttäuscht“, antworte ich. „Er verklärt die Lyell-Expedition, seit er ein kleiner Junge ist, und kann ganze Passagen von Besiegt, doch voller Kampfesmut auswendig aufsagen. Er hatte sich so darauf gefreut, Captain Tennant kennenzulernen.“
„Ach, wie schade.“ Sie pflückt ein Blatt von ihrem Rock. „Tja, jetzt muss ich mich wieder um meine anderen Gäste kümmern. Vergessen Sie nicht, dass wir uns hier in den Tropen befinden, Dr. Pearce. Es wird viel schneller dunkel, als Sie es gewöhnt sind.“
„Danke, ich werde darauf achten.“
Als sie endlich weg ist, zünde ich mir noch eine Zigarette an und warte, bis Nebel und feuchter Rosenduft die Erinnerung an sie vertrieben haben.
Ich beuge mich über die Mauer. Kaum vorstellbar, dass sich dort unten ein dampfender, malariaverseuchter Dschungel befindet. Laut Kits sind es gerade einmal fünfundsiebzig Kilometer bis zu unserem Berg. Allerdings werden wir drei Wochen lang stramm marschieren müssen, um ihn zu erreichen.
Vor Aufregung zieht sich mir der Magen zusammen. Du hast es getan, Stephen, du hast es wirklich getan. Schluss mit London, Schluss mit Clare, Schluss mit den Rechtfertigungen. Von nun an gibt es bloß noch Schnee, Eis und Felsen. Meilenweit entfernt von den grässlichen Verwicklungen, zu denen zwischenmenschliche Gefühle mitunter führen.
So seltsam es klingen mag, aber ich habe mir, seit mein Schiff in Southampton in See stach, kaum gestattet, an den Berg selbst zu denken. Vielleicht habe ich ja befürchtet, damit ein Unglück heraufzubeschwören. Ich habe mir einfach den sinnbildlichen weißen Gipfel ausgemalt. So wie den Glasberg im Märchenbuch, als wir Kinder waren.
Aber jetzt ist der Berg unvermittelt in greifbare Nähe gerückt. Er hat diese Wolken geschickt, er macht sich bemerkbar. Ich spüre seinen kalten, klammen Hauch auf der Haut.
In drei Tagen geht es los. Ich kann es kaum noch erwarten.
Sie hatte recht: Die Nacht ist so überfallartig hereingebrochen, als habe jemand eine Tür zugeschlagen.
Als ich über den Rasen zurückstolpere, bewegt sich etwas in der Dunkelheit hinter mir. Im nächsten Moment lugt ein Kopf über die Mauer, und eine schemenhafte Gestalt huscht davon. Die Makaken übernehmen das Kommando über den Garten.
Ich steuere auf das Licht zu, das durch die Terrassentüren auf die Veranda strömt. An der Vortreppe geraten meine Schienbeine leider mit einem Steinhaufen in Konflikt. Ich schimpfe vor mich hin.
„Wer da?“, ruft eine Männerstimme – scharf im Ton, gebildet, alt.
Ach herrje, das sind ja gar nicht die Türen zum Wohnzimmer. Ich bin falsch abgebogen. „Verzeihung, ich …“
„Stehen Sie nicht da draußen rum wie ein begossener Pudel! Kommen Sie rein und machen Sie die verdammte Tür hinter sich zu!“
Ich finde mich in einem großen, verwohnten Arbeitszimmer wieder, in dem es nach abgestandenem Zigarrenrauch stinkt. Im Kamin knistern Holzscheite, ein räudiges Tigerfell bedeckt den Boden. Die Lampe hat Fransen am Schirm und spendet ein schummriges Licht. Überall stehen Raucherutensilien herum: Tischfeuerzeuge, Humidore, Messingaschenbecher. Die Papierstapel auf dem gewaltigen Schreibtisch aus Sandelholz sind mit indischem Nippes gegen das Wegfliegen gesichert: ein mörderischer Krummdolch, eine gruselige Holzmaske mit hervorquellenden Augen und – auf einem Kästchen aus Mahagoni liegend – eine primitive Trompete, geschnitzt aus einem Material, das eindeutig früher ein menschlicher Oberschenkelknochen war.
Den Besitzer der Stimme entdecke ich zusammengekauert in einem Lehnsessel in der düstersten Zimmerecke, mit einer Decke über den Knien. Trotz seines Alters scheint er noch gut bei Kräften zu sein: breite Schultern, drahtiges silberweißes Haar und schwarze, stechende Augen, die mich abschätzend mustern. Sein grobknochiges Gesicht ist von geplatzten Äderchen durchzogen und hat sich seit dem berühmten Foto, auf dem er, in die Kamera grinsend, neben Edmund Lyell steht, auf erschreckende Weise verändert. Dennoch sind das Nussknackerkinn und die dunklen, über der Nasenwurzel ein Dreieck bildenden Augenbrauen unverkennbar.
Schlagartig bin ich wieder ein kleiner Junge, der ehrfürchtig vor seinem Helden steht. „Sie sind Charles Tennant“, platzt es wenig geistreich aus mir heraus.
„Sie haben es erfasst“, entgegnet er mit rauer Stimme.
„Es tut mir entsetzlich leid, Sir, ich war auf der Suche nach dem Wohnzimmer …“
„Lassen Sie das Tamtam. Ich verabscheue Tamtam. Jetzt sind Sie hier, also bleiben Sie!“
Mein Gott, er ist es wirklich. Als ich vortrete und ihm die Hand entgegenstrecke, kämpfe ich mit einem nicht sehr edlen Anflug von Schadenfreude. Der arme Kits. Er wird grellgelb werden vor Neid. „Stephen Pearce, Sir. Wie geht es Ihnen?“
„Für einen Arzt sehen Sie noch ziemlich jung aus“, knurrt er und straft meine Hand mit Nichtachtung.
Ich gestatte mir den Anflug eines Lächelns. „Ich bin vierunddreißig.“
„Mit dem eigentlichen Medikus gab es doch irgendwelche Schwierigkeiten, richtig?“
„Ich bin in letzter Minute eingesprungen, Sir. Er hat sich drei Tage vor der Abreise bei einem Autounfall das Bein gebrochen …“ Verlegen halte ich inne. Tennant sitzt gar nicht in einem Lehnsessel, sondern in einem altmodischen Rollstuhl, den man mithilfe von hölzernen Griffrahmen an den Rädern vorwärtsbewegen kann. Charles Tennant hat durch Erfrierungen beide Füße verloren.
Als er bemerkt, wie peinlich mir dieser Lapsus ist, grinst er spöttisch. Dann verlangt er, den Grund meiner Schimpfkanonade vorhin auf der Veranda zu erfahren. Ich erwähne den Steinhaufen, worauf er freudlos auflacht. „Das ist ein Grab, ist Ihnen das nicht aufgefallen? Der Foxterrier meines Enkels. Der dumme kleine Fratz ist vor eine tonga gelaufen. Der Hund, nicht der Junge.“
Ich presse die Lippen zusammen und nicke. Im nächsten Moment entdecke ich an der Wand hinter dem Schreibtisch ein großes, gerahmtes Foto, und alles andere ist vergessen.
Der Anblick ist wie Musik, ein dunkler, kräftiger Klang, der mich durchpulst. Der Berg unterscheidet sich grundlegend vom Everest, Annapurna oder K2. Er ist kein einsamer, keilförmiger Gipfel, sondern besteht aus einem gewaltigen, breiten Massiv, gespickt mit verschiedenen Satellitengipfeln. Ein einzelner spitzer Reißzahn erhebt sich über die anderen … Der Kangchenjunga.
Niemand weiß genau, was der Name bedeutet. Aber man hat sich auf „die fünf Juwelen des Schnees“ geeinigt. Was das allerdings heißen soll, bleibt ebenfalls rätselhaft. Bezieht es sich auf die Gipfel? Die fünf riesigen Gletscher, die sich die Hänge hinab ergießen?
Jedenfalls berührt mich das Bild, und ich verspüre dieselbe Mischung aus Vorfreude und Grauen wie vor jeder Expedition. Wir werden diesen Berg bezwingen. Wir werden die ersten Menschen weltweit sein, die je auf seinem höchsten Gipfel gestanden haben.
Tennant späht mit zusammengekniffenen Augen hinauf zu dem Foto, als bereite ihm allein das Hinschauen Schmerzen. Im nächsten Moment wendet er sich mit einem eigenartig krampfhaften Erschaudern ab. „Die Lepcha nennen ihn Kong Chen“, murmelt er. „Das heißt ›Großer Stein‹. Was die Dummköpfe aber nicht davon abhält, ihn anzubeten.“
„Kann man ihn von hier aus sehen, Sir?“ Obwohl hinter den Terrassentüren jetzt alles dunkel ist, habe ich den Verdacht, dass sie nach Norden zeigen.
„Das Foto wurde dort gemacht, wo Sie jetzt stehen“, antwortet Tennant überraschend unwirsch. „Man weiß nie, wann er sich zeigt.“ Er umklammert seine Knie. Tennant hat große, kräftige Hände, an denen dicke blaue Adern hervortreten. Seine Fingerknöchel verfärben sich vor Anspannung weiß.
Ich frage mich, wie er es aushält, den Berg tagtäglich vor Augen zu haben. Eine ständige Erinnerung an die Kameraden, die nie zurückgekehrt sind. Was mag er wohl sehen, wenn er das Foto betrachtet?
Außerdem wünsche ich mir allmählich, die anderen wären ebenfalls hier im Raum, denn ich fühle mich wie ein schlecht vorbereiteter Schuljunge. Eigentlich hatte ich vorgehabt, auf der Reise alles über Lyell zu lesen. Nur dass die Gepäckträger in Southampton meine Büchertasche verschlampt haben, weshalb mein Wissen, was die tatsächlichen Ereignisse angeht, recht lückenhaft ist: ein Schneesturm, eine Lawine und fünf Tote.
Der alte Mann sitzt zusammengesunken in seinem Rollstuhl. Ich hätte ihn mir ganz anders vorgestellt. In Besiegt, doch voller Kampfesmut wird Charles Tennant als echter Tausendsassa geschildert. Als guter Kumpel, mit dem jeder befreundet sein will. Wie konnte er sich in ein derart verbittertes, von Dämonen gequältes menschliches Wrack verwandeln?
Aber vermutlich hätte das, was er durchmachen musste, jedem den Rest gegeben. Obwohl es Edmund Lyell nicht geschadet zu haben schien. Der hat zwar ein Bein und eine Hand verloren, seinen Erfolg im Leben aber dennoch errungen. Ein Buch, Vortragsreisen, die Erhebung in den Adelsstand …
Tennant entgeht nichts. „Da habe ich Ihnen wohl Ihre Illusionen geraubt, was? Sind Sie etwa auch einer dieser jungen Rotzlöffel, die uns ihre ganze Kindheit lang angehimmelt haben?“
„Nein“, erwidere ich trocken. „Nur, bis ich neun war. Dann hat mir mein älterer Bruder meine Ausgabe von Besiegt, doch voller Kampfesmut weggenommen. Übrigens trinkt er gerade in Ihrem Wohnzimmer Tee. Er würde alles dafür geben, Sie kennenzulernen.“
„Ist er etwa der Schwachkopf, der entschieden hat, die Route über die Südwestflanke zu nehmen?“
Ich zucke zusammen. „Davon weiß ich nichts.“
„Was? Sie wissen nicht einmal, wohin es geht?“
Verdammt, Kits, das hättest du mir wenigstens verraten können. „Wie gesagt, Sir, bin ich in letzter Minute eingesprungen. Ich … ich nehme an, man hat diese Strecke gewählt, weil es die beste ist.“
„Stimmt. Aber Sie werden es nie schaffen.“
„Warum nicht? Sie haben es doch auch fast geschafft?“
Er zögert, und seine Miene nimmt einen argwöhnischen Ausdruck an. „Das hätten wir, wenn Lyell nicht gewesen wäre. Glauben Sie bloß kein Wort von seinem Geschreibsel. Er war ein schlechter Bergsteiger, als Expeditionsleiter eine Niete und außerdem eitel. Das sind Helden übrigens häufig.“
Sein Tonfall trieft von Hass, und ich halte mir vor Augen, dass er weit über sechzig ist. Außerdem steht es seiner Tochter zufolge um seine Gesundheit nicht unbedingt zum Besten.
„Die Südwestflanke, Sir“, wage ich mich vor. „Gibt es damit ein Problem?“
„… ein Problem?“, wiederholt er murmelnd. Wieder huscht sein Blick zu dem Foto, und er zuckt erschaudernd zusammen. Kurz malt sich ein sonderbarer Ausdruck auf seinem Gesicht. Offenbar hat er Angst.
Doch schon im nächsten Moment ist es vorbei, und Tennant hat sich wieder im Griff. „Was für Probleme könnte es wohl auf dem gefährlichsten Berg der Welt geben?“, knurrt er. „Sie kennen doch den Himalaya, oder? Schon mal dort geklettert?“
„Nein, Sir, bin zum ersten Mal in Indien.“
„Gütiger Gott, steh uns bei!“ Sein mitleidiger Blick lässt mich rot werden.
Trotzdem schlage ich sämtliche Vorsicht in den Wind und stelle die Frage, die mir unter den Nägeln brennt. „Warum haben Sie nie selbst einen Bericht über die Expedition geschrieben, Sir?“
„Was, zum Teufel, bilden Sie sich ein, mich so etwas zu fragen?“ Trotz seines streitlustigen Tonfalls wandert sein Blick zum Schreibtisch. Mir stockt der Atem. Könnte es sein, dass er doch etwas zu Papier gebracht hat?
„Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten“, entschuldige ich mich. „Aber Sie können vermutlich nachvollziehen, warum wir alle so entsetzlich neugierig sind. Es ist fast dreißig Jahre her, und Sie haben niemals darüber gesprochen oder geschrieben …“
„Zwei Brüder, die miteinander in die Berge gehen“, unterbricht er mich mit rauer Stimme. „Da können Sie sich wohl blind vertrauen, oder?“
Der plötzliche Themenwechsel trifft mich wie eine Ohrfeige und knallt die Tür für weitere Fragen zu.
„Wir klettern schon seit Jahren gemeinsam“, erwidere ich kühl.
Ein ungläubiges Schnauben. „Und die anderen?“
„Die habe ich erst heute kennengelernt. Wir sind getrennt angereist.“
„Und warum wollen Sie zu diesem Gipfel hinauf?“
„Verzeihung?“
„Sie haben mich sehr wohl verstanden. Warum?“
„Braucht man dazu einen Grund?“
Überraschenderweise scheint ihm die Antwort zu gefallen. Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem grimmigen Lächeln. „Ihnen ist schon bewusst, dass Norton ihn als schwieriger einschätzt als den Everest?“
„Ja, das habe ich gelesen.“
Das nun eintretende Schweigen macht mich glauben, die Geister von Nortons bedauernswerten Begleitern Mallory und Irvine befänden sich mit uns im Raum.
Die Stille dauert an. Der alte Mann scheint mich vergessen zu haben. Er umklammert noch immer seine Knie und spannt das Nussknackerkinn an. „Er tötet einen, wenn man ihm die Gelegenheit gibt“, stößt er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor „O ja, das tut er. Sie haben ja keine Ahnung …“
Wieder wirft er einen hastigen Blick auf das Foto – und fährt mit jenem seltsamen, krampfartigen Erschaudern zurück.
Inzwischen bin ich mir sicher. Er hat Angst. Charles Tennant, einer der zähesten Alpinisten, die je gelebt haben, hat Angst vor diesem Berg.
„Geben Sie mir das Kästchen auf dem Tisch“, herrscht er mich auf einmal an, sodass ich vor Schreck zusammenzucke.
„Äh … welches, Sir?“
„Das, auf dem der kangling liegt.“
„Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz.“
„Die Trompete, verdammt!“
Ich entferne die Knochentrompete vom Deckel und reiche ihm das Mahagonikästchen. Als es auf seinem Schoß liegt, bedeckt er es mit beiden Händen.
Mein Herz beginnt, laut zu pochen. Hat er mich aus einem bestimmten Grund aufgefordert zu bleiben? Um mich auf die Probe zu stellen? Um den Mut zu fassen, mir etwas – nur was genau – mitzuteilen?
Oder vernebeln Müdigkeit und Aufregung mir schon das Hirn?
Das Schweigen wird unerträglich. Dennoch macht er keine Anstalten, es zu brechen.
Ich halte nach wie vor die Knochentrompete in der Hand. Das Mundstück besteht aus schwarz angelaufenem Silber, das andere Ende ist mit schmuddeligen Türkisen besetzt. Nur um etwas zu sagen, frage ich ihn, wie das Ding klingt.
Sein Kopf fährt herum, und er starrt mich mit unverhohlenem Entsetzen an. „Was?“, stößt er mit zitternder Stimme hervor. „Wie es klingt? Was, zum Teufel, meinen Sie damit?“
Herrgott, was habe ich jetzt schon wieder angerichtet? Das Blut weicht aus seinem Gesicht, selbst seine Lippen nehmen einen fahlen Farbton an. Meine arglose Frage scheint ihm den letzten Rest Fassung geraubt zu haben.
Er wiegt sich hin und her. Sein Blick ist nach innen gerichtet. Auf die Vergangenheit. „Jede Nacht“, flüstert er. „Jede Nacht, verstehen Sie? Ich sehe sie … meine Kameraden am Kangchenjunga. Ich sehe ihre ausgestreckten Arme … ich höre ihre Hilfeschreie … Ja … ich werde sie immer sehen …“
Verzweifelt halte ich Ausschau nach etwas, das ich ihm einflößen kann. Wasser, Scotch, irgendetwas. Da, eine Karaffe auf dem Bücherregal. Brandy, dem Geruch nach zu urteilen. Ich kippe etwas davon in ein Glas und halte es ihm an die Lippen. Doch er stößt mich mit erstaunlicher Kraft weg.
„Raus!“, brüllt er. „Verschwinden Sie und lassen Sie sich niemals wieder blicken!“
2
Während der Fahrt in der tonga zurück nach Darjeeling kocht Kits vor Wut.
„Wie konntest du einfach bei Captain Tennant hereinplatzen? Und warum hast du mich nicht geholt, verdammt?“
„Das hätte er niemals gestattet“, erwidere ich. „Er ist ziemlich … herrschsüchtig.“
„Tja, das kann ich nicht beurteilen, denn ich habe ihn ja nicht kennengelernt, und vermutlich werde ich es nun auch nicht mehr. Herrgott, Stephen, was hast du bloß zu ihm gesagt?“
„Nichts. Er hat von früher erzählt und sich dabei in diesen Zustand hineingesteigert. Warum hast du mir nicht verraten, dass wir die alte Route von Lyell nehmen?“
„Ich dachte, das hättest du mittlerweile mitgekriegt.“
Wie denn?, würde ich am liebsten entgegnen. Vor seiner Abreise nach Bombay haben wir uns nur einmal gesehen. Ich steckte wegen Clares Familie ziemlich in der Bredouille, während er dringend einen Expeditionsarzt brauchte. Über Routen haben wir nie gesprochen.
Nun sitzen wir nebeneinander und entgegen der Fahrtrichtung in der tonga. Kits’ Blick ist starr auf die Straße gerichtet. Seine Augen sind glasig vor Zorn, und er zieht die Mundwinkel nach unten wie eine Bulldogge die Lefzen. Diese Angewohnheit hatte er schon in unserer Kindheit, ein Warnzeichen, dass ich gerade Prügel riskierte.
Ich bin versucht, ihm unter die Nase zu reiben, dass der alte Tennant ihn für einen Schwachkopf hält, weil er die Südwestflanke nehmen will, doch habe ich mir fest vorgenommen, mich nicht mit ihm zu streiten. Das wäre doch albern, schließlich sind wir beide erwachsene Männer.
Der Straße ist ein dunkler, sich verengender Tunnel aus tropfnassen Himalaya-Zedern und knarzenden Bambusstauden. Bis jetzt regnet es zwar nicht, doch es ist kalt, und die dichten Wolken ringsum, diese Gäste aus einer anderen Welt, ziehen sich immer weiter zusammen.
Ich bin aufgewühlt und habe wegen des alten Mannes ein schlechtes Gewissen. Obwohl ich beim besten Willen nicht sagen kann, warum ihn meine harmlose Frage nach einem angeschmuddelten, folkloristischen Souvenir so aus der Fassung gebracht hat.
Ständig habe ich vor Augen, wie Millicent Tennant ihm „seine Tropfen“ verabreicht und mich mit einem Blick, der einem das Blut in den Adern gefrieren lassen kann, zum Teufel schickt. Meine medizinischen Kenntnisse waren hier eindeutig nicht verlangt. Ich erinnere mich an die Todesangst im Blick des alten Mannes.
Und diese Todesangst macht mir zu schaffen. Die Vorstellung, dass ein weißer Mann – ein Sahib – Angst vor einem Berg hat.
Natürlich ist Angst beim Bergsteigen immer mit von der Partie. Ebenso wie Sehnsucht, Ehrfurcht, Respekt, ja sogar Liebe. Übermächtige, alles andere verschlingende Panik hat darin allerdings nichts zu suchen. Ich bin mir sicher, dass Tennant nicht senil ist. Was also steckt dahinter?
Und da wäre noch etwas. Ich werde den Verdacht nicht los, dass er doch irgendeinen Bericht über die Expedition niedergeschrieben hat.
Woraus sich ein zwingender Schluss ergibt: Diese Vermutung sollte ich Kits gegenüber tunlichst mit keinem Wort erwähnen. Der Himmel weiß, was er anstellen würde, wenn er herausfände, dass wir diesen Bericht nun niemals in die Hände bekommen werden, nur weil ich ins Fettnäpfchen getreten bin.
„Warum genau folgen wir Lyells Route?“, frage ich. „Ich muss zugeben, dass mir ein wenig mulmig dabei ist. Wir dürften doch ständig an die Katastrophe von damals erinnert werden.“
„Wieso musst du immer alles zerpflücken? Hoffentlich fängst du während der Expedition nicht wieder damit an. Der Rest der Mannschaft wäre davon nämlich nicht sehr begeistert.“
„Schon klar. Und warum folgen wir nun Lyells Route?“
„Weil es die beste Route ist.“
„Mehr steckt nicht dahinter?“
„Was soll das heißen?“
„Ach, ich weiß nicht“, frotzle ich. „Dass du dich an die Fersen deines Abgotts heftest und zu Ende bringen willst, was er begonnen hat …“
„Schon gut, spotte du nur, das kannst du schließlich am besten.“
Beschwichtigend hebe ich die Hände.
Aber ich kenne meinen Bruder. Vor einigen Jahren hat jemand am Nordwesthang des Everest Irvines Eispickel gefunden. Kits war wochenlang übellaunig. Warum war er es nicht gewesen, der über das Ding gestolpert und berühmt geworden war? Auch jetzt hat er ein klares Ziel vor Augen: Hinterlassenschaften der Lyell-Expedition aufspüren. Das Werk des großen Meisters vollenden. Der erste Mensch der Welt sein, der einen Achttausender bezwingt. Könnte er den Union Jack auf dem Gipfel aufpflanzen und damit den elenden Deutschen zuvorkommen, wäre dies das Sahnehäubchen.
Ich bedauere es, dass ich mich von dem alten Mann habe aus der Fassung bringen lassen. Dennoch sollte ich meine Lektion daraus lernen. Niemals darf ich vergessen, dass sich alles, was ihm damals zugestoßen ist, vor knapp dreißig Jahren ereignet hat. Seine Furcht darf ihren Schatten nicht auf meinen Berg werfen. Sie darf mich nicht anstecken.
Der Verlust meiner Bücher war deshalb in gewisser Hinsicht ein Segen. Und nur über meine Leiche würde ich mir welche von Kits ausleihen. Kein einziges Wort werde ich über die Lyell-Expedition lesen. Ich will rein gar nichts über die Geschichte von damals wissen. Sie sind Vergangenheit. Sie haben nichts mit uns zu tun.
Der Geruch von Holzkohle und Dung steigt mir in die Nase, und in der Ferne höre ich Hunde kläffen. Wir nähern uns Darjeeling.
„Ich habe gehört, dass es dort einen netten Basar gibt“, meine ich, ohne den Kopf zu wenden. „Warst du schon mal dort?“
Kits schnaubt verächtlich. „Der übliche Eingeborenenkitsch. Ich habe ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die Dorothy und den Jungen gefallen könnten.“
„Wie geht es ihnen?“
„Harry hat natürlich Heimweh, aber er wird sich schon eingewöhnen. Und Ronnie wird bald Kapitän der Schulelf.“ Er verzieht den Mund. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dorothy hat natürlich alle Hände voll zu tun. Dorffest und so weiter. Zurzeit ist eine Menge los auf dem Gut.“
„Natürlich.“
Krähen fliegen mit flatternden Schwingen von etwas Kleinem und Totem am Straßenrand hoch.
„Ich fürchte, Clares Vater wird mich wegen des gebrochenen Eheversprechens vor den Kadi zerren“, sage ich zu Kits.
Er wirft mir einen unwilligen Blick zu und starrt dann weiter mit finsterer Miene auf die Straße.
Das tut er immer. Entweder reden wir über ihn, seine Familie und das Klettern. Oder wir reden gar nicht.
„Hat Captain Tennant noch etwas zu der Route angemerkt?“, fragt er.
Ich zögere. „Nur, dass wir es seiner Ansicht nach nicht schaffen werden.“
Er dreht sich zu mir um. „Und warum nicht?“
„Das habe ich ihn auch gefragt, aber er hat mir nicht darauf geantwortet.“
Die weiß gekalkten Steine, die die Straßenbegrenzung markieren, weisen hier und da dunkelrote Flecken auf. Sie sehen aus wie Blut. Als ich mich bei Kits danach erkundige, erwidert er pan. Ich ziehe ein verständnisloses Gesicht, worauf er die Augen verdreht. „Betelsaft! Die Eingeborenen kauen das Zeug und spucken es wieder aus. Gütiger Himmel, Stephen, was hast du all die Wochen auf dem Schiff nur getrieben? Als ich dir angeboten habe, mitzukommen, habe ich dir einen Rettungsanker zugeworfen, vergiss das nicht! Es wäre doch das Mindeste gewesen, dass du dich, verdammt noch mal, mit dem Land vertraut machst, in das du reist!“
„Das war durchaus meine Absicht, aber die Gepäckträger haben meine Bücher verloren.“
„Das ist wieder mal typisch für dich!“
Ich blicke ihn an. „Kits. Pax.“
Übellaunig fixiert er die Straße und verpasst mir plötzlich eine Kopfnuss. „Manchmal kann man an dir wirklich verzweifeln, kleiner Bruder!“
Erstaunlich, was ein gutes Abendessen und einige Whisky Soda bei einem Mann bewirken können. Mein Unbehagen, was Charles Tennant betrifft, hat sich mehr oder weniger gelegt. Außerdem habe ich Kits besänftigt, indem ich mich nach seinem neuen Billardzimmer und danach erkundigt habe, wie sich der kleine Ronnie bei seiner ersten Jagd geschlagen hat.
Inzwischen haben wir es uns im Rauchersalon des Planters’ Club gemütlich gemacht und harren unseres Expeditionsleiters Major Cotterell, der einen „Kriegsrat“ einberufen hat. Wir haben beide keinen blassen Schimmer, was das zu bedeuten hat.
Unsere Sessel stehen nah am Kamin. Hinter uns verbreiten gewaltige Palmen in Messingkübeln eine angenehm intime Stimmung. Als ich die anderen Sahibs durch einen Nebel aus Zigarrenqualm betrachte, fühle ich mich nicht mehr so ganz wie der Neue in der Schule.
McLellan ist ein pummeliger junger Schotte mit karottenrotem Haar und Sommersprossen. Ich werde darauf achten müssen, dass er sich keinen Sonnenbrand holt. Er hat sich von seinem Regiment in Punjab beurlauben lassen. Sein Auftreten ist ein wenig wichtigtuerisch, weshalb er als Verantwortlicher für Träger und Ausrüstung vermutlich den richtigen Posten hat. Außerdem spricht er fließend Nepalesisch, dazu noch etwas, das er als „Basar-Hindi“ bezeichnet, und offenbar hat er als Einziger von uns Klettererfahrung im Himalaya. Allerdings weist sein Akzent darauf hin, dass er nicht ganz zu unseren Kreisen gehört, sosehr er sich auch bemüht, diesen zu unterdrücken.
Garrard kenne ich oberflächlich aus dem Internat in Winchester, wo er Kits’ bester Freund war. Er zeichnet verantwortlich für unsere Öffentlichkeitsarbeit, also für Presseerklärungen und Fotos, und wird sich zudem um die per Funk aus Darjeeling übermittelten Wetterberichte kümmern. Garrard ist Atheist, Snob sowie Salonsozialist und darüber hinaus mit seinem schütteren Haar, den zu eng beieinanderstehenden, dunkel umränderten Augen und der riesigen Hakennase eine beeindruckend hässliche Erscheinung. Trotz seiner Klugheit und Belesenheit hängt er sehr an Kits. Es ist eine jener sonderbaren Freundschaften, die, warum auch immer, sämtlichen Widrigkeiten trotzen. Als ich ihn beim Essen gefragt habe, warum er sich an der Expedition beteiligt, ist er errötet. „Warum? Weil Kits mich eingeladen hat. Aus keinem anderen Grund.“
In Winchester haben ihn seiner Nase wegen alle bloß „Beak“ – Schnabel – genannt, doch wir drei haben zuvor beschlossen, bei der Expedition auf Spitznamen zu verzichten, damit die anderen Teilnehmer sich nicht ausgeschlossen fühlen. Deshalb heißt Garrard Garrard, und ich heiße auch nicht mehr „Bodge“ – Tollpatsch. Was für ein Glück, denn ich hasse diesen Spitznamen, seit Kits ihn mir an meinem ersten Schultag verpasst hat.
Kits bleibt natürlich weiter Kits. Seit seiner Geburt hat niemand mehr Christopher zu ihm gesagt. Als unser bester Schütze wird er uns unterwegs in den Bergen mit Wildbret versorgen. Und da er auch der beste Bergsteiger von uns allen ist, haben wir dank seiner eine höhere Chance, den Gipfel zu erreichen.
Als Major Cotterell hereinmarschiert kommt, springen wir alle auf. Er bedeutet uns, wieder Platz zu nehmen, und wirft sich dann auf dem Teppich vor dem Kamin in Positur.
„Habe heikles Thema anzusprechen“, beginnt er und stopft stirnrunzelnd seine Pfeife aus Bruyèreholz. „Eingang: Schreiben von Captain Tennant mit unmissverständlicher Aufforderung, nicht Route von damals über Südwestflanke zu nehmen.“
Es herrscht entsetztes Schweigen.
Zu meiner eigenen Überraschung ergreife ich als Erster das Wort. „Es ist mir bewusst, dass ich weniger bewandert bin als Sie, aber … wenn wir uns stattdessen für den Nordgrat entscheiden würden, müssten wir doch einen völlig anderen Weg festlegen, oder?“
„Ja, natürlich müssten wir das!“, herrscht McLellan mich an, sodass ich erschrocken zusammenzucke. „Und ich müsste eine neue Mannschaft aus Kulis und Yak-Treibern zusammenstellen. Kommt also überhaupt nicht infrage!“
„Warum könnte er wollen, dass wir unsere Pläne ändern?“, erkundigt sich Garrard und zupft an seiner Hakennase, eine Geste, an die ich mich noch aus der Schule erinnere.
„Das sagt er nicht.“ Cotterell spricht mich direkt an. „Hat er Ihnen gegenüber Gründe erwähnt, Dr. Pearce?“
„Nur, dass wir seiner Ansicht nach scheitern werden, Sir. Er hat jedoch nicht ausdrücklich davon abgeraten, es zu versuchen.“
„Könnte er womöglich recht haben?“, wendet Garrard ein. „Schließlich haben es die meisten Gruppen über den Nordgrat …“
„Wieso fängst du jetzt damit an?“, fährt Kits ihn an. „Das haben wir doch schon eine Million Mal durchgekaut. Die Route von Lyell ist die beste!“
Garrard wirft ihm einen entschuldigenden Blick zu. „Kits, ich habe doch nur laut überlegt. Smythe hat dem Nordgrat den Vorzug gegeben. Und manche sagen, die Südwestflanke sei unbesteigbar.“
„Wer sagt das?“, faucht Kits ihn an.
„Tja, Bauer zum Beispiel.“
„Auch mit ›Schneegrab‹ erschafft Michelle Paver wieder eine unglaublich atmosphärische Story, die nicht nur den Zeitgeist einfängt, sondern auch sonst beim Lesen für eine unbehagliche und zugleich einnehmende Unterhaltung sorgt.“
„Ein Meisterwerk, das einem das Herz gefrieren lässt.“
„Eine beängstigende und mystische Bergsteigergeschichte, die einige Fakten aus der Vergangenheit aufgreift und mit einer extrem beklemmenden, sogartigen Wirkung punkten kann.“
„Michelle Paver hat ihrem Roman nach umfangreicher Recherche und mit raffinierter Sprache eine steigende, geradezu unheimliche Sogwirkung gegeben, die bis zum Ende nicht nachlässt.“
„Ein tiefsinniges, sensibles Buch, dass durch eine hohe Spannung und eine tiefgehende Sensibilität überzeugt. Man möchte gar nicht mehr aufhören, zu lesen. Absolut zu empfehlen.“
„Dieses Buch ist ein Pageturner der süchtig macht. Mich hat das Buch auf der Stelle gepackt.“
„Schneegrab ist der perfekte Lesestoff für lange dunkle Abende. Eine Mischung aus Bergsteiger- und Gruselroman, gekonnt und atmosphärisch dicht geschrieben“
„Ein packender Roman“
„Auch hiermit ist der Autorin zeitgenössischer Geister- und Schauerromane eine spannende Lektüre geglückt.“
„Packender Roman.“
„Wunderbar auf den Punkt gebrachte Mischung aus Abenteuer- und Gruselgeschichte, die glaubhaft im ›menschlichen Faktor‹ der Protagonisten wurzelt und langsam, aber unaufhaltsam auf einen konsequenten Höhepunkt zusteuert: Spannung ohne Gewäsch dank einer spursicheren Erzählökonomie.“
»Paver ist die Meisterin der Spannung«














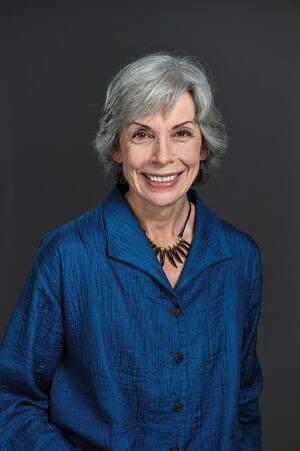



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.