
Schönes Chaos - eBook-Ausgabe
Mein wundersames Leben
„Sympathisch, kein bisschen trocken und mit tiefer Dankbarkeit zeichnet er sein privat wie wissenschaftlich bewegtes Leben nach.“ - Technology Review
Schönes Chaos — Inhalt
Für Benoît Mandelbrot ist Mathematik Poesie: Schönheit und Beschreibung der Welt. Als Junge kommt er, 1924 in Warschau geboren, nach Paris und wird von seinem Onkel in die Mathematik eingeführt. Chaotische Systeme prägen seine Zeit; während des Krieges muss er sich vieles selbst beibringen. Seiner unkonventionellen Denkweise verdankt Mandelbrot die größten Erfolge, aber auch die Rolle des Außenseiters: Nicht an der Universität, sondern bei IBM in den USA fand er genügend Freiheit für seine visionären Ideen. Er begründete die „fraktale Geometrie“, die komplexe Gebilde berechnen kann, und entwickelte die ersten Computerprogramme, um sie grafisch darstellen. Und sein weltberühmtes Apfelmännchen, die Mandelbrot-Menge, findet Ordnung im Ungenauen, und überall Anwendung: Wie wachsen Zellen, Blumenkohl oder Schneeflocken? Oder: Wie verhalten sich Finanzmärkte?
Leseprobe zu „Schönes Chaos“
Einführung
Schönheit und Rauheit
Fast alle normalen Muster der Natur sind rau. Sie besitzen äußerst irreguläre und fragmentierte Merkmale – nicht nur weit komplizierter als die wunderbare antike Geometrie Euklids; sie sind zumeist von einer ungeheuer viel größeren Komplexität. Für Jahrhunderte war die bloße Vorstellung, Rauheit zu messen, ein müßiger Traum. Dies ist einer der Träume, denen ich mein ganzes Leben als Wissenschaftler gewidmet habe.
Ich möchte mich vorstellen: Als eine Art Krieger der Wissenschaft und als mittlerweile alter Mann habe ich eine [...]
Einführung
Schönheit und Rauheit
Fast alle normalen Muster der Natur sind rau. Sie besitzen äußerst irreguläre und fragmentierte Merkmale – nicht nur weit komplizierter als die wunderbare antike Geometrie Euklids; sie sind zumeist von einer ungeheuer viel größeren Komplexität. Für Jahrhunderte war die bloße Vorstellung, Rauheit zu messen, ein müßiger Traum. Dies ist einer der Träume, denen ich mein ganzes Leben als Wissenschaftler gewidmet habe.
Ich möchte mich vorstellen: Als eine Art Krieger der Wissenschaft und als mittlerweile alter Mann habe ich eine Menge geschrieben, dabei aber nie ein verlässliches Publikum erworben. Erlauben Sie mir also, Ihnen in diesen Erinnerungen mitzuteilen, wer ich bin und wie ich dazu kam, so viele Jahre an der in der Tat ersten Theorie der Rauheit zu arbeiten, und wie ich schließlich damit belohnt wurde, dass sie sich zusehends mehr in eine Theorie der Schönheit verwandelte.
Der Mathematiker Henri Poincaré (1845–1912) hat festgestellt, dass man manche Fragen vorsätzlich stellt, während andere „natürlich“ sind und sich von selbst ergeben. Mein Leben war angefüllt mit solchen Fragen: Welche Gestalt hat ein Berg, eine Küstenlinie, ein Fluss oder die Teilungslinie einer Wasserscheide? Welche Form hat eine Wolke, eine Flamme oder eine Schmelze? Welche Dichte hat die Verteilung von Galaxien im Universum? Wie lässt sich die Volatilität von Preisen darstellen (und zwar so, dass man danach handeln kann), die auf Finanzmärkten genannt werden? Wie kann man das jeweilige Vokabular zweier Schriftsteller vergleichen und messen? Zahlen messen Fläche und Länge. Könnte es möglich sein, mithilfe irgendeiner anderen Zahl die „Gesamtrauheit“ rostigen Eisens oder zerbrochener Steine, von Metallstücken oder zerbrochenem Glas zu messen? Oder die Komplexität eines Musikstücks oder von abstrakter Kunst? Kann die Geometrie liefern, was die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes zu versprechen schien – getreue Messungen, und das nicht nur von bestellten Feldern entlang des Nils, sondern auch von brachliegender Erde?
Diese und ein Wust weiterer Fragen sind über eine Vielfalt von Wissenschaftsgebieten verstreut und erst seit Kurzem behandelt worden – durch mich. Als Heranwachsender begann ich während des Zweiten Weltkriegs eine zentrale Errungenschaft des Mathematikers und Astronomen Johannes Kepler (1571–1630) zu bewundern. Vor langer Zeit führte er die Ellipsen griechischer Geometer der Antike mit einem Fehler griechischer Astronomen zusammen, um die wahre Bewegung der Planeten verstehen zu können. Diese Astronomen hatten geglaubt, in der Bewegung der Planeten gebe es beständige „Anomalien“. Kepler nutzte sein Wissen auf zwei Gebieten – Mathematik und Astronomie – und berechnete, dass bei dieser Planetenbewegung keine Anomalie im Spiel war. Es handelte sich vielmehr um eine elliptische Umlaufbahn. Mein Kindheitstraum war, etwas in dieser Art zu entdecken.
Eine höchst unpraktische Aussicht! Sie führte nicht zu einer Karriere in einem ordentlichen Beruf und lieferte auch keine Möglichkeit, im Leben zu glänzen – eine Perspektive, die mein Onkel Szolem, ein herausragender Mathematiker, wiederholt als vollkommen kindisch bezeichnete. Doch irgendwie gestattete mir das Schicksal, mein Leben mit der Verwirklichung dieses Traums zu verbringen. Durch außerordentlich großes Glück und ein langes, schmerzlich kompliziertes Berufsleben wurde er schließlich erfüllt.
Am Ende lässt sich die Hauptrichtung meiner lebenslangen Arbeit festhalten. In meiner an Kepler orientierten Suche sah ich mich vielen Herausforderungen gegenüber. Die gute Nachricht lautet, dass ich Erfolg hatte. Die schlechte, vielleicht aber auch die zusätzliche gute Nachricht lautet, dass mein „Erfolg“ eine Menge neuer und anderer Probleme aufwarf. Zudem waren meine Beiträge auf scheinbar nicht miteinander verbundenen Gebieten in Wahrheit eng verwandt und führten schließlich zu einer Theorie der Rauheit – eine Herausforderung, die sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt. Der griechische Philosoph Platon hat dieses Problem fast zweieinhalb Jahrtausende vor uns umrissen, doch niemand wusste, wie es gelöst werden könnte. Sollte also ich der erste Mensch sein, dem dies gelänge?
Einer meiner Bekannten war der mächtige Dekan einer bedeutenden Universität. Als wir uns eines Tages auf einem belebten Flur über den Weg liefen, blieb er stehen und sagte mir etwas, das ich nie mehr vergaß: »Sie machen das sehr gut, aber Sie schlagen einen einsamen und schwierigen Weg ein. Ständig eilen Sie von einem Gebiet zum nächsten, führen ein unstetes Leben und kommen nie zur Ruhe, um sich an dem zu erfreuen, was Sie erreicht haben. Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Hinter Ihrem Rücken hält man Sie für vollkommen verrückt. Das glaube ich überhaupt nicht, und Sie müssen das fortsetzen, was Sie machen. Die ernsteste geistige Krankheit eines denkenden Menschen ist, nicht zu wissen, wer er ist. An diesem Problem leiden Sie niemals. Sie müssen sich nie neu erfinden, um sich geänderten Umständen anzupassen; Sie gehen einfach voran. In dieser Hinsicht sind Sie der Vernünftigste von uns allen.«
Gelassen erwiderte ich, ich würde keineswegs von einem Gebiet zum anderen eilen, sondern vielmehr an einer Theorie der Rauheit arbeiten. Ich war nicht der Mann mit dem großen Hammer, für den jedes Problem wie ein Nagel aussieht. Hatte er mir ein Kompliment machen oder mir nur Mut machen wollen? Ich kam bald dahinter: Er hatte mich für eine wichtige Auszeichnung vorgesehen.
Ist es mit geistiger Gesundheit vereinbar, wenn man von kaum gezügelter Rastlosigkeit besessen ist? In Dantes Göttlicher Komödie werden die zu ewiger Suche verdammten Verstorbenen in die tiefste Hölle des Infernos gestoßen. Für mich dagegen führte eine ewige Suche quer durch zahllose Gebiete der Wissenschaft ohne erkennbare Verknüpfung dann doch in der Summe zu einem glücklichen Leben. Möglicherweise ein rollender Stein, aber nicht teilnahmslos. Überaktiv und aus eigenem Antrieb handelnd, liebte ich es weiterzuziehen; ich hielt inne, um in Laienklöstern aller Art zuzuhören und zu predigen – manche waren glanzvoll und stolz, andere verlassen und abgelegen.
Im Alter von 20 Jahren war ich einer von 20 Auserwählten, die an der exklusivsten Universität Frankreichs zugelassen wurden – der École Normale Supérieure. Als ich mit 80 in Ruhestand ging, war ich Inhaber der Sterling-Professur an der mathematischen Fakultät von Yale – und zählte damit zu den etwa 20 Personen im höchsten Rang der Universität. Die Bedingungen, unter denen ich ins „aktive Leben“ eintrat, waren letztlich ebenso exklusiv und unumstritten wie die, unter denen ich es verließ. Und unterwegs habe ich durchaus einiges an „Moos“ angesetzt.
Nach meinem 35. Lebensjahr – einem Wendepunkt – ist mein Leben in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, aber fruchtbar verlaufen. Das erinnert mich an das Märchen, in dem der Held an einer unerwarteten Stelle einen kleinen Faden entdeckt, immer heftiger daran zieht und eine Vielfalt unglaublicher Wunder enthüllt… alle vollkommen unerwartet. Meine Wunder, eines ums andere betrachtet, gehörten zu weit voneinander entfernten Wissensgebieten. Jedes von ihnen konnte mit großem Gewinn einzeln bearbeitet werden, wie ich das am Anfang meiner Laufbahn gemacht habe. Später entwickelte ich eine breitere Perspektive, wofür ich angemessen belohnt wurde. All diese verschiedenen Gebiete waren am einfachsten zu studieren, wenn man sie als „Erbsen in einer Schote“ begriff oder wie Perlen jeder Größe aus einer sehr langen Halskette.
Sehen diese Gebiete so aus, als wären sie weit voneinander entfernt? Spaltete ich meine Anstrengungen in selbstzerstörerischer Weise auf? Schon möglich. Doch mit strenger und bewusster Selbstkontrolle blieb meine Aufmerksamkeit auf jene Formen konzentriert, die gemeinhin keinen Namen hatten und doch dringend einen benötigten. Indem ich diese separaten Gebiete zusammenführte, gelangte ich Schritt für Schritt in die unerwartete, seltene und gefährlich exponierte Lage, dass ich ein neues Gebiet erschloss und damit das Recht erhielt, es zu benennen. Ich gab ihm den Namen fraktale Geometrie.
Jede wichtige Facette der fraktalen Geometrie leidet an einem Dilemma, das Physiker zu Anfang des 20. Jahrhunderts als „Katastrophe“ bezeichneten. Die Theorien jener Zeit sagten für die von bestimmten Objekten abgestrahlte Energie einen unendlich großen Wert voraus. In Wirklichkeit war das nicht der Fall – es musste also etwas preisgegeben werden! Es war die Quantenmechanik, die dieses Dilemma auflöste – eine der großen Revolutionen des 20. Jahrhunderts und Grundlage eines großen Teils der modernen Technologien einschließlich Computer, Laser und Satelliten.
Was all meine „Erbsen“ unter einen Hut brachte, war das entgegengesetzte Ende desselben Dilemmas. Viele der Wissenschaftsbereiche, mit denen ich mich befasste, gruppierten sich um Größen, denen man wohldefinierte finite Werte unterstellte – etwa die Längen von Küstenlinien. Doch diese finiten Werte ließen sich nicht eindeutig bestimmen. Misst man die Länge einer Küstenlinie mit kleineren Maßstäben, entdeckt man kleinere Merkmale, was wiederum zu größeren Messungen führt. Dass ich diese Gebiete untersuchte, war auf die Einsicht zurückzuführen, dass man diesen entscheidenden Größen infinite Werte erlauben musste.
Wie kam es zu alledem? Mein Onkel Szolem und ich sind beide in Warschau geboren. Wir hatten beide ein gutes Auge und wurden bald als Mathematiker anerkannt. Doch die übertrieben aufregenden Zeiten, die der Fluch seiner und später meiner Adoleszenz waren, trugen dazu bei, uns zu jeweils unterschiedlichen Persönlichkeiten zu formen. Er fand Erfüllung als eng fokussierter Insider des Establishments, während ich mich zu einem schwer fassbaren Einzelgänger entwickelte.
Der Onkel erlebte den Ersten Weltkrieg als Heranwachsender; er durchstreifte ein Russland, das von der Agonie der Revolution und des Bürgerkriegs erschüttert war. Früh wurde er in einen wohldefinierten und nicht visuell dominierten Bereich eingeführt – die klassische mathematische Analysis, wie sie wesentlich in Frankreich entwickelt worden war. Er verfiel ihr in lebenslanger leidenschaftlicher Liebe und gelangte bis an ihren Grund. Bald schon gab man ihm seine akademische Fackel in die Hand, und er trug sie brennend durch gute wie durch schlechte Zeiten.
Ich erlebte den Zweiten Weltkrieg als Heranwachsender und fand Zuflucht im abgelegenen, verarmten Hochland Frankreichs. Anhand von überholten Mathematikbüchern voller Illustrationen wurde ich dort in eine von Bildern dominierte Welt eingeführt. Nach dem Krieg, als ich in die École Normale Supérieure aufgenommen worden war, wurde mir klar, dass eine von den Mysterien der realen Welt abgeschnittene Mathematik nichts für mich war, also nahm ich einen anderen Weg.
Ein halbes Jahrhundert vor meiner Geburt behauptete Georg Cantor (1845–1918), das Wesen der Mathematik liege in ihrer Freiheit. Seine Kollegen schickten sich an, ein Bündel von Formen zu erfinden – das dachten sie zumindest –, die sie als „monströs“ oder „pathologisch“ bezeichneten. Ihre Studien drängten die Mathematik mit Absicht zu einer Flucht vor der Natur. Mithilfe von Computern zeichnete ich diese Formen und verkehrte den ursprünglichen Vorsatz in sein Gegenteil. Ich erfand noch viel mehr davon und erkannte einige als Werkzeuge, die vielleicht dazu beitragen konnten, eine Menge oft alter, konkreter Probleme zu lösen – „Fragen, die einst für Poeten und Kinder reserviert waren“.
Inmitten reinster Mathematik führte mich mein ungeniertes Spiel mit aufgegebenen „Pathologien“ zu einer Reihe entlegener Entdeckungen. Eine als Mandelbrot-Menge bekannt gewordene, äußerst komplexe Gestalt ist als das komplexeste Objekt der Mathematik bezeichnet worden. Ich war der Erste, der Stapel von Bildern untersuchte und daraus viele abstrakte Vermutungen ableitete, die sich als extrem schwierig erwiesen, eine Menge harter Arbeit auslösten und viel Belohnung mit sich brachten.
Innerhalb der Naturwissenschaften war ich einer der Ersten, der vertraute Formen wie Berge, Küstenlinien, Wolken, turbulente Strömungen, Galaxienhaufen, Bäume, das Wetter und zahllose andere Phänomene untersuchte.
Was die Untersuchung menschlicher Tätigkeiten angeht, begann ich mit einer Kuriosität – einem Gesetz, das sich mit Worthäufigkeiten befasst. Den Höhepunkt erreichte ich mit dem „Fehlverhalten“, das in den Variationen spekulativer Märkte auftritt. Und auch zur Untersuchung der visuellen Kunst steuerte ich eine Kleinigkeit bei.
Aber wo gehöre ich nun tatsächlich hin? Ich vermeide das Wort „überall“, weil es nur allzu leicht als „nirgendwo“ verstanden werden kann. Stattdessen bezeichne ich mich, wenn jemand unbedingt auf einer Aussage besteht, als Fraktalisten. Eine Herausforderung, der ich mich immer wieder gegenübersah – und die ich nie ganz zu bewältigen verstand –, bestand darin, den Teilen wie dem Ganzen gerecht zu werden. In diesen Erinnerungen bemühe ich mich nach Kräften darum.
Alles in allem ist die schlichte altmodische Rauheit in Wissenschaft und Kunst kein Niemandsland mehr. Ich lieferte eine Theorie und zeigte, dass mittlerweile eine erstaunliche Anzahl und Vielfalt von Fragen mit starken neuen Werkzeugen angegangen werden kann. Sie stellen die herkömmliche Sicht der Natur infrage, die der Standardgeometrie zu eigen ist – sie betrachtet raue Formen als formlos. Wie es aussieht, habe ich als Reaktion auf jenen alten Hinweis Platons die Reichweite der rationalen Wissenschaft auf eine weitere grundlegende Empfindung des Menschen ausgedehnt – eine, die für so lange Zeit nicht gebändigt worden war.
Im Verlauf eines Lebens, das weit mehr Unterbrechungen ausgesetzt war, als mir lieb gewesen wäre, haben IBM Research für 35 Jahre und dann viele Jahre lang Yale eine Grundlage für Stabilität bereitgestellt. Zudem habe ich lange genug gelebt, um meine Arbeit in großartigerer Weise gewürdigt zu sehen, als ich mir je hätte vorstellen können.
Mein Berufsleben wäre vielleicht etwas einfacher verlaufen, wenn ich diese Erinnerungen früher geschrieben hätte. Doch die Verzögerung hat sich als fruchtbar erwiesen. Dadurch wurden manche weniger wichtige Details ausradiert, und mein Lebenslauf ist klarer geworden – sogar für mich.
In diesen Erinnerungen sind wörtliche Zitate kursiv gesetzt. Gespräche, die ich wiedergebe, sind durch An- und Abführungszeichen gekennzeichnet. Es gibt keine Fußnoten und nur sehr wenige Quellenverweise.
Teil I
Wie ich Wissenschaftler wurde
Alle Wahrheiten sind leicht zu verstehen, sobald man sie entdeckt hat; es geht darum, sie zu entdecken.
Galileo Galilei
1 Wurzeln – von Körper und Geist
In friedlichen und wohlhabenden Ländern haben die Kinder von Landbesitzern, Bäckern oder Bankiers eine einfache Option: der Tradition und dem Gewerbe der Familie zu folgen. Ich dagegen wurde in Polen geboren und bin in Litauen aufgewachsen – dort war es weder friedlich noch wohlhabend. Ein in diesem Teil Europas geborener Schriftsteller hat festgestellt: „Wehe dem Dichter, der in gewalttätigen Zeiten in einem interessanten Teil der Geografie geboren ist.“
Der wesentliche vererbbare Besitz meiner Vorfahren bestand in reichlich abgegriffenen Büchern. Tatsächlich bestand die Familientradition – über viele Generationen hinweg – darin, der Gier zu entsagen und geistige Tätigkeiten vorzuziehen.
Man sah es als höhere Berufung an, Wissenschaftler, Denker oder Erfinder zu sein – damit streifte man das Göttliche. Ein Wissenschaftler oder kreativer Kopf wurde als „großartig“ bezeichnet. Für die Jüngeren in unserer Familie und meine Freunde war es ein unglaubliches und außergewöhnliches Privileg, wenn einem gestattet wurde, zu denken und sein Leben der Wissenschaft zu widmen. Geld wurde gering geschätzt, und man strebte nicht nach Reichtümern oder einer Karriere. Ganz und gar nicht! Im Gegenteil, man wollte sich für die Wissenschaft aufopfern.
Diese Zeilen schrieb mein Onkel Szolem (1899–1983). Auf sehr unterschiedliche Weise brachten er wie auch ich dieses Opfer. Er wurde ein sehr bekannter Mathematiker des akademischen Mainstreams. Vielen Menschen mögen seine Worte naiv oder gar kitschig vorkommen. Ich finde sie beeindruckend, denn sie beschreiben eine außergewöhnliche Verschmelzung jüdischer und russischer Traditionen und in vieler Hinsicht einen Höhepunkt in der Bereitschaft des Menschen, sich den großen ungelösten Fragen der Erkenntnis zu stellen – ein Umfeld, das die Bedeutung des Ausdrucks „kitschig“ gar nicht kannte und viele Formen von Heldentum, aber selbstverständlich auch von Zerstörung begründet hat.
Begabten jungen Leuten gewährte diese Umgebung keineswegs das Gefühl, Ansprüche geltend machen zu können, und man ermutigte sie auch nicht mit schönen Worten. Sie bot nicht nur keine Zuflucht angesichts der tragischen Lebensrealität, sondern erlegte einem auch eine schwere Last auf: wissenschaftlich zu glänzen oder zumindest anzustreben, irgendeine Art Gelehrter zu werden – aber nicht ohne auch Zeit für eine Familie und Vergnügungen zu haben.
Wie habe ich reagiert? Kurz gesagt, ich gehorchte. Aber anders als dieser Onkel und beeinflusst durch den Zweiten Weltkrieg in Frankreich wählte ich einen Weg, auf den sich meines Wissens zuvor noch niemand gewagt hatte.
Schicksalhaftes Abendessen im Juni 1930
Wie bedeutend so manches Ereignis gewesen ist, wird oft erst erkannt, wenn es zu spät ist, es richtig wahrzunehmen. Für viele Theaterstücke oder historische Erzählungen wird eine Ausgangsszene entwickelt, in der man die Vergangenheit in Erinnerung ruft und viele wichtige Mitspieler zusammenführt. In meinem Leben spielte sich tatsächlich eine solche Szene ab. Sie wurde im Juni 1930 in der Wohnung der Familie aufgezeichnet, in der ich am 20. November 1924 geboren wurde.
Dieses außergewöhnliche Ereignis versammelte einige der wichtigsten Menschen meines Lebens an einem Tisch. Durch mehrere der Anwesenden bekamen einige im späten 19. Jahrhundert wurzelnde mathematische Vorstellungen einen vermutlich größeren und unmittelbareren Einfluss auf mein Lebenswerk als der Computer, eine Erfindung des 20. Jahrhunderts.
Schauplatz der Szene war das Esszimmer unserer Wohnung in der Ulica Muranowska 14 im Warschauer Ghetto. Über einen handtuchgroßen Park hinweg bot sie einen Blick auf die Fassade eines während der Bauzeit aufgegebenen Hauses, das wahrscheinlich noch immer nicht fertiggestellt war, als der Zweite Weltkrieg die ganze Gegend, diese ganze Welt einebnete.
Ein für den Anlass bestellter professioneller Fotograf produzierte mit seiner Momentaufnahme ein Familienerbstück, das allseits bewundert und kommentiert wurde. Es dokumentiert einen großen Teil meiner Familiengeschichte und die Tatsache, dass ich an einem Ort aufgewachsen bin, den man wohl als ein Haus von Mathematikern bezeichnen kann.
Auf unterschiedliche Weise hat jeder Teilnehmer des auf diesem Foto festgehaltenen Abendessens Einfluss auf meine Abstammung und auf mein Denken gehabt. Zu verschiedenen Zeiten sind sie für mich ein Vorbild, dem es nachzueifern galt, ein unbeugsamer Ansporn oder ein Gremium gestrenger Richter gewesen. Als nur schwach in seiner Gegenwart verankerter Einzelgänger fand ich bei ihnen auch eine tiefgehende und ständige Quelle des Trostes. Lassen Sie mich diese Mitspieler kurz skizzieren, ehe ich mit mehr Muße auf die wichtigeren zurückkomme.
Gastgeberin und einzige Frau auf dem Foto ist Tante Helena Loterman. Von Vaters vier Schwestern (davon zwei Zahnärztinnen) war sie die dritte und einzige, die sowohl willens als auch in der Lage war, einen Haushalt zu führen. Daher blieb Helena in einer Gemeinschaft, in der Frauen noch vor den Männern eine formelle Ausbildung erhielten – und in der man von ihnen erwartete, außer Haus zu arbeiten, wenn ihnen das möglich war –, eine zufriedene und kinderlose Vollzeit-Hausfrau. Zudem war sie die unerschütterliche Pflegerin für den 80-jährigen weißbärtigen Patriarchen auf dem Foto, ihren Vater und meinen Großvater Szlomo. Er starb fünf Jahre nach diesem Ereignis.
Großvater sprach kein Polnisch – was meine einzige Sprache war –, weshalb wir nicht miteinander reden konnten. Er hatte aber sehr großen Einfluss auf die Familie. Zur Welt kam Szlomo in einer ansehnlichen alten Stadt im russischen Zarenreich, die ein grausames Schicksal mit einer beträchtlichen Vielzahl von Namen versehen hat. Wie die meisten ihrer Bewohner seiner Zeit nannte er sie Wilna. Polen schreiben sie Wilno. Mittlerweile ist die Stadt unter dem noch älteren Namen Vilnius wieder die Hauptstadt eines unabhängigen Litauen – heute ein kleiner Staat des Baltikums, doch einst ein sehr mächtiges Großherzogtum, das bis zum Schwarzen Meer reichte und mit Polen verbunden war. Auf seiner unter einem schlechten Stern stehenden Reise nach Moskau im Jahr 1812 bezeichnete Napoleon Bonaparte das Land als das Jerusalem des Nordens. Meine Vorfahren beider Seiten hatten fünf Jahrhunderte in dieser Gegend gelebt und eine sehr intellektuelle Variante des Judentums praktiziert: irgendwie calvinistisch – im Gegensatz zu den eher baptistisch angehauchten chassidischen Varianten, die weiter südlich in der Ukraine aufkamen. Die wirtschaftliche Entwicklung veranlasste Szlomo, in das boomende Warschau zu ziehen, wo mein Vater geboren wurde. Ob die wenigen Familien, die unseren Namen – in verschiedenen Schreibweisen – tragen, mit uns verwandt sind, ist unklar. Auf jeden Fall kommt der Name wohl nur bei den Aschkenasim vor.
Man sagt, dass alle männlichen Vorfahren meines Vaters fromme Schriftgelehrte waren. Es waren Männer mit hoher Bildung, die allseits bekannt, manche sogar berühmt waren unter den Juden. Jeder stellte der Tradition folgend sicher, dass seine Lieblingstochter seinen bevorzugten Schüler heiratete – so war Großvaters Lehrer mein Urgroßvater geworden. Die unterschiedliche Kleidung der Personen auf dem Foto verrät, dass es innerhalb einer Generation zu einem scharfen Bruch gekommen war. Großvater und andere ältere Verwandte gehörten zu einem Ghetto, in dem Religion eine zentrale Rolle spielte. Ihre Kinder hingegen lebten in einer völlig anderen Welt, in der Religion viel weniger bedeutete. Wir kamen uns nie reich vor, aber Großvaters Haushalt war komfortabel und hatte manchmal einen oder sogar zwei bäuerliche Dienstboten.
Wie kam er zurecht, ehe seine vielen Kinder ihn versorgen konnten? Das habe ich mich immer verwundert gefragt. Angeblich durch den Einkauf von Hefe in großem Stil, die er dann in Einzelportionen an normale Kunden weiterverkaufte. Als Kind erledigte Szolem, sein jüngerer Sohn, die Auslieferungen. Doch da gab es noch mehr. Die jüdische Gemeinschaft bemühte sich, ihre gelehrten Männer zu unterstützen. Großvater war ein geachteter und beliebter Ratgeber. Die wohlhabenderen unter den Männern, die bei ihm beteten, sahen geschäftliche Abschlüsse als einen guten Vorwand, ihm das Leben angenehm zu machen und ihm zu ermöglichen, Hof zu halten – aber auch, um selbst weiterhin an seinen geschätzten Ratschlägen teilhaben zu können.
Hinter Großvaters Stuhl lehnt mein Cousin Leon (ca. 1900–1970), damals Redakteur bei der wichtigsten polnischsprachigen jüdischen Tageszeitung. Er hielt uns über alles, was sich ereignete, auf dem Laufenden. Dem Krieg in Polen entging er dadurch, dass er nach Ostsibirien deportiert wurde, bevor er sich später wieder in Richtung Westen aufmachte. Seine Frau Maria Bar war eine führende Pianistin. Ich habe Plakate von ihren Konzerten gesehen, sie jedoch nie spielen gehört. Leons Bruder Zygmunt lehrte an einem Gymnasium und war ein bekannter Dichter.
Der Mann, der als Zweiter von links gedankenvoll in die Kamera blickt, ist mein Vater (1883–1952), zweiter der vier Söhne Szlomos und damals 47 Jahre alt. Der zutiefst prinzipientreue und stolze, unabhängige Mann ist eine der zentralen Persönlichkeiten meines Lebens. Zwei ältere Geschwister hatten jung geheiratet und sich fern von Warschau den Familien ihrer Ehegatten angeschlossen – Vater dagegen nicht. Seine Selbstlosigkeit und Fürsorge als Sohn, Bruder, Ehemann und Vater hielt er bis zu einem sehr späten Zeitpunkt seines Lebens aufrecht. Viel später beklagte er sich bei mir, er habe – außerhalb seiner Familie – nichts getan, was ihm Freude bereitet habe, während sein jüngster Bruder Szolem nie etwas anderes getan habe.
Szolem ist der junge Mann ganz links, damals 31 Jahre alt. Großmutter war zur Zeit ihrer sechzehnten Schwangerschaft bereits 50 gewesen, erholte sich nie mehr richtig und starb vor dem Ersten Weltkrieg. Intellektuell und auch finanziell wurde ihr letztes Kind größtenteils von meinem Vater großgezogen.
Bei dem schicksalsträchtigen Abendessen war Szolem sowohl Gastgeber als auch Ehrengast und wahrscheinlich auch Dolmetscher. Als Kind hatte er in derselben Wohnung gelebt und war der Erste in Vaters Familie, der statt einer höheren Religions- oder Handelsschule eine akademische Oberschule besuchte und nicht an einer medizinischen Hochschule studierte. Er zog nach Paris, wurde rasch und umfassend akzeptiert und besuchte nun im Triumph seinen Geburtsort. Er war einer der vier französischen Professoren, die auf dem Weg waren, Frankreich bei einer großen, im Juni 1930 stattfindenden Veranstaltung in Charkow in der östlichen Ukraine offiziell zu vertreten – nämlich beim Ersten Mathematischen Kongress der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Kein anderer hat mein wissenschaftliches Leben auch nur annähernd so sehr beeinflusst wie dieser Onkel.
Auf dem Ehrenplatz zur Rechten von Großvater sitzt der älteste und ranghöchste Gast, Jacques Hadamard (1865–1963). Soweit ich mich erinnere, hatte man ihn mir als überragenden Mann der Wissenschaft geschildert, als den damals vielleicht größten Mathematiker Frankreichs – viele glauben, er habe sehr viel mehr Anerkennung verdient, als ihm heute zuteilwird. Auf verschiedene Arten hat auch er, wie sich herausstellen sollte, in speziellen Bereichen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich sehe in ihm meinen geistigen Großvater.
Links von Großvater sitzt der Mathematiker Paul Montel (1876–1975), der nur zwei Jahre zuvor Szolems Doktorarbeit betreut hatte. Mit Montel hatte ich gelegentlich zu tun – zu einer Zeit, in der er eher ins Abseits geraten war. Szolem pries die Arbeiten zweier unmittelbar von Montel inspirierter Mathematiker, Gaston Julia (1893–1978) und Pierre Fatou (1878–1929). Um 1980 hatte ich die Ehre, mit der Entdeckung der Mandelbrot-Menge Montels wissenschaftliche Nachkommenschaft zu vergrößern – diese Arbeit machte den Namen meiner Familie weithin bekannt.
Der Mathematiker Arnaud Denjoy (1884–1974) – er sitzt in der Mitte – beeinflusste nur einen Randbereich meiner Arbeit, der nicht allzu große Bedeutung hat.
Neben Tante Helena steht schließlich noch ihr Gatte Loterman, eine angenehme Erscheinung, sanft und kultiviert. Als mein Privatlehrer trug er dazu bei, meine sehr spezielle „formale“ Bildung zu fördern. Bei der damaligen wirtschaftlichen Depression in Warschau war regelmäßige bezahlte Beschäftigung ein Privileg, dessen sich Loterman, Mutters jüngerer Bruder und andere Verwandte anscheinend nie erfreuen konnten. Eine starke Familiensolidarität bewahrte sie jedoch irgendwie alle vor niedrigen Arbeiten. Die Lotermans gingen im Holocaust unter.


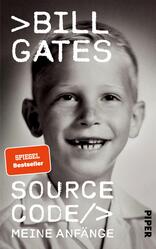
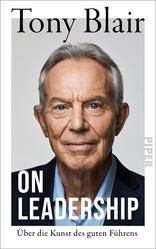




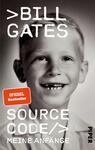
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.