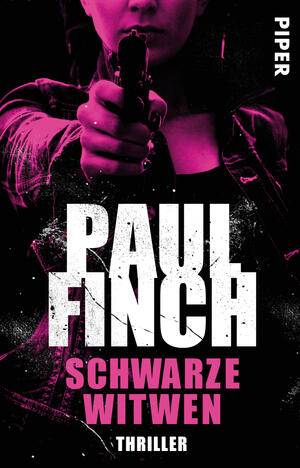
Schwarze Witwen (Lucy-Clayburn-Reihe 1) - eBook-Ausgabe
Thriller
Schwarze Witwen (Lucy-Clayburn-Reihe 1) — Inhalt
Eine junge Frau steht am Straßenrand, ein Mann hält an und nimmt sie ein Stück mit. Kurz darauf wird der Fahrer tot und grausam verstümmelt im Wald gefunden – das erste von vielen Opfern. „Jill the Ripper“, wie die Killerin von der Presse bald getauft wird, versetzt ganz England in Angst und Schrecken. Die junge, ambitionierte Polizistin Lucy Clayburn schwört sich, diesen Morden ein Ende zu setzen. Verdeckt ermittelt sie in der Unterwelt Manchesters – und ahnt nicht, dass der Chef des brutalen Syndikats „The Crew“ ihr dicht auf den Fersen ist …
Leseprobe zu „Schwarze Witwen (Lucy-Clayburn-Reihe 1)“
Vor vier Jahren
Michael Haygarth sah nicht gerade aus wie ein Mann, der zwei Frauen vergewaltigt und ermordet hatte, aber Lucy wusste ja bereits, dass man den Irren nicht unbedingt ansah, wie gestört sie waren. Er saß ihr gegenüber auf einer der hinteren Sitzbänke des nicht gekennzeichneten Mannschaftswagens der Polizei. Während der ganzen Fahrt hatte er kein einziges Wort gesagt, er ließ den Kopf hängen, als hätte er keine Kraft, ihn hochzuhalten.
Es war eine unbequeme Position. Haygarth war groß, etwa eins dreiundneunzig, aber auch schlaksig, und so, [...]
Vor vier Jahren
Michael Haygarth sah nicht gerade aus wie ein Mann, der zwei Frauen vergewaltigt und ermordet hatte, aber Lucy wusste ja bereits, dass man den Irren nicht unbedingt ansah, wie gestört sie waren. Er saß ihr gegenüber auf einer der hinteren Sitzbänke des nicht gekennzeichneten Mannschaftswagens der Polizei. Während der ganzen Fahrt hatte er kein einziges Wort gesagt, er ließ den Kopf hängen, als hätte er keine Kraft, ihn hochzuhalten.
Es war eine unbequeme Position. Haygarth war groß, etwa eins dreiundneunzig, aber auch schlaksig, und so, wie er da auf seinem beengten Platz saß, berührten seine spitzen Knie beinahe seine Brust. Er musste zwischen vierzig und fünfzig sein, vermutete sie, allerdings war sie sich nicht sicher. Er hatte kaum Haare, und die wenigen hinten und an der Seite hatte er abrasiert, sodass nur graue Stoppeln zu sehen waren. Seine Haut war dunkel, sonnengebräunt – als ob er eine Zeit lang im Süden gelebt hätte oder sogar von da kam, aber beides traf offenbar nicht zu. Sein schmales Kinn, seine Stupsnase und seine hervorstehenden Zähne verliehen ihm ein nagerartiges Aussehen, und dennoch strahlte er merkwürdigerweise eine gewisse Harmlosigkeit aus. Seine glasigen Augen und sein leerer Blick ließen vermuten, dass er gar nicht ganz da war. Jedenfalls verriet sein Gebaren nicht den leisesten Hauch von Gewalttätigkeit. Statt wie ein Mordverdächtiger wirkte er eher wie einer dieser hoffnungslosen, arbeitslosen komischen Käuze, die den ganzen Tag auf irgendeiner Parkbank herumsitzen.
Aber er hatte ein Geständnis abgelegt. Und das, ohne auch nur in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt worden zu sein.
Der Transporter wurde abgebremst und kam knirschend zum Stehen, vermutlich auf der unbefestigten Straße, die in den Borsdane Wood hineinführte, allerdings konnten die hinten sitzenden Insassen das nicht mit Bestimmtheit sagen, da es dort nur die beiden vergitterten Fenster in den hinteren Türen gab, durch deren getönte und verschmutzte Scheiben nichts als Düsternis in das Innere des Wagens fiel. Die anderen Detectives, die hinten in dem Mannschaftswagen zusammengedrängt waren, regten sich und unterhielten sich gedämpft, während sie sich zum Aussteigen bereit machten. Begleitet von einem Scheppern und dem Geräusch von aneinanderschlagendem Metall, wühlten sie in dem Haufen Spaten, Schaufeln und Hacken herum, die auf dem genieteten Stahlboden des Wagens bereitlagen.
Die Hintertüren des Wagens wurden von draußen aufgerissen. Kalte Luft strömte herein, dampfender Atem umwaberte die große, schlanke Gestalt von Detective Inspector Doyle und den kleineren, stämmigeren Umriss von Detective Sergeant Crellin. Sie waren beide bereits in ihre weißen Tyvek-Overalls geschlüpft, hatten sich Einweghandschuhe übergestreift und hielten jeweils eine Taschenlampe in der Hand.
„Jetzt sind Sie dran, Michael“, sagte Detective Inspector Doyle und klappte ihr Notizbuch auf. „Ich habe mir Ihre Wegbeschreibung genau notiert, aber ich möchte trotzdem alles noch einmal mit Ihnen durchgehen. Wir befinden uns jetzt am Ende der Straße, da wo die Poller stehen … also müssen wir von hier aus zu Fuß weiter, ungefähr vierzig Schritte nach Norden, richtig?“
„So ist es, Ma’am“, erwiderte Haygarth mit seiner bebenden, flötenartigen Stimme. Er sah immer noch nicht auf.
„Wir gehen so weit, bis wir auf einen verrotteten alten Stamm stoßen, der quer auf dem Weg liegt, richtig?“
„Richtig, Ma’am.“
„Von da aus gehen wir dreißig Schritte nach Westen … bis das Gelände ansteigt?“
„Genau.“
„Wir steigen den Hang nicht hinauf, sondern gehen etwa fünfzig Schritte unten an ihm entlang, bis wir auf eine Gruppe Weißbirken stoßen.“
„Es sind nicht nur Weißbirken, Ma’am.“ Er sah immer noch nicht auf, aber er sprach langsam, mit Bedacht. „Aber es sind auch ein paar Weißbirken dabei. Sie können die Stelle unmöglich verfehlen.“
„Hoffen wir es, Michael … um unser aller willen. Inmitten dieser Baumgruppe gibt es eine Lichtung, die ein bisschen unnatürlich wirkt, weil Sie sie dort vor einiger Zeit höchstpersönlich angelegt haben. Und dort befinden sich die beiden Gräber?“
„Das ist korrekt, Ma’am.“
„Was haben Sie noch mal gesagt, wie tief Sie sie vergraben haben?“
„Dreißig Zentimeter oder so. Sie werden die beiden Leichen innerhalb weniger Minuten finden.“
Die Beamten dachten schweigend darüber nach. Haygarth war wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an seiner fünfundsiebzigjährigen Nachbarin in Haft. Sein Geständnis, drei Jahre zuvor zwei Prostituierte vergewaltigt und erwürgt zu haben und ihre Leichen im Borsdane Wood vergraben zu haben, hatte er völlig unerwartet während seines ersten Verhörs abgelegt. Im ersten Moment hatte niemand gewusst, was von diesem Geständnis zu halten war, doch eine Schnellsuche im polizeiinternen Datensystem hatte ergeben, dass tatsächlich zwei in Crowley ansässige Prostituierte, eine gewisse Gillian Allen und eine Donna King, etwa zu der von Haygarth angegebenen Zeit als vermisst gemeldet worden waren. Seitdem waren die beiden spurlos verschwunden.
„Eine letzte Sache noch, Michael“, sagte Detective Inspector Doyle mit schneidiger, ernster Stimme. „Wenn wir die Stelle nicht finden, kommen wir zurück, damit Sie uns persönlich hinführen können. Aber ich warne Sie … Ich wäre alles andere als erfreut, wenn dies erforderlich sein sollte. Es wäre besser für Sie, wenn diese Beschreibung stimmt.“
„Das tut sie, Ma’am. Sie werden die Stelle finden.“
Doyle trat ein paar Schritte zurück, begleitet von Crellin, und die anderen Mitglieder des Teams drängten zur Tür, um auszusteigen. Doch zuvor musste Lucy, an die der Häftling mit einer Handschelle gefesselt war und die ihm gegenübersaß, den Platz wechseln und sich neben ihn setzen. Die übrigen Mitglieder des Teams, die inzwischen alle mit Schaufeln und Spaten bewaffnet waren, sprangen einer nach dem anderen aus dem Wagen nach draußen, wo Crellin jedem einen Tyvek-Overall in die Hand drückte.
„Die Schuhüberzieher brauchen wir erst, wenn wir die Stelle erreichen“, stellte Doyle klar. „Weiß der Himmel, durch was für einen Mist wir auf dem Weg dahin latschen müssen.“
Im milchigen Zwielicht dieses trüben Februarabends schien der Wald wie ein blattloses Gewirr, die unbefestigte Straße schlängelte sich vor ihnen unter einem Dach nasser, schwarzer Äste davon. Lucy sah auf die Uhr. Es war kurz vor fünf. In vierzig Minuten würde es stockdunkel sein. Wenn sie bis dahin nicht irgendwelche physischen Beweise zutage befördert hätten, würden sie bis zum nächsten Morgen nichts mehr tun können, deshalb war Eile geboten. Und falls sie tatsächlich die Beweise fanden, würde der ganze Zirkus inklusive Flutlicht und allem Drum und Dran herbeibeordert werden. Begleitet von Crellins barschen Anweisungen, verblasste das Geräusch der davonstapfenden Stiefel.
Nur Lucy und Detective Inspector Mandy Doyle blieben noch zurück.
Detective Inspector Doyle war eine eigenartig aussehende Frau. Sie war groß, schlank, hatte ein verhärmtes Gesicht und war oft chaotisch gekleidet, da sie dazu neigte, Röcke, Blusen und Blazer zu tragen, die nicht zueinanderpassten. Sie ging leicht vornübergebeugt und hatte ziemlich langes wuscheliges braunes Haar, das von grauen Strähnen durchsetzt war. All das zusammengenommen trug dazu bei, dass sie älter aussah, als sie vermutlich war, sie musste um die fünfunddreißig sein. Doch vor allem fand Lucy die Haltung verwirrend, die sie ihr gegenüber an den Tag legte. Von einer Frau, die sich auf der Karriereleiter nach oben gekämpft hatte, hätte man vielleicht erwarten sollen, dass sie die Anwesenheit einer jungen Beamtin in ihrem Team, die ihren ersten Einsatz bei der Kripo hatte, begrüßen würde, doch stattdessen hatte Detective Inspector Doyle von Anfang an den Eindruck erweckt, als ob Lucys Gegenwart ihr ein Dorn im Auge wäre.
„Sie will einfach ihre Arbeit machen“, hatte Crellin ihr gesagt. „Sie meint, sie hätte keine Zeit dafür, eine Praktikantin anzulernen.“
„Ich bin nun wirklich keine Praktikantin“, hatte Lucy eingewandt. „Ich habe sechs Jahre lang die Uniform getragen.“
„Natürlich, ist ja gut … mich brauchen Sie nicht zu überzeugen. Aber Mandy ist in dieser Hinsicht ein bisschen eigen. Sie ist davon überzeugt, dass jedes Team nur so gut ist wie das schwächste Glied. Wenn Sie in unserem Team mitarbeiten, erwartet sie von Ihnen, dass Sie sich in die Riemen legen.“
„Keine Sorge, das werde ich.“
„Ich weiß. Ich habe Ihre Personalakte gesehen.“ Bei diesen Worten hatte er ihr zugezwinkert. „Und ich bin sicher, Mandy auch.“
Was das anging, war Lucy sich nicht so sicher. Und schon gar nicht in diesem Moment.
„Passen Sie auf diesen Kerl auf, als hinge Ihr Leben davon ab, Detective Constable Clayburn“, wies Detective Inspector Doyle Lucy an und ließ ihren ungerührten Blick von Lucy zu dem Häftling schweifen und wieder zurück. Wenn sowieso kaum jemals ein Hauch von Freundlichkeit in ihrer Stimme lag, so hatte sie diesmal einen besonders scharfen Unterton. „Wobei … ich denke, wir brauchen nicht zu übertreiben … es geht weniger um Ihr Leben als um Ihren Job. Denn mindestens während der nächsten sechzig Minuten sind Sie für diesen Verdächtigen verantwortlich. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?“
„Absolut, Ma’am“, erwiderte Lucy und straffte sich dienstbeflissen, ärgerte sich jedoch, in dieser Weise vor Haygarth belehrt zu werden, der zwar nicht erkennen ließ, dass er zuhörte, aber er musste den Wortwechsel mitbekommen haben.
Doyle setzte ihre Ansprache in demselben bedrohlichen Tonfall fort, als ob Lucy ihr nicht soeben versichert hätte, dass sie verstanden hatte. „Ich warne Sie … Wenn irgendetwas passiert, während wir da im Wald rumbuddeln – was auch immer –, ist es mir völlig schnurz, ob es Ihre Schuld war oder seine oder die irgendeines Eichhörnchens, das Sie abgelenkt hat, weil es aufs Autodach geschissen hat. Alles, was während unserer Abwesenheit passiert und die Ermittlungen in diesem Fall beeinträchtigt, geht auf Ihre Kappe. Und falls Sie es aufgrund irgendwelcher misslicher Umstände fertigbringen sollten, ihn entkommen zu lassen, tja …“ Doyle setzte ein halbherziges Lächeln auf, das jedoch, wie für sie typisch, jeglicher Freundlichkeit entbehrte, „… in dem Fall schleichen Sie sich am besten nach Hause und senden uns Ihre Kündigung mit der Post zu.“
„Ich habe verstanden, Ma’am“, sagte Lucy.
„Lassen Sie sich nicht in eine Unterhaltung mit ihm verwickeln. Wenn er versucht, mit Ihnen zu reden, sagen Sie ihm einfach, dass er die Klappe halten soll. Wenn er irgendetwas Abgefucktes versucht und Sie die Kontrolle über ihn verlieren, denken Sie daran, dass Sie ein Funkgerät haben und wir nur gut hundert Meter entfernt sind. Außerdem haben Sie noch Alan in der Fahrerkabine, Sie brauchen ihn nur zu rufen, dann kommt er sofort zu Ihnen.“
Alan Denning war einer der größeren, muskulöseren Detectives bei der Kripo von Crowley. Sein Haar wurde licht, doch er hatte einen dichten roten Vollbart und die fiesesten Augen, die Lucy je gesehen hatte. Er sah so aus, als ob er mehr als nützlich sein könnte, falls etwas aus dem Ruder laufen sollte. Doch dass irgendetwas schieflief, war in Wahrheit das Letzte, was sie gebrauchen konnten. Gegen Haygarth war noch keine Anklage erhoben worden, doch vorausgesetzt, dass alles nach Plan lief, würde er sehr, sehr viel Zeit im Gefängnis verbringen, und auch wenn er sich im Moment gerade äußerst zahm zeigen mochte – vielleicht, weil es ihm schwerfiel, damit klarzukommen, was er seiner harmlosen alten Nachbarin angetan hatte –, würde ihm zu gegebener Zeit klar werden, wie tief er in Schwierigkeiten steckte. Deshalb mussten sie es um jeden Preis vermeiden, ihm etwas in die Hand zu geben, was seine Anwälte zu seinen Gunsten verwenden könnten – zum Beispiel eine Verletzung. Dabei wäre es egal, ob ihm eine etwaige Verletzung in Notwehr zugefügt werden würde oder um ihn nicht entkommen zu lassen. Wenn Polizeibeamte dieser Tage gegenüber einem Verdächtigen handgreiflich wurden, erhöhte das die Chancen des Verdächtigen beträchtlich, als freier Mann davonzukommen.
„Aber ich glaube nicht, dass Sie irgendwelche Dummheiten im Sinn haben, oder, Michael?“, fragte Doyle.
Haygarth antwortete nicht. Er hielt immer noch den Kopf gesenkt. Er hing so reglos da, dass es beinahe unheimlich war.
Lucy hingegen war innerlich aufgewühlt, und das lag nicht nur an der peinlichen Belehrung, die sie über sich hatte ergehen lassen müssen. Selbst ohne diese Ermahnung dämmerte ihr inzwischen, wie ernst die Situation war. Dieser merkwürdige, abwesende Mann, der an ihr rechtes Handgelenk gefesselt war, war womöglich tatsächlich ein mehrfacher Mörder. Das war beängstigend, aber zugleich auch aufregend. Nachdem sie so viele Jahre als Streifenpolizistin damit zugebracht hatte, Strafzettel zu verteilen, hinter problematischen Teenagern herzujagen und Ladendiebe mit zur Wache zu nehmen, war es genau dies, was sie tatsächlich veranlasst hatte, Polizistin zu werden, und weshalb sie sich wieder und immer wieder um eine Stelle bei der Kriminalpolizei beworben hatte.
„He, Michael, hören Sie mich?“, redete Doyle auf den Gefangenen ein.
„Hä?“ Haygarth blickte auf. Wie bisher schien er sich nur halb dessen bewusst zu sein, was um ihn herum vor sich ging. „Äh … ja, Ma’am.“
„Ja was?“
„Ja, ich werde ein braver Junge sein.“
Genau genommen konnte Lucy sich nicht vorstellen, dass der Kerl eine Bedrohung darstellte, selbst wenn er sich nicht wie ein braver Junge benahm. Er war groß, aber spindeldürr, wohingegen sie nicht nur gut zwanzig Jahre jünger war, sondern zudem auch noch in Bestform. Na schön, sie spielte nicht mehr in der Damenhockey-Mannschaft der Greater Manchester Police mit und auch nicht mehr in der Squash-Mannschaft, aber sie joggte und schwamm regelmäßig und ging ins Fitnessstudio.
„Sehr schön“, sagte Doyle. „Genau das wollte ich von Ihnen hören, Michael. Wenn Sie uns nicht an der Nase herumführen, werden wir Sie ebenfalls korrekt behandeln.“ Mit diesen Worten wandte sie sich wieder Lucy zu. „Denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe.“
„Das werde ich, Ma’am“, entgegnete Lucy.
Ohne ein weiteres Wort schloss Detective Inspector Doyle langsam, aber entschieden die hinteren Türen des Transporters. Das Geräusch ihrer in den Wald davonstapfenden Schritte verblasste allmählich und verstummte nach einer Minute ganz. Danach schien es einen Moment lang so, als herrschte absolute Stille, doch dann waren nach und nach andere Geräusche zu hören: ein leises Knacken von Metall, das von dem abkühlenden Motor herrührte; das statische Rauschen des Funkgeräts; und das dumpfe, aber unverkennbare Gemisch aus Musik und Stimmen, das vorne aus der Fahrerkabine drang, in der höchstwahrscheinlich Radio One eingeschaltet war. Davon abgesehen war die Stille, die zwischen den sie umgebenden Bäumen herrschte, geradezu beklemmend. Borsdane Wood war bei Weitem kein so idyllischer Ort, wie der Name womöglich verheißen mochte. Der Wald erstreckte sich auf einer mehrere Hundert Hektar großen Fläche eines verlassenen Industriegebiets am äußeren nördlichen Stadtrand unweit des alten Elektrizitätswerks und der Kläranlage und endete schließlich an der Autobahn M61. Im Sommer war der Wald unwegsam und überwuchert, im Winter trostlos und verlassen. Die Lichtungen waren in der Regel mit leeren Flaschen, Bierdosen und anderem Unrat übersät, mehr als einmal waren für den Konsum von Drogen verwendete Utensilien gefunden worden. Niemand ging je in den Wald, um dort ein Picknick zu machen.
Lucy rieb ihre behandschuhten Hände aneinander. Im Inneren des Transporters wurde es spürbar kälter, was vor allem daran lag, dass der Motor ausgeschaltet worden war, weshalb auch die Heizung nicht mehr funktionierte. Sie betrachtete Haygarth von der Seite. Jemand hatte ihm einen Mantel gegeben, den er über seinem weißen Häftlingstrainingsanzug trug, doch wenn ihm kalt war, zeigte er dies nicht. Sein Kopf hing immer noch herab, seine Hände, die übergroß aussahen und am Ende seiner langen, dürren Handgelenke knotig waren, hatte er gefaltet wie zu einem Gebet.
Diese bußfertige Haltung zeigte er schon, seitdem Detective Inspector Doyle ihn früher an diesem Tag verhaftet hatte. Es war nicht selten, dass Gewaltverbrecher gelegentlich von Schuldgefühlen befallen oder von Gewissensbissen geplagt wurden. Andere legten Geständnisse ab, weil sie mit dem Leben außerhalb des Gefängnisses nicht klarkamen und einen geregelteren, disziplinierteren Tagesablauf brauchten. Doch was Michael Haygarth anging, hatte Lucy nicht den Eindruck, dass eine dieser beiden Möglichkeiten bei ihm in Betracht kam. Dies hätte vielleicht der Fall sein können, wenn sein einziges Verbrechen der Überfall auf die alte Dame gewesen wäre, die neben ihm wohnte, doch in Anbetracht dessen, dass er bis zu diesem Tag problemlos damit klargekommen war, zwei andere Frauen umgebracht zu haben, schien es nicht sehr wahrscheinlich, dass sein Gewissen sich auf einmal geregt hatte.
Plötzlich blickte er völlig unerwartet auf und sah sie an. „Ma’am … Ich, äh …“ Seine Augen weiteten sich, traten sogar regelrecht hervor, sein feuchter Mund hatte sich verzogen, als ob ihm auf einmal irgendetwas zu schaffen machte.
„Am besten sind Sie einfach still, Michael.“ Lucy vermied jeglichen Blickkontakt mit ihm. „Es ist zu Ihrem eigenen Besten.“
„Aber … ich muss mal.“
„Ich fürchte, da müssen Sie warten.“
„Ich glaube, das kann ich nicht … wirklich nicht. Hat Miss Doyle nicht gesagt, dass sie eine Stunde weg sein würden? Oder sogar noch länger?“
„Es ist wirklich besser, wenn wir nicht miteinander reden.“
„Aber das ist doch lächerlich.“ Er starrte wieder auf den Boden, doch seine Stimme klang fester und verriet eine gefühlsmäßige Regung. Es war das erste Mal seit etlichen Stunden, dass er eine Emotion zeigte, genau genommen, das erste Mal seit seiner Verhaftung, doch er hatte immer noch diese Ausstrahlung eines bemitleidenswerten Jammerlappens, eines geschlagenen Mannes.
„Michael … es geht jetzt einfach nicht“, stellte Lucy klar. Sie war wütend auf sich selbst, weil sie nun doch angefangen hatte, mit ihm zu reden.
„Ich will doch nur mal schnell pinkeln, und Sie lassen mich nicht.“
„Auf der Wache haben Sie nichts davon gesagt, dass Sie auf die Toilette müssen.“
„Da musste ich auch noch nicht.“
„Aber wir haben die Wache doch erst vor zehn Minuten verlassen!“
„Tut mir leid, aber ich kann auch nichts dafür. Es liegt an dem vielen Tee, den Sie mir im Verhörraum ständig nachgeschüttet haben.“
„Dann versuchen Sie einfach, ein bisschen auszuhalten, Michael, Sie sind schließlich kein Kind.“
Doch jetzt setzte er sich aufrecht hin und verzog das Gesicht vor Unbehagen. „Und was ist, wenn ich einfach hierhin piss und Ihren Transporter einsaue? Jede Wette, dass Sie mich dann zur Schnecke machen.“
Lucy dachte angestrengt nach.
Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Festgenommener auf sie urinieren würde, und ziemlich oft war es hinten in einem Streifenwagen passiert. Es war nicht immer die Schuld der Festgenommenen; einige von ihnen waren einfach in so vielerlei Hinsicht Verlierer. Und es war ja nicht so, als ob man die Wäsche nicht in die Waschmaschine stecken könnte, oder als ob sie selber sich nicht einfach unter eine warme Dusche stellen könnte. Aber es dauerte immer sehr lange, den Geruch aus dem Wagen oder dem Transporter herauszubekommen. Das Fahrzeug, in dem sie gerade saß, wurde natürlich von der ganzen Abteilung genutzt, was bedeutete, dass jeden Tag andere Beamte damit unterwegs waren, sodass es nicht nur ihr Problem wäre … nur dass sie diejenige sein würde, die man dafür verantwortlich machen würde, und davon abgesehen, würde sie an diesem Abend weiß Gott wie lange in dem Gestank ausharren müssen.
„Wahrscheinlich werden sie nicht länger als eine Stunde wegbleiben“, sagte sie, wobei sie mehr zu sich selbst sprach als zu Haygarth. Allerdings funktionierte es nicht.
Höchstwahrscheinlich würden sie sehr viel länger als eine Stunde wegbleiben. Es könnte sogar mehrere Stunden dauern, bis sie zurückkamen.
Er murmelte etwas, seine Stimme wurde heiser. Sie sah, dass er seine knochigen Knie, die zuvor weit gespreizt gewesen waren, inzwischen fest aneinanderpresste. Er begann zu zucken und herumzuzappeln.
Konnte es wirklich schaden?
„Na gut“, willigte sie schließlich widerwillig ein. „Wir steigen aus, und Sie pinkeln an den nächsten Baum, aber Sie werden es einhändig tun müssen, da ich Ihnen die Handschelle auf keinen Fall abnehme.“
„Kein Problem.“ Er klang erleichtert und wartete geduldig, während Lucy nach unten langte, nach dem Entriegelungshebel der Tür tastete und ihn aufrecht stellte.
Falls Alan Denning in der Fahrerkabine das Aufschnappen der Schlösser der hinteren Türen gehört haben sollte, zeigte er jedenfalls keine Reaktion. Höchstwahrscheinlich hatte er es nicht gehört, denn gerade dudelte etwas aus dem Radio, das klang wie ein Song von Rihanna. Lucy erwog, ihn zu rufen, um auf der sicheren Seite zu sein, vermutete jedoch, dass Denning, dieser dicke, gefühlskalte, ungehobelte Polizist, wahrscheinlich nur sagen würde: „Mensch, Clayburn, Sie Weichei! Lassen Sie ihn verdammt noch mal warten! Soll er sich doch einen verdammten Knoten in den Schwanz binden!“ Oder etwas ähnlich Erleuchtendes.
Also hielt sie den Mund, als sie, gefolgt von Haygarth, aus dem Wagen stieg. Kies und Zweige knirschten und knackten unter ihren Schuhen. Inzwischen war der Wald in Finsternis gehüllt, irgendwo tropfte und prasselte es, doch man konnte nicht sehen wo. Einer von Lucys Kollegen hatte ihre Taschenlampe mitgenommen, aber hinten aus dem geöffneten Transporter fiel genug Licht, um den nächsten Baum erkennen zu können, einen von der Nässe glänzenden schwarz-grünen Stamm am Rand der Straße, gut fünf Meter entfernt. In einer Höhe von gut zweieinhalb Metern war offenbar ein dicker Ast abgefallen und hatte eine tiefe Aushöhlung hinterlassen. Haygarth steuerte den Baum sofort an, doch Lucy hielt ihn zurück und blickte an dem Transporter entlang, um zu sehen, ob vor dem Wagen womöglich ein anderes Mitglied des Teams herumstand und vielleicht eine rauchte. Aber nach allem, was sie sah, war dort niemand. Die Lichtkegel der Scheinwerfer strahlten wie Speere in die Finsternis und erhellten die Betonpoller, die das Ende der Straße markierten. Dahinter erstreckte sich sepiabraunes Dickicht. Nichts bewegte sich.
„Na gut“, sagte sie schließlich und steuerte mit ihrem Häftling den Baum an. „Der soll es wohl tun. Beeilen Sie sich.“
Haygarth grummelte dankbar und stellte sich in Position. Lucy stand neben ihm, wandte ihm jedoch die Schulter zu, sodass sie nicht einmal dann etwas sehen würde, wenn ihr Blick unbeabsichtigt nach unten wanderte. Sie hörte ihn seufzen, als die Flüssigkeit leise den Stamm hinabplätscherte.
„Das tut gut“, murmelte er. „Wurde wirklich höchste Zeit.“
„Detective Constable Clayburn, was zum Teufel geht da vor sich?“
Lucy drehte sich überrascht um. Hinter dem Lichtstrahl einer Taschenlampe, der sich von der anderen Seite der Poller näherte, war eine undeutliche Gestalt zu erkennen, aber Lucy wusste, wer es war. Die schwerfällige, leicht vornübergebeugte Gehweise war der deutlichste Hinweis, aber die barsche, humorlose Stimme lieferte zusätzliche Bestätigung.
„Ma’am, der Häftling …“ Lucy versagte die Stimme, als auf einmal alles gleichzeitig schiefzugehen schien.
Im ersten Moment spürte sie nur eine Bewegung neben sich. Als sie sich umblickte, sah sie, dass Haygarth, der ja eins dreiundneunzig groß war und mit ausgestreckten Armen bis auf eine Höhe von zwei Meter fünfundsiebzig hinauflangen konnte, einen Arm nach oben gestreckt hatte und in der Aushöhlung in dem Baumstamm herumtastete. „Was machen Sie denn da?“, brachte sie stammelnd hervor und war für einen Augenblick völlig perplex.
Im nächsten Moment stürmte Detective Inspector Doyle los. Gleichzeitig ertönte das dumpfe metallische Geräusch einer aufschwingenden Fahrerkabinentür. Dann war das Rascheln von Plastik zu hören, und Haygarth lachte, oder vielmehr kicherte er – es war eher ein hyänenartiger Laut als ein menschlicher.
Lucy versuchte, ihn am Arm zu packen, doch er rempelte sie mit voller Wucht mit seiner linken Schulter, sodass sie das Gleichgewicht verlor. In dem Moment kam auch das Objekt in Sicht, das er aus der Aushöhlung in dem Baumstamm hervorgeholt hatte. Es war nur klein, aber zum Schutz vor Schmutz und Nässe in eine Supermarktplastiktüte eingewickelt, sodass Marke und Modell nicht zu erkennen waren. Allein der Himmel wusste, um was für ein Kaliber es sich handelte.
Während Lucy zu Boden ging, schwang Haygarth das Objekt herum. Ein Knall peitschte durch die Dunkelheit, und Doyles Taschenlampe ging aus. Die Polizistin war gut zehn Meter entfernt, aber es machte Plopp, und das Licht erlosch. Dem Röcheln und Keuchen und der Art und Weise nach zu urteilen, in der sie vornüberklappte, war die Kugel glatt durch die Taschenlampe hindurchgegangen und hatte sie in den Bauch getroffen.
Lucy, die flach auf dem Rücken lag, war zu gelähmt, um zu reagieren. Grauenhafte, unvorstellbare Sekunden schienen zu verstreichen, bevor die Reflexe, die sie während ihrer Ausbildung verinnerlicht hatte, einsetzten, und sie versuchte wegzurollen – doch im nächsten Augenblick wurde ihr rechter Arm, der mit den Handschellen an Haygarths linken gefesselt war, straffgezogen. Während sie verzweifelt versuchte zu entkommen, umkreiste er sie langsam, immer noch lachend, eine schwarze skelettartige Gestalt im schwachen Licht, ein großes Streichholzmännchen, eine lebende Vogelscheuche. Und doch so viel stärker, als er aussah. Mit beschämender Leichtigkeit riss er sie nach hinten, warf sie hart auf den Rücken und richtete die Plastiktüte auf sie. Aus dem Loch, das an der unteren Seite in die Tüte gerissen worden war, schwelte immer noch Rauch.
Sie trat zu und rammte ihm mit voller Wucht die Unterseite ihres Fußes gegen sein rechtes Knie. Das Reißen einer Sehne war zu hören, und Haygarths Bein krümmte sich. Er stieß einen durchdringenden Schrei aus, stürzte auf sie und versuchte im Fallen, ihr mit seiner Pistole eins überzuziehen. Sie blockte den Schlag mit ihrem linken Arm ab, und einen Augenblick lang waren ihre Gesichter nur zweieinhalb Zentimeter voneinander entfernt. Seins war nicht mehr von dem melancholischen Ausdruck geprägt, den sie bisher gesehen hatte, sondern sein Blick war der eines Irren, zwischen seinen fest zusammengebissenen Zähnen quoll Schaum hervor, seine Wangen waren aufgebläht, die Stirn gerunzelt.
Er verpasste ihr einen Kopfstoß, direkt auf den Nasenrücken.
Der Schmerz, der mitten durch ihren Kopf schoss, war so furchtbar, dass ihr beinahe schwarz vor Augen wurde. Deshalb sah sie nicht, wie er erneut mit der Pistole zuschlug, sogar zweimal, und sie beide Male direkt auf der linken Schläfe traf. In ihrem Schädel dröhnte es wie von zwei detonierenden Explosionen. Während ihr Bewusstsein schwand und sich eine heiße, klebrige Flüssigkeit über ihrem linken Auge sammelte, sah sie ihn aufrecht über ihr knien. Er schwitzte, Sabber rann ihm den Mundwinkel herunter, während er mit den Zähnen die Plastiktüte wegriss, die glänzende stählerne Pistole enthüllte, auf ihr Gesicht richtete – und im nächsten Augenblick versteifte, als ein massiver Schlag auf seinen eigenen Hinterkopf niederkrachte.
Das Letzte, was Lucy sah, bevor sie bewusstlos wurde, war, wie Haygarths dünner, schlaffer Körper mit Brachialgewalt von ihr heruntergezerrt wurde, und zwar von niemand anderem als von Alan Denning.
Kapitel 1 Heute …
Er hatte gesagt, er heiße Ronnie Ford und stamme aus Warrington. Seinem kräftig gebauten Körper, seinem wettergegerbten Gesicht und seinem kreidegrauen Haar nach zu urteilen musste er Ende vierzig sein. Offenbar hatte er einen eigenen kleinen Betrieb – eine Kfz-Werkstatt, was erklärte, warum er einen abgetragenen Pullover und eine ölverschmierte Canvas-Hose trug –, doch er hatte hinzugefügt, dass er auf dem Weg nach Hause sei, wo das Abendessen auf ihn warte. Je länger die Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, mit ihm mitfuhr, desto stärker vermutete sie, dass er sie merkwürdigerweise tatsächlich aus ehrenhaften Gründen mitgenommen hatte, ja dass er sich womöglich sogar einfach nur als Gentleman hatte erweisen wollen.
Während der ersten Viertelstunde ihrer gemeinsamen Fahrt in seinem Wagen hatte er den Blick starr nach vorne auf die Straße gerichtet und freundliche Konversation betrieben, wobei er jedes nur erdenkliche Thema angesprochen hatte: das ungewöhnlich milde Herbstwetter, den miesen Zustand des Hotels in Malaga, in dem er gemeinsam mit seiner Frau die letzten beiden Augustwochen verbracht hatte, und die sich seiner Meinung nach noch aussichtsloser als üblich gebärdenden Teilnehmer der neusten Ausgaben der Castingshow X Factor. Harmlose, unverfängliche Themen.
Dieser Ronnie Ford hatte also ein bisschen etwas von einer Vaterfigur.
Oder zumindest von einem Onkeltypen.
Doch letzten Endes war auch er ein Mann. Und wie es schien, genauso scharf wie viele andere Kerle.
Als er den Wagen auf dem ruhigen Parkplatz abstellte und sie ausstieg, um kichernd zu dem Zaunübertritt zu laufen, folgte er ihr und bekundete übertriebene Bewunderung dafür, dass sie trotz ihres engen, knielangen Rocks und ihrer High Heels so geschmeidig die Sprossen hinaufstieg. Natürlich sah er vor allem, wie sexy sie die klapprige Leiter mit wackelndem Hintern hinaufstöckelte und wie graziös sie über die oberste Sprosse stieg, bevor sie auf der anderen Seite wieder hinabstieg und auf das hinter dem Zaun liegende Feld trat.
In dem Moment rief er: „Nicht so schnell, Miss! Warten Sie doch einen Augenblick.“
Er konnte sie nicht mehr sehen, was vor allem auf das herbstliche Zwielicht zurückzuführen war. Es war Anfang Oktober und noch nicht einmal sieben Uhr abends, die Dämmerung hatte sich also noch nicht wirklich herabgesenkt. Es herrschten angenehme Temperaturen. Sie hatten einen herrlichen Altweibersommer gehabt, der sich selbst in dieser späten Jahreszeit erst langsam verzog, aber der bewölkte Himmel spendete durchaus noch etwas Licht, aus dem Gestrüpp am Boden stiegen trübe Dunstschwaden auf.
Auf dem Feld waren von dem frisch gemähten Getreide nur noch scharfkantige Stoppeln stehen geblieben. Es hatte in etwa die Größe eines Fußballfeldes, doch wie sie bereits wusste, gab es einen stoppellosen Pfad, der schnurgerade über das Feld zu einer Reihe von Bäumen mit rötlichen Blättern führte. Immer noch kichernd, eilte sie den Pfad entlang. Sie hatte keine Ahnung, warum Männer dieses „kecke Kichern“ so anziehend fanden, aber all die notgeilen Männer fuhren nun mal darauf ab.
Hinter sich hörte sie das Stapfen von Ronnie Fords Schuhen auf den hölzernen Sprossen und sein lautes Keuchen. Ein nicht allzu fitter Onkeltyp, aber offenbar ein Mann, der jetzt das Gefühl hatte, auf einer Mission zu sein.
So endete es immer. Und es war immer so bemitleidenswert einfach.
Sie hatte lediglich ihre schwarze Strickmütze abnehmen, ihre blonden Locken schütteln und den Reißverschluss ihres Anoraks gerade so weit herunterziehen müssen, dass die knappe Bluse zum Vorschein kam, die sie darunter trug, und dann hatte sie ein paarmal die Beine übereinandergeschlagen und wieder geöffnet, während er versucht hatte, sich aufs Fahren zu konzentrieren.
Es hatte nicht lange gedauert, bis er angefangen hatte, ihr verstohlene Blick zuzuwerfen. Und als dann nach einer guten Viertelstunde, nachdem sie eingestiegen war, die von Andeutungen gespeiste Unterhaltung begonnen hatte, hatte sie gewusst, dass er ihr gehörte.
„Es ist schon in Ordnung, wenn Sie mich ein bisschen beäugen“, hatte sie in beinahe entschuldigendem Ton gesagt. „Ich weiß, dass ich einiges zu bieten habe. Ich bekomme ständig anzügliche Sprüche von Männern zu hören. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Tun Sie sich also keinen Zwang an, ich habe nichts dagegen, wenn Sie mich ansehen.“
„Das Problem ist nur, dass ich mich auf die Straße konzentrieren muss“, hatte er erwidert, wobei sein Nacken sichtlich errötete. Wohin wollten Sie noch mal?«
„Nach Liverpool.“
„Ich kann Sie am Busbahnhof in Warrington absetzen. Von dort dürften Sie problemlos nach Liverpool weiterkommen. Es ist nicht allzu weit.“
„Das ist sehr nett von Ihnen.“
„Kein Problem.“
Obwohl er ihre ausdrückliche Erlaubnis hatte, bedachte Ronnie sie weiterhin nur mit verstohlenen Blicken. Möglicherweise war er ein noch noblerer Gentleman, als sie im ersten Moment gedacht hatte. Oder es lag einfach nur an seinem Alter und seiner Erziehung. Er mochte zwar denken, dass es ihr nichts ausmachte, angegafft zu werden – ihr vielleicht sogar gefiel –, doch zunächst schien er zu versuchen, der Verlockung zu widerstehen, sie zu taxieren. Und zu versuchen, sich nicht in diesen großen Rehaugen zu verlieren, die ihn so eindringlich gemustert hatten, als er neben ihr angehalten hatte, als ob sie hätten fragen wollen: „Haben Sie gehalten, um mir zu helfen? Ist es möglich, dass Sie wirklich gehalten haben, um mir Ihre Hilfe anzubieten? Oder sind Sie auch nur auf das Eine aus?“
Dies trug immer dazu bei, ihren Auftritt zu perfektionieren, die Nummer des „verlorenen kleinen Mädchens“.
Sie setzte die neckische Unterhaltung fort und schlug erneut mehrmals die Beine übereinander und öffnete sie wieder, sodass der Saum ihres Rockes langsam ihre Schenkel hinaufwanderte.
„Bis nach Warrington ist es noch ein ganzes Stück“, stellte sie fest. „Und ich kann Ihnen nichts dafür geben, dass Sie mich dorthin bringen.“
„Kein Problem“, entgegnete er. „Ich fahre sowieso in die Richtung.“
„Kann ja sein, aber Sie sollten trotzdem etwas dafür bekommen, dass Sie sich solche Umstände machen. Ich heiße übrigens Loretta.“
„Äh … Nett, Sie kennenzulernen, Loretta.“
Etwas verspätet fummelte er am Radio herum und suchte einen anderen Sender, einen, auf dem etwas ruhigere Musik gespielt wurde als der Hardrock, der derzeit auf sie eindröhnte. Nach einem zwanzigsekündigen Rauschen und wiederholtem Betätigen der Sendersuchtaste fand er ein langsames bluesiges Saxofonstück und stellte die Laustärke so weit herunter, dass die Musik noch gut zu hören war, sie sich jedoch problemlos unterhalten konnten.
„Und? Was meinen Sie?“, fragte sie und sah ihn an. „Wie entschädige ich Sie am besten für Ihre Mühe?“
„Reden Sie doch keinen Unsinn, Loretta …“
Aber sie redete keinen Unsinn. Und das wusste er genau.
Das verrieten schon ihre freizügige Kleidung, ihre unschickliche Pose und diese Marilyn-Monroe-artige Mischung aus einem süßen, unschuldigen Mädchen und einer pulsbeschleunigenden Verführerin, die sie an den Tag legte.
„Hören Sie … und damit will ich auf keinen Fall irgendetwas andeuten, aber …“ Er räusperte sich. „Ich habe kaum Bargeld dabei.“
„Sie bezahlen doch schon, indem Sie mich mitnehmen“, stellte sie kichernd klar. „Ich frage mich ja nur, ob ich einen Gefallen erwidern kann.“
„Ziehen Sie mich bitte nicht so auf, Miss“, entgegnete er und fuhr nicht mehr ganz so konzentriert. „Damit machen Sie einen alten Mann nur noch betrübter.“
„Ich meine es absolut ernst“, stellte sie klar. „Ich möchte Sie angemessen entschädigen. Sie werden feststellen, dass ich sehr freigiebig bin.“
„Tatsächlich?“ Aber es war nicht wirklich als Frage gemeint.
„Hören Sie … gleich da vorne zweigt eine Nebenstraße ab“, sagte sie. „Sie führt nach Abram, aber nach etwa achthundert Metern kommt ein Parkplatz für Fernfahrer. Es gibt dort auch einen Fish-and-Chips-Wagen, aber um diese Uhrzeit hat er schon zu. Wir könnten da parken.“
Er sah sie verwundert an. Doch was auch immer er im Begriff war zu sagen – die Worte erstarben auf seiner Zunge, als sein Blick an ihrem silbernen Anorak herunterwanderte, dessen Reißverschluss inzwischen vollständig heruntergezogen war und einen tiefen Ausschnitt enthüllte, und dann noch tiefer, wo unter dem Rock zwei schwarze Strumpfränder zum Vorschein gekommen waren, die von glänzenden Klammern und weißen Strapsen gehalten wurden.
Er betrachtete erneut ihr hübsches Gesicht, diesmal misstrauisch. Und dann grinste er. Breit, wenn auch ein wenig ungläubig. „Ist das wirklich wahr?“
„Vielleicht. Sie werden es herausfinden müssen.“
Und dazu war er nur allzu gerne bereit, warum sonst sollte er sich nun hier auf dem abgemähten Feld wiederfinden. Sie hatte es bereits zu drei Vierteln überquert, vor ihr ragten die dunklen Bäume auf, Ronnie Ford war gut fünfzig Meter hinter ihr.
„Loretta!“, rief er und ächzte und keuchte, während er versuchte, sie einzuholen. „Warten Sie auf mich.“
Er war nicht nur schlecht in Form, sondern seine Gesundheit ließ auch zu wünschen übrig. Vielleicht wäre es geboten, ihm noch eine weitere Aufmunterung zu bieten. Der Wald lag jetzt direkt vor ihr, zwischen den nächsten Bäumen führte ein Pfad unter einem natürlichen, aus Ästen gebildeten Bogen in ihn hinein. Als sie den Wald betrat und kurzfristig aus seinem Sichtfeld verschwand, hob die Frau ihren Rock, streifte ihren weißen Seidenslip herunter, trat gewandt aus ihm heraus und hängte ihn an den nächsten Ast.
Dann kicherte sie wieder und huschte weiter in die Dunkelheit. Jegliche Bedenken, die er vielleicht noch hegen sollte, würden sich nun komplett in Luft auflösen.
„Loretta?“ Er betrat jetzt ebenfalls den Wald und versuchte es auf die humorvolle Weise. „Wie Sie gesehen haben, nähere ich mich dem Herbst meines Lebens. Ich bin eher so was wie ein erlesener Jahrgangswein, aber nicht mehr dazu geeignet, in der Gegend herumzurennen.“
Sie betrachtete ihn aus einer Entfernung von gut vierzig Metern. Sie stand hinter den Rhododendronsträuchern an der linken Seite des Pfades, nach denen sie Ausschau gehalten hatte.
Nachdem er etwa fünf Meter weit in den Wald hineingegangen war, blieb er stehen und sah sich um. Er war auf einmal auf der Hut.
Sie fragte sich, was er wohl dachte.
Zwischen den knorrigen Stämmen der Bäume machte sich zusehends bläuliche Düsternis breit, hier und da wuchsen niedrige Büsche, die mit Tau überzogen waren. In der Luft lag der typische Modergeruch des Waldes, es roch nach Pilzen und nach altem Laub. Auf einmal regte sich nichts mehr.
Es sah so aus, als ob er im Begriff war umzukehren. Doch dann hielt er abrupt inne.
Er hatte den Slip entdeckt, der zehn Meter zu seiner Rechten von einem Zweig herabbaumelte.
Er stapfte hastig auf den Baum zu, an dem der Slip hing. Seine Finger zuckten, erkennbar begierig darauf, den weichen, geschmeidigen Stoff zu begrapschen.
So viel zu dem Onkeltypen.
Er riss den Slip herunter und breitete ihn zwischen den Händen aus, zweifellos um zu prüfen, ob der Fetzen Stoff auch wirklich ein Höschen war. Dann legte er ihn zu einem ordentlich gefalteten Quadrat zusammen und schob ihn in seine linke Gesäßtasche. Er schlenderte zurück zu dem Pfad und stapfte weiter auf sie zu, tiefer in den immer dunkler werdenden Wald hinein, doch jetzt mit einem breiten, lüsternen Grinsen auf seiner Visage.
Sie hätte am liebsten laut losgelacht, verkniff es sich aber, um sich nicht zu verraten.
Der arme beschränkte Kerl glaubte tatsächlich, dass ihm eine Nummer bevorstand.
Kapitel 2
Die Siedlung Hatchwood Green war selbst nach den Maßstäben, die in Crowley – einer der heruntergekommensten Städte des Ballungsraums Greater Manchester – anzulegen waren, ein Schandfleck. Sie war wie all die anderen Siedlungen des hiesigen städtischen Wohnungsbaus in den 1950er-Jahren hochgezogen worden, allerdings war sie von allen die größte. Sie war auf einer ausgedehnten Industriebrache angelegt worden, genau genommen auf dem ehemaligen Gelände der längst nicht mehr existierenden Manchester Railway Company. Die Siedlung strafte in vielerlei Hinsicht den Verheißungen öffentlicher Sozialwohnungen aus der Nachkriegszeit Großbritanniens Lügen.
Die nagelneuen geräumigen Unterkünfte für die Arbeiter aus Crowley hatten sich für deren Bewohner rasch als unvorteilhaft erwiesen, so weit draußen, fern vom Stadtzentrum mit seinen Annehmlichkeiten und oftmals auch fern von der Arbeitsstelle. Noch entscheidender jedoch war, dass die Bewohner ihre mühsam aufgebauten sozialen Netzwerke verloren, indem sie aus ihrer vertrauten Umgebung in die neu hochgezogenen Trabantenstädte gezogen waren. Wenn man dann noch die jahrzehntelange Vernachlässigung und Isolation hinzunahm sowie den allmählichen Verfall der billig gebauten Wohnungen, die ihre erwartete Lebensdauer längst überschritten hatten, und die von Drogenkonsum und Kriminalität herrührenden Verheerungen, verstand man, warum man es mit einer wirklich deprimierenden Umgebung zu tun hatte. Viele Jahre nach diesem Verfall war Hatchwood Green, selbst nachdem den Bewohnern die Möglichkeit eröffnet worden war, ihre Wohnungen zu günstigen Bedingungen zu kaufen, immer noch ein bedrohlicher Ort der Trostlosigkeit.
Nach Ansicht von Police Constable Lucy Clayburn, die als Polizistin nicht umhinkonnte, alldem mit einem gewissen Zynismus zu begegnen, hatten diese monströsen, ausgedehnten Sozialwohnungssiedlungen von Natur aus etwas Seelentötendes. Alle Häuser waren aus dem gleichen roten Backstein gebaut, die identischen Türen waren in sich wiederholenden Farbmustern gehalten und abwechselnd blassblau, blassrot oder blassgelb; auf den Rasenflächen zwischen den Häusern gab es nichts – keine Bäume, keine Büsche, keine Blumenbeete –, höchstens hier und da die Überreste eines Kinderspielplatzes. Und wenn diese Siedlungen erst einmal in die Phase des allmählichen Verfalls eingetreten waren und es nur noch heruntergekommene Gebäude und kaputte Zäune gab, wie es in Hatchwood Green der Fall war, erreichte die Trostlosigkeit, die sie ausstrahlten, einen weiteren Tiefpunkt.
Deshalb war Lucys Gefühlslage von dem üblichen stoischen Gleichmut geprägt, als sie an einem späten Mittwochabend in Begleitung von Police Constable Malcolm Jarvis – einem jungen Beamten in der Probezeit, den sie seit zwei Monaten unter ihre Fittiche genommen hatte – die Adresse Clapgate Road Nummer 24 in Hatchwood Green ansteuerte, um in einem Fall von häuslicher Gewalt einzuschreiten.
Das Haus war weder in einem besseren noch in einem schlechteren Zustand als die anderen Häuser der Siedlung. Es gab einen kleinen Vorgarten, der im Wesentlichen eine Abfallhalde war (obwohl das nicht immer so gewesen war, wie Lucy sich erinnerte), ein verrottetes Tor hing schief in den Angeln, dicke Unkrautbüschel wucherten zwischen den schon lange nicht mehr gleichmäßig liegenden Platten des vorderen Zugangsweges. Als sie an der Haustür waren, konnten sie den Tumult in dem Haus bereits hören. Auf Lucys kräftiges, nachdrückliches Klopfen wurde ihnen sofort geöffnet. Im Haus sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, wobei man nicht sagen konnte, ob es sich um eine kürzlich zugetragene Verwüstung handelte oder um das übliche Chaos. Die schmuddeligen Tapeten und die schimmeligen Teppiche ließen Letzteres vermuten, aber ob die verstreute Unterwäsche, der überall herumliegende Müll und der sonstige verdreckte Nippes neueren Datums waren, war schwer zu sagen. Die Luft im Haus war natürlich furchtbar. Es stank nach einem Gemisch aus Schweiß, abgestandenem Zigarettenqualm, Alkohol und Ketchup – was zwar ekelerregend war, aber zugleich auch traurig, dachte Lucy, denn auch das war in diesem Haus nicht immer so gewesen.
Die Bewohner des Hauses waren Rob und Dora Hallam, er ein entwurzelter arbeitsloser Waliser, sie stammte aus der Gegend und hatte vor Kurzem ihren Job in einem Supermarkt verloren, weil sie etwas hatte mitgehen lassen. Sie waren beide Ende dreißig, sahen mit ihrem zerzausten Haar, ihren bleichen Gesichtern und ihren zahlreichen Zahnlücken jedoch älter aus. Rob Hallam war klein, gedrungen und übergewichtig, Dora so dünn, dass sie regelrecht ausgemergelt wirkte. Ihr Gesicht war stark eingefallen, als ob die Knochenstruktur selbst dabei wäre, sich zu zersetzen. Rob war momentan lediglich mit einer Unterhose, einem Unterhemd und schmutzigen Socken bekleidet, Dora trug Latschen, eine Schlafanzughose und ein Manchester-United-T-Shirt.
Beide bluteten stark, Rob aus einer aufgeplatzten Augenbraue und einer klaffenden Wunde an der linken Wange, Dora aus der Nase, aus der sich, als sie in ein Taschentuch schniefte, ein steter Strom schmieriger roter Blasen ergoss.
Wie es aussah, war das Wohnzimmer der Hauptschauplatz des Kampfes gewesen. Dort fanden sich die meisten zu Bruch gegangenen Möbel und die meisten verstreuten Scherben. Ein weiterer Hinweis war die aus den Angeln gerissene Tür, die aus dem Wohnzimmer in die Küche führte und jetzt an einem Sessel lehnte. Doch was für ein Gewaltausbruch auch immer sich hier entladen hatte, inzwischen war die Schlacht vorbei, vor allem, weil die Kombattanten zu erschöpft waren, um weiterzukämpfen. Sie standen ein paar Meter voneinander entfernt jeder auf einer Seite des Zimmers und starrten einander keuchend an. Zwischen ihnen dudelte surrealerweise der Fernseher vor sich hin, es liefen gerade ein paar verrückte Eskapaden von Muh-Kuh und Chickie.
„Was soll ich also nun mit Ihnen beiden machen?“, fragte Lucy, die dem unvermeidlichen Schlagabtausch und den gegenseitigen Beschuldigungen erst einmal eisern schweigend zugehört und sich geweigert hatte, Rob Hallams gewundene Erklärung für den Ausbruch des Streits auch nur eine Sekunde lang ernst zu nehmen. Er hatte doch tatsächlich darauf beharrt, sie hätten sich deshalb an die Köpfe gekriegt, weil seine Frau die „bescheuerte Behauptung“ aufgestellt habe, bei Red Guy, dem Erzfeind von Muh-Kuh und Chickie, handele es sich um eine eingebildete Figur und nicht wirklich um den Teufel.
„Sie müssen ihn festnehmen“, brachte Dora wimmernd hervor.
„Ihn verhaften?“, fragte Lucy. „Also wirklich, Dora … Jedes Mal, wenn wir versuchen, ihn zu verhaften, drehen Sie entweder durch, sobald wir ihn auch nur anfassen, oder sie kommen auf die Wache gestürmt und beharren darauf, dass er Ihnen kein Haar gekrümmt hat.“
„Diesmal hat er mir ein Haar gekrümmt, das sehen Sie ja wohl.“ Dora riss mit ihren blutverschmierten Fingern an ihrem Haar. „Sehen Sie doch nur, in was für einem Zustand ich bin.“
„Und was ist mit Rob?“
„Aber ich musste mich doch wehren …“
„Womit haben Sie sich denn gewehrt? Mit einem Fleischwolf?“
Doras Mund klappte auf wie das Maul eines Guppys. Sie verstand die Welt nicht mehr.
„Ich will darauf hinaus, Dora, dass immer zwei dazugehören“, stellte Lucy klar. „Jedes Mal, wenn Sie zu viel trinken, haben Sie Zoff miteinander – meistens wegen nichts – und wecken die ganze Nachbarschaft auf. Und es passiert nicht nur jeden Freitag und jeden Samstag. Wie es aussieht, kommt es inzwischen auch an normalen Wochentagen vor.“ Sie wandte sich Rob zu. „Was haben Sie denn zu dem Ganzen zu sagen? Und kommen Sie mir nicht mit so einem Scheiß, dass Sie sich wegen irgendwelcher Zeichentrickgeschichten für Kinder an die Gurgel gegangen sind!“
Rob sah sie hohläugig an. „Sie hat recht. Ich gehöre eingelocht. Selbst wenn sie ihre Anzeige zurückzieht, können Sie das tun. Das haben Sie mir letztes Mal selber gesagt.“
„Das stimmt, Rob … Aber diesmal ist die Körperverletzung nicht nur eindeutig von Ihnen ausgegangen, oder? Sie müssen mit mindestens genauso vielen Stichen genäht werden wie Ihre Frau. Ihr Anwalt wird seinen großen Tag haben. Es sei denn natürlich, ich nehme Sie beide fest.“ Lucy bearbeitete mit den Knöcheln ihr Kinn. „Ich könnte Sie beide wegen Körperverletzung, Ruhestörung und Beschädigung öffentlichen Eigentums drankriegen … das dürfte reichen.“
„Uns beide?“ Rob sah bestürzt aus.
„Uns beide?“, wiederholte Dora, als ob das nicht Teil ihres Plans gewesen wäre.
„Wir leben im Zeitalter der Gleichberechtigung, Dora“, entgegnete Lucy. „Häusliche Gewalt funktioniert heutzutage in beide Richtungen.“
Dora klappte erneut die Kinnlade herunter, und sie gaffte Lucy völlig perplex an.
„Natürlich wäre das letzten Endes für uns alle pure Zeitverschwendung“, fügte Lucy hinzu. „Oder? Ganz zu schweigen davon, dass es zudem auch noch Geldverschwendung wäre … wo Sie doch in Wahrheit nichts weiter brauchen als ein wenig psychologische Betreuung.“ Sie ging durch das zugemüllte Zimmer und nahm ein gerahmtes Foto vom Kaminsims, auf dem ebenfalls ein wildes Durcheinander herrschte. Das Foto zeigte einen kleinen, blonden Jungen, der trotz seiner fehlenden Schneidezähne zufrieden lächelte. „Bobbies Tod hat für Sie beide alles verändert, stimmt’s?“
Rob ließ sich auf das Sofa plumpsen. Er schüttelte eine Bierdose, kippte sich den letzten Rest, den sie noch enthielt, in den Mund und warf sie auf den Boden. „Ich kann mich an die Zeit davor nicht erinnern“, sagte er.
„Das müssen Sie aber versuchen“, entgegnete Lucy.
Als Antwort langte er in eine Einkaufstasche, die neben der Tür stand, entnahm ihr eine neue Bierdose und riss sie auf.
„Was meinen Sie mit psychologischer Betreuung?“, fragte Dora.
„Trauerbegleitung“, erklärte Lucy. „Ich weiß, dass Bobbies Tod Ihr und Robs Leben verändert hat, Dora, denn davor brauchte ich nie mitten in der Nacht hier aufzukreuzen. Aber es ist jetzt fünf Jahre her. Und es zerreißt Sie immer noch. Also brauchen Sie professionelle Hilfe. Und noch was: Sie müssen mit dem Trinken aufhören.“ Sie nahm Rob die Bierdose aus der Hand und stellte sie auf den Kaminsims. „Auch dafür gibt es Hilfe. Aber als Erstes müssen Sie es auch wollen.“
Rob sah mit trüben Augen zu ihr auf. „Also … ich komme nicht in den Knast?“
Er schien eher verblüfft als verwirrt, doch jetzt, da er sich ein wenig beruhigt hatte, wurde ihm vielleicht allmählich bewusst, dass die Vorteile, die damit verbunden waren, in seinem eigenen Bett schlafen zu dürfen, schwerer wogen als die Nachteile, die damit einhergingen, in eine mit Erbrochenem befleckte Gefängniszelle gesperrt zu werden.
„Hängt davon ab.“ Lucy zeigte auf die herausgerissene Tür. „Was ist damit?“
„Die kann ich, glaube ich, reparieren.“
„Bestimmt?“
„Ja.“
„Wann?“
„Sobald ich dazu komme.“
„Das reicht mir nicht, Rob. Morgen Nachmittag habe ich meine nächste Schicht. Als Erstes komme ich hier vorbei. Wird die Tür bis dahin repariert sein?“
„Ja.“
„Sicher? Sehen Sie mir in die Augen, und wiederholen Sie es.“
„Ja“, sagte er noch einmal, doch er sah zu fertig aus, um wirklich überzeugend wirken zu können.
„Na schön …“ Lucy dachte nach. „Also gut, jetzt mal im Klartext: Bevor ich hier verschwinde, möchte ich von Ihnen das heilige Versprechen hören, dass ich für den Rest dieser Nacht … Ach was, so billig lassen wir Sie nicht davonkommen … für den Rest dieses Jahres nicht noch einmal zu dieser Adresse gerufen werde.“
„Versprochen“, sagte Dora leise.
Rob nickte erneut.
„Und Sie werden sich Hilfe suchen, verstanden?“
„Ja“, sagte er.
Lucy wusste, dass sie das nicht tun würden. Im Moment schienen sie sich beruhigt zu haben, aber in einigen Tagen würden sie sich wieder wegen irgendeiner absurden Lächerlichkeit in die Wolle kriegen. Die Hallams waren zu sehr in diesem Trott gefangen, zu stark von den Ereignissen mitgenommen und ergaben sich zu sehr ihrem Elend und ihrer Hoffnungslosigkeit, um ihrem Schicksal eine neue Wende geben zu können. Jeder, der einen dunklen, feuchten Tunnel durchschritt, musste zumindest einen kleinen Lichtschimmer an dessen Ende erkennen können. Aber in Wahrheit scherte Lucy sich nicht groß darum, wie es mit Leuten wie den Hallams weiterging. Das konnte sie sich nicht leisten. Manchmal hatte sie die Nase von diesen Mini-Desastern im Leben anderer Menschen derart voll, dass sie einfach nur irgendwie dafür sorgen wollte, dass sie Ruhe gaben, auch wenn das nur eine vorübergehende Lösung war.
„Also gut …“ Sie hielt sich ihr Funkgerät vor den Mund. „Drei von 1485. Kommen.“
„Drei hört, reden Sie, Lucy“, knisterte die Antwort des diensthabenden Beamten der Funkzentrale aus dem Gerät.
„Einsatz an der Clapgate Lane beendet. Keine Straftaten zur Anzeige zu bringen. Alle Beteiligten verwarnt. Kommen.“
„Verstanden. Vielen Dank. Ende.“
„Das war echt cool“, stellte Jarvis fest, als sie wieder in ihren Polizeiwagen stiegen.
„Cool?“
„Wie Sie die Situation entschärft haben, meine ich.“
„Sie hat sich von allein entschärft.“ Sie legte den Gang ein. „Die beiden waren zu fertig, um weiter übereinander herfallen zu können.“
„Ja, aber wir hätten sie beide mitnehmen können. Dafür hätte es ausreichende Gründe gegeben. Stattdessen haben Sie die Leute beruhigt, ein paar ernste Worte mit ihnen geredet, sie belehrt und Ihnen einiges erspart …“
„Und uns einen Haufen Papierkram.“ Lucy steuerte den Wagen vom Randstein weg. „Das vor allem.“
„Sie können mir nichts vormachen“, entgegnete Jarvis grinsend. „Sie wollten die beiden nur nicht noch tiefer in die Scheiße reiten … Sie werden auf Ihre alten Tage weichherzig.“
Er war ein hochgewachsener, knochiger Typ mit roten Haaren und Sommersprossen, und angesichts dessen, dass Lucy schon zehn Dienstjahre auf dem Buckel hatte, wohingegen er gerade mal seit ein paar Monaten dabei war, hätte sein Ton einem Außenseiter vielleicht ein bisschen anmaßend erscheinen können, aber ein paar Monate Streifendienst in einer Stadt wie Crowley schweißten Polizisten zusammen, so wie es sonst höchstens noch beim Militär denkbar war.
„Na ja“, Lucy steuerte auf das südliche Ende der Siedlung zu, „es ist ja nicht so, als ob sie nicht auch so schon genug am Hals hätten.“
„Was ist eigentlich mit dem Kleinen passiert?“
„Er wurde überfahren.“
„Oh Scheiße!“
„Auf dem Nachhauseweg von der Schule. Hat mit seinen Schulkameraden irgendwelchen Unfug getrieben, ist dabei vom Bürgersteig auf die Straße und direkt vor einen Bus gesprungen.“
„Klingt furchtbar.“
„War es auch.“
„Waren Sie da?“
„Als erste Beamtin vor Ort. Aber wir konnten nichts mehr für ihn tun. Anschließend musste ich den Eltern auch noch die Todesnachricht überbringen.“ Sie seufzte. „Ist nicht gerade eine meiner Lieblingserinnerungen.“
Bevor Jarvis noch etwas sagen konnte, spuckte das Funkgerät ein lautes statisches Rauschen aus.
„November Drei an alle Einheiten, dringende Mitteilung … Angriff auf weibliches Opfer gemeldet – in der Telefonzelle am oberen Ende der Darthill Road. Ist jemand in der Nähe? Kommen!“
„1485 und 9993 verlassen gerade Hatchwood Green! Fahren sofort hin!“, rief Jarvis, während Lucy eine Hundertachtzig-Grad-Wende machte, durch die Siedlung zurückraste und das Blaulicht und das Martinshorn einschaltete.
Sie waren knapp fünf Kilometer von der Darthill Road entfernt, die einen steilen Hügel hinab verlief und an der Südseite von Häusern gesäumt war, wohingegen die Nordseite von Brachland begrenzt wurde. Somit gab es aus ihrer Richtung nur eine Möglichkeit, auf die Darthill Road zu gelangen, doch andere Streifenwagen waren näher am Tatort gewesen, und als Lucy und Jarvis die Telefonzelle erreichten, war Sergeant Robertson, der in dem Viertel Streife gefahren war, schon da. Außerdem waren bereits eine Verkehrsstreife sowie ein Krankenwagen vor Ort, der rein zufällig gerade in der Nähe gewesen war. Den hin und her jagenden Funksprüchen war zu entnehmen, dass der Angreifer zu Fuß geflohen war.
Lucy und Jarvis sprangen aus dem Wagen und eilten zum Schauplatz des Geschehens.
Die Frau, die eindeutig noch sehr jung war, aber im Gesicht so stark blutete, dass sie nicht zu erkennen war, saß weinend auf der Bürgersteigkante. Neben ihr knieten zwei Sanitäterinnen und verarzteten ihre Schnittwunden und ihre Prellungen. Robertson hatte sein Handy am Ohr und redete mit den diensthabenden Kollegen von der Kripo, doch während einer kurzen Besprechung mit den Verkehrspolizisten, die bereits dabei waren, den Ort mit Absperrband zu sichern, erfuhren Lucy und Jarvis, dass der Angreifer sein Opfer bereits ein paar Meter auf das Brachland gezerrt hatte, wo es sich so heftig gewehrt hatte, dass er nicht weitergekommen war. Er hatte mehrmals auf die junge Frau einschlagen müssen, um sie unter Kontrolle zu bringen, und als er geglaubt hatte, sie außer Gefecht gesetzt zu haben, hatte er begonnen, ihre Handtasche zu durchwühlen – doch dann war sie plötzlich aufgesprungen und abgehauen. Da der Kerl ihr Handy bereits hatte, war sie in die Telefonzelle gestürmt und hatte die Notrufnummer gewählt. Der Angreifer hatte wie von Sinnen auf die Tür der Zelle eingetreten und dann das Weite gesucht.
Lucy stürmte zurück zu ihrem Wagen, Jarvis folgte ihr hastig.
„Melden Sie der Zentrale, dass wir den India 99 brauchen“, wies sie ihn an, während sie eine rasante Wende in drei Zügen hinlegte. Dieser Funkspruch fand bei der Greater Manchester Police zwar offiziell keine Verwendung mehr, doch einige Begriffe des Polizeijargons änderten sich nie. „Einen Helikopter.“
„Wo fahren wir denn hin?“, fragte Jarvis.
„Auf die andere Seite der Aggies.“
„Glauben Sie, er hat das Gelände schon überquert?“
„Er wird unsere Martinshörner gehört haben, Malcolm … Wenn ihn das nicht dazu gebracht hat, sich schnellstmöglich aus dem Staub zu machen, müsste er ziemlich bescheuert sein.“
„In dieser Finsternis wird er sich auf dem Gelände sein verdammtes Genick brechen.“
„Die meisten dieser Arschlöcher sind hier großgeworden. Sie haben wahrscheinlich schon als Kinder hier gespielt. Ihre Ortskenntnisse sind nicht zu unterschätzen. Und jetzt besorgen Sie mir diesen verdammten Heli!“
Die Aggies waren eine der zahlreichen Brachlandhalden, die es in Crowley gab. Einstmals ein Zentrum des Kohlebergbaus und der Baumwollindustrie, lag die Stadt eingequetscht zwischen Bolton und Salford und war, was die Zuständigkeitsbereiche der Greater Manchester Police anging, der November Division zugeteilt. Die Gegend hatte definitiv bessere Tage gesehen, die glorreichen Zeiten, in denen Dreck und Geld nah beieinandergelegen hatten, waren lange vorbei. Die meisten Fabriken waren dichtgemacht und entweder verrammelt oder zu Teppichlagern umfunktioniert worden. Die Gruben waren allesamt stillgelegt, die Zecheneinstiege und Übertageanlagen demontiert, einige der Schlackehügel und der Brachlandhalden waren sogar platt gewalzt und bebaut worden, doch der größte Teil dieser einstigen Industrieflächen war noch unverändert vorhanden, trostlose graue Narben in der Landschaft, die sich mitunter über Hunderte Hektar unbrauchbaren Landes erstreckten.
Die Aggies waren in dieser Hinsicht typisch. Eine hügelige Mondlandschaft, übersät von Ruinen verfallener Bergwerks- und Fabrikanlagen. Es gab keine Straße, die über das sich zwischen dem inneren Bereich von Crowley und Bullwood befindende Gelände führte – ein Bezirk, der genauso heruntergekommen war wie Hatchwood Green und rechteckig geformt, was bedeutete, dass jemand, der sich auskannte und versuchte, das Gelände zu Fuß zu überqueren, gute Aussichten hatte, die andere Seite schneller zu erreichen als jemand, der mit einem Auto unterwegs war, denn der musste ganz um die Aggies herumfahren. Und Lucy konnte es nicht wagen, Blaulicht und Martinshorn einzuschalten. Am unteren westlichen Rand endeten die Aggies in einem morastigen Gebiet, einer seinerzeit mit verschmutztem Wasser überschwemmten Überlauffläche des River Irwell. In der Ferne ragten dort jede Menge schwarze verbogene Träger auf, Überreste der alten Bleicherei, die vor zwanzig Jahren komplett niedergebrannt war. Abgesehen davon war das Gelände eine weite offene Fläche – es gab keine weiteren Gebäude, und die Straße, die um die Aggies herumführte, die Pimbo Lane, war unbeleuchtet, sodass jemand, der das Gelände von Süden nach Norden überquert, das Blaulicht eines Polizeiwagens hätte sehen können, insbesondere von dem höher gelegenen Bereich in der Mitte.
Doch zumindest spielte die Tatsache, dass es schon spät am Abend und Mittwoch war, den Beamten in die Hände. Auf dem ganzen Weg die Darthill Road hinunter begegnete ihnen kein einziges Auto, und als sie in die Pimbo Lane einbogen, kam ihnen nur ein Nachtbus entgegen, dessen Fahrer so geistesgegenwärtig war, an den Rand zu fahren, damit sie schneller an ihm vorbeikamen.
Währenddessen krächzten fortwährend Mitteilungen aus dem Funkgerät. Der Funkverkehr war intensiv und das statische Rauschen laut, doch sie bekamen genug mit, um zu erfahren, dass das achtzehnjährige Opfer Verletzungen im Gesicht, am Hals und im Brustbereich erlitten hatte. Ansonsten ging es der jungen Frau jedoch gut. Offenbar hatte sie eine Beschreibung des Täters abgegeben. Demnach war er Ende zwanzig, blond und trug einen grünen Trainingsanzug mit weißen Streifen. Jarvis kritzelte die Anhaltspunkte auf seinen Block, während Lucy den Wagen mit halsbrecherischer Geschwindigkeit die Straße auf der anderen Seite der Aggies entlangjagte.
Nach fünf Minuten hatten sie Bullwood erreicht. Lucy bremste ab, schaltete die Scheinwerfer aus und fuhr nur noch im Schritttempo weiter. Der BMW rollte durch eine dunkle Seitenstraße nach der anderen. Sie durchforsteten einige von Reihenhäusern gesäumte Wohnstraßen, die alle am Rand der Aggies endeten. Auf den ersten Blick schien es, als habe man von keiner dieser Wohnstraßen Zugang zu dem Brachland. Entweder wurden die Straßen von Garagen begrenzt, oder das Gelände war durch einen Maschendrahtzaun abgesperrt. Doch für die ansässigen Kinder war das verlassene Areal ein beliebter Spielplatz, sie ließen sich von derartigen Hindernissen nicht abhalten. Im Laufe der Jahre hatten sie so viele Löcher in den Zaun geschnitten, dass man ohne Weiteres durchkam, wenn man nur wusste, wo diese Durchgänge waren.
Die Frage war nun, wie viel Ortskenntnis der Verdächtige hatte.
Vorausgesetzt, dass er überhaupt über das Brachgelände geflohen war.
Die ersten drei Wohnstraßen waren menschenleer, vor den identisch aussehenden Backsteinhäusern gab es nichts als parkende Autos. Da es beinahe Mitternacht war, brannte in den meistern Häusern kein Licht. Doch in der vierten Wohnstraße, der Windermere Avenue, erhaschten sie einen Blick auf etwas, das sich bewegte. Ein dunkler Umriss schlenderte in eine kopfsteingepflasterte Gasse und verschwand aus ihrem Sichtfeld. Lucy drehte ihr Funkgerät so leise wie möglich und bedeutete Jarvis, das Gleiche zu tun. Dann fuhr sie langsam an der Einmündung der Straße vorbei und bremste scharf, bevor sie die Einmündung der nächsten Straße erreichten, der Thirlmere Place.
„Lassen Sie Ihren Helm im Auto“, flüsterte sie und öffnete die Tür.
Jarvis nickte und stieg genau in dem Moment auf die Straße, in dem ein Mann aus der Thirlmere Place geschlendert kam, scharf nach rechts abbog und sich auf dem Bürgersteig von ihnen entfernte. Im schwachen Schein der Straßenlaternen konnten sie keine Details ausmachen, aber sie erkannten, dass er ein helles T-Shirt trug, das sich eng um seinen muskulösen, keilartig geformten Oberkörper schmiegte. Was jedoch wichtiger war: Er trug eine Trainingshose und hatte sich die dazugehörige Trainingsjacke um die Taille gebunden.
Sie folgten ihm ohne Hast, wobei sie ihn rasch einholten. Dabei hatten sie beide eine Hand an ihren Polizeigürtel gelegt; Lucy umfasste ihre Dose mit dem Pfefferspray, Jarvis den Griff seines ausfahrbaren Teleskopschlagstocks. Als sie bis auf fünf Meter an den Mann herangekommen waren, sahen sie, dass sein dicker Stiernacken vor Schweiß glänzte und sein blondes strohartiges Haar schweißnass war. Außerdem konnten sie seinen Trainingsanzug jetzt gut erkennen – er war grün mit weißen Streifen.
„Entschuldigen Sie bitte“, sagte Lucy. „Kann ich kurz mit Ihnen reden?“
Er wandte sich nicht um und zuckte nicht einmal zusammen, als er angesprochen wurde, sondern ging unbeirrt weiter.
Sie rückten näher zu ihm auf und erwarteten jeden Augenblick, dass er losrennen würde.
„Entschuldigen Sie bitte … Wir sind Polizeibeamte und müssen mit Ihnen reden.“
Wenn Lucy mit etwas nicht gerechnet hatte, dann damit, dass er herumwirbelte, um ihr mit voller Wucht eins überzubraten, aber sie war inzwischen derart an solche Situationen gewöhnt, dass sie automatisch reagierte. Sie duckte sich unter dem Schlag weg und umfasste mit beiden Armen seine Taille.
„Malcolm!“, rief sie.
Jarvis mochte zwar noch ein Neuling sein, aber er stürzte sich auf den Angreifer, legte von hinten seine Arme um dessen kugelförmigen Kopf, umklammerte das an einen Neandertaler erinnernde Gesicht und hängte sich mit seinem ganzen Gewicht an ihn, um ihn zu Boden zu bringen. Die drei landeten mit voller Wucht auf dem Bürgersteig, der Verdächtige auf Jarvis und Lucy mit dem Gesicht zuerst auf dem Verdächtigen. Die beiden Männer bekamen am meisten von dem Aufprall ab, doch den Verdächtigen erwischte es am Schlimmsten, denn als Nächstes verpasste Lucy ihm mit dem linken Ellbogen einen Schlag in den Solarplexus, bevor sie mit der rechten Hand ihre Pfefferspraydose zog und ihm die ganze Ladung in sein ohnehin bereits würgendes und röchelndes Gesicht sprühte. Er schrie wie am Spieß und verkrampfte sich. Begleitet von einem befriedigenden Klick, ließ Jarvis eine Handschelle um sein kräftiges Handgelenk zuschnappen.
„Sie sind festgenommen, Sie Mistkerl!“, stellte Lucy keuchend klar, während er sich unter ihr wand, und drückte ihm ihren rechten Unterarm gegen die Kehle. „Sie sind verdammt noch mal verhaftet!“ Sie hielt sich ihr Funkgerät vor den Mund. „Drei von 1485 … Haben einen Verdächtigen für den Überfall an der Telefonzelle an der Darthill Road festgenommen. Befinden uns an der Kreuzung Pimbo Lane und Thirlmere Place. Benötigen umgehend Verstärkung, Vorgesetzte und einen Wagen für den Gefangenentransport. Kommen.“
„Verdammte Schlampe“, brachte der Festgenommene würgend hervor. „Dafür werden Sie dran glauben müssen …“
„Was haben Sie gesagt?“, fragte Lucy und richtete sich auf. Jarvis, der eindeutig stärker und gewandter war, als er aussah, hatte dem Festgenommenen inzwischen beide Hände mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselt. Sie umfasste mit ihrer behandschuhten Hand die Kehle des Kerls und drückte zu. „Was?“
„Nichts“, krächzte er. „Verdammt … Ich habe nichts gesagt!“
„Ach nein?“ Sie schüttelte den Kopf. „Für mich klang es so, als ob Sie auf meine Belehrung über Ihre Rechte geantwortet hätten: ›Okay, ich war’s … Sie haben mich auf frischer Tat ertappt‹. Haben Sie dieses Geständnis nicht auch gehört, Police Constable Jarvis?“
„Klar und deutlich, Police Constable Clayburn“, entgegnete Jarvis. Er war nicht nur gewandter, als er aussah, er verstand auch seinen Job richtig. „Absolut klar und deutlich.“







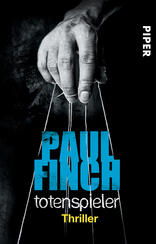

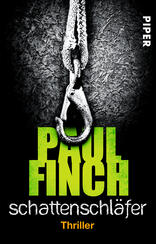





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.