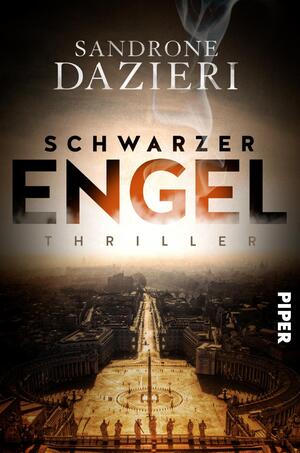
Schwarzer Engel (Colomba Caselli 2) - eBook-Ausgabe
Thriller
„Der zweite Fall für Colomba Casselli überzeugt auf allen Ebenen. (…) Sandrone Dazieri ist mit ›Schwarzer Engel‹ ein meisterhafter Thriller gelungen, der mit so manch unvorhergesehener Wendung durchgehend spannend bleibt.“ - Hamburger Morgenpost
Schwarzer Engel (Colomba Caselli 2) — Inhalt
Panik auf dem Hauptbahnhof in Rom: Im Luxusabteil des Schnellzugs aus Mailand werden alle Passagiere tot aufgefunden: auf mysteriöse Weise ermordet, hinter verschlossenen Türen, lautlos und rasend schnell. Colomba Caselli, die gerade wieder in den Polizeidienst zurückgekehrt ist, ist ratlos. Handelt es sich hier etwa um den Terroranschlag, den Rom schon so lange befürchtet? Doch der so geniale wie traumatisierte Dante Torre glaubt nicht an diese Theorie. Da stoßen Dante und Colomba auf die Spur eines Menschen, der jahrzehntelang unsichtbar geblieben ist – obwohl das Blut Hunderter Menschen an seinen Fingern klebt. Hat er auch die Toten aus dem Schnellzug auf dem Gewissen?
Leseprobe zu „Schwarzer Engel (Colomba Caselli 2)“
Kapitel I
Midnight Special
Zuvor
Die beiden Gefangenen, die in der Zelle zurückgeblieben sind, unterhalten sich leise. Der erste hat in einer Schuhfabrik gearbeitet, bevor er im Suff einen Mann umgebracht hat. Der zweite war Polizist und hat einen Vorgesetzten verpfiffen. Sie sind im Knast eingeschlafen und in der Schachtel wieder aufgewacht.
Der Schuhmacher schläft praktisch den ganzen Tag, der Polizist schläft praktisch nie. Wenn beide wach sind, unterhalten sie sich, um die Stimmen zu übertönen, die immer lauter werden und mittlerweile zu einem steten [...]
Kapitel I
Midnight Special
Zuvor
Die beiden Gefangenen, die in der Zelle zurückgeblieben sind, unterhalten sich leise. Der erste hat in einer Schuhfabrik gearbeitet, bevor er im Suff einen Mann umgebracht hat. Der zweite war Polizist und hat einen Vorgesetzten verpfiffen. Sie sind im Knast eingeschlafen und in der Schachtel wieder aufgewacht.
Der Schuhmacher schläft praktisch den ganzen Tag, der Polizist schläft praktisch nie. Wenn beide wach sind, unterhalten sie sich, um die Stimmen zu übertönen, die immer lauter werden und mittlerweile zu einem steten Gebrüll angeschwollen sind. Manchmal kommen auch noch Farben hinzu, so grell, dass sie die Männer zu blenden drohen. Das ist die Wirkung der Medikamente, die sie täglich nehmen müssen, die Wirkung des Helms, den man ihnen über den Kopf stülpt, woraufhin sie wie Würmer in der Pfanne zu zucken beginnen.
Der Vater des Schuhmachers saß während des Kriegs in einem Gefängnis mitten in seiner Heimatstadt. Unter dem Gebäude befand sich ein Raum mit einem Balken, auf dem man, wenn man draufgesetzt wurde, tunlichst das Gleichgewicht hielt, um nicht ins eiskalte Wasser zu fallen. Ein anderer Raum war so winzig, dass sich die Gefangenen nicht aufrichten konnten. Niemand weiß, wie viele Menschen in diesen Katakomben gefoltert wurden, niemand weiß, wie viele umkamen. Tausende, heißt es.
Aber die Schachtel ist schlimmer. Aus dem alten Gebäude ist man mit viel Glück nach Hause zurückgekehrt. Verletzt, geschunden, aber lebendig, wie der Vater des Schuhmachers.
In der Schachtel wartet man nur auf den Tod.
Die Schachtel ist weder ein altes Mietshaus noch ein Gefängnis, sie ist ein Betonkubus ohne Fenster. Ein wenig Tageslicht fällt durch die Gitter zum Hof über ihren Köpfen herein, jenem Hof, den solche wie sie nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen – das letzte Mal. Sie bringen dich nämlich erst wieder an die frische Luft, wenn du schon fast hinüber bist. Weil du vielleicht eine Wache angegriffen oder einen Zellengenossen umgebracht oder dich selbst verstümmelt hast. Oder weil du schon anfängst, deine Exkremente zu fressen. Jedenfalls reagierst du nicht mehr auf die Behandlung und bist nicht mehr von Nutzen für sie.
Diesen Punkt haben der Polizist und der Schuhmacher noch nicht erreicht, obwohl ihnen klar ist, dass nicht mehr viel fehlt. Sie sind gebrochen, sie haben gefleht und gebettelt, aber sie haben sich noch nicht aufgegeben, nicht im Mindesten. Und als das Mädchen kam, wollten sie es unbedingt beschützen.
Das Mädchen dürfte dreizehn Jahre alt sein, vielleicht sogar noch jünger. Seit es in ihre Zelle verlegt wurde, hat es kein Wort gesprochen. Es beobachtet sie nur mit seinen kobaltblauen Augen, die in dem kahl geschorenen Schädel riesig aussehen.
Sie reagiert auf nichts und hält sich von ihnen fern. Der Polizist und der Schuhmacher wissen nichts über sie, außer dem, was man in den Gängen der Schachtel so munkelt. Sperre Leute an den unzugänglichsten, schauerlichsten Orten ein, trenne sie voneinander, lege ihnen Handschellen an, reiße ihnen die Zunge aus dem Mund, sie werden trotzdem eine Möglichkeit finden, miteinander zu kommunizieren. Sie klopfen Morsezeichen an die Wand, flüstern in der Dusche, schmuggeln Zettelchen ins Essen oder in die Eimer für die Notdurft.
Irgendjemand meint zu wissen, dass sie mit der ganzen Familie in die Schachtel gekommen ist und als Einzige überlebt hat. Ein anderer behauptet, sie sei eine Zigeunerin und habe auf der Straße gelebt. Was auch immer die Wahrheit sein mag, das Mädchen behält sie für sich. Es hockt in seiner Ecke und verfolgt jede ihrer Bewegungen, misstrauisch. Es verrichtet seine Notdurft in den Eimer und nimmt das Essen und das Wasser, das ihm zusteht, redet aber kein Wort.
Niemand kennt seinen Namen.
Dreimal hat man das Mädchen aus der Zelle geholt. Die ersten beiden Male hat es hinterher aus dem Mund geblutet, und seine Kleider waren zerrissen. Die beiden Männer, die eigentlich dachten, innerlich schon vollkommen leer zu sein, haben geweint. Sie haben das Mädchen gewaschen und es gezwungen, Nahrung zu sich zu nehmen.
Beim dritten Mal war dem Polizisten und dem Schuhmacher klar, dass es das letzte Mal sein würde. Wenn die Wachen kommen, um dich in den Hof zu bringen, klingen ihre Schritte anders, verändert sich ihr ganzes Gebaren. Sie sind freundlicher und sanfter, damit du dich nicht aufregst. Sie bitten dich, deine Decke mitzunehmen und deinen nach Desinfektionsmittel stinkenden Zinnteller, beides schon für den nächsten Gefangenen bestimmt, und führen dich hinauf.
Als sich die Tür öffnete, richteten sich die beiden Gefangenen mühsam auf, um das Mädchen zu beschützen. Sie schien die Männer, mit denen sie fast einen Monat lang die Zelle geteilt hatte, zum ersten Mal wahrzunehmen. Aber sie schüttelte den Kopf und folgte den Wachen langsam hinaus.
Der Schuhmacher und der Polizist warten auf das Geräusch des Lkws, der die Leichen nach dem Gemetzel vom Hof wegbringt, denn es ist ein Gemetzel, mit dem man dir den Segen für deine letzte Reise erteilt. Eine kurze Reise, die hinter der umgrenzenden Mauer bereits endet, auf einem verschneiten Feld im Niemandsland. Das hat ein anderer Gefangener berichtet, der mal zu der Mannschaft gehörte, die die Leichen vergräbt. Mindestens hundert liegen unter der Erde, hat er gesagt, Körper ohne Gesicht und Hände. Die Schachtel wünscht nämlich nicht, dass man sie erkennt, sollten sie je gefunden werden. Irgendwann hat sich der Gefangene, der die Leichen vergraben hat, etwas in die Ohren gerammt, um die Stimmen zum Schweigen zu bringen. Inzwischen hat auch er die letzte Reise angetreten.
Zwanzig Minuten sind vergangen, aber der Polizist und der Schuhmacher haben immer noch nicht gehört, wie sich der alte Dieselmotor hustend in Bewegung setzt. Jenseits der Stimmen in ihrem Kopf und der Schreie aus den Nachbarzellen herrscht nur Stille.
Dann öffnet sich plötzlich die Zellentür. Es ist keine Wache und auch keiner der Ärzte, die regelmäßig zur Visite kommen.
Es ist das Mädchen.
Ihr Schlafanzug ist blutverschmiert, ein Spritzer ist auch auf ihrer Stirn gelandet, aber das scheint sie gar nicht zu merken. Sie hält den großen Schlüsselbund des Wachmanns, der sie hinausgeführt hat, in der Hand. Auch die Schlüssel sind blutverschmiert.
„Zeit zu gehen“, sagt sie.
In diesem Moment zerreißt das Schrillen der Sirenen die Luft.
1
Der Tod erreichte Rom zehn Minuten vor Mitternacht, mit einem Hochgeschwindigkeitszug aus Mailand. Er fuhr in die Stazione Termini ein, hielt an Gleis 7 und spuckte etwa fünfzig Fahrgäste mit leichtem Gepäck und müden Gesichtern aus. Sie zerstreuten sich rasch, um die letzte U-Bahn zu erwischen oder zum Taxistand zu gehen, während im Zug die Lichter erloschen. Aus der luxuriösen Executive Class war erstaunlicherweise niemand ausgestiegen – die pneumatischen Türen waren noch geschlossen –, und ein schläfriger Zugführer öffnete sie von außen, um nachzuschauen, ob vielleicht jemand eingeschlafen war.
Das hätte er besser bleiben lassen.
Sein Verschwinden wurde zwanzig Minuten später bemerkt, weil ein Mitarbeiter der Bahnpolizei in einer marokkanischen Bar auf den Zugführer gewartet hatte, um nach Ende der Schicht ein Bierchen mit ihm zu trinken. Sie waren nicht direkt Freunde, aber bei ihren gelegentlichen Begegnungen zwischen den Gleisen hatten sie ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt, darunter ihre Leidenschaft für denselben Fußballverein und für Frauen mit ausladenden Hinterteilen. Der Polizist stieg in den Waggon und sah seinen Trinkkumpan mit angezogenen Knien im Verbindungsgang liegen, die Augen weit aufgerissen und die Hände am Hals, als wolle er sich eigenhändig erwürgen.
Aus seinem Mund war ein Blutfaden gelaufen, der auf dem rutschfesten Teppichboden eine Pfütze hinterlassen hatte. Der Polizist dachte unwillkürlich, dass er noch nie einen toteren Toten gesehen hatte, aber er legte trotzdem die Finger an seinen Hals, um den Puls zu suchen, den er nicht finden würde. Ein Herzinfarkt vielleicht, überlegte er. Nun hätte er sich im Zug umschauen können, aber es galt, gewisse Regeln zu beachten und Ärger zu vermeiden. Daher kehrte er sofort auf den Bahnsteig zurück und rief in der Zentrale an, damit sie jemanden von den zuständigen Polizeibehörden schickten und den diensthabenden Staatsanwalt verständigten. Den Rest des Waggons und das, was er enthielt, bekam er nicht zu Gesicht. Er hätte nur den Arm ausstrecken und die automatische Milchglastür zurückgleiten lassen müssen, um sein Schicksal und das der Leute, die nach ihm eintrafen, zu verändern, aber das kam ihm nicht in den Sinn.
Die Untersuchung übernahm daher jemand aus der dritten Abteilung der Squadra Mobile – die von allen außer den Polizisten selbst Mordkommission genannt wurde –, eine Frau, die nach langer Rekonvaleszenz und einer Reihe unglücklicher Begebenheiten, die über Monate hinweg für Gesprächsstoff in den Talkshows gesorgt hatten, in den Dienst zurückgekehrt war. Sie hieß Colomba Caselli, und vor Ort hielt man ihr Erscheinen für einen Glücksfall.
Sie selbst tat es nicht.
2
Colomba traf um Viertel vor eins in einem Dienstwagen an der Stazione Termini ein. Am Steuer saß Massimo Alberti, siebenundzwanzig Jahre alt, aber mit seinen Sommersprossen und den hellen Haaren würde er auch im Alter noch wie ein Junge aussehen.
Colomba selbst war dreiunddreißig, ihre grünen Augen, die sich je nach Stimmung anders färbten, wirkten jedoch deutlich älter. Die schwarzen Haare hatte sie im Nacken straff zusammengebunden, was die ausgeprägten, eher orientalischen Wangenknochen, die sie von einem Vorfahren aus irgendwelchen ominösen Zeiten geerbt hatte, noch stärker hervortreten ließ. Sie stieg aus und ging zu dem Gleis, an dem der Zug aus Mailand stand. Vier Beamte der Bahnpolizei warteten dort. Zwei saßen in einem dieser albernen zweisitzigen Elektroautos, die die Polizei im Bahnhof benutzte, die anderen beiden standen neben der Verbindungskupplung des Zugs. Alle waren jung, und alle rauchten. Nicht weit entfernt hatten sich Schaulustige versammelt und fotografierten mit ihren Handys; ein Grüppchen von etwa zehn Leuten, darunter Reinigungskräfte und Sanitäter, war in eine leise Diskussion vertieft.
Colomba zückte ihren Dienstausweis und stellte sich vor. Einer der Polizisten kannte sie aus der Zeitung und setzte das übliche dumme Grinsen auf. Sie tat so, als bemerke sie es gar nicht. „Welcher Waggon?“, fragte sie.
„Der erste“, antwortete der Kollege mit dem höchsten Dienstgrad, während sich die anderen hinter ihn stellten, als benutzten sie ihn als Schutzschild.
Colomba versuchte, durch die dunklen Zugfenster zu schauen, konnte aber nichts erkennen. „Wer von Ihnen war drin?“
Sie wechselten verlegene Blicke. „Ein Kollege, aber der hat schon Schichtende“, sagte der Polizist von zuvor.
„Aber er hat nichts angefasst, er hat sich nur umgeschaut. Wie wir, vom Gleis aus“, meinte ein anderer.
Colomba schüttelte verärgert den Kopf. Ein Leichenfund bedeutete, dass man sich die Nacht um die Ohren schlagen musste, bis Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin mit ihrer Arbeit fertig waren und man selbst einen Haufen Papierkram erledigt hatte. Da wunderte es kaum, dass sich der Kollege verdrückt hatte. Sie könnte sich bei seinen Vorgesetzten beschweren, aber sie hatte auch keine Zeit zu verschwenden. „Weiß man, wer es ist?“, fragte sie, als sie die Latexhandschuhe und die blauen Plastiküberschuhe anzog.
„Er heißt Giovanni Morgan und gehörte zum Team der Zugbegleiter“, sagte der mit dem höchsten Dienstgrad.
„Haben Sie schon die Angehörigen verständigt?“
Noch mehr verlegene Blicke.
„Okay, vergessen Sie’s.“ Colomba nickte Alberti zu. „Hol die Taschenlampe aus dem Wagen.“
Er ging los und kam mit einer Maglite-Stabtaschenlampe aus schwarzem Metall wieder. Sie war einen halben Meter lang und wirkte wie ein besserer Gummiknüppel. „Soll ich mit reinkommen?“
„Nein, bleib hier, und halte die Schaulustigen in Schach.“
Colomba meldete an die Zentrale, dass sie nun den Tatort betrete. Wenig später suchte sie, wie auch schon ihr Vorgänger, den Puls am Hals des Zugführers, um ihn, wie auch schon ihr Vorgänger, nicht zu finden. Die Haut des Toten war feuchtkalt. Als sie in der Zentrale nachfragte, ob der Gerichtsmediziner und der diensthabende Staatsanwalt schon unterwegs seien, registrierte sie einen eigentümlichen Geräuschteppich im Hintergrund. Sie hielt die Luft an, als ihr aufging, dass es sich nur um mindestens ein halbes Dutzend klingelnder Handys handeln konnte, eine Kakofonie aus Signaltönen und Vibrationen, die direkt hinter der Tür zur Executive Class erklang, der Klasse mit den echten Ledersesseln und den vorgekochten Gerichten eines aus dem Fernsehen bekannten Spitzenkochs.
Durch die Milchglastür sah Colomba die blinkenden grünlichen Lichter der Handydisplays, die lange, tanzende Schemen produzierten. So viele Handys konnten unmöglich vergessen worden sein, aber die einzige Erklärung, die ihr in den Sinn kam, war zu ungeheuerlich, um wahr zu sein.
Doch sie war es, wie Colomba sofort begriff, als sie die Tür gewaltsam aufschob und ihr der Gestank von Blut und Exkrementen entgegenschlug.
Die Fahrgäste der Executive Class waren alle tot.
3
Colomba richtete den Strahl der Taschenlampe in den Waggon. Er fiel auf die Leiche eines Fahrgasts um die sechzig in einem grauen Anzug. Der Mann war zu Boden geglitten; seine Hände steckten zwischen den Schenkeln, der Kopf war zurückgeworfen. Das Blut, das aus seinem Mund gespritzt war, bedeckte sein Gesicht wie eine Maske. Was zum Teufel ist hier passiert?, fragte sie sich.
Vorsichtig ging sie weiter und achtete darauf, nichts zu berühren. Hinter der ersten Leiche folgte ein junger Mann mit offenem Hemd und enger, weißer Hose, die mit Exkrementen besudelt war. Er lag quer im Gang, und an dem Weinglas, das ihm vors Gesicht gerollt war, klebte Blut aus seiner Nase.
Zu seiner Linken saß ein alter Mann, der an seinen Platz fixiert war, weil ihm jemand seinen eigenen Spazierstock mit der Metallspitze voran in den Mund gerammt hatte. Sein Gebiss lag in einer Lache aus Blut und Erbrochenem in seinem Schoß. Zwei Männer asiatischer Herkunft in Kellnerkluft lagen auf dem Servierwagen beziehungsweise auf einer – ebenfalls toten – Frau in Kostüm und High Heels mit Zwölf-Zentimeter-Absätzen.
Colomba spürte, dass sich ihre Lunge zusammenzog, und atmete tief ein. Jetzt, da sie sich langsam an die Szenerie gewöhnte, registrierte sie in all dem Gestank einen merkwürdigen süßlichen Unterton, den sie nicht zuordnen konnte. Er erinnerte sie an die Backversuche ihrer Mutter, die unweigerlich damit geendet hatten, dass der Kuchen im Ofen verbrannt war.
Sie ging bis zum Ende des Waggons, wo ein Fahrgast um die vierzig in Supermanpose dalag, die rechte Faust vorgereckt, den linken Arm an den Körper gepresst. Colomba trat an ihm vorbei und warf einen Blick in die Toilette: Ein Mann und eine Frau, Ersterer in der orangefarbenen Uniform der Reinigungskräfte, waren auf dem Boden zusammengesackt, die Beine ineinander verschlungen. Die Frau war mit dem Kopf gegen das Waschbecken geknallt, sodass Blut und Haare am Beckenrand klebten. In diesem Moment meldete sich Colombas Funkgerät zu Wort. „Ihr Fahrer will wissen, ob er in den Zug einsteigen kann“, krächzte die Zentrale.
„Nein, ich melde mich selbst bei ihm. Ende“, sagte sie mit fast normaler Stimme und rief Alberti dann auf dem Handy an. „Was ist?“
„Dottoressa … hier sind Leute, die auf irgendwelche Personen warten … Angeblich sollen sie in diesem Zug gewesen sein.“
„Warte.“ Colomba öffnete die Tür zum nächsten Waggon und warf einen Blick in die Businessclass. Sie war leer, ebenso wie die nächsten Wagen. Sicherheitshalber ging sie bis zum Ende durch und kehrte dann zurück. „Sollten sie in der Executive Class sitzen?“
„Ja, Dottoressa.“
„Wenn du in ihrer Nähe stehst, geh ein Stück weg. Sie sollen dich nicht hören.“
Alberti gehorchte und stellte sich neben den Führerstand. „Was ist los?“
„Sie sind alle tot. Alle Fahrgäste im ersten Waggon.“
„Verdammt. Wie sind sie gestorben?“
Colomba spürte, wie ihr Herz einen Schlag aussetzte. Bislang hatte sie sich wie in Trance bewegt, aber jetzt wurde ihr bewusst, dass die Unglückseligen um sie herum keine sichtbaren Wunden aufwiesen, von dem aufgespießten Alten mal abgesehen. Ich hätte schon beim Anblick des Zugführers das Weite suchen sollen.
Vermutlich wäre es da ohnehin schon zu spät gewesen.
„Dottoressa … sind Sie noch da?“, fragte Alberti besorgt.
Colomba riss sich zusammen. „Ich weiß nicht, woran sie gestorben sind, Alberti. Aber es muss sich um etwas handeln, das sie gegessen oder eingeatmet haben.“
„Um Gottes willen …“ Alberti wirkte fast panisch.
„Bleib ganz ruhig, denn du hast jetzt eine wichtige Aufgabe. Du darfst niemanden an den Zug heranlassen, weder Spurensicherung noch Staatsanwaltschaft, bis die Leute vom ABC-Schutz da waren. Sollte sich jemand widersetzen, verhafte ihn, oder schieß auf ihn, aber lass ihn nicht in den Zug.“ Colomba lief eiskalter Schweiß den Rücken hinab. Wenn es Anthrax ist, bin ich geliefert, dachte sie. Bei Nervengas habe ich vielleicht noch eine Chance. „Noch etwas. Du musst den Polizisten ausfindig machen, der in den Zug gestiegen ist. Lass dir von seinen Kollegen die Adresse geben. Er muss unter Quarantäne gestellt werden. Die anderen dürfen auch nicht gehen, vor allem wenn sie sich die Hand gegeben oder sich gegenseitig Zigaretten angeboten haben, egal was. Dasselbe gilt für die Angehörigen und Bekannten auf dem Bahnsteig. Wenn sie Körperkontakt mit euch hatten, müsst ihr sie dabehalten.“
„Soll ich ihnen die Wahrheit sagen?“
„Um Gottes willen, nein. Sag in der Zentrale Bescheid, dass man sämtliche Reisende aufspüren soll, alle, die mit den Fahrgästen in Berührung gekommen sein könnten. Aber als Erstes lass den Dekontaminationstrupp schicken. Nimm das Handy dafür, nicht das Funkgerät, sonst bricht Panik aus. Hast du mich verstanden?“
„Und Sie, Dottoressa?“
„Ich habe die verdammte Dummheit begangen, in den Zug zu steigen. Wenn das Gift noch wirksam ist, könnte ich eine Übertragungsquelle sein. Ich darf nicht aussteigen, weil das Risiko für andere zu groß wäre. Hast du alles verstanden?“
„Ja.“ Albertis Stimme zitterte bedenklich.
Colomba beendete die Verbindung. Sie kehrte zu der Stelle zurück, wo sie eingestiegen war, und schloss mithilfe des Nothebels die Schiebetür zum ersten Wagen. Dann suchte sie sich einen Platz in der Businessclass, die verglichen mit der Executive Class ein Arme-Leute-Abteil war, und wartete auf das Urteil, ob sie die Sache überleben würde.
4
Die Einsatzkommandos der Feuerwehr mit ihren weißen Schutzanzügen und den Sauerstoffflaschen spulten das gesamte Maßnahmenprogramm zur Abwendung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren ab. Sie riegelten das Areal um den Zug herum ab, hüllten die Waggons in undurchlässige Plastikplanen und errichteten am Eingang des ersten Wagens ein kleines Sauerstoffzelt.
Im Innern saß Colomba und lauerte auf jede Regung ihres Körpers, um Symptome für eine Kontaminierung festzustellen. Die Drüsen schienen zu funktionieren; sie schwitzte nicht mehr als sonst und zitterte auch nicht. Andererseits wusste sie natürlich nicht, wie lange das Virus oder das Gift brauchen würde, um seine Wirkung zu entfalten. Nach zwei Stunden der Paranoia, als Gestank und Hitze schier unerträglich wurden, stiegen zwei Soldaten in Schutzanzügen ein. Der erste hielt einen weiteren Schutzanzug in der Hand, der zweite richtete sein Sturmgewehr auf Colomba. „Legen Sie die Hände in den Nacken“, befahl er, die Stimme vom Sauerstoffgerät gedämpft.
Colomba gehorchte. „Ich bin Vicequestore Caselli“, sagte sie. „Ich war es, die den Alarm ausgelöst hat.“
„Keine Bewegung“, sagte der Soldat mit dem Gewehr, während sein Kollege sie trotz der plumpen Handschuhe mit geschickten Bewegungen durchsuchte. Er nahm ihr die Dienstwaffe und das Schnappmesser ab, steckte sie in eine Plastiktüte mit hermetischem Verschluss und übergab sie einem dritten Soldaten, der draußen auf den Eingangsstufen stehen geblieben war. Der wiederum reichte ihm einen größeren Beutel, den der Soldat an Colomba weitergab. „Ziehen Sie sich komplett aus, und stecken Sie Ihre Kleider in den Beutel“, sagte er. „Dann ziehen Sie den Overall an.“
„Vor Ihnen?“, sagte Colomba. „Bestimmt nicht.“
„Wenn Sie sich weigern, sind wir befugt, Sie zu erschießen. Zwingen Sie uns nicht dazu.“
Colomba schloss die Augen und dachte, dass es Schlimmeres gab, als sich vor anderen auszuziehen. Blut zu spucken und zu sterben zum Beispiel oder mit einer Kugel im Nacken zu enden. Sie zeigte auf die Kamera, die der Mann mit dem Gewehr am Helm trug. „In Ordnung. Aber die da machst du aus. Ich möchte nicht nackt im Internet landen, weder tot noch lebendig.“
Der Soldat hielt die Hand vors Objektiv. „Beeilen Sie sich.“
Colomba zog sich schnell aus, wohl wissend, dass die Blicke der Männer auf ihr ruhten. In Kleidung wirkte sie durch die Oberschenkelmuskulatur und die breiten Schultern kräftiger, als sie es tatsächlich war. Im nackten Zustand sah man die perfekten Proportionen einer Frau, die sich immer fit gehalten hatte. Sie zog den dicken Overall an, und die beiden Soldaten halfen ihr, das Sauerstoffgerät anzuschnallen.
Obwohl Colomba eine gute Taucherin war, flößten ihr die Maske und der Klang ihres eigenen Atems in den Ohren ein Gefühl der Beklemmung ein. Erneut krampfte sich ihre Lunge zusammen, aber auch dieses Mal konnte sie das Gespenst schnell wieder vertreiben. Die Soldaten schoben sie hinaus und geleiteten sie durch die abgesperrten Gänge vor dem Zug, der wie ein Kunstwerk von Christo verpackt war.
Ringsherum herrschte die reinste Apokalypse.
Es war vier Uhr morgens, und der von den Scheinwerfern der Armee taghell erleuchtete Bahnhof wimmelte von Soldaten, Carabinieri, Polizisten, Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Zivil. Kein Geräusch ankommender und abfahrender Züge, keine Lautsprecherdurchsagen, keine Fahrgäste, die am Handy hingen, nur der dumpfe Klang der Kampfstiefel, der vom Deckengewölbe widerhallte und von gebrüllten Kommandos und den Sirenen der Streifenwagen durchbrochen wurde.
In der Schalterhalle schoben die Soldaten Colomba in einen Campingwagen, der zum mobilen Labor umfunktioniert worden war. Ein Militärarzt nahm ihr Blut ab, indem er durch einen Gummiflicken an ihrem Ärmel hindurchstach. Auf dieselbe Weise injizierte er ihr etwas, das ihr sofort einen säuerlichen Geschmack in den Mund steigen ließ.
Niemand redete mit ihr, und niemand reagierte auf ihre Fragen, nicht einmal auf die elementarsten. Nach einer halben Stunde platzte Colomba der Kragen, und sie stieß den Arzt gegen die Wand des Campingwagens. „Ich will jetzt wissen, wie es um mich steht, kapiert? Und ich will wissen, was ich eingeatmet habe!“ Ihre Augen waren zwei funkelnde Jadesteine.
Zwei Soldaten packten Colomba, warfen sie zu Boden und bogen ihr die Arme auf den Rücken. „Ich will Antworten!“, schrie sie weiter. „Ich bin keine Gefangene, sondern Polizeibeamtin, verdammte Scheiße.“
Der Arzt stand auf. Unter der Schutzhaube war ihm die Brille von der Nase gerutscht. „Alles gut, alles gut“, murmelte er. „Sie können ja gleich gehen.“
„Und das hätten Sie mir nicht einfach sagen können, verdammt!“ Die Soldaten ließen Colomba los. Sie erhob sich und stieß dem, der neben ihr stand, den Ellbogen in den Bauch. „Was ist mit meinen Kollegen?“
Der Arzt wollte sich, ohne die Handschuhe auszuziehen, die Brille auf die Nase schieben und rammte sich fast den Bügel ins Auge. „Alles in Ordnung. Machen Sie sich mal keine Sorgen.“
Colomba nahm den Helm ab. Himmel, war es schön, Luft einzuatmen, die nicht nach ihrem eigenen Schweiß stank. Fünf Minuten später bekam sie ihre Kleider zurück und konnte sich wieder wie ein normaler Mensch fühlen, nicht wie ein Stück Vieh bei der Fleischbeschau. Nach den Stunden der Angst hatte sie Kopfschmerzen, aber sie lebte, womit sie fast nicht mehr gerechnet hätte. Die Scheinwerfer waren mittlerweile ausgeschaltet, aber im Bahnhof herrschte immer noch eine surreale Besatzungsatmosphäre. Die Leichen steckten in hermetisch verschlossenen weißen Säcken, die neben dem Zug aufgereiht lagen. Ein paar fehlten, weil man sie in einen der Campingwagen geschafft hatte, um sie dort zu untersuchen.
Colombas Chef Marco Santini löste sich aus der Gruppe der Polizisten, die neben dem Eingang zur U-Bahn standen, und kam auf sie zu. Er war groß und hinkte auf dem linken Bein. Über seinem drahtigen Schnäuzer hatte er eine Adlernase. Mit seinem verschlissenen Trenchcoat und der Tweedkappe hätte man ihn für einen Rentner halten können, aber wenn man ihm direkt in die Augen sah, merkte man, dass er ein gemeingefährlicher Hurensohn war. „Wie geht’s, Caselli?“
„Nach Auskunft des Arztes gut. Ich selbst muss noch ein wenig darüber nachdenken.“
„Das hier soll ich dir geben.“ Santini reichte ihr die Tüte mit den Waffen, die man ihr abgenommen hatte. „Mir war gar nicht bewusst, dass du mit einem Schnappmesser herumläufst.“
„Das ist mein Glücksbringer“, sagte sie, als sie es in die Jackentasche steckte. „Außerdem ist es nützlicher als ein vierblättriges Kleeblatt, wenn dir mal jemand auf die Nerven geht.“
„Ziemlich ungewöhnlich für eine Dienstwaffe.“
„Hast du ein Problem damit?“
„Nein, solange du mir das Ding nicht in den Rücken jagst.“
Colomba befestigte das Holster der Beretta an ihrem Gürtel. In ruhigen Phasen steckte sie die Waffe hinten in den Bund ihrer Hose, damit sie nicht so auffiel – was sich im Sommer regelmäßig als Drama erwies. „Besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Unfall handelt? Dass irgendwelche Chemikalien ausgetreten sind oder so?“
„Nein.“ Santini schaute sie an. „Es hat sich bereits jemand zu der Tat bekannt. Der IS.“
„›Schwarzer Engel‹ ist für mich ein Thriller der Extra-Klasse. Spannend, aktuell, politisch und international ohne den italienischen Bezug zu verlieren (…).“
„Grandios choreografierter Showdown mit Schurken und Gemetzel. Fortsetzung garantiert.“
„Colomba und Torre sind beide spröde und liebenswert zugleich. Sie verbeißen sich in die Suche nach Tätern und Motivationen und dabei kann ich als Leser wunderbar miträtseln. Und ich werde immer wieder dabei überrascht, immer mehr Aspekte tauchen auf und die Fäden laufen alle schön zum Ende zusammen.“
„Eine explosive und nervenaufreibende Story, die es wirklich in sich hat.“
„›Schwarzer Engel‹ ist eine emotionale Achterbahnfahrt, eine Spannungskurve auf Speed, ein kongeniales Ermittlerteam (...) Ich werde selten derart von Thrillern mitgerissen. Dazieri schafft es nun schon zum zweiten Mal.“
„Der zweite Fall für Colomba Casselli überzeugt auf allen Ebenen. (…) Sandrone Dazieri ist mit ›Schwarzer Engel‹ ein meisterhafter Thriller gelungen, der mit so manch unvorhergesehener Wendung durchgehend spannend bleibt.“
„Ein hervorragender, intelligenter Thriller mit zwei beeindruckenden Hauptpersonen.“
„Dazieri legt die Messlatte mit dem zweiten Band der Reihe nochmals ein Stück höher und es dürfte schwer fallen, Vergleichbares auf derart hohem Thriller-Niveau zu finden. Man kann sich schon jetzt auf den nächsten Fall dieses eigenwilligen Ermittlerduos freuen.“
„Dazieris Roman besticht durch seine Dialogführung, die die Leser am kriminalistisch-logischen Denken teilhaben lässt.“







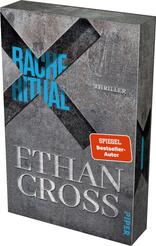







Bei diesem Buch konnte ich fast nich aufhöhren zu lesen. Inteligent geschrieben, spannend bis zur letzten Seite da das Duo wieder Willen ( zumindest am Anfang) nicht dem gängigen Polizisten Bild entspricht!! Ich bin sehr gespannt wie die Geschichte weiter geht+ Dante mehr über sich und seine Familie erfährt.... Hammer Buch!!!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.