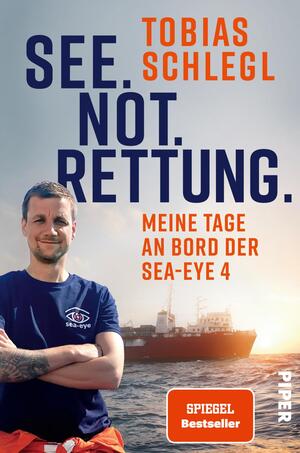

See. Not. Rettung. See. Not. Rettung. - eBook-Ausgabe
Meine Tage an Bord der SEA-EYE 4
— Bewegender Bericht über das Schicksal Geflüchteter - an der tödlichsten Meeresgrenze der Welt.„Mit seinem Buch wolle er seinen kleinen Teil beitragen, dass dieses Thema weiterhin in der Öffentlichkeit stattfindet‹. Und das gelingt Schlegl eindringlich.“ - dpa-Meldung
See. Not. Rettung. — Inhalt
Tagebuch aus dem Katastrophengebiet
Über mehrere Wochen half Tobias Schlegl als Notfallsanitäter bei der Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Libyens – und es wurde eine aufreibende Zeit für die Crew und ihn. Erst Schwierigkeiten bei Übungseinsätzen und das bange Warten auf den ersten Einsatz, dann: Notrufe, Verfolgungsjagden mit der libyschen „Küstenwache“ und Menschen im Wasser. Schließlich die quälende Suche nach einem sicheren Hafen für die mehr als 400 Geretteten. Schlegls Aufzeichnungen machen die menschliche Tragödie erfahrbar, die sich Tag für Tag vor den Mittelmeerküsten abspielt.
Sehr persönlich schreibt Tobias Schlegl über Ängste und Fehler, ist nachdenklich und ehrlich. Einfühlsam schildert er Szenen aus dem Schiffsalltag und zeigt die Menschen um ihn herum – auch die Geretteten, die durch die Hölle gegangen sind und nun an Bord eine Zeit voller Hoffnung erleben.
Leseprobe zu „See. Not. Rettung.“
24 Stunden
vor Abflug:
Kapitän über Bord 3. Mai
„Unfortunately our captain just informed us that he will not take part in the mission.“ Das kam gerade per Mail. Unser Kapitän ist abgesprungen. Was? So kurzfristig? Erst vor ein paar Tagen hatte er sich in der WhatsApp-Gruppe der Crew vorgestellt. „Looking forward to see you on board“, Daumen hoch, Smiley. Und nun? Was weiß der Mann, was ich nicht weiß? Stimmt etwas mit dem Schiff nicht? Hat er ein Leck entdeckt und sieht zu, dass er Land gewinnt?
Vertrauenserweckend ist das nicht. Vielleicht sind es [...]
24 Stunden
vor Abflug:
Kapitän über Bord 3. Mai
„Unfortunately our captain just informed us that he will not take part in the mission.“ Das kam gerade per Mail. Unser Kapitän ist abgesprungen. Was? So kurzfristig? Erst vor ein paar Tagen hatte er sich in der WhatsApp-Gruppe der Crew vorgestellt. „Looking forward to see you on board“, Daumen hoch, Smiley. Und nun? Was weiß der Mann, was ich nicht weiß? Stimmt etwas mit dem Schiff nicht? Hat er ein Leck entdeckt und sieht zu, dass er Land gewinnt?
Vertrauenserweckend ist das nicht. Vielleicht sind es persönliche Gründe. Vielleicht hat er sich doch noch mal schlau gemacht und realisiert, dass manch Kapitän und Kapitänin eines Seenotrettungsschiffs angeklagt wurden. Ob er auch mitbekommen hat, dass die Verfahren bisher immer in Freisprüchen endeten?
Bestimmt verschiebt sich die Mission. Ich muss den Flug umbuchen. Oder die Sache fällt ganz aus. Wäre das so schlimm? Jein. Ich spüre, wie sich Erleichterung in mir ausbreitet – und Enttäuschung.
„Kapitän*innen, die abspringen, sind keine neue Herausforderung“, schreibt mir der Sea-Eye-Vorsitzende Gorden. Na dann. Erleichterung und Enttäuschung weichen, Anspannung und Aufregung erobern meinen Magen zurück. Wir sollen fliegen und uns morgen in Spanien treffen. Auch ohne Kapitän. Der werde noch „rangekarrt“, schreibt Gorden. Okay. Optimistisch. Seine Nachrichten würden mich beruhigen, wäre da nicht diese leicht verzweifelt klingende Nachfrage in der Rundmail an alle gewesen: „Habt ihr zufällig einen Kapitän in Familie oder Bekanntenkreis?“ Also ich zufällig nicht.
Heute ist der Tag vor meiner Abfahrt. Wanderrucksack plus Sporttasche plus kleiner Rucksack stehen gepackt vor mir. Reisepass, Flugticket, Impfpass, Regensachen, Stirnlampe, Medikamente gegen Seekrankheit, Krankenversicherungskarte, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen, Ladekabel, Schlafsack, Badelatschen zum Duschen und alte Kleidung sind bereits verstaut. Zur Klamottenauswahl bekamen wir den Hinweis: „Könnte nach der Mission unbrauchbar sein.“ Die Foo-Fighters-Shirts und der Rick-&-Morty-Kapuzenpulli bleiben also zu Hause.
Wie der Kapitän. Ach, verdammt, kann es wirklich sein, dass alles vergebens war? All die Anstrengungen, mir die kommenden Wochen freizuschaufeln, damit ich weg sein kann. All die Online-Vorbereitungskurse, die ich durchgestanden habe. Die Auswahlgespräche und fachlichen Bewertungen. Denn nicht alle, die wollen, werden auch genommen. Hilfsorganisationen wie Sea-Eye überprüfen den Charakter der Bewerberinnen und Bewerber und deren Qualifikation genau – auch wenn bei meiner Position als Notfallsanitäter die Arbeit ehrenamtlich ist.
Ich darf dabei sein. Meine Mondreise. Allen Familienmitgliedern, Freunden und Freundinnen habe ich Tschüss gesagt. Und viel Anerkennung bekommen. „Respekt, was du da machst. Mutig.“ Danke. Doch nun sind bei den anderen auch Erwartungen geweckt. Die Enttäuschung wäre groß, wenn es jetzt nicht klappt.
Nur wegen eines Kapitäns, der kurzfristig das Handtuch geworfen hat. Jetzt verstehe ich die gestrige WhatsApp-Notiz: „Kapitän Sea-Eye 4 hat die Gruppe verlassen.“ Hatte mir nichts dabei gedacht. Kann es gut verstehen, wenn Leute keinen Bock auf eine WhatsApp-Gruppe haben. Nicht jeder möchte mit unzähligen Nachrichten pro Tag zugeballert werden. Wobei in unserer Gruppe bisher nicht wirklich viel passiert ist. Sehr diszipliniert alle. Hat noch keiner Scheiß gepostet, den dann alle mit einem Emoji kommentieren müssen. Alles anders in dieser Gruppe, da herrscht eine gewisse Ernsthaftigkeit. Diese Ernsthaftigkeit gefällt mir. Das wird kein Unterhaltungstrip. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen ein Zeichen setzen. Für die Menschlichkeit – drunter geht es nicht. Das ist der Anspruch, auf jeden Fall meiner. Ich finde es unerträglich, dass im Mittelmeer nahezu täglich Menschen ertrinken. Und die EU, Friedensnobelpreisträgerin 2012, sieht zu. Europa sollte sich schämen. Jeder Mensch, der gerettet wird, ist ein Zeichen der Hoffnung. Ein Zeichen, dass die Menschlichkeit noch nicht ersoffen ist. Warum will der Kapitän das nicht mehr unterstützen?
Je näher der Flug rückt, desto aufgeregter bin ich. In den nächsten Wochen wird mein Leben ein komplett anderes sein. Keine Privatsphäre mehr. Keine gewohnte Struktur mehr. Nur Menschen um mich, die ich noch nicht kenne. Mit mehreren Personen in einer engen Kajüte. Wie oft kann ich mein Zeug waschen? Kann ich regelmäßig duschen? Habe ich Internetempfang? Auf dem Mittelmeer eher unwahrscheinlich – digital detox deluxe. Den Koffein-Detox habe ich bereits vor einer Woche eingeleitet. Kaffee mag ich eh nicht, aber die zuckerfreien Energydrinks sind abgesetzt. Zum Aufstehen und Über-den-Tag-Kommen erlaube ich mir höchstens noch Cola Zero, seitdem bin ich immer müde. Aber ich wollte auf keinen Fall einen kalten Entzug auf dem Schiff erleben. Dort wird es sowieso hart genug.
Habe ich Zweifel? Noch könnte ich den Kapitän machen. Ein „positiver“ Coronatest, und ich bin raus. Tief in mir ruft es: Nichts da! Ich will es, schon lange. Ich will helfen. Trotz allem Respekt vor dem, was vor mir liegt: An mir wird es nicht scheitern.
Ich greife nach der Wasserflasche neben meinem Bett und nehme einen kräftigen Schluck. Ich sollte versuchen zu schlafen. Ich werde die Kraft noch brauchen.
Tag 1:
Abflug 4. Mai
„Tobias, hast du eine Lebensversicherung, die im Notfall zahlt?“ So reagierten meine Eltern. Nein, eine Lebensversicherung habe ich leider nicht mehr. Kam bei Mama und Papa nicht ganz so gut an. Ansonsten waren sie aber sehr verständnisvoll, haben mich fest gedrückt und mir zum Abschied eine hellblaue Tasse geschenkt: „Nimm dir Zeit für MEER“.
Der Wecker klingelt um 7 Uhr, aber ich bin schon vorher wach. Der große Tag. Jetzt gibt es wirklich kein Zurück mehr.
Sturm über Hamburg. Als wollte das Wetter mich losscheuchen. Wie in Trance suche ich im Flieger meinen Sitz, stecke mir Kopfhörer in die Ohren und lasse Marteria laufen. Paradise Delay. Das Paradies muss warten.
In Madrid steige ich um. Eine spanische Frauen-Fußballmannschaft sitzt mit mir in der Maschine nach Valencia. Die Fußballerin zu meiner Rechten möchte nicht reden. Ich auch nicht. Kämpfe mit meinen Gefühlen, diesmal eine Mischung aus Vorfreude und blanker Angst.
Am Flughafen von Valencia treffe ich die ersten beiden Crewmitglieder: Guillaume und Stefan. Guillaume aus Frankreich – klein, langer Bart und Hipster-Beanie – ist für die Dokumentation zuständig, er soll Fotos und Videos machen und für die internationalen Medien bereitstellen. Stefan, wie ich aus Norddeutschland – schwarze, dünne Brille, gräuliches Haar –, ist Internist in Rente und unser Bordarzt, mit ihm werde ich ab jetzt zusammenarbeiten.
Guillaume gibt mir ein High Five, Stefan drückt mich an sich. Auf seiner Brust prangt ein großer Totenkopf, er trägt einen St.-Pauli-Kapuzenpulli. Ausgerechnet. Mein Lieblingsverein. Ich deute das als gutes Vorzeichen.
Wir nehmen ein Taxi nach Burriana. 30 Minuten Fahrt. Call Me Maybe scheppert es aus den kaputten Boxen. Nein, kein „Call me“ mehr. Das war das alte Leben. Jetzt soll mich bitte keiner mehr anrufen. Ich lehne meinen Kopf ans staubige Fenster. So viel Blau am Himmel. Grüne Zypressen. Graue Steinformationen. Wärme. Alles wirkt surreal. Wo bin ich hier? Gelandet auf einem anderen Planeten.
Am Hafen von Burriana schultern wir unser Gepäck, ich habe am meisten dabei, wie peinlich. Zwar wurde uns von Sea-Eye per Mail empfohlen, Klamotten für nur eine Woche einzupacken, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Was, wenn es nur eine Waschmaschine gibt und alle darum kämpfen, dass sie randürfen? Und so habe ich jetzt Klamotten für zwei Wochen dabei. Okay, eigentlich für drei. Ich bin so beladen, dass ich nur kleine Schritte machen kann. Zum Glück ist das Schiff bereits in Sichtweite.
Die Sea-Eye 4 wirkt winziger als auf den Fotos. Dabei sind die Rahmendaten recht beeindruckend: 53 Meter lang, 12 Meter breit, 11 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Nicht mehr ganz jung, Baujahr 1972, nun in neuem, glänzendem Lack-Gewand – die Bordwand knallrot, Brücke und Reling strahlend weiß und die Containeraufbauten weiter hinten tiefblau. Ganz vorne, an der Spitze, hängt die gelbe Flagge von United 4 Rescue, dem Bündnis aus Unterstützerinnen und Unterstützern der Sea-Eye 4. Sie ist vor Kurzem von der Werft in Rostock nach Burriana überführt worden und wartet nun auf ihren ersten Einsatz, ihre Jungfernfahrt als Rettungsschiff. Vorher diente sie unter den Namen Wind Express und Oil Express als Offshore-Versorgungsschiff und wurde dann von Freiwilligen innerhalb von sieben Monaten komplett umgebaut.
Und damit wollen wir wirklich Hunderte Menschen retten? Das wird eng werden. Von den deutschen Behörden ist das Schiff für maximal 200 Personen zugelassen, aber wenn wir weitere Boote in Seenot sehen, können wir doch nicht einfach die Hilfe verweigern.
„Machen wir auch nicht“, sagt Jan, der Head of Mission. In seinem anderen Leben ist er Chirurg. „Wenn wir mehr Menschen retten müssen, retten wir die auch.“ Er ist der Chef der gesamten Rettungsmission, ein großer Lockenkopf mit Lachfältchen und Fünftagebart, auf Anhieb sympathisch, umgänglich, einnehmend. An Bord hat er den zweithöchsten Rang – unter dem Kapitän. Aber der ist ja nicht da.
„Flugangst. Der wollte nicht fliegen.“ Jan schüttelt den Kopf. „Keine Ahnung, ob das stimmt. Warum hat er das denn nicht vorher gesagt? Wir hätten eine andere Lösung finden können. Anreise mit dem Zug oder per Auto, geht doch auch.“
Mir ist das inzwischen egal. Fühle mich wie bei der Einschulung: alles neu, alles aufregend. Wir machen einen Rundgang durch das Schiff. Über die Gangway gelangt man auf das große Hauptdeck, das weitgehend überdacht ist. Hinten stehen zwei Container mit Schlafplätzen für Gerettete, gegenüber sind ihre Toiletten und Waschbecken, dann kommt eine Küche für die Versorgung der Menschen, und daneben ist die Tür zu unserer Krankenstation. Alles wirkt ein wenig unfertig. Überall liegen Werkzeuge und Baumaterial herum. Planen und Stangen versperren den Eingang zum Hospital. Das müssen wir morgen dringend aufräumen.
Wir unterhalten uns durchweg auf Englisch, sobald nicht nur deutsche Crewmitglieder anwesend sind. Das gebietet die Höflichkeit – außerdem ist Englisch die offizielle Bordsprache, auch wenn das Schiff unter deutscher Flagge fährt. Englisch hören und verstehen ist nicht so das Problem, US-Serien gucke ich auch im Original. Aber Englisch sprechen musste ich schon lange nicht mehr. Es fällt mir schwer, mich richtig auszudrücken, Worte für das zu finden, was ich sagen will. Was kommt dabei heraus? „Nice hospital.“ Ich war auch schon pointierter.
Schräg gegenüber der Krankenstation, Richtung Bug, beginnt der Innenbereich des Schiffs, zu dem die Geretteten keinen Zugang haben werden. Die Kombüse, der Speise- und Versammlungsraum – Crew Mess Room genannt –, einige der Schlafkabinen und ein Lagerraum. Nach unten geht es zum Maschinenraum, in dem unentwegt einer der Generatoren rattert. Nur ein kurzer Blick hinein in das neonbeleuchtete Gewirr aus grün lackierten Rohren und Pumpen, Ventilen und Kabeln. Es ist höllisch laut, und es riecht komisch. Nach oben führt die Treppe aufs Vorderdeck, unterhalb der Brücke. Ganz vorne, in der Spitze, gibt es eine Luke, sie ist geöffnet, und von der Unterseite des Deckels grinst mich ein riesiger sonnengelber Smiley an. Don’t worry, be happy, singt er.
Hinter der Brücke sind weitere Container für die Besatzung und die Geretteten aufgestellt – und ganz hinten ist der schönste Ort des Schiffs. Auf die Dächer der beiden unteren Container ist eine Holzterrasse geschraubt: das Sonnendeck.
Die Kajüte teile ich mir mit Stefan. Jugendherbergsstyle. Unsere Cabin Two ist eine enge Kammer, Tür und Schrank gleichzeitig öffnen geht nicht, neben dem Schrank ein kleines Regal, gegenüber unser Stockbett, am Ende eine mit Kunstleder bespannte Bank und ein Brett als Schreibtisch. Über der Bank – das Tollste – zwei Bullaugen, die den Blick auf das Hafenbecken freigeben.
„Ich will unten schlafen“, sagt Stefan. „Ich muss nachts öfter raus.“ Mist. Genauso geht es mir als Täglich-vier-Liter-Wasser-Trinker auch. Aber ich habe keine Chance, Stefan reserviert mit seinem Rucksack die untere Koje. Was soll’s. Ich bin froh, dass ich so einen sympathischen Zimmergenossen abbekommen habe. „Ich schnarche“, ergänzt Stefan. Okay, ganz so froh bin ich doch nicht.
Ein paar Crewmitglieder stehen abends draußen am Kai und trinken Limo und Bier aus Dosen. Langsam lerne ich, wer wer ist und wofür die Leute zuständig sind.
Generell ist die Besatzung aufgeteilt zwischen Freiwilligen, die alles komplett ehrenamtlich machen und wie ich auch den Flug aus eigener Tasche finanziert haben, und den bezahlten, professionellen Angestellten. Die Sea-Eye 4 ist als Frachtschiff eingetragen, es gibt strikte Auflagen, die alle eingehalten werden. Demnach braucht es neun professionelle Seeleute, die die notwendigen Zertifikate besitzen, um das Schiff betreiben zu können. Dazu gehören die Maschinisten sowie die Arbeiter an Deck und auf der Brücke bis hin zum Kapitän. Dieses Schiff kann man nicht mit einem Sportbootführerschein fahren, wie das früher bei zivilen Rettungsmissionen mit kleineren Schiffen oft gemacht wurde.
Ich schaue in die Gesichter meiner ehren- und hauptamtlichen partners in crime, die Wangen blass im Scheinwerferlicht, die Haare verwuschelt von Anreise und Arbeit, die Stimmung gedämpft, ermattet vom Tag. Das Gegenteil von meiner inneren Aufgekratztheit.
Da ist Arnaud, muskelbepackter 48-jähriger Franzose, Tattoos lugen unter seinem T-Shirt hervor, besonders fester Händedruck. Eigentlich arbeitet er als Wissenschaftler in einem Labor. Für diese Mission hat er seinen gesamten Jahresurlaub genommen. Er wird an Bord die Position des RHIB-Leader übernehmen, als Chef auf einem der zwei Rigid-Hulled Inflatable Boats, der Rettungsschlauchboote mit Festrumpf. Seit Jahren fährt er auf Rettungsschiffen mit. Ich hätte ihn nie auf 48 geschätzt. Er sagt: „When I’m over fifty years old, I will stop with these rescue missions. They are too exhausting.“ Ich glaube ihm kein Wort. Der wird noch mit über 60 dabei sein und manchen 30-Jährigen alt aussehen lassen.
Da ist Urtzi aus Spanien. Ein schweigsamer Typ, auf dem Kopf eine zerfledderte Baseballcap. Einer der festen Schiffsarbeiter, zuständig für Reparaturen und Instandhaltung. Er erzählt mir, dass er immer furchtbar seekrank wird, was mich insgeheim freut, denn dann hänge ich im Zweifelsfall nicht allein über der Reling. Die Übelkeit nimmt Urtzi in Kauf, um diese Missionen mitmachen und Menschenleben retten zu können.
Da ist der Deck Manager Eddie aus Ghana, ein kleines Kraftpaket mit großer Sehnsucht nach seiner Familie. In Hafennähe nutzt er jede Gelegenheit für einen Videocall mit den Liebsten. Drei bis vier Monate gehen seine Einsätze jeweils, das Gehalt legt er zurück, denn sein großer Traum ist es, in Ghana eine Geflügelfarm mit mehreren Tausend Hühnern zu betreiben. Momentan will aber auch er unbedingt auf Rettungsschiffen arbeiten, um zu helfen.
Da ist die Französin Canelle, Anfang 30, deren Brille hüpft, wenn sie lacht. Sie ist zuständig für die Organisation und Kommunikation von Abläufen an Bord und gleichzeitig unser Human Rights Observer. Sie soll Menschrechtsverletzungen dokumentieren, indem sie das Gespräch mit den Geretteten sucht und Hinweise auf Folter dokumentiert. Canelle ist ein Sprachtalent. Sie kann Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Arabisch. Sie hat schon für eine Hilfsorganisation Geflüchtete auf der Balkanroute mit Essen versorgt und wurde deshalb mehrmals von der Polizei festgenommen.
Da ist Marlene, eine Intensivkrankenschwester aus Berlin, die blonden Locken zurückgebunden, ihr Auftritt zurückhaltend. Sie war bereits auf dem Vorgängerschiff, der Alan Kurdi, im Einsatz. Für die Sea-Eye 4 hat sie die Krankenstation mitgeplant und ausgestattet. Dort werden wir drei in den nächsten Wochen zusammenarbeiten: der lebenslange Mediziner Stefan, Marlene aus dem Krankenhaus und ich als Vertreter für den Rettungsdienst und akute Notfälle. Mein spontaner Eindruck ist, dass wir gut zusammenpassen.
Und da ist der Erste Offizier Josh, ein professioneller Seenotretter, der aussieht wie Pippi Langstrumpfs Papa in jung. Jeden Morgen springt er zur Erfrischung vom Schiff ins Wasser, behauptet er jedenfalls. Früher fuhr er auf Cargo-Schiffen, doch da habe ihm irgendwann der „Sinn“ gefehlt: Er wolle etwas bewegen, nicht nur „LKW-Fahrer auf dem Wasser“ sein. Deshalb habe er damals bei seiner Reederei gekündigt. Einfach kündigen und etwas Sinnvolles machen, das habe ich doch schon mal gehört. In Josh erkenne ich mich wieder, meinen Weg, mein Denken, meinen Antrieb. Ich bin nicht ganz allein. Sehr gut.
Was für ein bunter Haufen. Mich schüchtern die Gespräche allerdings ein wenig ein. Die anderen haben alle so viel Erfahrung mit der Seenotrettung. Ich bin dagegen ein kompletter Grünschnabel. Ich hab nicht mal großartig See-Erfahrung. Deshalb weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt seetauglich bin. Von der Schiffsschaukel im Heide Park wird mir jedenfalls extrem übel. Vielleicht war das alles ein Fehler, vielleicht gehöre ich gar nicht hierher. Eines tröstet mich: Doktor Stefan hat auch null See-Erfahrung. Wenn er das mit Ende 60 packt, kann ich das doch auch. Oder? Hör auf zu jammern, befehle ich dem Angsthasen in mir.
Als ich gegen Mitternacht todmüde in der Koje liege, formt sich ein Bild in meinem Kopf: die Umrisse eines der unteren blauen Container. Die Tür an der Kopfseite ist geöffnet und gibt Einblick in einen dunklen, schmalen Schlund. In diesen Containern sollen jeweils 25 Geflüchtete Platz finden. Vielleicht auch viele mehr. Die Längsseiten füllen Doppelstockbetten, Holzplatten als Liegeflächen, gehalten von einem Stahlrahmen, blau und gelb bemalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wirklich Menschen unterkommen werden. Bisher war der Trip eine reine Urlaubssimulation. Ein paar verwegene Jungs und Mädels treffen sich und machen eine Schiffsreise. Fünf Freunde plus X erforschen die Schatzinsel. Nun grinst dieser Container mich bösartig an. Realitätscheck. Nichts ist gut im Mittelmeer. Leid erwartet uns.
Komm rein in meinen Schlund, Tobias. Leg dich hin und schließ die Tür. Dann verdaue ich dich langsam, ganz langsam, flüstert mir das Monster zu.
Ich liege mit offenen Augen da, die Bettdecke bis zum Kinn gezogen. Die Luft ist stickig. Das Brummen des Generators dringt bis in die Kajüte. Unter mir ist Stefan eingeschlafen. Und schnarcht, dass das Holz zu vibrieren scheint. Der Mann hält, was er verspricht.
„Mit seinem Buch wolle er seinen kleinen Teil beitragen, dass dieses Thema weiterhin in der Öffentlichkeit stattfindet‹. Und das gelingt Schlegl eindringlich.“
„Sie werden danach nicht im Tal der Tränen versinken, sondern es wird eine Mischung sein aus Aha-Effekt und guter Unterhaltung.“
„Die Szenen, die er aus dem Alltag an Bord schildert, sind bisweilen ›eine Kombination aus Tragik und Komik‹.“
„Sein Bericht wechselt gekonnt zwischen Spannung, Tragik und Komik, dazu eindrucksvolle Fotos.“
„Sehr emotional geschrieben“
„›See. Not. Rettung.‹ ist Tobias‘ persönlicher Blick auf die Tragödien, die sich im Mittelmeer tagtäglich abspielen.“












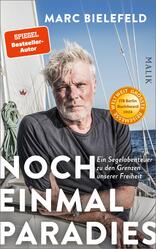


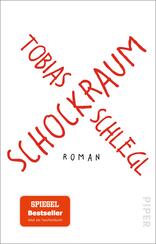



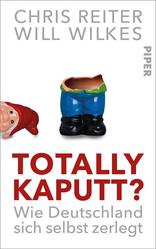
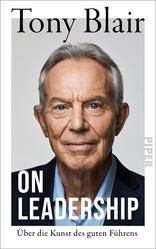







Tobias Schlegl hat mit See.Not.Rettung einen sehr persönlichen und berührenden Einblick in die zivile Seenotrettung gegeben. Dieser Bericht tut an zwei Stellen weh: Einmal sind es die persönlichen Schicksale der Menschen auf dem Schiff und die untätige Politik kaum auszuhalten und zum Anderen die bittere Erkenntnis, dass wir in einer Welt (in einem Europa!!) leben, in der/dem es möglich ist, dass sich solche Grausamkeiten tagtäglich ereignen und es zivile Retter:innen braucht, die für ihr Engagement kriminalisiert werden. Tobias Schlegl hat einen authentischen Bericht über Frust und Wut, aber auch Hoffnung geschrieben - ein wichtiges Buch, das hoffentlich viele erreicht, denen noch nicht klar ist, was auf dem Mittelmeer wirklich passiert.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.