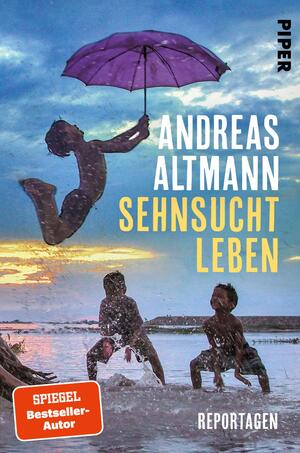
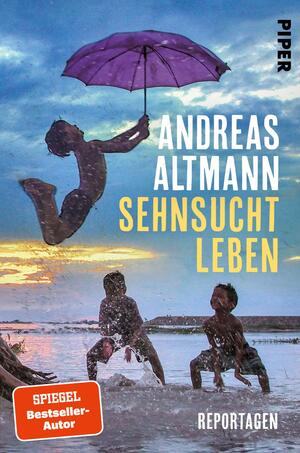
Sehnsucht Leben Sehnsucht Leben - eBook-Ausgabe
Reportagen
„Andreas Altmanns Texte beleuchten die Welt aus verschiedensten Perspektiven in zeitlos poetischer Sprache.“ - Humanistischer Pressedienst
Sehnsucht Leben — Inhalt
Wenn einer das Leben in seinen mannigfaltigen Formen in Worte fassen kann, dann ist es Andreas Altmann. Dass seine Erzählungen zum Träumen und ab und zu auch zum Schaudern anregen, hat er schon oft bewiesen. In seinem neuen Buch lässt er uns durch seine unverwechselbare Erzählkunst an Begegnungen in aller Welt teilhaben. Von Abenteuern in Acapulco zur einmaligen Eleganz von Paris, vom höchsten Gewirr in Kathmandu zu den zauberhaften Weiten Lapplands, von Megametropolen wie Shanghai und Jakarta ins paradiesische Goa – mit diesem Best-of sorgt Altmann für ganz viel Sehnsucht nach Leben.
Leseprobe zu „Sehnsucht Leben“
VORWORT
Vor nicht langer Zeit erzählte mir ein Freund, dass er sich verliebt hatte. Auf einem Festival. Nach vier Tagen schworen sie sich gegenseitig Liebe. Dann mussten sie auseinander, jeder zurück in seine Stadt. Mit dem feurigen Versprechen, sich so bald, nein, so schnell wie möglich wiederzusehen.
Zwei Wochen später besuchte er sie, die neue Liebe. Und nach zwei Stunden, so ungefähr, krachte es. Zu verschieden ihr beider Blick auf die Welt, zu diametral ihre Pläne für die Zukunft, zu rechthaberisch sie, zu rechthaberisch er.
Ach, mit welchem Donner [...]
VORWORT
Vor nicht langer Zeit erzählte mir ein Freund, dass er sich verliebt hatte. Auf einem Festival. Nach vier Tagen schworen sie sich gegenseitig Liebe. Dann mussten sie auseinander, jeder zurück in seine Stadt. Mit dem feurigen Versprechen, sich so bald, nein, so schnell wie möglich wiederzusehen.
Zwei Wochen später besuchte er sie, die neue Liebe. Und nach zwei Stunden, so ungefähr, krachte es. Zu verschieden ihr beider Blick auf die Welt, zu diametral ihre Pläne für die Zukunft, zu rechthaberisch sie, zu rechthaberisch er.
Ach, mit welchem Donner war er angereist. Und welch stille Heimfahrt.
Ich umarmte meinen Freund und tröstete ihn mit dem Hinweis, dass derlei Desaster uns allen passieren. Weil wir Menschlein immer derselben Versuchung unterliegen: nicht das zu sehen, was ist, sondern das, was wir sehen wollen.
Die Sehnsucht ist ein vielschneidiges Schwert. Und die Sehnsucht nach Liebe wohl die gefährlichste. Jede weiß es, jeder weiß es. Dennoch, alle treibt sie an, aber nicht alle kommen ans Ziel. Ich kenne Leute, die nahmen ihre Sehnsucht mit ins Grab. Zu fordernd war sie, zu hochtrabend, zu unerfüllbar.
Die einen sehnten sich nach dem Traummann, die anderen nach der Traumfrau. Sie haben nie begriffen, dass es die beiden nicht gibt. Sie wollten keine echten Menschen, sie wollten den Traum.
Todesursache: Überdosis Illusionen.
Sorry, ich bin leicht vom Thema abgekommen. Hier soll die Sehnsucht nach Leben verhandelt werden. Und doch, die zwei Sehnsüchte haben etwas gemeinsam, das Wichtigste: Sie müssen in der Nähe der Wirklichkeit angesiedelt sein.
Ein – rein theoretisches – Beispiel, durchaus lustig und aberwitzig: Ich träume davon, eines Tages wie Shakespeare schreiben zu können. Das ist ein ungeheuer vorlauter Traum, der nie in Erfüllung gehen wird. Auch dann nicht, wenn ich täglich von zehn Literaturnobelpreisträgern unterrichtet werden würde, nicht, wenn ich zuletzt nur noch aus Buchstaben und Worten bestünde. Es ist ein schwachsinniger Traum, an dem ich zerbräche. Denn zwischen mir und dem Genie des englischen Weltwunders liegen die tausend Sonnen, die nur ihm gehören.
Bin ich einsichtig, dann erlaube ich mir zu jedem Jahresende die Sehnsucht, dass ich die nächsten zwölf Monate ein, zwei Nuancen eleganter mit der deutschen Sprache umgehe – federleichter, geschmeidiger, raffinierter. So eine Sehnsucht ist realitätstauglich, die schaffe ich. Bisweilen.
Martin Walser: „Abends gehen wir der Sehnsucht ins Netz.“
Sehr stimmig. Nachts liegen wir im Bett und spüren, dass manches nicht stimmt: entweder die Frau nicht oder der Mann oder der Beruf oder das ganze Leben. Und dann sehnen wir uns und träumen.
Nelly Sachs: „Alles beginnt mit der Sehnsucht.“
Gut so. Fantasie als erster Schritt in eine verlockendere Zukunft. Nur sollten sich die Wünsche nicht überschlagen, nicht zu größenwahnsinnig, nicht zu gigantomanisch unser Herz besetzen. Solche Kopfgeburten landen im Aus, sie ersticken uns, kommen nie zur Welt.
„Alles ist möglich“, was für ein esoterisches Gebabbel, was für eine Abzocker-Phrase für Coaches, was für eine Einladung zum Unglücklichsein.
Eine Sehnsucht – eine realistische (!) – vom Kopf ins tatsächliche Leben zu zerren: Das fordert Schneid und die Bereitschaft, Niederlagen auszuhalten. Und jeden Tag dem Gravitätsgesetz zu widerstehen – das so penetrant zu Trägheit und Stillstand verführt.
Sein Leben upgraden, das ist ein anstrengendes, ein grandioses Unternehmen. Doch wie selig der Mensch, der da ankommt, wo er hinwollte. Er genießt den Triumph umso mehr, je zäher er dafür geschuftet hat. Lieber nicht hoffen, nicht beten, nicht „Wünsche ins Universum schicken“, vielversprechender wäre: einen Plan machen und sich ein Ziel einprägen. Und dann loslegen.
Wie ängstigend wäre die Vorstellung, ziemlich dem Ende entgegen, dass man nicht das Leben hatte, das man sich vorstellte. Dass man aus irgendeinem Grund – und Gründe gibt es viele – irgendwann falsch abgebogen ist. Aus Bequemlichkeit, weil geistig träge, weil leichtfertig trügerischen Spuren gefolgt.
Die Tapferen beichten Fehler, die weniger Mutigen suchen nach Ausreden. Und verteilen die Schuld auf die Eltern, die Schule, die Gesellschaft, auf immer andere. Wer nun tatsächlich verantwortlich ist, ist dem Leben egal. Es blühte nicht, und das ist eine traurige Nachricht.
Michel Houellebecq: „Alles kann im Leben passieren – vor allem nichts.“
Das ist eine bedrohliche Bemerkung. Das Nichts ist ein Todesurteil. Ein bisschen Glut sollte schon sein. Und die Freude am Leben – um die heillosen Tage zu überstehen. Und Poesie, das wäre das Vergnügen, denken und fühlen zu wollen. Und auf einer Arbeit bestehen, die bereichert – und nicht in den Stumpfsinn treibt. Und von einer Handvoll Menschen wissen, die einen lieben. Und – wichtiger – selbst lieben, ein paar Frauen und Männer entlang der Zeit.
Das ist unglaublich viel verlangt, aber das Leben darf das. Es ist ein einmaliges, einzigartiges Geschenk. Wer es nicht achtet, wer nichts dafür hergeben will, der bekommt kein Leben. Bekommt nur Jahre, die glanzlos an ihm vorbeiziehen.
Über dem Eingang einer Kneipe in Cali, in Kolumbien, stand: „Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujar, que no hay que decirle, que hagan las cosas“, mir gefallen die Leute, die vibrieren, die man nicht anschubsen muss, denen man nichts anschaffen muss, die einfach machen.
„Vibrar“, vibrieren, das ist ein treffliches Synonym für das Wort leben.
Am nächsten Morgen, noch immer in derselben Stadt, bat ich die Rezeptionistin um eine Quittung für meine vorausbezahlten Nächte. Die vielleicht Zwanzigjährige kam eher schleppend voran, da sie jeden Buchstaben auf dem Computer suchen musste. Das Hotel war fast leer, sie hätte sicher viel Zeit gehabt, um ihre Fertigkeiten zu verbessern. Doch neben dem Laptop stand ein Fernseher, wo gerade eine Soap mit schönen Menschen zu sehen war. Sie konnte den Blick kaum abwenden, man spürte, dass sie dazugehören wollte. Hier wollte sie nicht sein. Sie wollte aber auch nicht kämpfen, sie schaute lieber auf eine Welt der gut aussehenden Lügen und Märchen.
Consuela, so soll sie heißen, trieb eine Sehnsucht um, die keine Folgen haben wird. Das ist schmerzhafter, als gar keine Sehnsüchte zu haben. Denn der Frust wird sich in ihr Herz bohren und dort schwären. Auf ewig.
Aber ja, Glück sei willkommen – auf dem Weg zu dem, was man sein und haben will. Der reine Wille reicht nicht.
Um zu erklären, auf wie vertrackte Weise das Glück einem zugutekommen kann, darf ich kurz von mir berichten. Denn ich hatte Glück, ich hatte es leichter als viele.
Ich wuchs in einem Sumpf aus Anmaßung, Bigotterie und Gewalt auf, in einem Kraal unauslotbarer Ignoranz. Kein Wunder, dass die Sehnsucht nach einem anderen Leben zu übermächtig wurde, um nicht eines Tages, noch minderjährig, davonzurennen. Weg in die große weite Welt.
Und nochmals Glück, da ich für alle Studien und Berufe, die ich fast zwanzig (!) Jahre lang ausübte, auszuüben versuchte, nicht taugte. Zu minderbegabt? Zu unwillig? Zu müßig? Vielleicht die drei zusammen.
Und doch, welch Glückssträhne! Denn am Ende dieses Abstiegs entdeckte ich die deutsche Sprache, das Schreiben, tatsächlich ein Tun, das mich begeisterte. „Last Exit“, absolut letzte Ausfahrt Richtung Sinn, Richtung Innigkeit und Anerkennung. Und – wie irdisch und erfreulich – Geld, das ich für Anstrengungen kassierte, die zu überwinden ein Gefühl erstaunlicher Befriedigung auslöste.
Gewiss, manche Leute in meiner Umgebung waren heller als ich, kamen früher an. Ich brauchte die Umwege.
„Sehnsucht Leben“ heißt das Buch, und es besteht (fast) ausschließlich aus Geschichten von Frauen und Männern, die ich beneide und bewundere. Die mich – ohne es je auszusprechen – antrieben, ja mich ansteckten mit ihrem Lebenswillen und der unbedingten Bereitschaft, jeder Art trübsinnigen Daseins aus dem Weg zu gehen.
Manche von ihnen strandeten. Ich vermute, sie mussten ohne Glück auskommen, ohne „serendipity“, diesen glückreichen Zufall, der anschiebt in Notzeiten.
Ich erinnere mich an ein Interview mit einem französischen Gefangenen, der wegen zentnerschweren Kokainhandels einsaß. Ich stellte ihm die denkbar banalste Frage: „Warum haben Sie das getan?“, und Luc antwortete auf überaus verblüffende Weise: „Weil ich mein Leben nicht liebte.“
Der Satz gefiel mir. Aber ja, die Liebe zum Leben ist die Mutter aller Sehnsüchte.
GOA
Die Sanftmut des Lebens
Nicht viele Gegenden auf dieser Erde können mit solchen Trümpfen prahlen. Alles da. Die Magie, das Verrückte, die Versuchung, das Blau des Ozeans und des Himmels, die Freundlichkeit der Goaner und ihr wundersam skurriles Kopfwackeln. Signalisiert es doch so beruhigende Zustände wie Einverständnis und das unglaubliche Versprechen, dass alles gut wird.
Irgendein Gott, irgendeiner von den Millionen indischer Götter, hat vor endloser Zeit einen Pfeil aus seinem Köcher gezogen und ins Meer geschossen. Und das Meer zog sich zurück, um Platz zu schaffen für ein Land, das von nun an Goa hieß. Ein Götterkind, schön, begabt, verwöhnt, Liebling aller, die es betraten.
Klar, Blut floss, wollte es doch jeder für sich allein besitzen. Könige, Häuptlinge und Sultane rauften zwei Jahrtausende lang, dann kamen 1510 die Portugiesen und räumten auf. Alfonso de Albuquerque, begnadeter Conquistador und gläubiger Christ, gibt Order, die „schöneren Frauen“ einzufangen und den Rest zu massakrieren. Hinterher wird es friedlicher. Er verteilt das Land und die Schönen an seine untergebenen Raubritter. Goa blüht, wird Umschlagplatz für arabische Pferde, Seide und Baumwolle, Gewürze, Porzellan, Schmuck und Parfum. Ein „Dourado“ – siehe das spanische „Eldorado“ – soll entstehen. Bald wird es heißen: „Quem viu Goa não precisa ver Lisboa“, wer Goa gesehen hat, braucht Lissabon nicht zu sehen.
Bis zum 19. Dezember 1961, immerhin 450 Jahre lang, können die Portugiesen sich halten. Dann kommt der Tag der „Fliegenklatsche“. So der Deckname jenes (unblutigen) Einmarsches der „Ureinwohner“, die die uneinsichtigen Europäer hinauswerfen und das Gebiet als seine rechtmäßigen Besitzer zurückholen.
Heute ist Goa der kleinste Bundesstaat des Subkontinents, knapp 3800 Quadratkilometer winzig. Ein Däumling an der Westküste, wirtschaftlich unbedeutend, für hiesige Verhältnisse dünn besiedelt, politisch ein Wurm. Alles, was es anzubieten hat, ist seine Anmut, seinen – was für ein schönes altes Wort – Liebreiz.
Wie alle Natur, die keinen Profit abwirft, steht dieser Erdteil auf der Abschussliste der Freizeitindustrie. Noch erwarten niemand die üblichen Club-Méditerranée-Gräuel, noch finden keine Bingoturniere bei Sonnenuntergang statt, noch ist (fast) nichts „erschlossen“, noch hat dieses bedrohliche Lieblingswort der Immobilienmafia wenig Bedeutung. Die „Vigilantes“, die Aufpasser, die Liebhaber Goas, wachen, greifen tapfer zu getrockneter Kuhscheiße, um die Naturschänder zu vertreiben. Ein zäher Kampf kündigt sich an.
Mein Hotelbesitzer verleiht auch Motorräder, ich nehme eine Enfield, sorry, eine Royal Enfield. Man muss sich umstellen, denn hier herrscht Linksverkehr, das heißt, die Fußbremse befindet sich links unten und die Gangschaltung rechts. Einen Helm gibt es nicht, aber ohne Helm düsen verschafft ein gehobenes Lebensgefühl. Zur weiteren Beruhigung steht auf dem ersten sichtbaren Verkehrsschild: „Traffic in Goa is a major killer area.“
Hundert Kilometer Küste haben sie hier. Und ein Großteil davon taugt als Märchenstrand. Oben im Norden, am Arambol Beach, fangen die Aufregungen an. Ein Schild – „Nudism is prohibited“ – soll warnen, doch viele liegen (halb) nackt herum. Faszinierender als das bloße Fleisch ist das grandiose Schauspiel, das es provoziert: Um die Mittagszeit rollt eine Busladung stattlicher Herren an. Inder, Geschäftsleute mit Krawatte und Bügelfalte. Der Vorgang ist wohl einmalig, ein fast lautloses, unerhörtes Ereignis nimmt seinen Lauf. Würdevoll und in beinahe militärischer Formation bewegen sich die hungrigen Voyeure den Strand entlang, verziehen keine Miene, verdrehen nur schmerzhaft die Augen, um die so verlockenden, bronzefarben getönten Leiber in Augenschein zu nehmen. Und überwältigt wieder den Bus zu besteigen, Abfahrt, der Betriebsausflug ist zu Ende. Welch Abenteuer in einem Land, in dem die Gemahlinnen nur bis zum Knie – und dann voll bekleidet – das Meer betreten.
Ein Strand nach dem nächsten. Anjuna, Baga, Calangute, Miramar, Bogmalo, Colva, Varca, Mobor, Betul. Nichts fehlt, wahre Händlerkarawanen ziehen an den Badenden vorbei, im Angebot: Nasenringe, Zehenringe, heißer Tee, cold drinks, Schmuckdosen aus Muscheln, Armreifen aus Kupfer, die gesamte Silberkollektion im Aktenkoffer, Bambusflöten, ein vierteiliges Trommelset, Riesenbananen, Saris, bengalisch gestrickte Unterhosen, Pfeil und Bogen, ein Ikeakatalog aus dem letzten Jahrhundert, Tarzanhefte, Bilder von Gott Krishna und seinen 16 800 Freundinnen, Räucherstäbchen, Tempelasche und eine Dreierpackung „Love“, bunte Gummis fürs „lovemaking“.
Das esoterische Dienstleistungsgewerbe ist ebenfalls unterwegs. Kashu verabreicht mir eine „magical full body massage“ unter der warmen Nachmittagssonne. Anschließend knetet Shailesh meine Zehen und Sohlen, deklariert den Vorgang pompös „rebalancing“. Einer bietet „yoga sessions“ und verspricht eine „ecstatic figure“. Der Nächste ist Experte in „palmreading“ und entziffert die Handlinien seiner Kundschaft. Der Fünfte versteht sich auf „eyereading“ und blickt dramatisch ins linke Auge, „to see your soul“. Wer noch mehr wissen will, bekommt eine „eardiagnosis“ verpasst. „Zeige mir dein Ohr, und ich sage dir, wer du bist“, so verkauft Manohar seinen preiswerten Hokuspokus.
Auffällig wohltuend: Niemand fleht und bettelt, hier bieten sie nur an. Braucht man nichts, so erntet man keinen Sack voller Schuldgefühle, eher ein schwereloses Lächeln: „Okay, baba, nevermind.“ Dann eben morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr.
Dennoch, in Goa existieren noch immer Meilen von menschenleerer Einsamkeit – mit diskret schützenden Dünen. Wo so vieles passieren kann, und wäre es nur der arglose Blick hinauf in die himmelblaue Ewigkeit. Solche Momente nannten die Portugiesen „Sosegado“: Lass los, begreif doch die Schönheit der Welt.
Das Sinnliche bleibt, auch wenn man das Meer verlässt und ins Innere des Landes fährt. Vorbei an ein paar Hundert Quadratkilometern Reisfelder, vorbei an den geduldigen Wasserbüffeln vor Pflügen aus der Eisenzeit, vorbei an scheu lächelnden Frauen, die am Brunnen die Wäsche waschen, vorbei an Männern, die mit nackten Füßen Cashewnüsse zerstampfen, um aus dem Saft den schweren Fenischnaps zu gewinnen, vorbei an einer fröhlich johlenden Kinderbande, die eine flüchtige Sau jagt, vorbei an Fischen, die zum Trocknen auf der Straße liegen, vorbei an einer Klinik, die „sexual problems – before or after marriage“ behandelt, ja selbst „pimples and gas troubles“, Pickel und Fürze. Und immer wieder vorbei an alten portugiesischen Wohnhäusern, die beweisen, dass Architektur und Natur fehlerlos miteinander harmonieren können.
Im Dorf Chauri gehe ich ins Kino. Heute Sonntagskino, massives Gedränge, um „Aashiqui“, Lovers, zu sehen. Die kindischsten Filme zeigen sie in diesem Land. Springen und tanzen und hopsen und schluchzen. Und der Hauptdarsteller – umgeben von brennenden Kerzen auf einer Straßenkreuzung – wimmert: „I love you.“ Pulsadern öffnen kommt auch vor: um mit Blut geschriebene Liebesbriefe zu verfassen, die wiederum alles retten. Hinterher hüpfen die Versöhnten beim Mondschein am Meeresstrand. Hüpfen, so höre ich, ist in Bollywood die Metapher für Sex. Hört das Hüpfen irgendwann auf, weil so ganz außer Puste, dann ist der Liebesakt zu Ende. Das Schlussbild zeigt ein sausendes Feuerwehrauto, vorne die Liebesleute auf dem Weg ins Happy End: Denn die Liebe brennt, brennt, brennt. Aber ja, vollkommen debil und hinreißend lustig.
Als ich nachts im Bett liege, beginnt mein Kopf zu strudeln, angenehmer Schwindel. Bilde mir ein, dass das Herz durch den Körper wandert. Sehe, wie es den Körper verlässt und wieder zurückkehrt. Verliere den Orientierungssinn und registriere die (wohlige) Angst, dass ich schwebe. Schwebend schlafe ich ein.
Schuld an dem Rausch hat Vinayak, der Straßenhändler, der mir auf dem Nachhauseweg zwei Stück „bhang papad“ – hart, dunkel, handtellergroß – verkaufte. Eine Art Trockenbrot, hergestellt aus Hanf (Cannabis), der auf arglose Weise das Hirn euphorisiert.
Stets lauern in Goa Überraschungen. Nicht nur (heilige) Kühe, die unbeleuchtet nachts auf den Straßen lungern und mit einmalig indischer Geduld von Autofahrern zur Freigabe der Fahrbahn überredet werden müssen: Zwei packen die Hörner, zwei stemmen sich gegen das Hinterteil. Haben sie Glück, erhebt sich das Faultier und schlendert davon.
Aber ja, Drogen zuhauf. Neben dem eher harmlosen Bhang stehen reichlich auch die heftigeren Substanzen zur Verfügung, Opium und Heroin. Alles verboten und alles vor Ort zu haben. Wer sich darauf einlässt, sollte nur eine Institution scharf im Auge behalten – die indische Polizei. Sie ist ein undurchschaubarer Ausbund von Scheinheiligkeit, Nachsicht und Korruption. Oft ist nichts zu befürchten. Man überweist rechtzeitig Bakschisch an sie und wird wiederum rechtzeitig über eine anstehende Razzia informiert. Wird man trotzdem – Bodycheck auf der Straße am helllichten Tag – mit dem heißen Stückgut erwischt, zahlt man nachträglich. So funktioniert es seit Jahrzehnten – reibungslos.
Irgendwann, an irgendeinem Tag, ist plötzlich alles anders. Dann wird ein Exempel statuiert. Kein Lösegeld der Welt kauft mehr frei. Nun gilt das, was auf verwitterten Tafeln am Strand steht: „Punishable with 10 to 30 year R. I.“, strafbar mit zehn bis dreißig Jahren schwerem Zuchthaus – R. I. = rigorous imprisonment. Damit der Schein gewahrt wird und die Heuchelei nicht zu kurz kommt. Damit die Zeitungen Lobeshymnen lügen und der amerikanische Präsident dem indischen Innenminister ein Glückwunschtelegramm – Stichwort „war on drugs“ – nach Neu-Delhi kabelt.
Nicht weit von der kleinen Hauptstadt Panaji entfernt, direkt in die Klippen hineingebaut, befindet sich das Central Jail von Goa. Teil des wuchtigen Fort Aguada, eine von den Portugiesen zurückgelassene Festung. Über einen Trick gelange ich hinein. Ich gebe mich als Verwandten von George Harris aus, dessen Name mir ein Holländer zuspielte, der seine Schwester hier besuchte. Auch sie sitzt wegen Drogen ein.
Wenn immer sich eine Gelegenheit ergibt, betrete ich ein Gefängnis. Weil ich davon ausgehe, so die Erfahrung, dass sich Leute in einer solchen Umgebung – extremer Stress – radikaler, ungeschützter äußern.
George und ich haben zwanzig Minuten, um miteinander zu reden. In der Ecke steht ein Wachposten. Der 27-Jährige ist ein statuiertes Exempel. Der CID, das „Crime Investigation Departement“ hat ihn geschnappt. Mit siebzehn (!) Gramm Hasch im Brustbeutel. George wirkt apathisch. Die ganz große Depression hat er schon hinter sich. Meine Anwesenheit wird sein Schicksal nicht ändern. Seit 25 Monaten sitzt er – ohne dass ein Verfahren eröffnet wurde. Mit mindestens acht (Glück), mit höchstens 28 (Pech) Jahren Strafe muss er rechnen. So sein Anwalt. Die mitgebrachten Zigaretten, etwas Wäsche, eine Tüte voller Obst und Konserven kann er brauchen. Er ist in Kontakt mit der amerikanischen Botschaft, seine Eltern haben ihn bereits mehrmals besucht. Schmiergeldüberweisungen kommen in einem solchen Stadium nicht mehr an. Denn George soll nun als formidabler (Fake-)Beweis für die Unbestechlichkeit indischer Beamter dienen.
Nach dem Gespräch renne ich runter zum Meer. Mir ist, als wäre Goa gleich noch einmal so schön. Einblicke in ein hiesiges Verlies machen dankbar. Für jede Stunde Freiheit.
Abstecher Richtung Vasco da Gama, der Hafenstadt mit dem erstaunlichen Baina Beach. Der Strand wird nirgends erwähnt. Ich vermute sittliche Bedenken. Denn hier trifft sich eine ganz spezielle Sorte von Touristen: Seefahrer und Seemänner, Typen voll wilder Tätowierungen. Hungrig, entschieden, großzügig. Hier stranden sie täglich, denn hier warten, ich schwöre, die schönsten Mädchen der Welt. Natürlich ist das Liebesgeschäft in Indien strengstens verboten. Aber der kleine, runde Hermes – der Name passt gut, kommt er doch von jenem griechischen Gott, der zuständig war für das „Verkehrswesen“ – klärt mich auf: „This is a controlled area“, soll sagen: Regelmäßige Überweisungen an die Lokalpolizei garantieren, dass „kontrolliert“ wird, das Business folglich störungsfrei abläuft.
Ältere Ladys sitzen neben ihren Petroleumlampen und verkaufen Mangos und Papayas. Ein Straßenprediger ruft zu Spenden für Amputierte auf. Zwei Ordnungshüter plaudern mit den Mädels. Hermes kuppelt. Die Kundschaft flaniert, ich registriere sieben verschiedene Sprachen. In einem Tempelchen singen drei Priester ergeben zum Lobe von Gott Shankar. Bunte Lämpchen hängen vor den Buden. Und in der Manila Bar zupft Suneeta an meiner Hose, um mich zu einem Nachtlager in ihrem Hinterzimmer zu überreden.
Aber ich kann nicht. Weil ich ein ergreifendes Bild beobachte. Zwei Tische entfernt sitzt ein fernöstlicher Matrose. Und ich höre ihn erregt und inständig auf seine Schöne einreden. Und ich verstehe nichts und verstehe das Wichtigste. Weil seine Hände reden. Seine kleinen japanischen Männerhände, die emsig und tapsig am Sari der jungen Frau nesteln, dem so geheimnisvollen Kleidungsstück, von dem Fremde nicht wissen, wo es anfängt und wo es aufhört. Der Kerl und sein Fieber, seine Unkenntnis und seine Not, alle kichern in der Manila Bar.
Umwerfende Städte haben sie hier nicht. Aber Old Goa, die einstige Hauptstadt der europäischen Eroberer, ist auf morbide Weise faszinierend. Der breite Mandovi River fließt vorbei. Überall stehen und liegen die Überreste und Bruchstücke der portugiesischen Kolonialzeit. In einer der Kirchen steht der gläserne Sarg des „heiligen“ Franz Xaver, der Goa mit der „Frohen Botschaft“ heimsuchte. Beneidenswert die Anziehungskraft des Alten, der nicht mehr ganz vollzählig daliegt. Historisch verbürgt ist, dass ihm – schon tot, schon schimmelig – Verehrerinnen manch Körperteil abbissen …
Vergnüglicher ist die nächste Geschichte, die sich Mitte vorletzten Jahrhunderts hier ereignete: als Sir Richard Francis Burton – unheilbarer Romantiker, Übersetzer, Autor, Sprachgenie und nebenbei Abenteurer – Goa besuchte und sich in eine hübsche Nonne – „black-eyed, rosy-lipped“ – verliebte. Ein Schmied fertigt ihm einen Zweitschlüssel an, Burton verkleidet sich als Wandermönch und bricht um Mitternacht ins Kloster St. Augustine ein. Alles ist bestens vorbereitet, und alles läuft schief. Er umarmt in der Finsternis die falsche Frau. Statt der ganz einverstandenen, ganz reizenden Schwester greift er nach der Vize-Oberin, die schrill und keifend sich wehrt. Bis er den Irrtum bemerkt und sein „ugly burden“ verschreckt fallen lässt. Noch in den Morgenstunden tritt er die Flucht an.
Auch ich bin um Mitternacht da. Nur der Mond ist derselbe, genau wie der Engländer ihn beschrieb. Aber auf keine roten Lippen leuchtet er jetzt, nur auf eine stille, unheimlich stille Ruine, das Kloster. Und kein Schrei einer Toderschreckten vertreibt mich, nur das böse Knurren streunender Hunde.
Am nächsten Morgen treffe ich Father George – langes Silberhaar, weißer Bart. Er war einmal Sohn eines reichen Vaters und gab alles auf. Er lebt und arbeitet hier, zeigt mir sein „retreat“. Fast achtzig Kinder ziehen für jeweils drei Tage in ein altes, schlicht renoviertes Gebäude. Die Eltern geben, was sie entbehren können. Die Religionszugehörigkeit spielt keine Rolle. Auch viele kleine Hindus kommen.
Sie schauen Dias an, die Indien und seine Landschaften zeigen. Aus Büchern werden Beispiele der Nächstenliebe vorgelesen, man singt, tanzt, es soll heiter zugehen. Irgendwann bittet der Priester jedes Mädchen und jeden Jungen, sich vor den großen Spiegel zu stellen. Dann fragt er sie, wie sie sich finden, sich fühlen. Und was immer als Antwort kommt, er spornt sie an, sich gern zu haben und alles an sich zu akzeptieren.
Jeder Reisende sucht romance, eine Art „émotion forte“, so nennen es die Franzosen. Eine starke Empfindung, wer will das nicht. Zustände, die das Herz beschleunigen, die jenes flirrende Gefühl von Erregung und Intensität herstellen.
Eins dieser Geschenke muss ich noch erwähnen, nein, von nichts Sensationellem, von keiner atemberaubenden Höllenmaschine soll die Rede sein. Eher Alltägliches.
Über die vielen kleinen Flüsse von Goa ziehen tagein, tagaus Fähren. Alte, rostige Kisten, der Notbehelf für die oft maroden Brücken. Die Kähne, bisweilen ziemlich löchrig, sind nur eine Spur sicherer. Alles transportieren sie, Ziegen, Radfahrer, Autos, Brahmanen, Bettler, die Schulkinder. Die Ladebleche bersten, die Scheinwerfer bleiben schwarz, und der Maschinenraum steht meist ein paar Zentimeter unter Wasser.
Wie belanglos. Gerade abends, wenn am Himmel die Sterne schaukeln, wenn das Schiff schaukelt, wenn der Kapitän durch die zerbrochene Scheibe seiner Kajüte lächelt, wenn man das Salz vom nahen Meer riecht, wenn alle an Bord unfassbar still und glücklich sind, dann fühlt man in diesen Augenblicken, unausweichlich, den Zauber Goas, den Zauber Indiens.
Eine Veranstaltung von Literatur LIVE in Kooperation mit der Thalia Buchhandlung. Präsentiert von[...]
Veranstaltung abgesagt!
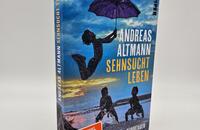

















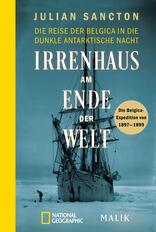
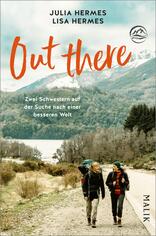






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.