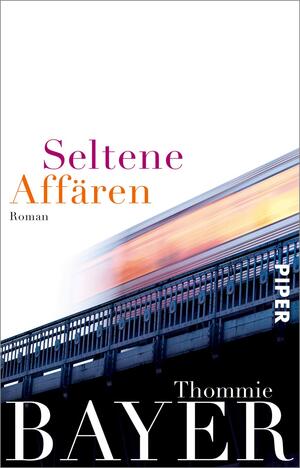

Seltene Affären Seltene Affären - eBook-Ausgabe
Roman
„Thommie Bayer erzählt in ›Seltene Affären‹ eine wunderbare, anrührende Liebesgeschichte.“ - Frankfurter Neue Presse
Seltene Affären — Inhalt
Von Montag bis Donnerstag führt Peter Vorden ein Feinschmecker-Restaurant in Lothringen. Am Wochenende jedoch schreibt er Kurzgeschichten für seinen Zwillingsbruder Paul, den Schriftsteller, dem er damit immer wieder aus der Klemme hilft. Seit Paul vor Jahren Anne geheiratet hat, die einzige Frau, die für Peter je infrage kam, lebt Peter mit Affären – und ahnt doch, dass er den großen Konflikt in seinem Leben endlich lösen muss. Thommie Bayer erzählt von einem ungewöhnlichen Doppelleben und stellt die spannende Frage, was es heißt, aus Anstand auf die große Liebe verzichten zu wollen.
Leseprobe zu „Seltene Affären“
1
In der Kurve, die ich immer mit Schwung nehme, war auf einmal dieser Roller vor mir, und ich musste bremsen, um die junge Frau darauf nicht ins Gebüsch zu schleudern. Sie trug Jeans und ein dunkelblaues Sweatshirt, keinen Helm, den hatte sie auf das Trittbrett gelegt. Die Straße ist eng an dieser Stelle, ich würde erst oben in der nächsten Biegung an ihr vorbeikommen, also schlich ich im ersten Gang hinter ihr her und sah mir als Entschädigung für die erzwungene Trödelei ihren Hintern an.
Ein Hintern auf einem Roller ist nicht direkt abendfüllend, aber [...]
1
In der Kurve, die ich immer mit Schwung nehme, war auf einmal dieser Roller vor mir, und ich musste bremsen, um die junge Frau darauf nicht ins Gebüsch zu schleudern. Sie trug Jeans und ein dunkelblaues Sweatshirt, keinen Helm, den hatte sie auf das Trittbrett gelegt. Die Straße ist eng an dieser Stelle, ich würde erst oben in der nächsten Biegung an ihr vorbeikommen, also schlich ich im ersten Gang hinter ihr her und sah mir als Entschädigung für die erzwungene Trödelei ihren Hintern an.
Ein Hintern auf einem Roller ist nicht direkt abendfüllend, aber die Büsche links und rechts des Hohlwegs kannte ich, der Roller war uninteressant – was blieb mir anderes übrig, als die Frau zu betrachten, die da scheu und souverän zugleich den Berg emportuckerte – so langsam, dass nicht einmal ihr glattes dunkles Haar sich in irgendeinem Fahrtwind bewegen konnte.
Als ich endlich oben war und an ihr vorbeizog, warf ich einen Blick auf ihr Gesicht im Rückspiegel und fand sie hübsch.
Ich ließ mein Haus rechts liegen und fuhr weiter zur Wendeplatte, denn ich wollte an der Straße parken, mit der Nase in Richtung Abfahrt, und nicht auf meinem Vorplatz, aus dem ich nur rückwärts bergauf wieder herauskäme.
Sie war hinter mir hergefahren und bog jetzt vor mir ein, stellte den Roller vor meiner Tür ab und nahm einen Schlüssel aus ihrer Tasche, schloss auf, ging hinein, und ich ließ den Wagen wieder abwärtsrollen, weil ich begriff, dass sie die Vertretung meiner Putzfrau sein musste. Ich wollte ihr nicht begegnen.
Es gibt Momente, da ist mir nicht nach Reden und dessen Vermeidung jeden Umweg wert. Na ja, nicht jeden vielleicht, aber ich steuere mich dann aktiv an allen Small-Talk-Gefahren vorbei, täusche Eile oder Zerstreutheit vor oder starre so verbissen auf mein Handy, dass niemand es wagt, mich anzusprechen. Mag sein, dass mich das manchen Leuten unsympathisch macht, aber das ist eine Frage des Timings. Ich bin von Montag bis Donnerstag sympathisch und Freitag bis Sonntag eben nicht.
Mit dem Timing war es diesmal allerdings nicht zu erklären, es hatte mit dem Ort zu tun. Die hübsche Putzfrau fuhr an einem Dienstag vor mir her, aber ich bin Montag bis Donnerstag eigentlich nicht zu Hause. An diesem Tag wollte ich nur schnell einen USB-Stick holen, der in der falschen Jackentasche steckte und auf dem ich allerlei Recherchen gespeichert hatte, die ich am nächsten Vormittag durchgehen wollte.
Ich fuhr also unverrichteter Dinge zurück nach Luxeuil-les-Bains, nahm die südliche Strecke über Mulhouse, Belfort und Lure zu meinem Arbeitsplatz unter der Woche, einer Villa mit Park mitten in der Stadt, in deren Erdgeschoss ich mit meinen Partnern George und Magali ein Restaurant betreibe.
„Arbeitsplatz“ ist eigentlich das falsche Wort, ich bin dort nur anwesend. Eine Art Grüßaugust. Ich spiele den Wirt, gehe durch den Gastraum, setze mich bei Leuten, die sich für bedeutend halten, kurz an den Tisch und gebe allen das Gefühl, sie könnten sich jederzeit an mich wenden, wenn sie ein Problem hätten. Das tun sie dann meistens nicht – von einigen Wichtigtuern und Ehebrechern abgesehen, die ihre neue Geliebte damit beeindrucken wollen, dass man ihnen die Wünsche von den Augen abliest –, das Angebot reicht meistens aus, und nur die aufgeblasenen Nullen nehmen es tatsächlich wahr.
Diese „Arbeit“ wird von Freitag bis Sonntag, in der wichtigeren Zeit also, in der unsere Tische alle vorbestellt sind, von Magali gemacht. Sie ist eine beiläufige Schönheit und sorgt mit ihrem bourgeoisen Charme für eine Menge treuer Gäste.
Was immer sonst noch für den Erfolg unseres Unternehmens gebraucht wird, bringt George mit seinem Organisationstalent und kaufmännischen Geschick ein. Als wir uns zusammentaten, war er der Mann mit den Fähigkeiten, und ich der mit dem Geld.
An der Mautstelle Burnhaupt, als ich meine Karte in den Automaten schob, wurde mir bewusst, wie absurd ich mich wieder mal verhielt: Ich fuhr hundertfünfzig Kilometer, um einen USB-Stick zu holen, und dann ohne dieses Ding zurück, weil jemand, den ich nicht kannte und der mich nichts anging, in meiner Wohnung war. Erklären konnte ich das niemandem.
Das musste ich auch nicht, denn ich lebe allein. Mein Bruder hat die Frau geheiratet, die als Einzige für mich infrage kam.
~
Mein Parkplatz im Garten war von einem der Gäste okkupiert, und ich musste meinen Wagen draußen an der Straße abstellen und durch den seit Lure anhaltenden Regen zur Villa hasten. Der Mittagsbetrieb lief gerade erst an, also ließ ich mir Zeit in meiner kleinen Wohnung im Obergeschoss, um die Haare zu frottieren und ein trockenes Jackett anzuziehen, bevor ich in den Gastraum ging und meine Runde machte.
Am schönsten Tisch, von dem aus man durch ein fast bodentiefes Erkerfenster in den Park schauen kann, saßen zwei Militärs, ein Colonel und ein Capitaine der Finanzverwaltung, und zwei Zivilisten, aus deren Benehmen und Haltung ich schon auf dem Weg zum Tisch geschlossen hatte, wer Chef und wer Assistent war. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt: Die Aufmerksamkeit zeigt den Rang, wenn man keine Schulterklappen mit Symbolen oder unterschiedlich teure Anzüge hat – der Assistent wandte sich alle paar Sekunden zum Chef, der ihn seinerseits jedoch keines Blickes würdigte.
Die Aperitifs waren geleert, die Amuse-Gueules verzehrt oder zur Seite geschoben, und als ich mein Sprüchlein aufgesagt hatte, dass ich hoffte, sie fühlten sich wohl, und sie sich, falls irgendetwas nicht zu ihrer Zufriedenheit sei, bitte an mich wenden sollten, sah ich die beiden Frauen vom Service schon mit den Vorspeisen bereitstehen und zog mich zurück.
Der Chef, wohl ein Bauunternehmer oder Händler, der den Militärs einen Auftrag abluchsen wollte, hatte auch an mich keinen Blick verschwendet, also wappnete ich mich innerlich für seine sicherlich bald erfolgende Reklamation. Die Consommé würde zu kalt oder zu warm oder am Lachs zu viel Dill sein. Solche Typen brauchen das.
Ich ging in den Vorraum und machte mit Bleistift im Reservierungsbuch einen kleinen Haken hinter seinen Namen. Am Wochenende käme dieser Name auf eine kurze Liste, und das nächste Mal, wenn er reservieren wollte, würden wir leider keinen Platz mehr haben.
Magali hatte das ganz am Anfang so vorgeschlagen, und wir waren gut gefahren mit dieser rigiden, aber unauffälligen Ausgrenzungsmethode. Auf diese Weise erhielten wir uns den Stil, der, neben der Qualität des Essens und der Weine, unser Markenzeichen ist: familiär, freundlich, entspannt und ohne Getue. Zu diesem Stil gehören zwei Parteien. Der Service verliert seine Herzlichkeit, wenn die Gäste nicht ebenso herzlich sind. Zum Glück konnten wir uns das leisten.
Ich setzte mich in das Büro im Erdgeschoss, das eigentlich mehr ein Aufenthaltsraum für Magali oder mich ist, aus dem wir schnell auftauchen können, wenn wir tatsächlich mal gebraucht werden, las Zeitung auf meinem Laptop und trank einen Espresso, bis der Mittagsbetrieb vorbei war.
Ich musste das Häkchen später wieder ausradieren. Der Mann hatte nicht nur keinen Mucks gemacht, sondern auch noch ein ausgezeichnetes Trinkgeld gegeben, das erzählte mir Javier, unser Oberkellner, als ich ihn beiläufig nach den Herrschaften am schönen Tisch fragte. Ich sollte mir meiner Menschenkenntnis nicht allzu sicher sein, dachte ich, klappte meinen Laptop zu und ging nach oben, um mich hinzulegen.
~
Die Tage in Luxeuil bringe ich meist mit leerem Kopf hinter mich, und vielleicht kommt es mir deshalb so vor, als vergingen sie schneller. Montagmittag bis Donnerstagnacht verfliegen mit schwimmen, schlafen, essen, die Gäste begrüßen, die Gäste verabschieden, abends einem Glas Wein mit George oder Magali oder beiden und wieder schlafen. Ganz selten mal muss ich vermitteln, wenn George sich mit unserem Koch anlegt, was aber nur zwei- oder dreimal im Jahr geschieht. Er ließe es besser bleiben, denn Melih, der Koch, ist ein Hitzkopf und Diktator wie so viele seiner Zunft, und der kleinste Vorschlag, wie er etwas anders machen könnte, ist für ihn Majestätsbeleidigung, die er mit einer Art Generalmobilmachung quittiert.
Zum Glück gelingt es uns, die Küche, in der meist Drama, Hektik oder zumindest miese Stimmung herrschen, so von den Gästen abzuschotten, dass der Eindruck heiterer Gelassenheit nicht gestört wird. Die Küche ist im Untergeschoss und kommuniziert mit dem Service per Sprechanlage und Speiseaufzug.
Spricht Melih mit den Gästen, dann ist er wie ausgewechselt. Charmant, bescheiden und auf eine unprätentiöse Art eloquent, kein Mensch käme auf die Idee, dass er seine Leute derart schikaniert, dass kaum einer es länger als ein paar Monate bei uns aushält. Wir zahlen schon über Tarif, aber Melih sorgt für ständigen Wechsel. Ich versuche, ihm so selten wie möglich über den Weg zu laufen.
2
Am Donnerstagnachmittag holte ich meine Sachen aus der Reinigung und legte sie in den Kofferraum, und kurz vor elf Uhr nachts, als die letzten Gäste gegangen waren, überließ ich Javier die Aufsicht über die letzten Tätigkeiten – Tischwäsche wechseln, Spülküche aufräumen, Licht ausmachen und abschließen – und fuhr los.
Ich hatte die Landstraße hinter mir und bog aus dem Kreisverkehr vor Lure auf die N19 ein, als mein Handy klingelte. Es war Paul, mein Bruder.
„Hast du vielleicht was in der Schublade, das zu Weihnachten passt?“
„Nicht direkt“, sagte ich, „aber man kann alles umschreiben. Weißt du doch am besten.“
„Dann genauer gefragt“, sagte er, „hast du was in der Schublade?“
„Ja.“
„Ich habe für eine Anthologie zugesagt und brauche elftausend Zeichen bis Mitte des Monats. Ich hab’s vergessen, wollte dich immer fragen und hab’s einfach vergessen.“
„Geht schon“, sagte ich, „wie findest du einen selbstgerechten Typen, der am Ende ordentlich was auf die Nase kriegt?“
„An Heiligabend zum Beispiel?“
„Warum nicht. Aber besser fände ich einfach in der Weihnachtszeit, nicht direkt an Heiligabend. Da kriegt jeder was auf die Nase, das ist ein Klischee.“
„Du bist der Kurzgeschichtler“, sagte er, „entscheide du. Wird sowieso gut.“
„Ich schick’s dir Sonntag in einer Woche, okay?“
„Okay“, sagte er, „du bist super, ich liebe dich.“
„Reiner Narzissmus“, sagte ich, und er lachte. Das ist ein Running Gag zwischen uns beiden. Wir sind eineiige Zwillinge und quittieren jedes Lob vom anderen mit dem Verweis auf dessen eigene Eitelkeit.
Ich fragte ihn noch, wie er mit seinem Roman vorankomme, und er stöhnte und erklärte mir, er ersaufe in Recherchen und verliere noch die Figuren aus den Augen vor lauter Daten und Dingen und Zeitgeistnotizen, und er fürchte, den Abgabetermin im Februar nicht einhalten zu können, wenn das so weitergehe.
„Wird es nicht“, sagte ich, „du hast immer gestöhnt in der Phase und dann gejauchzt, wenn du alles beisammenhattest und losschreiben konntest.“
„Drück Daumen“, sagte er. „Trotzdem.“
„Mach ich“, sagte ich, und wir verabschiedeten uns mit dem Gruß, den wir seit unserer Jungmännerzeit verwenden. „Nieder mit den Alpen“, sagt einer, und der andere: „Freie Sicht aufs Mittelmeer.“
Wenn andere Leute dabei sind und uns hören könnten, lassen wir das natürlich bleiben. Dann sagen wir Tschüss oder Ciao wie jeder normale Mensch. Nur unter uns ist es die ewig gleiche Formel „Nieder mit den Alpen“.
Paul schreibt Romane. Damit ist er ziemlich erfolgreich, er kann davon leben, wenn man die Honorare für Lesungen und journalistische Arbeiten mit einrechnet. Dieses Privileg bezahlt er aber mit fast absurdem Fleiß. Er verbringt den weit überwiegenden Teil seines Lebens am Schreibtisch. Nur wenn er recherchiert oder auf Lesereise geht, bekommt er etwas anderes zu sehen als den Blick über Duden und Brockhaus hinweg auf die Fenster des gegenüberliegenden Hauses.
Irgendwann, als er wieder mal über Abgabetermine klagte, habe ich ihm vorgeschlagen, seine Anthologiebeiträge, meist Kurzgeschichten, manchmal aber auch Essays, für ihn zu entwerfen. Er brauche sie dann nur noch zu überarbeiten und seinem eigenen Ton anzugleichen, sagte ich, mir mache das Spaß und ihn entlaste es.
Er stimmte damals zwar nur zögerlich zu, war aber bald begeistert, als er merkte, wie viel Zeit er damit gewann, wie wenig er an meinen Entwürfen zu ändern brauchte und wie gut zuerst ihm selbst und später auch den Herausgebern die Geschichten gefielen. Die Honorare sind fast immer lächerlich, so lächerlich, dass ich deren Weitergabe an mich ablehne und wir übereingekommen sind, stattdessen damit eine gemeinsame Reise zu unternehmen.
Ich bin auf Geld nicht angewiesen, weil die eine und andere glückliche Wendung mich schon vor Jahren zu einem gut situierten Bürger gemacht hat.
Bevor ich George und Magali kennenlernte, führte ich eine Zeit lang das Leben eines Privatiers, reiste viel, las viel und wusste nicht, wozu ich auf der Welt war, also war mir die Abwechslung, mich als Zulieferer in der „Werkstatt“ meines Bruders zu betätigen, sehr willkommen. Es machte mir tatsächlich Spaß, weil auf einmal aller Müßiggang seinen Sinn bekam. Beobachtungen, Erkenntnisse, Erlebnisse, alles war plötzlich von Nutzen, zumindest potenziell, und konnte in einer Geschichte aufleuchten. Es kam uns beiden zugute: Ich hatte Langeweile, und Paul konnte Hilfe gebrauchen.
Die Autobahn war angenehm leer. Ein paar Lastwagen, ein paar Pkws. Ich konnte dem eigentlich unangemessen starken Motor meines Mini so richtig Auslauf gewähren. Da ich die fest installierten Radarfallen inzwischen alle kannte, ging ich rechtzeitig vor ihnen auf die in Frankreich erlaubten Hundertdreißig herunter, um danach wieder mit Lichtgeschwindigkeit davonzuschießen. Mobile Radarfallen gibt es bei Nacht nicht. Auch französische Polizisten wollen schlafen.
Weniger als eine Stunde nach dem Telefonat mit meinem Bruder rollte ich über den knirschenden Kies meiner kleinen Auffahrt unters Dach des Carports.
~
Meine Wohnung nach vier Tagen Abwesenheit wieder zu betreten ist für mich immer, mal weniger, mal mehr, mit gemischten Gefühlen verbunden. Ich freue mich, endlich wieder in meine zweite Haut schlüpfen zu dürfen, und gleichzeitig wird mir bewusst, dass diese zweite Haut sich erst einmal ein wenig zu kalt anfühlt, sich vielleicht nicht wieder so anschmiegsam um mich legen lassen wird, sich verändert, mich vergessen oder sich von mir entfernt haben könnte. Das ist natürlich alles Unsinn, aber es ist eben der Unsinn, der mich anfliegt, wenn ich müde nachts die Tür aufschließe, meine Taschen mit Laptop und Wäsche in den Flur stelle und in jedem Zimmer Licht mache.
Eigentlich war ich schon müde, aber das Glas Wein, das ich mir jetzt einschenkte, hatte ich mir schon auf der Fahrt hierher vorgestellt, und außerdem bin ich ein Mensch, der seine Rituale liebt: Tür zu, Tasche abstellen, Wein aufmachen, mit dem Glas in der Hand durch alle Räume gehen und schauen, ob alles noch da ist.
Irgendetwas war anders an diesem Abend. Der Geruch natürlich, das war klar, das hatte ich erwartet – eine Wohnung riecht nach vier unbelebten Tagen fader und neutraler, das Essen, das ich koche, die Zigaretten, die ich rauche, der Kaffee, mein Rasierwasser, das alles hat sich dann verflüchtigt. Außerdem war die Putzfrau in meiner Abwesenheit hier gewesen, und es riecht noch ganz leicht nach den Mitteln, die sie benutzt hat. Zitronig und seifig und manchmal, wenn sie sich den Steinboden vorgenommen hat, auch nach Bittermandel.
Ich war oben in meinem Arbeitszimmer, schaltete den Computer ein, um mich vielleicht noch ein bisschen auf Facebook umzuschauen, hatte die Hand an der kleinen Steinfigur eines fahrenden Gesellen mit Hund und merkte, dass ich sie diesmal nicht zurechtrücken musste. Sie stand genau so, wie sie stehen sollte, in lockerer Reihe mit einer Taube, drei Zinnsoldaten, einer Glaskugel und einem Tintin aus Plastik, leicht abgewandt von dem Feuerzeug in Form eines Teddybären mit Latzhose, den Soldaten und der Taube zugewandt, als redeten die auf sie ein.
Ich rücke normalerweise fast alles in meinem Arbeitszimmer zuerst einmal wieder zurecht. Die Utensilien auf dem Schreibtisch genauso wie all die anekdotischen Figürchen, Spielzeuge, Mitbringsel und Kleinigkeiten der allerverschiedensten Art – wenn die Putzfrau unter der Woche sauber gemacht hat, stehen und liegen und lehnen sie anders da und haben aufgehört, miteinander zu kommunizieren.
In meinem Arbeitszimmer ist jede Freifläche bevölkert mit Zitaten aus meinem bisherigen Leben, die sich auf den ersten Blick als Chaos darstellen, auf den zweiten und alle weiteren Blicke aber als Ordnung. Die natürlich nichts mit Akkuratesse zu tun hat, nichts steht in Reih und Glied, nicht einmal die Zinnsoldaten, es ist eine Ordnung, die sich als Zufall maskiert und all diese stummen Dinge durcheinanderplappern lässt. Nur für mein inneres Ohr natürlich.
Diesmal war nahezu alles am richtigen Platz. Ich schob, nach längerer Betrachtung, den kleinen Smart unter meinem Bildschirm ein Stückchen nach hinten und rollte ein Ei aus rotem Marmor etwas näher an den Rand der Ablage, in der sich die Rechnungen stapeln. Mehr nicht.
Zuerst dachte ich noch, die Putzfrau habe das Zimmer diesmal ausgelassen, aber der Papierkorb war leer, nirgends lag ein Körnchen Staub oder ein Krümel Asche, alles glänzte, der Boden, die Flächen, der Bildschirm – es war verblüffend.
Ich ging ins Bad und in die Küche, sah, dass auch dort genau das richtige geordnete Chaos herrschte, und war konsterniert, weil so etwas einfach nicht vorkommt. Jetzt fiel mir auch die junge Frau auf dem Roller wieder ein, deren Gesicht ich nur kurz im Rückspiegel und vor der Einfahrt zum Haus gesehen hatte. War sie vorher mit dem Handy durch die Zimmer gegangen und hatte Fotos gemacht? Oder war sie Autistin? Eine Sonderbegabung mit fotografischem Gedächtnis?
Ich schenkte mir noch ein Glas Wein ein, in der Hoffnung, das innere Autofahren möge aufhören, damit sich meine Müdigkeit nicht noch lange mit der nervös-alarmierten Aufmerksamkeit kabbeln musste, und ich inspizierte noch einmal alles, das Gewürzregal, den Waschtisch und das Arbeitszimmer. Alles lebendig. Alles richtig. Ein Wunder.
Ich versuchte, mir das Gesicht der Frau ins Gedächtnis zu rufen, aber den Hintern hatte ich länger betrachtet, und er war auch das einfachere Motiv, er schob sich immer wieder über das blasse Bild, das ich vor meinem inneren Auge entstehen lassen wollte.
Leonie Wildenhain, die Frau, die seit Jahren für mich putzte, eine blonde, fröhliche mit Pferdeschwanz und Lederjacke, war für ein paar Wochen in den USA und hatte mir per E-Mail eine Vertretung angekündigt, der sie absolut vertraue. Eine Freundin aus Italien. Und da ich ihr ebenso vertraute, hatte ich das gleich wieder vergessen.
Endlich war die Schnellfahr-Einstellung in meinem Gehirn zur Ruhe gekommen, und ich endlich müde genug, um zu schlafen. Ich fuhr den Computer herunter, löschte die Lichter überall, putzte mir die Zähne, nahm einen frischen Pyjama aus dem Schrank und legte mich ins Bett.
~
Eine Hand lag auf meiner Hüfte. Es war wohl kühl in meinem Zimmer, wegen des offenen Fensters, denn die junge Frau, zu der die Hand gehörte, trug eine dunkle Jacke. Die Farbe konnte ich nicht erkennen, im Raum war nur das spärliche Licht der Straßenlaterne. Die Hand verursachte ein wohliges Surren auf meiner Haut, das ich von der Brust bis zum Knie spürte.
„Hallo“, sagte sie.
„Wie sind Sie hier hereingekommen?“, fragte ich, hatte dabei aber das Gefühl, die Frage sei dumm, weil ich vermutlich träumte und in Träumen so etwas wie ein Schloss oder eine Tür keine Rolle spielt.
„Natürlich träumen Sie, sonst könnte ich Sie doch nicht einfach so besuchen.“
„Wie haben Sie das geschafft, dass alles wieder genauso steht wie vorher?“
„Es stand vorher richtig und musste nachher auch wieder richtig stehen.“
„Ich habe mich sehr darüber gefreut. Danke.“
„Gern geschehen.“
„Ich kann leider kaum die Augen offen halten. Ich bin müde und muss schlafen. War ein langer Tag“, sagte ich.
„Ihre Augen sind nicht offen. Sie träumen mich.“
„Und Sie? Träumen Sie mich auch?“
„Das ist schwer zu erklären. Schlafen Sie gut.“
Sie nahm ihre Hand weg, und ich wachte auf. Das Wohlgefühl auf meiner Haut war noch da, ließ aber nach und legte sich ganz, als ich die Decke hochschlug und aufstand.
Ich schlafe nie durch. Mindestens einmal wache ich jede Nacht auf, gehe zum Kühlschrank und esse ein Stückchen Schokolade. Eine Tafel musste noch da sein. Ich lasse das kleine Depot nie ganz leer werden. Wenn die letzte Tafel angebrochen ist, kaufe ich nach.
Ich hatte auch früher schon Träume gehabt, in denen ich wusste, dass ich träume, aber daran, dass ich mich darüber auch noch mit einer geträumten Person ausgetauscht hätte, konnte ich mich nicht erinnern, das war neu. Vielleicht ist das eine Alterserscheinung, eine Form von langjähriger Erfahrung, dachte ich, wenn man so viele Träume geträumt hat, kann sich ja auch mal deren Art ändern. Und wenn man träumt, man sei wach, kann man auch träumen, man träume.
Ich wollte nicht richtig wach werden. Dieser Zwischenzustand gefiel mir, vielleicht würde ich gleich weiterträumen, ich sei wach gewesen und zum Kühlschrank gepilgert.
Und hätte dort keine Schokolade gefunden.
Das war bitter. Und eigentlich ausgeschlossen. Ich war mir sicher, letzten Sonntag noch eine Tafel gesehen zu haben. Die einzige logische Erklärung war, dass die Putzfrau sie aufgegessen hatte. Nicht okay.
Ich behalf mich mit einem schrumpeligen Apfel und stellte fest, dass mein Bild von der Frau, die mich eben noch so nett besucht hatte, einen Kratzer aufwies. Wenn sie mir die überlebensnotwendige Nachtarznei klaut, dann ist das mehr Übergriff, als ich zu erlauben bereit bin. Das geht nicht.
~
Am Morgen sah ich, dass ich das Fehlen der Schokolade nicht geträumt hatte, aber ich war schon nicht mehr ärgerlich darüber, sondern dachte mir allerlei Entschuldigungen aus. Ein Unterzuckerungsanfall, Heißhunger, Sternsinger, nein, Quatsch, nicht im Juni, was auch immer die Frau dazu gebracht haben mochte, die Schokolade zu nehmen, musste irgendeiner Art von Not gefolgt sein. Ich würde das Depot in Zukunft einfach nicht mehr so weit schrumpfen lassen, dann gäbe es keine nächtlichen Enttäuschungen mehr.
Mein morgendliches Ritual ist, mit Cappuccino und Zigarette am Fenster des Arbeitszimmers zu stehen, übers Rheintal hinweg nach Frankreich zu schauen und mich erst an den Computer zu setzen, nachdem ich einen Zug gesehen habe. Die Güterzüge sind unterbrochen und unregelmäßig, sie führen glänzende Tankwagen mit sich, bunte Container und rostige Lafetten, auf denen Autos oder Landmaschinen stehen, die Nahverkehrszüge sind rot und manchmal doppelstöckig, die Fernzüge weiß und schnell, und ich habe den Eindruck, als seien mehr von ihnen nach Süden unterwegs als nach Norden. Vermutlich stimmt das nicht, aber ich habe nicht mehr die Geduld für Statistik.
Als ich elf war und meine Eltern mich für die Sommerferien alleine, ohne Paul, zu meiner Großmutter abschoben, weil sie eine Reise nach Kanada machten, verbrachte ich die meiste Zeit am Fenster und schrieb jede Automarke auf, die vorbeikam, machte dann Striche dahinter, vier senkrecht, einen quer, und hatte am Abend eine saubere Verkehrszählung. Wäre Paul dabei gewesen, dann hätten wir unsere Tage im Schwimmbad oder im Wald verbracht, aber alleine fiel mir nichts Besseres ein, als, meist vergeblich, auf einen vorbeifahrenden Borgward oder Porsche zu warten. Auf der Liste standen die immer gleichen Opel, Volkswagen, Ford und DKW, selten mal ein NSU, eine Isetta oder ein Mercedes und noch seltener ein Fiat oder Renault.
Paul war in diesem Sommer bei der anderen Großmutter, und wir schrieben einander Briefe, in denen er mich Paul nannte und ich ihn Peter.
Diese Namen sind dem biederen Humor unseres Vaters geschuldet. Unsere Mutter hätte lieber einen Florian und einen Anselm gehabt, aber ihr Mann hatte sich, wie fast immer, durchgesetzt mit der apodiktischen Bemerkung: Dann sind wenigstens ihre Namen heilig, wenn schon sonst nichts an ihnen.
Ich beneidete Paul damals um seinen Namen, der war wenigstens selten zu dieser Zeit. Peter gab es wie Sand am Meer, und man nannte außerdem noch seine Katze so. Peterle. Oder Mohrle. Wenn sie schwarz waren.
Die Geschichte, die ich am letzten Wochenende geschrieben hatte, lag ausgedruckt auf dem Schreibtisch. Das mache ich immer so. Am Wochenende schreiben, dann, bevor ich losfahre, ausdrucken und am nächsten Wochenende mit neuem Abstand durchlesen und überarbeiten. Diesmal würde ich sie nicht nur überarbeiten, sondern ganz umschreiben, denn es war die Geschichte, die ich Paul in der Nacht zuvor am Telefon vorgeschlagen hatte. Den Trödelmarkt, auf dem sie spielte, konnte ich einfach zum Weihnachtsmarkt umschreiben, das Frühsommerwetter gegen Schneetreiben im Dezember austauschen und den Antagonisten ausbauen. Der Ich-Erzähler, der so stolz auf sich selbst ist, hatte schon alles, was er brauchte, aber wenn ich das Ganze auf zehntausend oder elftausend Zeichen aufblasen musste, dann gab es noch Platz für die Genese seiner Feindseligkeit.
Ich duschte und arbeitete danach konzentriert bis in den Nachmittag, nur unterbrochen von etlichen Cappuccino-Pausen mit Fernblick und einem kurzen Imbiss. Gegen fünf inspizierte ich die entsprechenden Schrankfächer in der Küche und den Kühlschrank, schrieb einen Einkaufszettel und fuhr hinunter in das kleine Städtchen, um alles, was ich brauchte, in den verschiedenen Läden zusammenzukaufen. Brot beim einen Bäcker, Schwäbische Seelen beim anderen, das, was ich drauflegen würde, und Gemüse, Obst und Schokolade beim einzigen kleinen Supermarkt, den die Stadt noch hat, Gelbe Säcke im Schreibwarenladen und Getränke, Milch, Spaghetti und Olivenöl beim Discounter, weil ich dort mit dem Einkaufswagen bis zur Hecktür fahren konnte.
Ich bin ein bekennender Provinzler. Das war nicht immer so, natürlich nicht, wenn man jung ist, glaubt man, das wirkliche Leben sei nur in der Metropole zu finden und die kleinen oder mittelgroßen Städte dämmerten in einer Art Halbschlaf hinter dem Wandel der Moden und Zeiten her und betäubten sich mit der Suggestion eines falschen Friedens, der in Wahrheit nur die Gegensätze verdecke, die in den Großstädten hart aufeinanderträfen.
Inzwischen weiß ich, dass es diesen falschen Frieden nicht gibt. Die Abwesenheit von Krieg ist echter Frieden, egal, wie er aufrechterhalten wird. Wenn ein Mensch, der mich hasst, trotzdem freundlich zu mir ist, dann bleibt der Hass sein alleiniges Problem, er wird nicht auch noch zu meinem. Wenn er die Feindseligkeit nicht auslebt, dann richtet sie keinen Schaden an. Außer in seiner eigenen Seele.
Selbstverständlich gibt es in diesem Idyll hier mit seinen Renaissancefassaden und Brunnen alles Schlimme, Hässliche und Gemeine, was auch den Rest der Welt behelligt, aber in anderer Dosis und deshalb mit geringerer Wirkung auf das Zusammenleben aller. Auch hier bringt man sich selbst und andere um, missbraucht Kinder und quält Abhängige, aber all das kommt eher alle paar Jahre mal vor oder ans Licht und nicht alle paar Wochen.
Je kleiner eine Stadt ist, desto eher haben die Menschen eine Chance, als Einzelne wahrgenommen zu werden. Wenn in Berlin oder München jemand im Porsche an mir vorüberfährt, dann gehört der für mich automatisch zu den Reichen, kommt aus Dahlem oder Grünwald und erfüllt auch sonst alle Klischees, die an der Gruppe kleben. Hier in meinem Provinznest kann ich mitbekommen, dass er in einer Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss lebt, bei Aldi einkauft und als Fliesenleger arbeitet. Und der Mann mit dem alten R4 besitzt drei Mietshäuser. Und der Bankdirektor wohnt direkt neben dem Malermeister. Und die Ärztin neben der kroatisch-italienischen Familie, die eine Pizzeria betreibt.
~
Nachdem ich mir Tomatensalat mit Spiegelei gemacht hatte, verbrachte ich den Abend mit Lesen. Ich esse unter der Woche kulinarisch und am Wochenende frugal. Ich musste die Heizung höherstellen. Dieser Juni ähnelte einem April. Schade, dass ich keinen Kaminofen hier einbauen konnte, das Prasseln und Knacken eines Feuers wäre jetzt das i-Tüpfelchen auf meinem sowieso schon vorhandenen Wohlbefinden gewesen.
Manchmal wird mir klar, was für ein Glück ich habe, und ich nehme mir vor, es nicht mit schlechter Laune oder Ignoranz zu schmälern. Jeden Tag kann eine Diagnose oder ein unvorsichtiger Verkehrsteilnehmer diesem Glück ein Ende machen. Ich bin zweiundsechzig Jahre alt und kann noch ein Viertel meines gesamten Lebens vor mir haben. Zwanzig gute Jahre. Genauer gesagt: zwanzig-komma-null-sechs. Aber vielleicht auch nur noch Tage oder Stunden.
Ich las, bis die Buchstaben verschwammen, und trödelte dann noch ein wenig bei Facebook herum. Im Laufe der Jahre ist die Liste meiner „Freunde“ auf knapp zweihundert angewachsen, alte Bekannte, Künstler aller Art, die diese Öffentlichkeit suchen, Journalisten, Leser von Paul, Buchhändler, Verleger – inzwischen ist das so was wie ein Pressespiegel für mich geworden, weil sie alle immer wieder Artikel teilen, und es ist eine Art virtueller Marktplatz, auf dem sich Linke, Liberale, Spießer, Witzbolde und Eigensinnige ins Grundrauschen des allgemeinen Geplappers mischen.
~
Ob ich in dieser Nacht etwas träumte, weiß ich nicht, aber von der obersten Tafel Schokolade auf dem kleinen Stapel war am anderen Morgen nur noch die Hälfte übrig, also war ich auf jeden Fall in Bewegung gewesen.
~
Mit der Weihnachtsgeschichte war ich mittags fertig. Ich druckte sie aus, legte mich für eine Stunde hin und las sie danach auf Papier noch einmal durch. Melodische Änderungen und einige Korrekturen, die Bezüge klarer machen sollten, arbeitete ich noch ein, und dann schickte ich sie ab.
Super, stand nur in der SMS von Paul, die am frühen Abend bei mir ankam.
Ich freute mich. Lob von meinem Bruder tut mir gut.
~
Ich weiß nicht, wer von uns beiden zuerst die Idee hatte, Schriftsteller werden zu wollen, vielleicht Paul, vielleicht auch ich. Wir lasen, seit wir das konnten, ein Buch nach dem anderen. Wahllos und gierig. Das konnte Schund sein wie Harold Robbins oder Simmel und ebenso Literatur wie Kafka oder Steinbeck. Und irgendwann fingen wir an, die Geschichten zu korrigieren, uns gegenseitig zu erklären, was wir anders gemacht hätten, was eigentlich hätte passieren müssen und wie man etwas besser hätte ausdrücken können. Paul blieb dabei, ich verzettelte mich, er schrieb und schrieb, und ich jobbte und reiste und kiffte und bildete mir ein, frei zu sein, weil ich wie ein Schaustellergehilfe lebte.
Er zog sein Germanistikstudium durch, ich probierte und schmiss zuerst Kunstgeschichte, dann Vergleichende Kulturwissenschaft, zog dann jahrelang mit Rockbands als Roadie durch die Gegend, trampte durch Europa, arbeitete in Plattenläden, Clubs und Kneipen, im Blumenhandel, in einer Galerie, bis mir unser Stiefvater, der mich adoptiert hatte, die Verwaltung eines Seminarhauses in Volterra anbot, weil er es nicht mehr mit ansehen konnte, wie ich zusehends verkaterter, verwahrloster und verpeilter wurde. Ich blieb acht Jahre. Bis zu seinem Tod. Danach musste ich nicht mehr arbeiten, denn ich war sein einziger Erbe. Und ich hatte mir das Kiffen abgewöhnt.
Auf einmal war ich ein wohlhabender Mann, der sich die Unterstützung diverser Hilfsprojekte und Kulturinitiativen leisten konnte. Und eine Wohnung, die dem Auge nicht wehtut.
In meinen Wanderjahren, deren größeren Teil ich grasbenebelt verbracht hatte, war mir klar geworden, dass ich ästhetisch verletzbar bin. Das hat zwei Seiten: Das Glück im Angesicht von Schönheit ist erregend, aber das von Gleichgültigkeit erzeugte Unglück triumphierender Hässlichkeit ist niederschmetternd.
Das gilt nicht für Menschen und Tiere, deren Schönheit oder Hässlichkeit liegt in niemandes Verantwortung, oder gar die übrige Natur, in der es keine Hässlichkeit gibt, es gilt nur für Artefakte. Architektur, Design und Kunst.
~
Am Sonntagabend nahm ich Abschied von meiner zweiten Haut, wartete wieder, bis ein Zug, diesmal ein weißer, schneller nach Norden, vorbeikam, und druckte die Geschichte in ihrer Endfassung aus, obwohl ich sie längst abgeschickt hatte. Das ist ein Ritual. Ich würde sie am nächsten Freitagmorgen trotzdem noch einmal durchgehen und eventuelle Änderungen und Verbesserungen nachreichen.
Ob die Putzfrau das lesen würde?
Auf die beiden Tafeln Schokolade, die noch im Kühlschrank lagen, klebte ich einen Zettel mit der Bitte, eine für mich übrig zu lassen. Wäsche nahm ich diesmal keine mit. Das reicht alle zwei bis drei Wochen.
Ich fuhr diesmal die längere, landschaftlich schönere Strecke durch die Vogesen über Thann, La Bresse und Remiremont und genoss es, über die Pässe und durch die Wälder zu kurven.
Da es nach Westen ging, verlängerte sich der Tag, und die Dunkelheit kam erst, als ich Fougerolles hinter mir hatte.
~
Ein Glas Wein mit Magali, ein Imbiss aus Resten, den mir Melih noch gezaubert hatte, ein weiteres Glas Wein mit George, der sich zu uns gesellt hatte, nachdem der letzte Gast gegangen und der letzte Teller gespült war, dann legte sich die Betriebsamkeit im Haus, die Angestellten brachen mit erleichterten Seufzern zu ihren Familien oder Fernsehern auf, und schließlich gingen auch George und Magali nach Hause.
Ich schloss hinter ihnen ab und aktivierte den Alarm, las noch eine Stunde, legte mich schlafen und wusste, dass die nächsten vier Tage an mir vorbeiziehen würden mit den immergleichen Beschäftigungen: Händeschütteln, Plaudern, Schlafen, Essen, Hygiene, Schwimmen, einem bisschen Zeitung, einem bisschen Fernsehen, Spaziergängen im Internet und in der Stadt, und das alles wie auf Autopilot. Mein richtiges Leben, das, in dem meine Fantasie und Erfahrung eine Rolle spielten, wartete am Wochenende auf mich.
~
Das stimmte nicht. Zumindest meine Fantasie war diesmal wohl nach Frankreich mitgekommen. In der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch saß ich am Bett der jungen Frau. Sie schlief, und ich wusste nicht, wie ich in ihre Wohnung gekommen war, ich saß auf ihrer Bettkante und lauschte ihren Atemzügen.
Ich tat nichts, berührte sie nicht, bewegte mich nicht, gab keinen Laut von mir, ich bewachte ihren Schlaf, als hätte sie mich darum gebeten, weil sie sich vor irgendetwas fürchtete.
Direkt meiner Fantasie war diese kleine Szene vielleicht nicht entsprungen, falls man Träume nicht als Teil davon betrachtet, aber als ich aufwachte, war das Bild der schlafenden Frau noch eine Weile da, und auch mein Gefühl der Zuneigung, mein Beschützerinstinkt und ein leises Bedauern, dass ich sie nichts gefragt hatte. Zum Beispiel nach der Schokolade.










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.