
Señora Gerta — Inhalt
Zu allem entschlossen marschiert das jüdische Wiener It-Girl Gerta Stern kurz nach den Novemberpogromen 1938 in das Gestapo-Hauptquartier in Hamburg, um die Liebe ihres Lebens aus dem KZ Sachsenhausen zu befreien. Durch eine glückliche Fügung findet sie zudem einen Helfer in Uniform. „Herr Otto“ riskiert sein Leben, um Gertas und Moses' Flucht nach Panama zu ermöglichen. Einfühlsam und berührend erzählt Anne Siegel die packende Geschichte der Sterns, deren späteres Leben in Panama noch viele weitere wundersame Wendungen nehmen soll. Und sie findet eine Antwort auf eine der größten Fragen von Gerta und Moses: Wer war der mutige Deutsche, der ihnen einst zur Flucht verhalf wirklich?
Leseprobe zu „Señora Gerta“
Prolog
Warum bleiben manche Geschichten in der Welt, andere aber verschluckt das Leben, sodass sie irgendwann für immer verschwinden, wie die Körper der Menschen, von denen sie erzählen?
Wie kann es sein, dass eine Geschichte, die am einen Ende der Welt stecken geblieben ist, plötzlich zurück auf den Kontinent katapultiert wird, auf dem sie einst begann? Manche Geschichten sind so stark angefüllt mit eigener Energie, mit Leben, Liebe, Hoffnung und Zuversicht, dass sie Grenzen überwinden und Barrikaden niederreißen. Sie verweisen auf das Wesentliche und [...]
Prolog
Warum bleiben manche Geschichten in der Welt, andere aber verschluckt das Leben, sodass sie irgendwann für immer verschwinden, wie die Körper der Menschen, von denen sie erzählen?
Wie kann es sein, dass eine Geschichte, die am einen Ende der Welt stecken geblieben ist, plötzlich zurück auf den Kontinent katapultiert wird, auf dem sie einst begann? Manche Geschichten sind so stark angefüllt mit eigener Energie, mit Leben, Liebe, Hoffnung und Zuversicht, dass sie Grenzen überwinden und Barrikaden niederreißen. Sie verweisen auf das Wesentliche und zeugen von einer Kraft, die Menschen über sich selbst hinauswachsen lässt.
Dies ist die Geschichte einer unerschrockenen Frau, die hundert Jahre alt wurde und noch immer lacht wie ein junges Mädchen. Die Geschichte einer Frau, der Wien weiterhin am Herzen liegt, auch nach Jahrzehnten in ihrer tropischen zweiten Heimat Panama, wo sie ihren Hausmädchen die Zubereitung von Knödeln und Palatschinken aus der Heimat beibrachte und glücklich und wohlhabend wurde.
„Wir kamen mit drei Dollar in der Tasche“, sagt Gerta Stern manchmal und schüttelt, sich selbst darüber wundernd, den Kopf, der nicht aussieht wie der einer Hundertjährigen.
Ihre Geschichte begegnete mir, weil die Neugierde mich auf einen seltsamen Pfad trieb. Eines Tages, nach einer Lesung in Panama, stand eine alte Dame vor mir und erzählte mir von ihrer Leseleidenschaft, ihrer Sehnsucht nach dem Deutschland, das sie einst verlassen hatte, und von der kleinen Kolonie jüdischer Einwanderinnen in dem mittelamerikanischen Land. Sie zelebrierten das Leben miteinander und hatten sich in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts geschworen, Panama, dem Land ihrer Rettung, die Treue zu halten.
Regelmäßig treffen sie sich zum Bridge, feiern freitags das Shabbes-Dinner, sobald der erste Stern am Himmel über dem Pazifik steht, und gehen samstags in die Synagoge. Die Feste, die kommen, feiern sie, als gäbe es kein Morgen. Das scheint ihr Elixier für ein langes Leben zu sein, denn sie sind alle schon betagte Leute.
Als Lotte in einem orangefarbenen Kleid mit Schlangenmuster-Druck vor mir stand und mir von alldem auf ihren Stock gelehnt erzählte, war ich ein wenig irritiert. Jüdisches Exil in Panama? Davon hatte ich noch nie gehört, dabei glaubte ich, mich in der Exilwelt des vergangenen Jahrhunderts auszukennen. Sollte es noch einen Ort auf der Welt geben, von dessen großzügiger Regelung für jüdische Emigranten wir Nachgeborenen nichts wussten, so wie das jüdische Exil in Shanghai erst fünfzig Jahre später in unser aller Bewusstsein gedrungen war? Auch mein Großonkel hatte es nach Shanghai geschafft. Aber Panama?
„Wir waren viele, und fast niemand wusste damals, dass Panama uns Juden überhaupt Zuflucht gewährte“, sagte Lotte, und das machte mich noch neugieriger.
Im Jahr darauf, während eines erneuten Aufenthalts in Panama, beschloss ich, Interviews zu diesem Thema zu führen, und ein weiteres Puzzlestück fiel mir auf seltsame Weise zu. Ich erfuhr, dass die Nichte des bekannten Komponisten Siegfried Translateur, mit dem ich mich bereits in einem anderen Zusammenhang befasst hatte, hier lebte. Gerta Stern war sogar Teil des Clubs der alten jüdischen Damen um Lotte. Translateur war ein verfemter Komponist, von den Nazis umgebracht, obwohl von ihm eines der verbreitetsten und bekanntesten Stücke stammte, der „Sportpalastwalzer“.
So ist das mit manchen Geschichten. Sie irren durch die Welt, wie Zugvögel, die die Orientierung verloren haben, und erst nach Jahren treffen sie auf einen Menschen, der ihnen gewissermaßen den Weg zum Ziel weist, indem er sie aufschreibt. So ging es Gerta und mir, nachdem wir einander kennengelernt hatten.
Da traf Lebenslust auf Tatendrang, und dass Gertas Geschichte nun hier zwischen zwei Buchdeckeln steht, hat auch damit zu tun, dass sie noch nicht zu Ende erzählt war, als ich sie an einem verregneten Frühsommertag zwischen quietschendem Papageiengeschrei und dem Autolärm einer mittelamerikanischen Millionenstadt in der Avenida Argentina von Panama City in einem Appartement im fünften Stock fand. Da fehlte noch ein Stück, das Bild war noch nicht vollkommen.
„Haben Sie eigentlich noch eine Frage ans Leben?“, wollte ich von Gerta wissen. Das digitale Aufnahmegerät stand zwischen uns auf dem Tisch in ihrer großzügig eingerichteten Wohnung, die auf mich stets wirkt, als tanze sogleich Carmen Miranda durch den Salon. Wenn ich in Gertas Wohnung stehe, nachdem ich aus dem Aufzug durch die Eingangstür getreten bin, habe ich einen Moment lang das Gefühl, ich sei aus einer Zeitmaschine gestiegen und versehentlich in den Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gelandet. Ich komme mir vor wie in einem dieser alten Musical-Filme, in denen die Helden unter tropischen Bedingungen Spezialaufgaben lösen müssen. Warum also nicht Vergleichbares am Rande des Panamakanals bewerkstelligen? Wo einst Männer mit Tropenhelmen in beigen Kolonialanzügen und Frauen mit ananasartigen Gebilden über dem hochgesteckten Haar flanierten. Auf der Bühne eine Bigband, deren Bläser im selben Moment aufstehen und im Rhythmus ihre Trompeten, Saxofone und Posaunen mit eingeknickten Hüften nach rechts und links schwenken. Ich stelle sie mir vor, vorne, in Gertas Salon, hinter der kleinen Cocktailbar, die es tatsächlich gibt, in gestepptem Samt, und links davon die opulenten Sessel und Couchtische aus dem letzten Jahrhundert. Möbel, die heute in Europa wieder sehr beliebt sind. Und dann sehe ich vor meinem geistigen Auge besagte Carmen Miranda durch diesen Raum tanzen, diese schöne Latina, die in den alten amerikanischen Filmen stets die mittelamerikanische Exotin spielen musste. Sie tanzt in den Seitenflügel der Wohnung, dorthin, wo sich Señora Gertas Kosmetikstudio befindet, denn die alte Dame praktiziert noch immer.
In einem Zimmer weiter hinten im Nebentrakt dieser Wohnung saßen wir vor einem Jahr, und ich stellte ihr also diese Frage: ob Gerta nach einem so abenteuerlichen und erfüllten Leben noch eine Frage habe ans Leben. Da sagte sie diesen Satz, der mich seitdem nicht mehr losließ: „Wir haben nie erfahren, wer der Mann war, dem wir unsere Rettung verdanken.“
Der heimliche Helfer im Hamburg des Jahres 1938. Ein Komplize in Nazi-Uniform. „Herr Otto“ von der HAPAG Shipping Company, der Mann, der Gerta den größten Schrecken einjagte und dann ihr Fleisch gewordener Schutzengel wurde, denn ohne ihn wäre sie nicht mehr am Leben, und vielleicht hätte sie ohne ihn nicht den Mut besessen, todesmutig ins Gestapo-Hauptquartier zu marschieren und durch einen Trick ihren Mann aus dem Konzentrationslager frei zu bekommen.
Als ich Gertas Satz zum ersten Mal hörte, war sie neunundneunzig Jahre alt. Ihr hundertster Geburtstag näherte sich mit großen Schritten, sie wollte ihn in Europa feiern, in der Sommerfrische in den österreichischen Alpen. Ich dachte ein paar Wochen darüber nach, war selbst nach Europa zurückgekehrt und beschloss, Gerta zu ihrem hundertsten Geburtstag ein besonderes Geschenk zu machen und etwas über jenen Herrn Otto herauszufinden. Daran, ein Buch zu schreiben, dachte ich noch lange nicht. Dazu kam es erst Monate später, als wir mit Gästen aus zwölf Nationen eine Woche lang im Grand Park Hotel in Bad Hofgastein die frischgebackene Hundertjährige feierten. Da waren ein Cellist aus Taiwan, eine Opernsängerin und ein junges Klavierwunder, Gäste aus Tel Aviv und New York, Barcelona und Miami. Menschen verschiedener Herkunft und aller Altersklassen.
Nach drei Tagen, die ich mit alten jüdischen Damen aus Übersee und anderen Gästen der Feier verbracht hatte, machte am Nebentisch im Speisesaal jemand Bemerkungen über die saudischen Familien, die den Sommer über ihrer Wüstenheimat mitsamt des Hofstaates den Rücken gekehrt hatten und mit uns im Hotel in milderen Temperaturen wohnten. Viele der Frauen trugen dunkle Vollverschleierung, den Niqab, bei dem nur die Augenpartie frei bleibt. Die nicht ganz wohlwollende Nachrede konterte Gerta mit: „Lasst sie doch, uns wollte hier früher auch niemand.“ Und in dem Augenblick hatte sie mein Herz endgültig erreicht. An diesem Tag beschloss ich, Gertas Geschichte aufzuschreiben. Sie hatte diesen Satz weder schnippisch noch bösartig gesagt, beides passt nicht zu ihr. Sie hatte dabei diesen aufgeweckten Gerta-Blick, der sie schon auf den Kinderfotos ausmachte. Die edel gekleidete alte Dame hatte ihre Ansicht kundgetan, ganz offen hinübergesehen, und der Nachbartisch duckte sich unter den eindeutigen Worten und Blicken hinab in das Vanillekipferl-Parfait an glasierten Zwetschgen.
Vielleicht wird es am Ende dieses Buches so sein wie bei den Riesenpuzzles, die in Tausenden von Teilen lange auf den Tischen tüftelnder Menschen liegen. Da gilt es inmitten eines großen Durcheinanders einen Zusammenhang zu schaffen und alles, was passt, einzufügen, und am Ende fehlt dieses eine letzte Stück, das wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Da klafft eine Lücke im Bild, aber der Tisch ist leer. Man sieht das erst, wenn alle anderen Stücke in das große Bild eingefügt sind. Mag sein, dass dieses eine letzte Stück gar nicht mehr nötig ist, weil trotzdem ein neues großes Ganzes entstehen konnte.
Vielleicht wird es mir mit dieser Geschichte auch so gehen.
Gertas Puzzleteile liegen in Hamburg und in Wien, in Miami, New York, London und Panama und vielleicht auch dazwischen irgendwo auf dem Atlantik. Auf ihm fuhr sie ins Ungewisse … mit drei Dollar in der Tasche.
Auf einem Passagierschiff, auf das ihr heimlicher Helfer sie inkognito eingeschifft hatte. Nachts hatten sie an einem Steg in der Dunkelheit der Bretagne ausharren müssen. „Um halb zwei nachts wird ein Ruderboot kommen und Sie dort abholen“, hatte er ihr gesagt, und tatsächlich. So hatten sie Europa verlassen, die Heimat im Rücken, die Zuversicht im Herzen und vor sich das Ungewisse in der Fremde, in einem Land, dessen Sprache sie nicht sprachen.
Es gehörte unendlich viel Vertrauen dazu, nicht nur in das eigene Schicksal, sondern auch in die wildfremden Menschen, die ihnen den Weg ins rettende Panama wiesen. Mit ihnen war ein Mann mit einer tragbaren Schreibmaschine als weiterer Gast an Bord des fremden Schiffes gekommen, das sie in Hamburg niemals hätten besteigen dürfen, denn als Juden hätten sie es dort nicht einmal über die Grenze des Hafens hinaus geschafft.
Von Frankreich aus nach Panama.
Schon einmal hatte Gerta das Boot heimlich betreten, weil sie ein Abkommen mit einem fremden Mann an Bord geschlossen hatte. Auch er gehört zu denen, ohne die sie nicht nach Panama gekommen wären. Ihr Hamburger Helfer hatte andere Menschen mit ins Boot geholt, im doppelten Sinne des Wortes.
Letzte Hoffnung Panama.
Der Kerl mit der Schreibmaschine schien sie wie die Motte das Licht zu umkreisen, und sie mussten den Atlantik schon halb überquert haben, bis Gerta endlich keine Angst mehr vor ihm hatte. Bis dahin machte sie kein Auge zu. War der Mann ein Spion? Hatte ihn die Gestapo geschickt, Hitlers Geheimpolizei, um sie doch noch zurückzuholen?
Drei Wochen später kamen sie in Panama an. Es war die Rettung, selbst wenn sie mitten im Dschungel wohnten und Hitze und anderes Ungemach durch fremde Flora und Fauna drohte. Der Urwald spie Tiere aus, von deren Existenz sie bis dahin nicht einmal etwas geahnt hatten. Die Klänge, die allabendlich aus dem dichten Grün des Regenwaldes drangen, waren furchterregend. Aber was war schon die Furcht vor der Natur gegen das, was hinter ihnen lag? Hinter Gerta und ihrem Mann Moses, genannt Munio, dem Profifußballer, den sie aus dem Konzentrationslager frei bekommen hatte. Wie sollten sie nach allem, was sie hinter sich hatten, mitten im nächtlichen Urwald furchterregende Tiere und verworrene Geräusche im grünen Blättergetümmel schrecken? Zu Gerta und ihrem Mann Moses Stern gehörte noch Sigmund, Kosename Sigi, Moses’ kleiner Bruder. Denn: „Wenn ihr geht, müsst ihr den Sigi mitnehmen“, hatten Gertas Schwiegereltern einst verfügt.
Am 11. Januar 1939 hatte sie das Schiff in einem fernen Karibiknest namens Cristóbal ausgespuckt. An Bord dieser mittlerweile gar nicht mehr ganz fremde Mann, der von nun an fest mit ihrem Schicksal verbunden sein sollte. Herr Rosenberg aus Bogotá. Der Mann, mit dem Gerta ein geheimes Abkommen geschlossen hatte. Sie hatte ihm ein Lied gesungen, und er hatte zugesagt, ihnen Geld zu leihen. Erst Jahre später sollten sie ihn wiedersehen und bei Herrn Rosenberg ihre Rechnung begleichen.
Der sichere Boden, auf dem sie in Mittelamerika standen, war ein Versprechen, das sich erst beweisen musste, denn dieser Boden, das waren stinkende Sümpfe und schlickiger Grund. Urwaldboden und schlechte Schotterpisten, um deren Existenz man mit jedem Tropenregen aufs Neue fürchten musste.
Da saßen sie nun, Gerta, ihr Mann Moses und dessen minderjähriger Bruder aus Wien, in der kleinen Exilantenunterkunft, die ihnen zugewiesen worden war. Direkt nebenan die Panamakanalzone unter amerikanischem Protektorat, das den wichtigen Wasserweg und die überbordenden Einnahmen daraus in seinen Händen hielt. Moses, genannt Munio, der Profifußballer, mag sich im Herzen Lateinamerikas besonders fehl am Platze gefühlt haben. Weit und breit war hier an Fußball gar nicht zu denken. Und der Junge, Sigi, versuchte tapfer zu sein und dachte wohl an die Eltern, die sie im fernen Wien hatten zurücklassen müssen.
Weit über siebzig Jahre später. Gertas Appartement mitten im Zentrum von Panama City.
Manchmal ist es nur ein Satz, ein Punkt, der nicht gesagt, nicht gesetzt, ein Atem, der nicht hinausgelassen wurde, oder das letzte Wort, das einfach noch niemandem über die Lippen kam. So einem seltsamen Moment verdankt diese Geschichte, dass sie nun in der Welt ist. Mein Audiorekorder war längst ausgestellt nach dem langen Interview in Panama City, als ich Gerta diese eine Frage stellte, die alles in eine vollkommen andere Richtung lenkte.
„Eine letzte Frage habe ich doch noch, Gerta“, sagte ich und stellte meinen Rekorder noch einmal an, dieses Gerät, das mit seiner Digitalanzeige so seltsam deplatziert schien in Gertas Welt zwischen böhmischen Saftgläsern mit Feinschliff, eleganten Spitzendecken und herrlich voluminösen Samtsesseln.
Von draußen drang durch die halb offenen Fenster, die aus raffinierten, übereinanderliegenden Glaslamellen bestanden, das Dauerbrummen der Millionenstadt hinein, überlagert von den Schreien exotischer Vögel. Der alles betäubende Verkehr eines Freitags in Panama City mit seinen Hupkonzerten im Stau, dazwischen Marktverkäufer, die auf den Grünstreifen, die die Avenidas trennen, Kokosnüsse feilbieten, Hüte und süße Köstlichkeiten. Hier, bei Gerta: schöne Blumengestecke und alte Fotos, eine Oase im Kontrast zum Wahnsinn des modernen Mittelamerikas direkt vor der Tür.
Mein Blick fiel auf visionär gestaltete Hochhäuser, die sich nur eine Avenida entfernt in die Höhe zwirbelten und wundersame weiße Wolken darüber, deren Schimmern das grün-violette Licht des Pazifischen Ozeans wiedergab. Was für ein sonderbarer Kontrast zu dieser Welt im fünften Stock des Appartmenthauses, in dem Señora Gerta, oder Don˜a Gerta, wie sie ehrerbietig genannt wird, noch immer lebte und arbeitete. In ihrem Salon strahlt etwas anderes: Es ist ein beeindruckendes Ölgemälde, das inmitten all der anderen geschmackvollen Bilder an der Wand hängt und in perfekter Technik gemalt ist. Es zeigt Gerta in jungen Jahren, hat etwas geradezu Magisches und wurde gefertigt von einer malenden Legende, Isaac Benítez, aus dem Panama der Fünfzigerjahre. Dieser Mann wäre niemals ein berühmter Maler geworden, hätte nicht Moses, Gertas Mann, eines Mittags einen Spaziergang am Strand gemacht und im Vorübergehen diesen Pinselstrich entdeckt, ihn ermutigt, ihm richtige Farben gekauft und dafür gesorgt, dass dieses Talent etwas lernt. Munio verschaffte Benítez einen Job im Museum, wo er andere Bilder restaurierte, und in der Folge sogar ein Stipendium in Florenz, wo der offensichtlich hochbegabte Maler endlich die Ausbildung genoss, die ihn zu einem der Stars der Fünfziger- und Sechzigerjahre in Panama machte. Nachdem er einem Schlaganfall erlag, war es Gerta, die seine Grabrede hielt.
Hätte Gerta ihren Mann nicht aus dem Konzentrationslager befreit und er es nicht mit ihr ins Exil nach Panama geschafft, auch der Maler, der die schöne junge Wienerin in Öl darstellte, hätte wohl weiter Skizzen am Strand der Hauptstadt gezeichnet und wäre nie berühmt geworden, schon allein, weil er sich gar keine richtigen Ölfarben hätte leisten können.
Manche Menschen sind wie Dominosteine. Sie bewegen andere und die bewegen wiederum andere … Gerta ist so ein Mensch. Und auch Munio wollte der Welt etwas zurückgeben, nachdem er einmal schon dem Tode geweiht aus dem schlimmsten Lager des Landes wieder befreit worden war durch seine junge Frau.
„Eine letzte Frage …,“ begann ich meinen Satz, und Gerta sah erwartungsvoll von ihren Händen auf, die sie vor sich liegend auf dem Tisch betrachtete.
Don˜a Gerta muss um die sechzig gewesen sein, als sie beschloss, dass sie nun erst einmal eine Weile lang nicht zu altern gedenke. Und weil alles, was Gerta unternimmt, sehr elegant geschieht, gelang ihr auch dieses Unterfangen auf stille, glaubhafte und bemerkenswerte Weise. An diesem Tag, als ich sie zum ersten Mal besuchte, sagte sie leicht errötend: „Ja, das ist durch einen Zufall im letzten Jahr aufgeflogen, und dann beschloss ich, nicht mehr zu lügen. Es ist ja auch zu albern, aber eigentlich würde ich jetzt fünfundachtzig.“ Sie strahlte. Ihr Lächeln gab eine weiße, ebene Zahnreihe frei und einen schamvollen Blick, der den Backfisch erahnen ließ, das Wiener Teenagergirl, das sie Ende der Zwanzigerjahre gewesen sein mochte, als die Raumdecken noch höher waren und mit Stuck verziert statt all der großblättrigen Ventilatoren, die in den Tropen seit Jahrzehnten in ihrem Heim die Luft auffächeln. Im nächsten Moment ging Gertas Lachen in ein albern-freudiges Kichern über, und sie verbarg ihr Gesicht schamvoll hinter ihren Händen.
Gerta Stern hat ungewöhnlich schöne Hände. Sie erzählen so viel über diesen Menschen. Ja, sie sind alt und faltig, aber gleichermaßen kraftvoll, und die Schönheit, die sie ausstrahlen, birgt eine große Vitalität. Schließlich leisten sie bei ihren täglichen Kosmetiksessions für Kundinnen noch immer ganze Arbeit. Und haben die präziseste Maniküre erfahren, die es an diesem Ort zwischen Atlantik und Pazifik gibt. Was relativ sein mag, denn Panama erstreckt sich auf dreiundsiebzig Kilometern zwischen den beiden beachtlichen Weltmeeren.
Unweit von hier strömen diese beiden Meere durch den sie verbindenden Wasserstreifen eines Kanals aufeinander zu und tragen so die seltsamsten Menschen und Waren quer durch dieses Land. In den riesigen Schleusen blicken die Matrosen fasziniert über die Relings. Es sind hübsche und bunte Menschen aus aller Herren Länder, die auf einer wässernen Spur von gut siebzig Kilometern für ein paar Stunden Panamas Gäste sind, bevor das nächste Weltmeer sie aufnimmt und sie darauf wieder ihrer Arbeit nachgehen.
Wer schon länger in diesem Land lebt, ist es gewohnt, unter Spannung zu existieren. Wer so alt ist wie Gerta, weiß, dass die Menschen hier an einem Morgen aufwachen und die Revolution ist da und macht aus der Regierungsbank binnen Stunden ein Trümmerfeld. Man entwickelt seine Tricks. „Ich wusste ja immer schon, wenn etwas passieren wird!“, sagte Gerta in einem Nebensatz später einmal zu mir. Dann erst begriff ich: All die Politikergattinnen hatten seit Jahrzehnten in ihrem Kosmetikstuhl gesessen. Wem, wenn nicht dem Friseur und der Kosmetikerin, wollten sie ihr Leid klagen in diesem oft sehr korrupten Staat, wenn der eigene Mann wieder einmal seinen Rang und Namen durch eine am Horizont heraufdräuende Revolte verteidigen musste und Villa, Pool und Reputation sich schnell dem Abgrund näherten?
Dass Señora Gerta bis ins Grab über die Details schweigen würde, wussten sie. Heute sind sie längst tot, und nicht einmal die Revolutionen in Mittelamerika sind noch das, was sie einmal waren. Sie geschehen heute virtuell und lösen andere Erdbeben aus als jene, die man von früher kannte auf diesem schmalen Streifen Land, der flankiert von den Ozeanen Süd- von Nordamerika trennt und Arm und Reich nur binnen eines Straßenzuges. Die Revolutionen zetteln heute die Whistleblower an, und Akten tauchen auf Wolken auf, die mehr als nur den Schein des pazifischen Lichtes haben, denn ganze Diktatoren- und Verbrecherdynastien nutzen Häfen fern des Kanals, die einzig ihrem Kapital dienen.
Gerta mag eine elegante Dame aus dem Wien des letzten Jahrhunderts sein, aber in manchen Dingen ist sie immer noch das It-Girl, das sie früher einmal war. Der Lack auf ihren Fingernägeln: immer der neueste Hit.
An diesem Tag trugen sie eine milde, herrlich milchige Farbe, die irgendein schlauer Mensch in den Fashion-Zentralen nude genannt hatte. Nude, wie nackt, wie offen, wie direkt vor uns auf dem Tisch liegend. Gertas Hände erzählen auch deshalb so viel, weil elegante Goldringe sie zieren, feine, gut gearbeitete Goldreife mit Edelsteinen und Brillanten, die von vorzüglichem Handwerk zeugen und einer großen Liebe. Seltsam, nach diesen Ringen habe ich Gerta bei all unseren Begegnungen nie gefragt. Wir haben uns oft gesehen seit diesem Tag in Panama im Mai. Immer wenn ich auf Gertas Hände schaue, sehe ich auch Moses Stern. Moses, den Juwelenhändler aus dem fernen Wien, der deshalb Juwelenhändler wurde, weil in den Vierzigerjahren ein europäischer Profifußballer im fernen Panama so ziemlich das Exotischste war, was man sich denken konnte.
Aber wo, wenn nicht auf fremden Kontinenten, erfinden sich die Menschen neu, frei von allen Erwartungen und alten Visionen. Was wird gebraucht? Was kann ich? Wer sich und sein Leben von Grund auf neu gestalten und definieren muss, dem sind keine Branche und kein neues Handwerk fremd genug. Denn der Wille zu leben ist immer stärker, und Moses Sterns Lebenswille war sehr groß, nachdem seine Frau ihn erst einmal aus den Händen der brutalen Nationalsozialisten befreit hatte. Moses wusste wahrscheinlich spätestens zu jenem Zeitpunkt, dass er ihr fortan nie auch nur einen Wunsch verwehren würde, denn sie hatte ihn und seinen geliebten Bruder gerettet und grenzenlos unerschrocken dabei ihr eigenes Leben mehr als einmal aufs Spiel gesetzt. Sie hatte tatsächlich gespielt, denn dies konnte nur einer wie Gerta gelingen, die von Kindertagen an Schauspielerin im alten Wien gewesen war. Und damals hatte das Schicksal sie zur Rolle ihres Lebens herausgefordert.
Dabei war seinerzeit, im Jahr 1938, gerade eine frischgebackene Kosmetikerin aus ihr geworden. Sie war nach Wien zurückgekehrt, hatte Moses geheiratet, und wäre nicht ihre gesamte Existenz durcheinandergewirbelt worden, wer weiß, was aus Gerta geworden wäre? Schließlich hatte sie, die selbst aus einer prominenten Familie stammte, einen der bekanntesten Fußballer im Wien der Dreißigerjahre geheiratet.
Dass das größte Abenteuer ihres Lebens noch vor ihnen läge, ahnten weder Sigi noch Moses oder gar Gerta.
Heute leben Moses, Sigi und auch ihre Tochter Terry, die den Sterns in Panama später geschenkt worden war, nicht mehr.
Nur Gerta ist noch da. Sie und ihre Freundinnen, die noch immer feiern. Mittwochs beim Bridge und freitags beim Shabbes-Dinner und auch sonst, wenn sich die Gelegenheit ergibt und sie ihr Leben in tropischer Luft förmlich umarmen. Weil sie noch da sind, trotz allem, und weil es ganz selten passiert, dass Menschen aus dem Schleudergang, in den sie das Leben schickt, aufrechter als zuvor wieder hervortreten.
So ein Mensch ist Gerta.
Dies ist ihre Geschichte.
Kapitel 1
Panama City. Ein Abend im Mai des Jahres 2015. Es dämmert. Am Ende der Avenida Ecuador, steht an einer Palmenallee ein Jugendstilgebäude. Der Festsaal der Handelskammer von Panama. Vor dem Portal treffen elegante Limousinen ein.
Eine nach der anderen halten sie vor den marmornen Treppen des Portals und spucken im Minutentakt Herren in Smokings und Damen in eleganten Roben aus. Ein Diener in Livree empfängt die Gäste und geleitet einige der Herrschaften die hohen Stufen des Eingangsbereiches hinauf. Der oberste Rabbiner ist soeben in einem alten Chrysler eingetroffen. Er hält sich die Kippa auf dem Scheitelpunkt seines üppig gewellten Haares fest. Ein starker Abendwind lässt die tropische Hitze des Tages vergessen und hat seine Kopfbedeckung erfasst. Der Himmel über dem weiß getünchten Gebäude im Kolonialstil verdunkelt sich schlagartig.
Alles war schon immer ein wenig dramatischer an diesem Ort, den Goldräuber einst erbauten, weil sie, die Konquistadoren, ferne Inkareiche plündern wollten und einen genialen Verbindungsweg gefunden zu haben glaubten. Hier, an der schmalen Taille des Kontinents, wo die ausschweifenden Weiten des Nordens sich zunächst, in Lateinamerika übergehend, verengen und den breiten Kontinentteil des Südens an diesem schmalen Bändchen Land berühren. Geologisch weist Panama, das lange nur eine Provinz Kolumbiens war, ein weiteres Phänomen auf, das klingt wie eine seltsame Krankheit, mindestens aber wie ein Schluckauf. Wenn Geologen von einer Landverengung inmitten dieses Kontinents, den dieses schmale Bändchen Erde zusammenhält, sprechen, dann nennen sie es Isthmus. Ein Isthmus ist eine Landenge, die ein Durchkommen gewährt, im Falle Panamas an dem Punkt, an dem heute der berühmte Kanal fließt. Er wurde von Menschenhand erschaffen, war jedoch als geologische Formation mit einem angedeuteten Flussbett schon von der Erde selbst als dieses Wasserwunderwerk angelegt, aus dem sich derart viel speist für Panama.
Die Formation, die es möglich machte, entstand hier schon vor Jahrmillionen. Sie erstreckte sich von den Bergen nach Osten und formte eine schmale Verbindung, die das Rückgrat des Landes bildet, das sich wie ein fester Grat einmal quer durch das Land zieht. Genau dort, wo heute auf dem Isthmus der Kanal fließt, überquert ihn an der Bruchstelle des Kontinents nur eine waghalsige Brücke und bildet für die Reisenden auf der sogenannten Panamericana-Route den Übergang nach Südamerika. Erst im Süden Panamas wird diese Straße jäh unterbrochen, wie sonst auf keinem anderen Stück der asphaltierten Piste von Alaska bis nach Feuerland.
Von alldem träumte vor mehr als fünfhundert Jahren ein verlorener Sohn aus verarmt-adeligem, galizischem Hause, der einen Hügel erklomm und als erster weißer Mann vom höchsten Punkt aus an der Landenge den atlantischen und gleichzeitig den pazifischen Ozean erblickte. „Schreibt dies nieder!“, soll er gerufen haben und befahl die anderen sechsundsechzig, die ihn begleiteten, erst danach zu sich auf den Berg. Dieses Schlitzohr wollte nämlich nichts so sehr, wie berühmt und reich zu werden, und erkannte die Chance, seinen Namen an diesem Ort für die Nachwelt zu erhalten. Vasco Núñez de Balboa, ein bärtiger Spanier mit übergroßer Nase, hinterließ dabei eine Spur aus Blut und Niederschlagungen im späteren Panama. An seiner Seite trabte dabei sein Bluthund, der ihn überallhin begleitete. Er galt als eine Bestie, die mit weiteren Bluthunden den Weg der europäischen Eroberer im Dschungel von gefährlichen Tieren frei machte. Oft wurden diese Hunde auch zu blutigen Gemetzeln gegen die Ureinwohner eingesetzt, die sich staunend den ersten Weißen auf dem Kontinent entgegenstellen wollten.
Mehr die Habgier trieb diesen Mann als seine Entdeckerlust.
Núñez de Balboa war ein Rastloser, einer, der aus dem fernen Spanien kommend sein Glück in der Karibik nicht finden konnte. Einer jener Verschlagenen, die sich vom zurückgekehrten Kolumbus hatten blenden lassen, als er aus Amerika (das er zunächst für Indien hielt) zurück nach Spanien gegangen war. Triumphierend prahlte der Entdecker dort mit Gold aus fernen Kolonien und eigenartigen Tieren aus der „Neuen Welt“, die er stolz mit sich führte. Er zog mit Kokosnüssen, Tabak, Tapiren und Papageien durch die großen Städte. Die Menschen jubelten ihm zu, denn so einer war mutig ins Ungewisse aufgebrochen, und sie staunten bei seiner zirkushaften Vorstellung, bei der er die fremdartigen Geschöpfe zeigte und noch dazu ganz und gar fremde Waren, die einen neuen Genuss versprachen. Dieser beglückend und aufrüttelnd wirkende Kult um Kolumbus muss etwas in dem damals schon durchtriebenen Balboa ausgelöst haben, dem in Spanien die rechte Bestimmung zu fehlen schien.
Viele der Männer, die es wie ihn ins neu entdeckte Amerika zog, hatten nichts mehr zu verlieren, sie waren Gescheiterte und sahen in den Goldvorkommen in der Ferne die Chance, dem Leben zu entkommen, das sie zu Hause führten. Vielleicht wollten sie auch nur den Menschen ihrer Heimat entkommen und sich und ihnen in der Ferne etwas beweisen?
So einer war Núñez de Balboa, ein Spieler, Zocker, Schweinezüchter aus Not. Viele, darunter auch Balboa, stiegen gleich an der ersten Insel aus, und in Hispaniola, der späteren Dominikanischen Republik und Haiti, schlug sich ein Gouverneur mit ihnen herum, denn schnell war klar, dass diese skrupellosen Outlaws seiner Insel nichts als Unheil brachten und ihre kriminelle Energie die hiesigen Gefängnisse füllte.
So dachte sich der Gouverneur von Hispaniola einen wunderbaren Trick für sie aus. Jeder der hier Angelandeten erhielt ein Stückchen Land, siebzig Sklaven, Saatgut und Tiere und wurde so zum Farmerdasein gezwungen. Sie saßen auf der Insel fest, kamen nicht fort, auch die nicht, deren Ziel die ferne Stadt „El Dorado“ war, ein verheißungsvoller Ort voller Gold. Es war nicht mehr als ein Mythos, den die, die zurück aus dem Süden Amerikas kamen, zunehmend befeuerten. Niemand konnte sagen, ob dieser geheimnisvolle Ort nur eine Fantasie war. Die, die den fremden Kontinent mit aller Macht eroberten, brachten immer mehr von dem glänzenden Metall zurück, schnell erkannten sie seine Kostbarkeit, und das lockte viele Halbseidene auf abenteuerliche Pfade, die sie gleich um ihr Leben bringen oder mindestens genauso schnell sehr reich machen konnten.
So saß Balboa, der eigentlich dem Ruf des Goldes gefolgt war, zwischen Schweinen und Zuckerrohr auf seiner Farm fest, die er sich keineswegs ausgesucht hatte, und an ein Fortkommen war nicht zu denken. Wieder einmal war Balboa pleite. Also kam ihm ein Schiff gerade recht, das Hispaniola auf dem Weg in die Kolonie „terra firma“ passieren sollte, die genau dort lag, wo man das Gold gesichtet hatte.
In Hispaniola meinte man es allerdings ernst damit, die Abtrünnigen zu sozialisieren. Die Landwirte wider Willen wurden nicht aus ihrer Pflicht entlassen, denn sie hatten Schulden auf der Insel und sollten sich erst einmal durch ihre Arbeit auf dem Land bewähren. Das angekündigte Schiff durfte nicht einmal den Hafen von San Domingo anlaufen. Draußen, weit vor den Mauern der Stadt, ankerte es. Balboa erdachte daraufhin einen sagenhaften Trick, versteckte sich in einer Kiste und schaffte es darin an Bord. Nur sein Bluthund war bei ihm, bewachte ihn und die Kiste, in der er steckte. Das Tier wich ihm nicht von der Seite. Zu wem der seltsame Hund gehöre, soll die Mannschaft gefragt haben, so Stefan Zweig später in seinen „Sternstunden der Menschheit“, die er im brasilianischen Exil verfasste.
Mit einer Mischung aus Trotz, Verzweiflung und Abenteuerlust spült es also vor mehr als fünfhundert Jahren Núñez de Balboa durch seinen Trick näher an den Ort, zu dem er eigentlich aufgebrochen ist. Erst auf hoher See kommt der Inhalt der Kiste zum Vorschein. Es ist zu spät, den blinden Passagier an Land zurückzubringen. Noch an Bord reißt er das Kommando an sich, lenkt das Schiff an einen anderen Ort, als die Mannschaft erfährt, dass terra firma von einer Epidemie heimgesucht und zerstört wurde, und sie landen vor der Küste Panamas.
Die Ureinwohner dort haben Gold, Balboa folgt der Spur des Edelmetalls, und auch an Land zettelt der Rastlose wieder eine Revolte an. Diesmal verläuft sie ohne großen Widerstand, denn der dortige Gouverneur ist verschollen. Der Urwald hier ist derart dicht, die fremden Gestalten, die seit Ewigkeiten dort leben, scheinen derart trickreich, da passiert es oft, dass Menschen einfach verschwinden. Manchmal auch nur, weil sie einem Riesenkrokodil begegnet und nicht rechtzeitig davongekommen sind.
So reißt Balboa kurzerhand die Macht an sich und zieht weiter der Spur des Goldes folgend nach Südwesten, brutal alle niederschlagend, die sich ihm, den Bluthunden und seinen Männern in den Weg stellen. Auf der anderen Seite dieses Landes, das so schmal ist, dass sie es durchwandern können, sollen angeblich die Schätze und ein unentdeckter Ozean liegen. Wenn er die andere Küste erreicht und von dort nur ein paar Tage südlich segele, hört er von den wenigen Ureinwohnern, die sie nicht töten, lande er im Paradies. Dort soll es Gold geben in einer heiligen Stadt in einem hohen Gebirge, und das Reich heißt Birú. Es handelt sich um das spätere Peru.
Tatsächlich verbündet Balboa sich auf dem Weg zum anderen Ozean inmitten der Wildnis mit einem Stammeshäuptling und heiratet sogar dessen Tochter.
Das Klima macht den Konquistadoren zu schaffen. Die brütende Hitze lastet schwer auf ihnen, immer wieder gehen heftige, ganz plötzliche Regenschauer auf sie hernieder und reißen die Wege ein, die sie sich eben noch mit der Machete durchs dichte Grün geschlagen hatten. Die Luftfeuchtigkeit der panamaischen Tropen ist kaum auszuhalten, sie zersetzt sogar ihre Kleidung. Im dichten Dschungel begegnen ihnen zudem Tiere, deren Anblick nicht immer so erfrischend ist wie der der Tukane mit ihrem bunten Gefieder und ihren übergroßen, bizarren Schnäbeln. Während im Mangrovensumpf die Gürteltiere und giftigen Schlangen neben riesigen Krokodilen umherkriechen, fliegen über den Köpfen der Eroberer Harpyien, sehr große, überaus kräftige Raubvögel, dank ihres erschreckenden Aussehens damals noch „Sturmdämonen“ genannt. Ihre Spannweiten von bis zu zweieinhalb Metern lassen sie so riesig erscheinen, dass diese Greife in manchen Mythen auch mit Frauenkörpern dargestellt wurden, aber den starken Eindruck, den das Tier auf die Eroberer machte, mag das Fieber der Tropen verstärkt haben.
Núñez de Balboa, der am 25. September 1513 auf dem berühmten Hügel landet und der mit aller Macht berühmt sein will, hat den Marsch zum Pazifik wohl nur gemacht, weil seine letzte Revolte nicht funktioniert hat. Er muss vor seinen Verfolgern fliehen und sieht in der Suche nach dem wichtigen Ort am Pazifik, von dem die Indigenen sprechen, seine letzte Chance, um sein Leben zu retten. Wenn er so berühmt ist, wer soll ihn dann schon töten wollen? Er setzt alles auf eine Karte.
Kurz nachdem er auf dem legendären Hügel die beiden Meere erblickt, setzen Balboa und seine Männer dort, wo heute Panama City liegt, den Fuß ins Meer. Sie hatten den Ort gefunden, von dem aus die spanische Krone die größten Schätze Südamerikas ins Königreich bringen sollte. Der fremde Ozean, der vor ihnen liegt, wird dafür kurzerhand für die Spanier konfisziert.
Der Isthmus zeigt ihnen den Weg, den sie später durch das Hinterland schlagen würden, um auf der karibischen Seite die Reichtümer an Bord der Schiffe und damit nach Europa zu bringen.
Der Ort, den sie am Rande des soeben eingenommenen Meeres finden, hieß bald schon Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.
Núñez de Balboa, der gefallene Sohn seines Landes, den die Habgier in die Ferne gelockt und mehrmals hatte scheitern lassen, wurde später vom spanischen König zum Kapitän der Provinzen Coiba und Panama ernannt und bald darauf zum Gouverneur der Südsee.
Von diesem Ort aus, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, stach er wieder in See. Seine gesellschaftliche Rehabilitation änderte nichts daran, dass er nur dreieinhalb Jahre später durch das Schwert eines Henkers sterben sollte, denn die Rache der neuen Machthaber der spanischen Krone war größer als sein eigener Einfluss.
Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, das später Panama la Vieja und heute Panama City heißt, wurde bald zu dem Dorado, das die Eroberer vor Augen hatten. Es wurde zur Drehscheibe für das geraubte Gold der Inkas, ebenso für die Silberschätze anderer Völker, und auch ein anderes wertvolles Gut wurde hier gehandelt, das später eine große Rolle spielen sollte: Sklaven.
Mit dem Reichtum kamen die Freibeuter aus der Südsee, die die Stadt immer wieder plünderten und abbrannten. Auch auf der anderen Seite des Kontinentalbruchs tobt in den Jahren darauf ein unerbittlicher Seekrieg. Sir Francis Drake plündert die Schätze dieser reichsten spanischen Kolonie, und auch er zerbricht zum Schluss daran. Wird er schlicht irre oder ist es der Rum? Am Ende seiner Tage schenkt der berühmte Freibeuter all das, was er in Panama erbeutete, der Kirche. Kurz darauf kommt er dort zu Tode, wo heute die karibische Einfahrt zum Panamakanal liegt. Seine Leiche wird hier, in der Nähe des Fort Lorenzo im Meer versenkt.
Auch Balboas Geist wirkt über seinen Tod hinaus. Er hat sich auf eine Art ins Gedächtnis der Menschen in diesem turbulenten, heute so modernen Staat gebrannt, wie er es sich als habgieriger Mensch nicht schöner hätte träumen lassen: Der Balboa wurde zur Währung Panamas. Er existiert gleichrangig mit dem US-Dollar, Kurs 1:1. Scheine gibt es nicht.
An diesem Ort, der Glücksritter und Händler stets gleichermaßen anzog, liegt noch immer eine eigenartige Energie in der Luft. Panama pulsiert, wenn nicht gerade die Staus die Menschen auf der Straße zum zeitweiligen Stillstand verdammen. Die Staus sind das Einzige, was hier jeden Morgen mit Gewissheit vorausgesagt werden kann.
„Mein Leben war immer aufregend“, sagt die Frau, die einen sehr ausgefüllten Terminkalender hat und die vor Kurzem erst ihren Führerschein abgab. Señora Gerta fuhr mit einer traumwandlerischen Kenntnis all der kleinen Abkürzungsstraßen, um dem Stillstand der Staus von Panama City zu entgehen. Señora Gerta fuhr noch Auto bis sie neunundneunzig Jahre alt war, also bis vor Kurzem. „Schneller und besser als jeder andere“, sagen die, die sie kennen. Das war auch der Tatsache zu verdanken, dass sie da noch alle für vierundachtzig hielten und erst neuerdings ihr wahres Alter kennen. Und mit neunundneunzig noch fahren? Das erschien endgültig „crazy“, wie man hier selbst im Spanischen sagt, „loco“ oder „crazy“, denn nach den Spaniern kamen die Amerikaner und nahmen dieses Nest am Pazifik ein, das zur Millionenmetropole anwuchs und dessen Häuser bis heute immer weiter in die Höhe schießen. Señora Gertas kleine Lüge ist allerdings erst später dran. Jetzt herrscht hier die „blaue Stunde“, und sicher wusste der Rabbiner, der heute der Zeremonie beiwohnt, darüber Bescheid, dass die alte Kosmetikerin weit älter ist, als sie scheint.
In der lateinamerikanischen Millionenmetropole am Pazifik herrscht die blaue, die eher eine leuchtend violette Stunde ist, wenn das milde Licht des Ozeans durch bizarre Regenwolken scheint. In diesem Jahr ist die Regenzeit sehr früh gekommen. In den Pfützen, die sich vor der alten Handelskammer bilden, spiegelt sich ein Pelikanschwarm. Am Abend kehren die erhabenen Segler mit Schnäbeln voller Fische aus den Gründen des Pazifiks zurück an Land. Nicht weit von hier fließt besagter Panamakanal, die zweitgrößte Einnahmequelle des Landes, in den Ozean. Einzig Panamas Banken sind lukrativer als dieser Kanal, in dem ein Durchschnittsschiff um vierzigtausend Dollar am Ende der Passage ärmer ist. Kreuzfahrtschiffe kommen fast auf hunderttausend Dollar Gebühr, wenn sie über Stunden verlangsamt durch die Schleusen schippern.
Weißer Asphalt zieht sich als opulente Prachtstraße direkt am Ufer entlang. Auf acht Spuren entfernen sich die beiden Straßenseiten an manchen Stellen voneinander und geben einen breiten Grünstreifen in der Mitte frei. Darauf liegen Park- und Sportplätze. Brücken überqueren die Avenida von der Innenstadt zum Strand, an dem die Jogger unter Palmen laufen, den Blick aufs Meer gewandt. Eisverkäufer mit ihren Wagen voller bunt gefärbter Gaumenfreuden in Kühlfahrrädern klingeln sich den Weg frei. Zuckerwatteverkäufer haben ihre Süßigkeiten zu aberwitzigen Türmen in die Höhe gestapelt und halten sie wie Zauberer an nur einem Stock in die Höhe. Im nahen Park jubelt eine Big Band, Paare flanieren verliebt am Strand entlang.
Der Blick fällt auf die in Beton gegossene Hauptstadtfront. Die edelsten Hotels der Stadt liegen hier und dahinter das Zentrum.
Der Reichtum der Prachtmeile wird deutlich durch den Jachtclub, an dessen Stegen die edelsten Boote liegen. Ein schwarz gekleideter Privatsheriff in strenger Uniform sitzt am Eingang, ein furchterregendes Gewehr quer dazu auf seinem Arm. Hier haben nur jene Zutritt, die sich einen Liegeplatz in beträchtlicher Dollargröße leisten können. Viele leben in den Hochhäusern gegenüber. Eines schicker als das nächste, Hilton und Philippe Starck. Hier sind die Häuser eigene Marken, und es ist kaum zu glauben, dass in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts nur flache, gerade mal dreistöckige Häuser auf der anderen Seite der Avenida Balboa standen. Die hatte zwei Fahrbahnen und war schon damals erstaunlich frequentiert.
Die mittelamerikanische Metropole steht im starken Kontrast zu den Mangrovensümpfen, die sie umgeben. Die Hälfte der Bevölkerung dieses Landes lebt heute in Panama City. Vier Millionen Menschen, viele unter ihnen, die die Sehnsucht nach einem besseren Leben in die Häuserschluchten trieb, deren Enden von kleinen Bungalows, aber auch von ärmeren Vierteln gesäumt sind, wo die Wäsche über den Geländern hängt und die Kinder in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft kicken oder klauen lernen. Fast alle der Multimillionen-Dollar-Türme am anderen Ende der Stadt sind abgesichert mit Wächtern, einige bis an die Zähne bewaffnet.
Dazwischen liegt die herrlich anzusehende Altstadt mit ihren kolonialen Zinnen, die viele an Havanna erinnert und die Weltkulturerbe wurde. An ihren alten Häusern mit den ausladenden Balkonen wird stetig gehämmert und gebaut. Das alte Erbe hübscht sich nicht so schnell auf wie die Türme des Kapitals, die einer nach dem anderen in die Höhe gebaut werden, ganz ohne jeden Stillstand. Panama gilt als das neue Shanghai.
Amerikanische Rentner erhalten sogar Subventionen, wenn sie sich hier zur Ruhe setzen. Für sie macht es das Leben in der ehemaligen US-Sonderwirtschaftszone dadurch um ein Drittel günstiger als daheim, in den Vereinigten Staaten. Jeder Pensionär Panamas zahlt für Kino, Theater und Hotels nur die Hälfte. Dies und viele Sonderrechte erhöhen die Quote der „Jubilados“ hier.
In diesem Frühsommer des Jahres 2015 ist die neue Regierung gerade mal ein Jahr alt. Niemand hatte gewusst, was sich ändern würde. Im Jahr darauf ist der Dollar noch immer stabil, eine kleine Insel, so groß wie drei Fußballplätze, ist als künstliches Eiland vor den Hochhäusern von Punta Pacifica inzwischen entstanden. Sie stellen neben dem Trump Tower die nördliche Spitze der hoch in den Himmel aufragenden Wohn- und Bürotürme dar und bieten mit ihren schicken Gated Communities ein höchstes Aufgebot an Sicherheit. Die meisten Häuser hier haben einen eigenen Steg und damit Zugang zum Meer und Appartements von fast tausend Quadratmetern. Dort, in den Garagen, die die unteren Ebenen der Hochhäuser (Keller hat niemand) füllen, stehen Bentleys neben Jaguar-Modellen, und die Insel, die in einem Jahr entstand, hat einen Hubschrauberlandeplatz erhalten, denn wer wirklich etwas auf sich hält, vergeudet keine Zeit. Bis zu zwei Stunden dauert es, je nach Verkehrslage, die fünfeinhalb Kilometer von hier aus bis zum anderen Ende der Avenida Balboa im Auto zurückzulegen, wenn die Hauptverkehrszeit angebrochen ist.
Aber auch die ist längst kein verlässliches Kriterium mehr, denn die Zeiten, in denen kein Stau ist, werden rar. Je mehr Menschen zu Geld kommen, das gilt auch für den Mittelstand, desto höher die Autodichte an diesem Ort, an dem sich zwischen Bussen und eigenen PKWs auch Arm und Reich trennen.
Im Jahr eins nach der neuen Regierung hat sich etwas Wesentliches verändert, und es schreit einen jeden Tag im Bellagio Tower an. Ein perfekter Ort für Fernwehkranke ist das. Direkt neben dem Bellagio Tower liegt der unfassbar weit wirkende Pazifik in seinem Grüntürkis, aus dem zweiundzwanzigsten Stock fällt der Blick auf die Ausfahrt des Panamakanals weiter im Süden, da, wo die Isla Taboga sich in der Ferne aus dem Wasser erhebt. Oder sollte ich lieber sagen: „die Einfahrt“?
Auch dort staut sich der Schiffsverkehr, als sei das Rückgrat des Landes etwas so Profanes wie eine Autowaschanlage an einem Samstagnachmittag. Tanker, kleine Segeljachten, riesige Containerschiffe, die aus dem Pazifik kreuzend in einer deutlich sichtbaren Schlange den Horizont füllen. Jede Stunde ändert sich diese Schiffsparade wie auf einer Linie aufgereiht zwischen der Isla Taboga und der Kanaleinfahrt. Es ist, als schwimme die ganze Welt am Betrachter vorbei. Direkt hier, an der Spitze Punta Pacificas, treffen altes und neues Panama in einem krassen Gegensatz aufeinander, wie an vielen Orten dieser Stadt. Abends, wenn die alten, bunten Fischerboote mit ihren vollen Netzen zurück in die Bucht von Panama City kommen, kreuzen über ihnen Hubschrauber, die auf der künstlichen Insel vor den Towern Menschen zu einem Tennismatch auf dem dort angesiedelten Platz mit Meerblick absetzen.
Ein paar Stockwerke weiter unten offenbart sich ein anderes typisches Phänomen Panamas. „Das ist hier alle paar Jahre so“, erzählt ein deutscher Manager, der schon länger in Panama lebt, auf einer Party. Ein früherer Minister, der dort wohnt, steht unter Hausarrest. Wer im gläsernen Aufzug den Tower hinab zum Pool oder zur Garage rauscht, sieht in jenem Stockwerk vor einer prunkvollen Tür aus altem, kostbarem Tropenholz drei Polizisten neben Orchideen im Entree sitzen und Wache schieben, rund um die Uhr.
Der früher noch so wichtige Mann darf sein Appartement nicht verlassen. Hinter der Edelholztür verbergen sich allerdings eintausendvierhundert Quadratmeter Wohnung. Eine Wohnung ein paar Etagen höher gehört, wie zu vernehmen ist, einem international tätigen Organhändler. Auch das ist Panama.
Jede Regierung Panamas scheint mit der Vorgängerregierung abzurechnen. Präsident Martinelli, der im Jahr zuvor abgewählt worden war, hinterließ ein paar Löcher im Haushalt des Landes, dessen Wirtschaft floriert. Ausgerechnet der Minister für Soziale Entwicklung soll sich um zwanzig Millionen Dollar bereichert haben, der Minister des Nationalen Unterstützungsprogramms angeblich um fünfundzwanzig Millionen. Ein Richter des Obersten Gerichtshofes ist inzwischen ebenfalls kaltgestellt und unter Hausarrest. Seine vermeintliche persönliche Bereicherung im einstelligen Millionen-Dollar-Bereich wirkt da fast schon wie eine Petitesse.
Es heißt, die alte Regierung habe Großaufträge an Unternehmen vergeben, die einen erheblichen Teil des Auftragswertes in Bargeld zurückzahlten. Da diese Barmittel aus den Vorauszahlungen der Regierung für die Aufträge geflossen sein sollen und schon vor Beginn von Bautätigkeiten wieder in die Kassen diverser Regierungsbeamter zurück, sind die Spuren des Geldes nicht immer offensichtlich.
Gleichzeitig hat die Regierung Martinelli viele Entwicklungsprojekte des Landes realisiert und dem Land auch Fortschritt und Aufstieg gebracht. Vielleicht ist ein Teil der „Rückzahlungen“ an hohe Regierungsbeamte schon ein vorgeleistetes Schmerzensgeld gewesen, denn auch wenn die Minister und hohen Beamten der letzten Regierung nun mit Vorwürfen und Anklagen belastet werden, schützt jeden panamaischen Präsidenten nach seiner Amtsenthebung eine fünfjährige Immunität, bevor auch gegen ihn ermittelt werden darf.
Panama ist offenbar noch immer ein Ort der Vertuschung. Betrachtet man den Flughafen Tocumen, an dem wie von Zauberhand immer wieder ein neuer Terminalteil entsteht, kann man nur feststellen, dass der Flugverkehr und die Gelder offensichtlich so elegant fließen wie die Avenida Balboa die paar Kilometer am Strand entlang in beide Richtungen. Ebenso wie dort treffen auch im Flugverkehr die sozialen Klassen aufeinander. Hier fliegen die venezolanischen Hausmädchen oder spanischen Händler neben den internationalen Managern ein, so, wie die Eisverkäufer am Strand oder die indigenen Kuna-Yala-Frauen, die dort ihren kunstvoll gewebten Perlenschmuck feilbieten, oftmals nur Meter von den russischen Oligarchen und deren Jachten entfernt. Manche nämlich liegen hier, gut drei Kilometer von Punta Pacifica, an der Avenida Balboa. Dort ist der Jachthafen derer, die nicht die Lust aufs Meer beschleicht und die deshalb weiter südlich an den Balboa Docks vor Anker gehen. Oder auf der anderen Seite der Bucht, in einem eigens für Segler organisierten Hafen, wo sich die sportlichen Trans-Pazifik-Segler zeitweilig ausruhen, bevor sie den Panamakanal in Richtung Karibik passieren. Hier, an der achtspurigen Prachtstraße mit den vielen Palmen, liegen die Angeberboote vor Anker, auf denen die CEOs internationaler Firmen zum Picknick auf dem Meer am Sonntag laden oder für ihre Geschäftsgäste zum Hochseefischen ein paar Stunden in den Pazifik stechen.
In diesem Monat, im Mai des Jahres 2015, liegen auch ein paar schicke Schiffe reicher Amerikaner im Jachtclub. Noch ist die Lage unverdächtig. Manchmal sitzen alte Geier auf einer der Laternen, mitten in der Stadt mit Blick auf genau diesen Jachthafen. Wer ahnt zu dem Zeitpunkt schon, dass es das perfekte Bild sein würde für die sogenannten Panama Papers oder Leaks, die nur acht Monate später ans Licht der Öffentlichkeit dringen. Ein Whistleblower hatte die gesamte Kundendatei einer international agierenden Anwaltskanzlei, die hier Kapital im ganz großen Stil in anonymisierte Briefkastenfirmen verschob, öffentlich gemacht und damit einen internationalen Skandal ausgelöst, denn wenn Panama neben Gerüchten aus der Upper Class mit viel Money bis dahin etwas wirklich ausmachte, dann war es seine vollkommene Verschwiegenheit.
Der Skandal im Jahr darauf ist auch deshalb ein Skandal, weil die Dimension der Kapitalflüsse selbst die Vorstellungskraft fantasiebegabter Menschen sprengt. Hunderttausende von Briefkastenfirmen betreibt die Mossack Fonseca, deren Geschäftsgeheimnisse nach den Leaks als Panama Papers von einem internationalen Journalistenkonsortium veröffentlicht wurden, und die Spuren führen von Panama aus in die ganze Welt. Die alte Freibeutermentalität scheint noch immer zu herrschen. Dass Panama heute mit diesen Papers verbunden wird, ringt den hier lebenden Menschen auch jetzt nur ein müdes Kopfschütteln ab. „So war es doch immer schon“, heißt es, und natürlich ist diese Kanzlei, die Waffengelder und Unversteuertes als Stiftungen oder in geschickten Kapitalflüssen tarnt, nur eine von vielen.
An einem dieser Frühsommertage stehen wir im Stau ausgerechnet vor der verspiegelten Fassade des Hauses, in dem sich Mossack Fonseca befindet. Draußen regnet es wie aus Eimern, ein heftiger Monsunregen geht nieder, und vor der Fassade dieses Gebäudes läuft eine Frau eiligen Schrittes in das Gebäude hinein. Der Anblick hat durch die Regentropfen auf der Scheibe des Wagens und die Geschwindigkeit der rennenden Frau etwas ganz Eigenes. Die Dame trug goldene Sandalen, ihre Gestalt war leicht verwischt, eine elegante Frau mit goldenen Schuhen, die in das Gebäude hineinhetzte. Für mich toppt es noch den Anblick der Geier mit dem Blick auf die Oligarchen-Jacht am Strand der Avenida Balboa. Die Oligarchen schippern weiter, die Frauen mit den goldenen Schuhen rennen längst in andere Kanzleien, weil dieses Land genug Menschen auf Vorrat hat, die sich als vermeintliche Briefkastenfirmen-Besitzer einspannen lassen, weil sie wissen, hier in Panama City können sie es schaffen, aus der totalen Armut der Mangrovensümpfe vor den Toren der Metropole mit ihrer Skyline zu entkommen.
Und so spiegelt auch Gerta Stern, die Frau, die an jenem Abend im Mai 2015 im Innern des weiß getünchten Gebäudes gefeiert wird, einen Teil der Geschichte dieses Staates wider, der seit seiner Gründung so viele Revolutionäre und Glücksritter kommen und gehen sah. Auch sie entkam hierher, aber aus einem ganz anderen Grund. Wenn die Panama Papers auch viele Menschen in ihrem Glauben an dieses alte Piratennest am Pazifik eine Weile lang zu erschüttern vermögen, es werden andere kommen und sich wieder neu erfinden.
Natürlich sind bei Weitem nicht alle, die in Panama landen, von krimineller Energie getrieben. So wie heute zahlreiche Studenten aus dem schrecklich armen Venezuela an der Universität studieren und wissen, sie finden genug Arbeit in Panama City, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, hat auch das jüdische Leben auf diesem verrückten Flecken Erde schon mit den Judenpogromen des späten 19. Jahrhunderts hier eingesetzt. Mit den Spaniern und Portugiesen siedelten sich die ersten jüdischen Kaufleute an, und mit dem Bau des Panamakanals kam die nächste Welle jüdischer Einwanderer. Ihre Mischung ist sonst so wohl nur in Israel zu beobachten, denn durch die Spanier waren es sephardische Juden, die die arabische, nordafrikanische Kultur irgendwann ausspuckte, und mit der ersten großen Auswanderungswelle kamen die aschkenasischen Juden aus der Bukowina und aus den Schtetln Ost- und Mitteleuropas damals nach Panama. Anders als in ihrer Heimat fanden sie hier ein reformiertes Judentum vor.
Die Gemeinde, die Gerta, die frisch gekürte Ehrenbürgerin der Stadt, einst aufnahm, hat sich schon 1876 gegründet. Kol Shearith Israel spiegelt heute das Reformjudentum. Panama City ist aber auch bevölkert von orthodoxen Juden und neben den reformierten zudem von jenen, die selten in die Synagoge gehen. Es gibt sechs Synagogen. Das ist ein Stück jüdischer Identität in Mittelamerika, die man als Europäer nicht erwartet. Gerta Stern blieb, nachdem dieses Streiflein Erde zwischen den Meeren ihr zur Rettung aus dem finsteren Europa wurde, für immer.
Politiker, Diplomaten, wichtige Künstlerinnen und Vertreter panamaischer und österreichischer Kultur sind an diesem Abend zusammengekommen, um Señora Gertas Ernennung zur Ehrenbürgerin zu feiern. Sie ist mit neunundneunzig Jahren die frischeste, wenn auch nicht die jüngste Ehrenbürgerin der Stadt. Kaum eine halbe Stunde nachdem die Gäste ihre Schirme abgegeben haben, sitzen sie in zwanzig Stuhlreihen vor dem Rednerpult.
Der Bürgermeister der Metropole am Pazifik, José Blandón, hat seine Rede gerade erst begonnen. Vom Podium herab spricht er vom Aufstieg der Stadt, vom Gelingen und dem aktuellen, positiven Wandel durch die neue Regierung. Wie oft er das wohl in seinem Bürgermeisterleben noch sagen wird? Die Regierungswechsel sind hier in etwa so sicher wie der mal früher, mal später einsetzende Regen zu dieser Zeit des Jahres. Blandón hat kaum fünf Minuten gesprochen, als er die Anwesenden bittet aufzustehen. Seine rechte Hand kreuzt die Brust vor der grauen Anzugjacke. Er legt sie flach aufs Herz. Die Versammelten tun es ihm gleich. Bürgermeister Blandón ergreift nun mit seiner anderen Hand das Stoffende einer der Landesflaggen, die neben ihm stehen. Fest umklammert er den Samt, während die Melodie der Nationalhymne erklingt.
Gerta Stern steht in der ersten Reihe. Sie muss sich an den Stuhllehnen stützen, um sich zu erheben, aber dann merkt man ihrem Körper die Spannkraft der ehemaligen Schauspielerin an, und wenn Gerta eines gut kann, dann das: Zu wissen, wann „Showtime“ ist, sie hat die perfekte Präsenz eines Menschen, der das Rampenlicht kennt, und knipst diese Präsenz von einer Minute zur anderen perfekt an.
Aus den hinteren Reihen ist ein heiseres Räuspern zu vernehmen. Die Hauttöne der Gäste hier haben alle möglichen Schattierungen. Kaum eine Metropole auf dem amerikanischen Kontinent vereint ein solches Völkergemisch wie Panama City. Alle Ethnien leben friedlich vereint miteinander.
Dass Chinesen, Afrikaner und Karibikbewohner neben Weißen und Südamerikanern in Panama landeten, hat vor allem mit dem Bau des Kanals vor hundert Jahren zu tun. Nicht alle Einwanderer kamen freiwillig, viele der dunklen Hauttöne stammen von Sklaven, die einst die schwere Arbeit schon unter den Konquistadoren leisten mussten. Später, nach dem Bau des Kanals, blieben viele Menschen, die es ursprünglich auf die andere Seite des Pazifiks zog, einfach hier. Der Goldrausch im Nordwesten Amerikas geriet beim Anblick weiter Palmenhaine und ob der Arbeit, die sich ihnen in Panama bot, schnell in Vergessenheit. Menschen blieben, vollkommen überrascht von den Möglichkeiten, die sich ihnen im Land der tausend Inseln boten.
In der alten Handelskammer der panamaischen Hauptstadt singen alle im Saal Anwesenden inbrünstig die zackig klingende Hymne ihres Landes. Ein Blasorchester begleitet die Melodieführung. Strenge und Stolz zeichnen sich auf den Gesichtern der Versammelten ab.
So reich die Kulturen und verschiedenen Herkünfte der Menschen hier gewesen sein mögen, so eint sie doch die Identität als Panameños und Panameñas. Für Gerta Stern gehört auch Dankbarkeit dazu. Die Dankbarkeit gegenüber der Gemeinde Kol Shearith, von der heute Abend Vertreter gekommen sind, aber auch die Dankbarkeit, dass sie und ihr Mann in diesem Land, zu dessen Kontinua die stete Instabilität gehört, ein sehr stabiles Leben fanden. Alle im Saal wissen, dass die alte Lady in der ersten Reihe eine Österreicherin ist. Gerta würde mich hier unterbrechen und sagen: „Eine Wienerin“ − und wenn sie es sagt, hat sie diesen schönen Wiener Akzent, der immer auch etwas Gemütliches ausstrahlt.
Neben Gerta in der ersten Reihe hat sich auch die österreichische Botschafterin erhoben, mit der sie eben noch in ihrem herrlich altmodisch klingenden Wienerisch parlierte. Da klingt jedes „r“ richtig, und jedes „s“ ist perfekt. Neben der Konsulin steht stolz singend ein Minister. Panamas Nationalhymne erzählt vom Kampf der Revolution und der Pracht der Natur dieses Landes. Sie preist den Fortschritt und die Einigkeit der Menschen. Fotografen springen beim Schlussakkord nach vorn und bilden die an diesem Abend versammelte Elite ab: Da sind die reichen Damen, deren Nasen auf den Fotos in der Zeitung am anderen Tag einander auf frappierende Weise ähneln. Die Schönheitschirurgie ist eine der bestflorierenden Branchen dieses Landes. Wie sollte sich eine Kosmetikerin da je zur Ruhe setzen wollen? Gerta Stern fährt zwar kein Auto mehr, aber sie praktiziert noch immer und ist vermutlich die älteste noch arbeitende Kosmetikerin der Welt.
Neben den straffgesichtigen Damen der Gesellschaft blicken ihre Begleiter stolz in die Kameras, Latinomänner älterer Semester mit Brillantine-Frisuren, darunter helle Nadelstreifen und blank polierte Lackschuhe, die den Pfützen draußen vor der Tür auf geschickte Weise entkommen sind.
Die kleine Frau in der ersten Reihe ist noch immer ein Ausbund purer Energie. Gerta Stern sticht auf dem Foto heraus, nicht nur weil sie nicht geliftet ist. Das ist auch bei den alten Damen, deren tatsächliche Lebensjahre man hier nur an Hals und Händen erahnt, eine Seltenheit. Gerta liebt die Kamera, und die Kamera liebt Gerta. Sobald ein Rotlicht blinkt, strafft sich ihr Körper. Da schimmert noch die einstige Ballett-Elevin durch, der die Haltung in Fleisch und Blut überging, selbst wenn die Beine heute nicht mehr so wollen.
Auf Gertas offenes Gesicht mit den vielen Fältchen hat sich an diesem Abend ein zarter Glanz gelegt. Die Fotos, die die Presse tags darauf veröffentlichen wird, zeigen hundertundfünfzig Bürgerinnen und Bürger von Panama sowie ein paar Diplomaten und Musikerinnen, deren ernste Blicke sich auf Oberbürgermeister Blandón richten. Nur die neue Ehrenbürgerin Panama Citys, diese kleine Frau, die in schwarzer Abendrobe mit Goldbrokat-Paspeln in der ersten Reihe steht, lächelt selig und blickt in eine andere Richtung. Gerta Stern denkt an Franz Lehár und Wien. „Dein ist mein ganzes Herz“, wird Diana Duran gleich vortragen, eine der wenigen klassischen Sängerinnen dieses Landes, ein junges, soeben erblühendes Talent. Señora Gerta schaut auf dem Foto in die andere Richtung, sie nickt dem Sopran aus der ersten Reihe voller Erwartung zu. Diana hat in Wien studiert. Irgendwann begegneten sie sich bei einem Konzert, und Señora Gerta fragte, woher sie denn die schönen Léhar-Lieder könne, die schon ihre Tante im Wien der Zwanzigerjahre gesungen hatte.
Mit Gerta werden an diesem Abend noch andere geehrt für ihr bürgerliches Engagement in diesem Land, in dieser Stadt. Aber dass je eine der Geehrten bei dem für sie angesetzten Liedvortrag laut mitsingen und in ein Duo mit einer lateinamerikanischen Soubrette einstimmt, das hat es hier so auch noch nicht gegeben. Gerta hört nicht auf, für Überraschungen zu sorgen, denn Wien und Panama, das beweist sie jeden Tag aufs Neue, passen eben doch ziemlich gut zusammen.





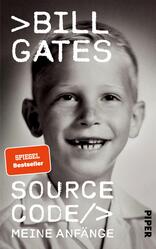
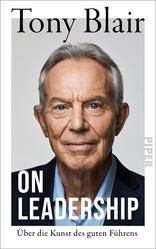

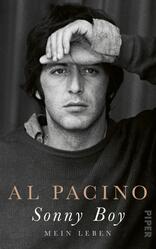





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.