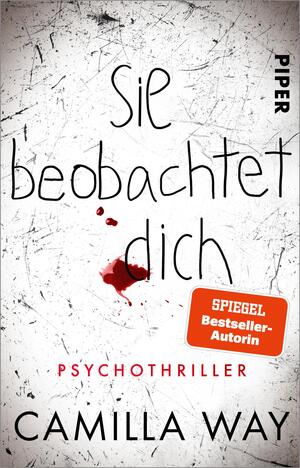
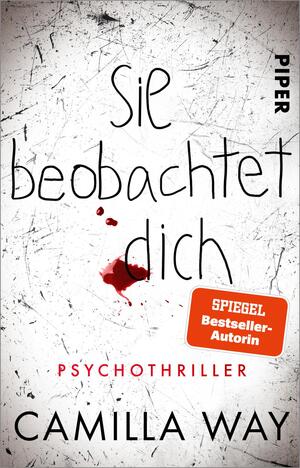
Sie beobachtet dich Sie beobachtet dich - eBook-Ausgabe
Psychothriller
— Für Fans von „Das Böse in ihr"„Diese Autorin schreibt phänomenal, erschafft eine bedrückende, unheilvolle Atmosphäre & baut trotzdem emotionalen Tiefgang mit ein. Das lässt ihre Psychothriller für mich zu etwas sehr besonderem werden.“ - lesebegeistert_
Sie beobachtet dich — Inhalt
Da war es wieder! Dieses Gesicht in der Menge, das Edie jedes Mal erschrocken und zitternd zurückließ. Sie blickte genauer zu der Frau, doch es war nicht Heather. War es nie. Und trotzdem fuhr ihr der Schreck in alle Glieder. Zurück in ihrer Londoner Wohnung dachte Edie wieder mal an die Zeit, als sie noch jung und voller Träume war. Bis zu dem Tag, als alles sich änderte und dunkler wurde. Plötzlich klingelt es an der Tür. Als Edie öffnet, muss sie sich am Türrahmen festklammern. Das kann nicht sein! „Hallo, Edie“, sagt Heather lächelnd und betritt die Wohnung.
Leseprobe zu „Sie beobachtet dich“
TEIL EINS
Danach
meinem Küchenfenster verblasst der lange Nachmittag. Ich schaue auf London, das sich unter mir ausbreitet, während ich die tropfenden Hände über das Spülbecken halte. Es klingelt an der Wohnungstür, ein langes, hohes Läuten; die kaputte Gegensprechanlage vibriert. Der Blick von hier oben ist unglaublich, fast so, als würde man fliegen. Deptford und Greenwich, New Cross und Erith, dann die Themse und jenseits davon die hoch aufragenden Fassaden des Gherkin und Shard. Aus meiner Wohnung auf dem Telegraph Hill im obersten Stockwerk des [...]
TEIL EINS
Danach
meinem Küchenfenster verblasst der lange Nachmittag. Ich schaue auf London, das sich unter mir ausbreitet, während ich die tropfenden Hände über das Spülbecken halte. Es klingelt an der Wohnungstür, ein langes, hohes Läuten; die kaputte Gegensprechanlage vibriert. Der Blick von hier oben ist unglaublich, fast so, als würde man fliegen. Deptford und Greenwich, New Cross und Erith, dann die Themse und jenseits davon die hoch aufragenden Fassaden des Gherkin und Shard. Aus meiner Wohnung auf dem Telegraph Hill im obersten Stockwerk des Hauses sieht man unendlich weit. Wie immer beruhigt und besänftigt mich dieser Anblick: Wie groß doch alles ist, wie klein ich dagegen selbst bin, wie weit entfernt von allem, was früher war.
Die Türklingel ertönt jetzt dringlicher – jemand drückt unablässig auf den Knopf. Es wird schon Abend.
Anfangs habe ich Heather überall gesehen. Connor natürlich auch. Ich sah sie oder ihn flüchtig aus den Augenwinkeln, und dann spürte ich diesen scharfen, eisigen Ruck. Auch nachdem ich begriffen hatte, dass es nur eine Illusion gewesen war, jemand mit ähnlichen Haaren, einem gleichartigen Gang, war ich noch lange zittrig, und mir war flau im Magen. Immer wenn das geschah, flüchtete ich an einen belebten Ort, um mich in der Menschenmenge zu verlieren. Ich ließ mich durch die Straßen Süd-Londons treiben, bis ich mir wieder sicher war, dass all das vor langer Zeit und in großer Ferne geschehen war. Unendlich weit weg in einer Kleinstadt in den West Midlands. Und die Türklingel läutet und läutet … Ich habe immer gewusst, dass es eines Tages geschehen wird.
Zusammen mit vielen anderen wohne ich in einem großen, hässlichen Haus aus dem 19. Jahrhundert mit winzigen, zugigen Wohnungen. Die meisten davon sind Genossenschaftswohnungen. Ich stelle einen Schuh in die Wohnungstür, damit sie nicht zuschlägt, und mache mich auf den Weg nach unten, zur Haustür. Auf der Treppe höre ich die Bewohner durch die weißen, mit Messingschildern versehenen Türen: das Schreien eines Babys, Lachen aus dem Fernseher, ein streitendes Paar – das Leben von Fremden.
Völlig unvorbereitet auf das, was mich hinter der breiten, schweren Eingangstür erwartet, ziehe ich sie auf. Plötzlich ist mir, als würde die Welt kippen, ich muss mich am Türrahmen festhalten, um nicht hinzufallen. Denn auf der Schwelle steht sie und sieht mich an. Nach all diesen Jahren ist sie da: Heather.
Ich habe mir diesen Moment so viele Hundert Male und so viele Jahre lang vorgestellt, habe von ihm geträumt und ihn gefürchtet, sodass er sich jetzt, in der Wirklichkeit, einerseits völlig surreal und zugleich sehr enttäuschend anfühlt. An diesem ganz normalen Nachmittag an einer ganz normalen Londoner Straße nehme ich wie aus weiter Ferne wahr, dass das Leben um mich herum weitergeht – Autos und Menschen kommen vorbei, ein Stück entfernt spielen Kinder, ein Hund bellt –, und während ich ihr ins Gesicht starre, schmecke ich das saure Aroma von Furcht auf der Zunge. Ich mache den Mund auf, bringe aber kein Wort heraus, und so stehen wir eine Weile schweigend da, zwei dreiunddreißigjährige Versionen der Mädchen, die wir einst waren.
Sie ergreift als Erste das Wort. „Hallo, Edie.“
Und dann tut sie etwas, was ich mir bisher nie vorstellen konnte: Sie tritt über die Schwelle. Mein Herz macht einen Satz, als sie mir so nahe kommt, sie breitet die Arme aus und umarmt mich. Steif und verschlossen stehe ich da, während die Erinnerungen auf mich einprasseln: das Gefühl ihrer drahtigen Haare auf meiner Wange, der merkwürdige Zwiebelgeruch, den ihre Kleider immer schon verströmten, ihre große, massige Gestalt. Mein Kopf ist leer, nur noch der Herzschlag in meiner Kehle ist zu spüren. Und jetzt geht sie hinter mir her durch den Flur – nein, nein, nein, das ist alles nur ein Traum – und die Treppe hinauf, vorbei an den Türen mit den Messingschildern und der abblätternden Farbe. Dann sind wir oben, und ich sehe, wie meine Hand die Tür zu meiner Wohnung aufschiebt, und wir betreten meine Küche – nein, nein, nein. Wir setzen uns an meinen Küchentisch, und ich blicke in das Gesicht, von dem ich hoffte, es niemals in meinem Leben wiedersehen zu müssen.
Zunächst sagt keine von uns etwas, und ich sehne mich zutiefst nach dem ruhigen Leben, das ich noch vor wenigen Augenblicken in diesen drei engen Räumen geführt habe. Der Wasserhahn tropft, die Sekunden vergehen, die bräunlichen Triebe meiner Grünlilie zittern auf dem Fensterbrett. Ich stehe auf, damit ich Heather nicht mehr ansehen muss, und halte mich an der Arbeitsplatte fest. So, mit dem Rücken zu ihr, bringe ich endlich etwas heraus. „Wie hast du mich gefunden?“, frage ich, und als sie nicht antwortet, drehe ich mich um. Sie mustert das Zimmer, blickt hinaus in den Flur und in das schmale Wohnzimmer mit dem ausgezogenen Klappbett.
„Hm?“, macht sie. „Ach …“ Sie sieht mich an. „Deine Mutter. Sie wohnt noch in eurem alten Haus.“
Und ich nicke, obwohl ich das nicht mit Sicherheit wusste, weil meine Mutter und ich schon seit vielen Jahren nicht mehr miteinander reden. Im nächsten Moment bin ich dort, in dem Haus in Fremton. Wir sitzen in der Küche, das Neonlicht flackert, die Fenster sind wie Spiegel vor der schwarzen Dunkelheit draußen. Mir laufen die Tränen übers Gesicht, und ich erzähle Mum alles, was in dieser Nacht geschehen ist, bis ins kleinste Detail, so als würden, wenn ich ihr davon berichte, die Schreie in meinem Kopf aufhören, als könnte die Schilderung die Erinnerungsbilder in mir zum Verschwinden bringen. Ich erzähle von Heather und Connor und davon, was sie getan haben, aber es ist, als würde ich einen Horrorfilm nacherzählen. Ich lausche meinen eigenen Worten und kann kaum glauben, dass alles, was ich erzähle, tatsächlich wahr ist. Ich höre nicht auf zu reden, bis ich ihr auch noch die kleinste Kleinigkeit beschrieben habe, und als ich geendet habe, strecke ich die Arme nach ihr aus. Aber der Körper meiner Mutter ist stocksteif, ihr Gesicht grau vor Entsetzen. Sie weicht vor mir zurück, und ich hoffe, dass mich niemals mehr in meinem Leben jemand so ansieht wie sie in diesem Moment.
Als sie endlich etwas sagt, spuckt sie die Worte aus wie Steine. „Geh ins Bett, Edith“, sagt sie, „und sprich mit mir nie wieder darüber. Hörst du? Ich will davon nie mehr etwas hören.“ Dann dreht sie sich um, starrt aus dem Fenster, und ich sehe ihr verkrampftes, schreckliches Gesicht, das sich in der Scheibe spiegelt. Am nächsten Morgen stehe ich vor Sonnenaufgang auf, nehme etwas Geld aus ihrem Portemonnaie und steige in den Zug zu meinem Onkel Geoff in Erith. Ich kehre nie mehr zurück.
Dass Heather meine Adresse von meiner Mutter hat, verblüfft mich. Mein Onkel hat nie erfahren, was der Auslöser für den Bruch zwischen uns war. Er hoffte immer, wir würden uns eines Tages wieder versöhnen. Daher überrascht es mich nicht, dass er meiner Mutter verraten hat, wo ich wohne. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie die Adresse tatsächlich notiert und aufbewahrt hat.
Plötzlich überfällt mich eine tiefe Erschöpfung. Dennoch zwinge ich mich zu fragen: „Was willst du, Heather? Warum bist du hier?“ In meinem tiefsten Inneren wusste ich immer, dass dieser Moment kommen würde. Hatte ich nicht Nacht für Nacht davon geträumt und war in den frühen Morgenstunden voller ängstlicher Erwartung aufgewacht?
Zunächst antwortet sie nicht. Auf dem Tisch vor ihr liegt ihre Handtasche, ein aus schwarzer Wolle gestricktes Ding mit einem abgestoßenen Plastikknopf. Fussel, Krümel und eine Menge beigefarbene Härchen hängen daran – vielleicht Katzenhaare. Ihre kleinen, dunkelbraunen Augen sehen mich durch die lichten, hellen Wimpern an; sie trägt kein Make-up, abgesehen von einem verschmierten hellrosa Lippenstift, der überhaupt nicht zu ihr passt. In die Stille hinein tönt eine Frauenstimme von der Straße herauf: „Terry … Terry … Teeerrryyy …“ Wir lauschen, wie sie leiser wird und verhallt, und genau jetzt senkt sich die Dunkelheit auf London herab, dieser melancholische Moment, kurz bevor die Lichter der Stadt plötzlich hell erstrahlen. Ich vernehme ein leises Beben in Heathers Stimme, als sie sagt: „Nichts. Ich will nichts. Ich wollte dich nur wiedersehen.“
Mit Mühe versuche ich das zu verstehen, verwirrt tastet mein Geist nach verschiedenen Erklärungen. Aber da ergreift sie erneut das Wort und sagt mit so viel Einsamkeit in der Stimme, dass ich sie fühlen kann wie eine offene, schmerzlich vertraute Wunde: „Du warst meine beste Freundin.“
„Ja“, flüstere ich und wende mich ab. Und weil mir nichts Besseres einfällt, stehe ich auf, setze Wasser auf und mache Tee, während Heather weiterredet, als wäre das ein völlig normaler Besuch – zwei alte Freundinnen, die sich nach langer Zeit wiedersehen. Dass sie, kurz nachdem ich fortgegangen bin, auch umgezogen sei. Dass sie jetzt in Birmingham wohne und einen Teilzeitjob in einem Zeitungsladen habe.
Während sie spricht, mustere ich sie insgeheim. Wie gewöhnlich sie aussieht. Ein bisschen pummelig, dicke Hände, die sie vor sich auf dem Tisch gefaltet hat, der weiche walisische Akzent, die schulterlangen Haare, das unablässige Lächeln. „Lebst du noch immer bei deinen Eltern?“, frage ich, um überhaupt etwas zu sagen, um ihr Spiel mitzuspielen, wenn es denn eines ist. Und sie nickt. Ja, denke ich bei mir, es ist immer noch schwer, sich vorzustellen, wie sie ohne die beiden zurechtkommt. Heather war nicht dumm, nicht zurückgeblieben oder so – tatsächlich war sie sogar ziemlich gut in der Schule. Aber trotz ihrer Bildung hat ihr immer etwas gefehlt, etwas, das sich nur schwer beschreiben lässt. Sie hatte eine Naivität, die sie verletzlich machte, sie leicht vom Weg abbrachte. Ich setze mich auf den Stuhl neben ihr. „Heather“, sage ich erneut, ehe mich der Mut verlässt, „Heather, was willst du von mir?“
Anstelle einer Antwort streckt sie die Hand aus und nimmt eine Strähne meiner Haare zwischen die Finger. „Noch immer so hübsch, Edie“, sagt sie träumerisch. „Du hast dich überhaupt nicht verändert.“ Und ich kann mich nicht zurückhalten: Ich zucke überdeutlich zusammen. Vor Anspannung muss ich aufspringen und das Teegeschirr klirrend ins Spülbecken stellen, während sich ihr Blick in meinen Rücken bohrt.
„Darf ich mir deine Wohnung ansehen?“, fragt sie, und als ich nicke, stellt sie sich in die Tür meines winzigen Wohnzimmers. Ich folge ihr, und gemeinsam schauen wir auf das enge, staubige Durcheinander, das Klappbett, die Kleiderstange, den schäbigen, alten Fernseher. „Wie schön“, bemerkt sie mit heiserer Stimme, „du hast so ein Glück“, und ich verspüre den Wunsch, laut aufzulachen. Hätte man mich mit sechzehn gefragt, was für ein Mensch ich werden will, was für ein Leben ich führen werde – so hätte ich es mir nie vorgestellt.
Als ich darüber nachdenke, dass sie, um zu mir zu kommen, den ganzen Weg allein nach London gefahren sein und dann die ganze Stadt durchquert haben muss, bin ich sowohl beeindruckt als auch entsetzt. Plötzlich dämmert mir, dass sie vielleicht damit rechnet, hier übernachten zu können, und diese Vorstellung ist so schrecklich, dass ich hervorstoße: „Heather, es tut mir wirklich leid, aber ich muss eigentlich weg, ich muss bald gehen … Es war wirklich sehr nett, dich mal wiederzusehen, aber ich kann auf keinen Fall …“
Sie sieht sehr geknickt aus. „Oh!“ Sehnsüchtig blickt sie sich im Zimmer um, die Enttäuschung ist ihr ins Gesicht geschrieben. „Kann ich denn nicht hierbleiben, bis du wiederkommst?“
Sie wirft einen hoffnungsvollen Blick auf mein Sofa, und ich versuche mit aller Kraft, die Panik aus meiner Stimme herauszuhalten, als ich lüge: „Weißt du, ich fahre ein paar Tage weg, mit Freunden.“ Vorsichtig führe ich sie zurück in die Küche. „Tut mir leid.“ Zögernd nickt sie und folgt mir dorthin, wo sie ihre Sachen abgestellt hat. Schließlich ist sie gerade erst eine Viertelstunde hier. Während sie ihren Mantel anzieht, stehe ich neben ihr und sage nichts.
„Gibst du mir deine Telefonnummer?“, fragt sie. „Ich könnte dich anrufen, und beim nächsten Mal verbringen wir den Tag oder sogar das Wochenende miteinander.“ Ihr Blick ist so flehend, dass ich unwillkürlich nicke; eifrig wühlt sie in ihrer Handtasche. Mit fest verschränkten Armen sehe ich ihr zu, wie sie meinen Namen langsam in ihr Mobiltelefon eintippt.
Erwartungsvoll hebt sie den Kopf, und meine Körperhaltung oder die Position, in der ich vor ihr stehe, verrät mich. Sie reißt den Mund auf. „Du bist schwanger!“, sagt sie.
Ganz kurz erhasche ich in ihren haselnussbraunen Augen einen Ausdruck, der mich erschauern lässt, ohne dass ich weiß, warum. Schnell lege ich schützend die Hand auf meinen Bauch, und Heris Gesicht huscht mir durch den Kopf, ist verschwunden, ehe es richtig zu sehen ist.
„Na dann“, sagt sie nach kurzem Schweigen, „herzlichen Glückwunsch. Wie schön.“ Sie hält den Blick immer noch auf mich gerichtet, ihre Augen zucken, und ich ahne, dass sie gleich weitere Fragen stellen wird. Ich rattere meine Telefonnummer herunter und warte, während sie unerträglich langsam tippt. Schließlich öffne ich die Tür, verabschiede mich so freundlich, wie ich nur kann, und endlich macht sie Anstalten zu gehen. Doch plötzlich hält sie inne, schweigt einen Moment und sagt dann sehr leise: „Erinnerst du dich noch an den Steinbruch, Edie? Zu dem wir immer hinaufgegangen sind, alle miteinander?“
Ich fühle mich auf einmal benommen, eine Woge von Übelkeit überrollt mich, und mit einer Stimme, die kaum mehr ist als ein Flüstern, sage ich: „Ja.“
Sie nickt. „Ich mich auch. Ich denke die ganze Zeit daran.“ Und dann geht sie. Ihre praktischen Schnürschuhe machen Geräusche im Treppenhaus, während sie immer weiter hinabsteigt. Schwach vor Erleichterung lehne ich an der Wand, bis sich weit unter mir die schwere Eingangstür schließt, die sie hinter sich ins Schloss fallen lässt wie eine Gefängniswärterin.
Davor
Es ist der letzte Schultag vor den Abschlussprüfungen, und wohin man auch sieht, schreiben Mädchen einander mit Filzstift etwas aufs T-Shirt. Sie trinken aus Coladosen, in denen sich, glaube ich, etwas anderes befindet, und werfen Mehlbomben aus den oberen Fenstern des Schulgebäudes. Ich sitze auf der Bank unter dem Bibliotheksfenster und sehe zu. Später werden sie alle auf den Sportplatz gehen, um sich zu betrinken – in den Toiletten habe ich sie darüber reden hören. Mich haben sie nicht eingeladen, aber das macht mir nichts aus, weil Mum sich sowieso immer Sorgen macht, wenn ich spät heimkomme. Am Trinkwasserbrunnen bemerke ich Nicola Gates, aber als ich ihr zuwinke, dreht sie sich um.
In diesem Moment sehe ich Edie zum ersten Mal, sie geht über den Vorhof zum Haupteingang. Ihr Gesicht taucht inmitten der vielen anderen immer wieder auf und verschwindet dann wieder, doch auf einmal bleibt sie stehen. Ihr Blick wandert an dem Gebäude empor, dann dreht sie sich um und sieht schließlich mich an. Ich halte die Luft an. Ich glaube nicht, dass ich schon einmal ein so hübsches Mädchen gesehen habe.
Und dann steht sie auf einmal vor mir. Erst bin ich zu abgelenkt, um zu verstehen, was sie sagt. Ich studiere sie in allen Einzelheiten: der Geruch der Lederjacke, die sie über dem Arm trägt, gemischt mit einem sanften Apfelduft, ihre großen, braunen Augen mit den dicken, schwarzen Lidstrichen, ihr helllila Nagellack. In der Vertiefung unterhalb ihrer Kehle hängt ein kleiner goldener Anhänger mit einem winzigen, grünen Edelstein in der Mitte. Würde man den Finger darunterschieben, könnte man das regelmäßige Pulsieren ihres Herzens spüren.
„Entschuldigung“, sage ich, „was?“
Sie lächelt. „Das Sekretariat. Wo ist das?“ Ihre Stimme ist klar und selbstsicher, mit einem nordenglischen Akzent – vielleicht Manchester.
Von allen, die sie hätte fragen können, hat sie sich ausgerechnet mich ausgesucht. Ich stehe auf. „Ich muss auch gerade in diese Richtung“, sage ich, obwohl das nicht stimmt, „ich bringe dich hin, wenn du magst.“
Sie nickt und zuckt die Achseln. „Ja, okay, einverstanden.“
Im Gehen sehe ich Sheridan Alsop und Amy Carter am Brunnen stehen. Sie unterbrechen ihr Gespräch und mustern uns, als wir vorbeikommen. Ich spüre den verrückten Impuls, mich bei ihr, dieser Fremden, die neben mir geht, einzuhängen, und stelle mir vor, wie wir so dahinschlendern würden, Arm in Arm wie beste Freundinnen. Da wären Amy und Sheridan so richtig verblüfft. Natürlich mache ich es nicht. Ich habe schon begriffen, dass die Leute so etwas nicht mögen.
„Ich heiße Heather“, sage ich stattdessen zu ihr.
„Ich bin Edie. Na ja, eigentlich Edith. Aber wie langweilig ist das denn?“ Sie blickt um sich, schüttelt den Kopf. „So eine Scheißschule.“
„Ja, ich weiß! Total langweilig. Bist du neu hier?“
Sie nickt. „Ich soll an dieser Schule meinen Abschluss machen. Im September fange ich an.“
„Ich mache auch die Prüfungskurse zu den A-Levels! Was für Fächer hast du? Ich habe Biologie, Mathe und Chemie belegt. Ich wollte auch noch eine Sprache lernen, aber meine Eltern fanden das überflüssig, weil ich so etwas für Medizin an der Uni nicht brauche. Besser, ich konzentriere mich auf die drei Fächer. Ich hab ja auch noch meine ehrenamtliche Arbeit und so. Irgendwann werde ich Ärztin, und dann …“ Ich unterbreche mich, mache den Mund fest zu. Mum findet, ich rede zu viel. Ich beiße mir auf die Lippe und warte, dass Edie mich so ansieht wie die anderen Mädchen immer.
Aber das tut sie nicht, sie lächelt nur. Das lange, braune Haar fällt ihr ins Gesicht, und sie schiebt es hinters Ohr. „Ich mache Kunst“, erzählt sie. „Und Fotografie. Ich will später Kunst an einem Art College in London studieren. Vielleicht am Saint Martins“, fügt sie mit fröhlicher Selbstsicherheit hinzu. Und sie erklärt, dass sie vor Kurzem mit ihrer Mutter aus Manchester nach Fremton gezogen sei. Ihr Tonfall wirkt gelangweilt, und ihr Blick gibt einem das Gefühl, als sei für sie alles ein Witz. Dabei sieht sie mich so an, als müsste ich genau wissen, was eigentlich so komisch ist. Das gefällt mir. Ich könnte sie stundenlang ansehen.
Wir sind schon am Sekretariat, obwohl ich den längeren Weg um das Gebäude genommen habe. „Da ist es“, sage ich und will schon hinzufügen, dass ich draußen auf sie warte, dass ich ihr später noch die Schule zeige, aber sie entfernt sich bereits. „Okay. Danke!“, sagt sie. „Wir sehen uns.“
Die Tür schließt sich hinter ihr. Edie. Iiidiie. Auf dem Heimweg drehe und wende ich den Namen in Gedanken, ich probiere ihn an und verräume ihn dann sicher, als wäre er ein wertvoller Anhänger an einem Goldkettchen.
„Heather … Heather … HEATHER!“ Ich fahre hoch und sehe mich benommen in meinem Zimmer um. Wie lange sitze ich schon so da? „Heather!“ Meine Mutter ruft aus der Küche nach mir, die Gereiztheit in ihrer Stimme steigt, und ich springe auf. Dann sehe ich mich nach Anhaltspunkten um. Ich trage noch meine Schuluniform, meine Büchertasche liegt auf dem Schreibtisch. Es ist hell draußen, aber das Licht wirkt bereits abendlich. Allmählich erinnere ich mich wieder. Heute war der letzte Schultag des Trimesters, ehe die Prüfungszeit beginnt. Ich bin aus der Schule nach Hause gekommen und in mein Zimmer hinaufgegangen, um mit dem Lernen anzufangen. Und dann … Es muss einfach so passiert sein, wie schon öfter, ich weiß nicht, warum. Es ist fast so, als würde ich schlafen, obwohl ich hellwach bin. Normalerweise geschieht es, wenn ich genervt oder wütend bin, so wie damals bei Daniel Jones, dem Jungen, der mich während der gesamten Grundschulzeit gequält hat. Erst als ich das Blut sah, begriff ich, dass ich ihn geschlagen hatte. Ein wirres Durcheinander von Stimmen früherer und jetziger Mitschüler sammelt sich in mir, bis sie zu einem einzigen spöttischen Zischen zusammenfließen. Was ist bloß los mit dir? Warum starrst du so? Idiotin. Du verdammte Irre! Ich schüttle den Kopf, um die Stimmen zu vertreiben.
Mein Vater sammelt Uhren, wir haben Hunderte davon im Haus, und alle ticken gleichzeitig. Es hört sich an, als würde die Luft mit den Zähnen klappern. Ich lausche, und tatsächlich, ein paar Sekunden später kommt es: das klingelnde Klimpern der Dings und Dongs, wenn sie alle gleichzeitig die Stunde schlagen. Ich zähle bis sieben. Abendessenszeit. Meine Mutter ist nie zu spät. Die Vorstellung, wie sie in der Küche darauf wartet, mit dem Essen anzufangen, bringt mich in Bewegung. „Komme!“, rufe ich. „Ich komme schon!“
Im Erdgeschoss sitzt mein Vater am Küchentisch und liest laut einen Zeitungsartikel über Geotechnik vor. Mum hört gar nicht zu, sie ist damit beschäftigt, von der Arbeitsfläche aus Teller mit Essen vor uns auf den Tisch zu stellen. Ich versuche, ihre Stimmung einzuschätzen, aber sie platziert den letzten Teller, setzt sich, ohne mich anzusehen, und beginnt zu beten.
Manchmal erinnert meine Mutter mich an den See, an dem wir zu Hause in Wales öfter beim Campen waren. Wenn ich an heißen Sommertagen hineinwatete, stieß ich gelegentlich plötzlich auf eine eiskalte Senke, und einen Schritt weiter wurde das Wasser gleich wieder flacher und wärmer. Dort blieb ich dann so lange wie möglich, ehe mich die Berührung einer schleimigen Wasserpflanze oder der Gedanke an Aale oder tote Fische in Panik versetzte und weitertrieb. Bei Mum weiß man auch nie, wo die kalten Stellen sind, oder was einen als Nächstes erwartet.
„Heather!“ Meine Mutter unterbricht plötzlich ihr Gebet, und ich merke zu spät, dass ich geistesabwesend von meinem Tomatensalat gegessen habe.
„Entschuldigung“, sage ich und spüre, wie ich rot werde.
Manchmal hilft es mir beim Einschlafen, so zu tun, als wäre alles noch so wie früher, als wäre ich wieder sechs und Lydia drei, und mit uns wäre alles in Ordnung. Ich stelle mir Lydias Hand in meiner vor, wie wir zusammen in den Garten unseres alten Hauses rennen, und höre sie lachen, ehe mich der Schlaf übermannt.
Wie um mich aus meinen Gedanken zu reißen, taucht vor meinem inneren Auge das Gesicht des Mädchens auf, das ich heute Nachmittag kennengelernt habe, und es ist, als ob ein Licht in meinem Herzen erstrahlen würde. Edie.
Fremton ist eine entsetzliche Stadt. Das sollte ich nicht sagen, aber es stimmt. Ich war zehn, als wir aus Wales hergezogen sind – ein Neuanfang, sagte meine Mutter. Nach dem, was passiert war, sahen mich Leute, die ich schon mein ganzes Leben lang kannte, plötzlich völlig anders an, wenn ich an ihnen vorbeiging, oder sie stürzten sich wie gierige Krähen auf meine Eltern, krächzten mitleidig und pickten nach Erklärungen.
Mit der Zeit hörten meine Eltern mit allem auf, was sie zuvor in ihrer Freizeit getan hatten. Mum ging nicht mehr zu den Chorproben und nicht mehr in den Lesekreis, beteiligte sich nicht mehr an der Organisation von Schulfesten. Außer zum sonntäglichen Kirchgang verließ sie das Haus fast überhaupt nicht mehr. Dad unterrichtete zwar noch an der Jungenschule auf der anderen Talseite, aber zu Hause zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, schraubte an seinen Uhren und las Bücher. Vermutlich wirkte das auf Außenstehende so, als würden wir die Welt aussperren, um Trost innerhalb der Familie zu finden, aber so war es nicht. Meine Eltern waren gespalten wie ein vom Blitz getroffener Baum, und ich fühlte mich wie ein einsames Eichhörnchen, das zwischen den beiden Hälften hin und her springt. Dad sah mich danach nie wieder so an wie zuvor, und das galt auch für Mum, aber bei ihr war es anders. Tief im Herzen wusste ich, dass sie sich wünschte, an diesem Tag wäre Lydia sicher und gesund nach Hause gekommen, und nicht ich.
Als sie mir dann eines Abends nach dem Essen erzählten, Dad habe in einer Stadt in England, etwa hundertsechzig Meilen weit entfernt, eine bessere Stelle angeboten bekommen, und wir könnten uns ein größeres Haus leisten, wusste ich sofort, was der wahre Grund für den Umzug war: Wir würden an einen Ort gehen, wo uns niemand kannte, wo niemand wusste, was geschehen war und was das bedeutete. Und einen Monat später waren wir hier. Aber eigentlich änderte sich nicht viel. Meine Mutter hat eine Kirche gefunden, in die sie regelmäßig geht, aber abgesehen davon verlässt sie das Haus immer noch kaum. Inzwischen konzentriert sie sich auf mich. Meine Schularbeiten, mein Gewicht, meine Klavierübungen, meine Zukunft. Ich glaube, sie versucht, mich besser zu machen.
Wenn die Prüfungen am Ende des Schuljahrs vorbei sind, muss ich sieben leere Wochen herumbringen. Wenn ich nicht Mum im Haus helfe oder ehrenamtliche Arbeit mache, bleibt mir nicht viel anderes, als spazieren zu gehen. Fremton liegt unmittelbar an der Autobahn, die man von jedem Punkt in der Stadt hören kann – ein nie endender Strom von Autos, die irgendwohin unterwegs sind, an einen anderen Ort. Die Stadt wirkt wie eine große Autobahnraststätte, eine Durchgangsstation, nicht dafür gedacht, um darin zu leben. Mitten hindurch fließt ein Kanal, aber dort geht fast niemand hin. Die Läden im Zentrum sind meistens leer, seit der Superstore an der Wrexham Road aufgemacht hat. In der Mitte des Marktplatzes steht die große Statue eines Bergmanns, der einen Sack Kohlen auf dem Rücken trägt, jemand hat ihm mit oranger Sprühfarbe einen Penis auf den Kopf gemalt. Ansonsten gibt es lediglich endlose Straßen mit Gemeindebauten, bis man zum Pembroke Estate kommt, drei turmartigen Hochhäusern, die wie Wachposten so unmittelbar an die Autobahn gebaut sind, als sollten sie die Vorbeifahrenden davon abhalten, hier haltzumachen.
Bei meinen Spaziergängen halte ich Ausschau nach Edie, betrachte die Gesichter, an denen ich vorüberkomme, und hoffe, dass ihres irgendwann dabei sein wird. Ich denke an ihr Lächeln und ihre braunen Augen und wie nett sie zu mir war. Ich frage mich, was sie wohl gerade macht und wo sie wohnt, und ob sie sich genauso langweilt oder einsam ist wie ich. Und dann entdecke ich sie tatsächlich, als ich gerade über den Marktplatz nach Hause gehe. In einiger Entfernung sitzt sie auf einer Bank neben der Statue und raucht eine Zigarette. Im Eingangsbereich eines Ladens bleibe ich stehen, um sie zu beobachten. Sie trägt einen kurzen Jeansrock, ihre ausgestreckten Beine sind lang und gebräunt, um den Knöchel trägt sie ein Silberkettchen. Das Haar hängt ihr offen über die Schultern, und sie zieht an ihrer Zigarette, als wäre sie tief in Gedanken versunken. Sie ist wunderschön. Ich finde, sie sieht aus, als würde sie vor der grauen Kulisse dieser Stadt erstrahlen, als wäre sie voller Licht. Ich zögere kurz, dann hebe ich unentschlossen die Hand, um ihr zu winken. Gerade will ich ihren Namen rufen, als jemand ganz nahe an mir vorbeigeht und vor mir bei ihr ist. Meine Hand sinkt herab, und ihr Name verklingt ungehört auf meinen Lippen.
Ich kann den Jemand, diese Person, die zwischen uns getreten ist, nicht genau erkennen. Ich weiß nur, dass er eine unmittelbare Wirkung auf sie ausübt. Ihr Gesicht und der Hals laufen rot an, ihre Augen weiten sich und strahlen. Sie hört ihm zu, lacht und blickt beiseite, aber nur einen Moment lang, als ob ihre Augen magisch von ihm angezogen würden. Dann setzt er sich neben sie, so nahe, dass sich ihre Arme berühren. Er sagt etwas, und sie schüttelt den Kopf, ein leichtes Lächeln auf den Lippen, und ich weiß nicht, was das ist, diese seltsame Hitze in dem knisternden, atemlosen Raum zwischen ihnen, ich weiß nur, dass dort kein Platz für mich ist.
So schnell, wie es anfing, so schnell ist es auch vorbei. Er beugt sich zu ihr und flüstert ihr noch etwas ins Ohr, das ihre Wangen zum Glühen bringt. Dann steht er auf und geht davon. Jetzt kann ich ihn genauer betrachten. Er trägt eine Trainingshose und einen Hoodie. Ich schätze ihn auf um die zwanzig; er sieht sehr gut aus, obwohl mir sein grob geschnittenes Gesicht gar nicht gefällt und auch sein Lächeln nicht – er weiß genau, dass sie ihm nachschaut. Im Schatten des Ladeneingangs warte ich noch ein paar Sekunden, ehe ich durchatme und zu ihr gehe.
Als ich vor ihr stehe und ihren Namen sage, sieht sie mich so seltsam an, als wüsste sie kaum, wo sie ist. Mühsam löst sie den Blick von der verschwindenden Gestalt und blinzelt. „Edie?“, wiederhole ich, doch erst nach einer Weile scheint sie mich zu erkennen. Sie lächelt und sagt: „Hey du! Heather, stimmt’s?“, und mein Herz macht einen erleichterten Satz.
„Diese Autorin schreibt phänomenal, erschafft eine bedrückende, unheilvolle Atmosphäre & baut trotzdem emotionalen Tiefgang mit ein. Das lässt ihre Psychothriller für mich zu etwas sehr besonderem werden.“
„Dieses Buch hat mir wieder einmal mehr gezeigt, welche Kraft gut geschriebene Seiten haben können. (...) Der kraftvolle, fesselnde Schreibstil hat schon in den ersten Kapiteln seine volle Sogwirkung entfacht. (...) Das Buch war für mich eine hochspannende Mischung aus Magie und hoher Schreibkunst - ein Psychothriller in Vollendung.“
„Ein unglaublich spannendes Buch, was einen sofort in seinen Bann zieht und was man kaum einmal aus der Hand legen mag.“
„Ich fand es gruselig, düster und sehr unheimlich, für mich persönlich einer der besten Psychothriller, die ich dieses Jahr gelesen habe!“
„Gruselig bis fesselnd intelligent geschriebenen Roman, dass man beim Lesen das Buch kaum noch aus der Hand legen mag.“







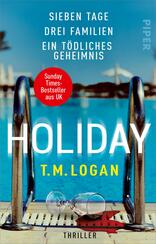






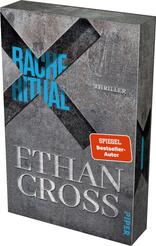
















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.