
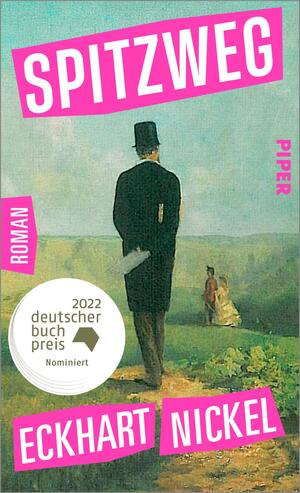
Spitzweg Spitzweg - eBook-Ausgabe
Roman
— Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022. Coming-of-Age-Geschichte zwischen Biedermeier und digitaler GegenwartSpitzweg — Inhalt
Überraschend, klug, komisch und auf anspruchsvolle Weise höchst unterhaltsam.
Ein Kunstdiebstahl aus Liebe - Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022 | Shortlist
„Spitzweg“ ist die Geschichte zweier junger Männer, die der Wahrheit unserer Existenz und der Frage nach „Original und Fälschung“ auf der Spur sind und sich in einer Verfolgungsjagd am Zug wähnen, während sie längst Erfüllungsgehilfen weiblicher Masterpläne sind.
Als die von beiden bewunderte Kirsten ein Selbstporträt anfertigt, dem die Lehrerin „Mut zur Hässlichkeit“ bescheinigt, überstürzen sich die Ereignisse: Kunstwerke entstehen und verschwinden, das Mädchen taucht auf und wieder ab, und eine fieberhafte Suche beginnt, auf der die drei immer wieder in die Abgründe des Lebens schauen.
Eckhart Nickel erzählt wie in „Hysteria“ die Geschichte einer Obsession: War darin von der Natur nur noch künstliche Reproduktion übrig, wird nun die Kunst zur zweiten Natur des Menschen.
„Drei Schüler fliehen aus der banalen Realität in die Welt der Kunst und drohen sich darin zu verlieren: ›Spitzweg‹ ist die Geschichte einer frühen Liebe, ein literarisches Vexierspiel und ein Bildungsroman, der das Zauberhaft-Verrückte der Romantik in unsere kontrollbesessene Gegenwart holt ... Eckhart Nickel ist ein fantastischer Erzähler! “ Niklas Maak
„Klug komponiert und unterhaltsam gebaut, ein literarisches Glanzstück.“ 3sat Buchzeit
Leseprobe zu „Spitzweg“
1
Original und Fälschung
Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Die meisten Bilder, die ich zu Gesicht bekam, fand ich entweder unansehnlich oder nichtssagend. Bisweilen auch beides zugleich. Wie kamen Künstler nur auf die Idee, die Welt habe sich dafür zu interessieren, was sie zu Papier bringen? Gemälde an sich, wozu sind sie gut? Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort einen Spiegel an. Kunst versucht oft, [...]
1
Original und Fälschung
Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Die meisten Bilder, die ich zu Gesicht bekam, fand ich entweder unansehnlich oder nichtssagend. Bisweilen auch beides zugleich. Wie kamen Künstler nur auf die Idee, die Welt habe sich dafür zu interessieren, was sie zu Papier bringen? Gemälde an sich, wozu sind sie gut? Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort einen Spiegel an. Kunst versucht oft, beides zu sein, Fenster wie Spiegel, und kann doch weder das eine noch das andere ersetzen. Gerade, wenn sie versucht, das Leben wirklichkeitsgetreu abzubilden, zeigt sich das Ausmaß ihres Scheiterns besonders deutlich.
Das hat mir eine unerhörte Begebenheit in der Schule vor Augen geführt, und es brauchte die Überzeugungskraft einer einzig und allein aus der Kunst abgeleiteten Existenz, um mich vom Gegenteil zu überzeugen: dem Wunder der Kunst, eine Vision der Wahrheit in ästhetischer Form anschaulich verdichten zu können. So gesehen kann ich den Umstand, dass Carl erst kurz vor dem Tag, da die Geschichte sich ereignete, bei uns aufgetaucht war, kaum als Zufall deuten.
Die Kunstlehrerin gab uns ein Selbstporträt als Aufgabe, und wie stets stellte die Mehrheit, mich eingeschlossen, wieder einmal nur stümperhaft ihre Unfähigkeit unter Beweis. Während also alle verzweifelt über den Zeichenblock gebeugt versuchten, wenigstens die Umrisse ihrer Gesichter halbwegs ordentlich hinzubekommen, schlich Frau Hügel, wie wir es gewohnt waren, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen von Tisch zu Tisch.
Ihr strenges schwarzes Kostüm, von dem sie nur selten abwich, bestand aus einem feinmaschigen Rollkragenpullover zum Faltenrock. Die ölig dunklen Haare waren zur Seite weg gebunden, aber immer fiel eine glänzende Strähne nach vorne, wenn sie sich über die Schulter eines Schülers beugte, um sein Werk genauer zu begutachten. So auch bei Kirsten, dem einzigen Talent unter uns. Sie musterte betont genau die bereits nahezu vollendete Zeichnung, räusperte sich dann gedehnt und sprach schließlich mit tonloser Stimme ihr Urteil: „Ausgesprochen gelungen, Respekt: Mut zur Hässlichkeit!“
Kirsten schluckte in die unmittelbar eingetretene Stille hinein. Nach einer ins Unerträgliche gedehnten Pause, in der alle wie gelähmt auf sie starrten, stand sie auf und rannte mit vor die Augen geschlagenen Händen nach hinten aus dem Kunstraum in das steinerne Treppenhaus. Und obwohl Kirsten ihre zerbrechlich hoch kieksende Stimme nicht erhoben hatte, höre ich den stummen Schrei bis heute, wie er sich über das immer weiter entfernt hallende Klicken ihrer Schuhe im Flur legte.
Frau Hügel starrte wie alle anderen völlig gebannt der verschwundenen Kirsten hinterher. Weil ich als Einziger direkt in der Reihe vor ihr saß, bekam niemand sonst das Unglaubliche mit, was währenddessen geschah: Carl, der in Kunst seinen Platz neben Kirsten hatte, blickte zwar genau wie die anderen Schüler Richtung Tür. Gleichzeitig ließ er aber mit ausgestrecktem Arm nahezu geräuschlos seinen Zeichenblock sehr langsam über das Porträt von Kirsten gleiten, bis dieser es vollends bedeckte. Ich weiß bis heute nicht, warum mich diese seine Bewegung unwillkürlich an den Mondschatten erinnerte, wie er sich bei einer Finsternis vor die Sonne schiebt. Aber ich hielt augenblicklich die Luft an, weil ich befürchtete, mein Ausatmen würde ihn verraten. Obwohl ich dem „Neuen“, wie ihn die meisten nannten, bis zu diesem Zeitpunkt eher skeptisch gegenübergestanden hatte, fühlte ich, wie uns von diesem Moment an so etwas wie eine erzwungene Komplizenschaft verband. Sie wuchs mit jedem Millimeter, den der Zeichenblock, nun mit dem Porträt von Kirsten darunter, wieder in Richtung Carl zurückwanderte, bevor er unmerklich vor ihm zum Halt kam.
Carl war anders, er sprach mit niemandem von uns. Der erste und einzige Satz, den ich von ihm außerhalb des Unterrichts gehört hatte, fiel auf dem Hof, kurz vor Ende der großen Pause am Getränkeautomaten. Er war vor mir an der Reihe und hatte nach dem Einwerfen der Münzen ziemlich unentschlossen und gelangweilt auf die Auswahl gesehen, bevor er schließlich die Rückgabetaste gedrückt und das Kleingeld wieder in seine Hosentasche gesteckt hatte. Dabei musste ich ihn wohl etwas zu unverblümt angestarrt haben, jedenfalls schnipste er mit den Fingern in die Luft, als ob er mich wie ein Zauberer aus der Trance zurückrufen würde. Dazu lächelte er mir gequält ins Gesicht und sagte mit einem entschuldigenden Achselzucken: „Ich frequentiere Milch. Und daran fehlt es hier offensichtlich, wie an vielem anderen mehr.“ Womit er mehr als recht hatte.
„So habe ich es ja gar nicht gemeint!“, murmelte Frau Hügel kopfschüttelnd in die beklemmende Ruhe des Saals, aber eher zu sich selbst. Als ich gerade etwas zu Kirstens Verteidigung sagen wollte, streifte mein Blick Carl, der eine Augenbraue hochgezogen hatte und mir direkt in die Augen sah. Sein Daumen zog vor dem Mund einen imaginären Reißverschluss zu, dann fletschte er für den Bruchteil einer Sekunde seine Zähne und nahm sofort wieder seine übliche Pose ein – eine betont teilnahmslose Ernsthaftigkeit.
Nach der stillschweigend besiegelten Übereinkunft des Geheimnisses, das wir teilten, fiel es mir schwer, meine Enttäuschung darüber zu verbergen, dass er tatsächlich in Erwägung gezogen haben könnte, ich würde ihn verraten. Mein Stolz war gekränkt, obwohl wir uns kaum kannten und er daher allen Grund hatte, mir nicht gleich blind zu vertrauen. Dennoch war ich mir sicher, er habe in dem Bewusstsein gehandelt, ich würde ihn bei seiner Tat genauestens beobachten. Ich konnte ja gar nicht anders, als ihm zuzusehen, wie er die Zeichnung geschickt an sich brachte. Er hatte mich gewissermaßen ungefragt dazu gezwungen, ein Augenzeuge seines Coups zu werden und so gleich ordentlich Mitschuld auf mich zu nehmen. Weil das Ganze unmittelbar vor meinen Augen geschah, musste er zudem die allergrößte Genugtuung darüber empfunden haben, während der gesamten Aktion bei jeder kleinsten Bewegung mit meiner absoluten und ungeteilten Aufmerksamkeit rechnen zu können, ohne mich auch nur ein einziges Mal dabei anzusehen.
Was das Wissen darum, einen Betrachter oder Beobachter zu haben, wiederum mit Kunst an sich zu tun hatte, davon hatte ich keinen Begriff. Wie gesagt, bevor ich Carl kennenlernte, konnte ich so gut wie gar nichts mit Malerei anfangen. Alles, was ich an Kenntnis über sie besaß, war der Rubrik in einer Programmzeitschrift meines Elternhauses zu verdanken, die den bezeichnenden Titel Original und Fälschung trug. Sie war immer auf der letzten Seite platziert, wo ein und dasselbe Gemälde gleich zweimal untereinander abgedruckt war. Während man die beiden Versionen auf den ersten Blick kaum unterscheiden konnte, waren in einem der beiden Bilder zehn Fehler geschickt versteckt worden, die es als Fälschung auswiesen. Welches von beiden das Original war, wurde erst klar, wenn man nach dem detektivischen Aufspüren der kleinen Unterschiede einen direkten Vergleich anstellen konnte. Da fehlte zum Beispiel an einer antikischen Vase im Hintergrund einer der Henkel oder eine Figur am vorderen Rand des Motivs hatte einen Finger zu viel an der Hand. Wobei oft gar nicht so sicher war, ob die Abweichungen nicht vielmehr auch Teil des künstlerischen Konzepts sein konnten. Letzten Endes half alles nichts. Um der nahezu philosophischen Verwirrung, was nun Original und was Fälschung sei, Herr zu werden, blieb oft allein die Recherche nach dem Gemälde im Netz oder in einem Lexikon, um herauszufinden, ob dem armen Gärtner im Gras wirklich und vom Künstler gewollt ein Ohr abhandengekommen war oder es sich dabei nur um eine der makabren Kopfgeburten des Erfinders der Rubrik handelte. Vor allem, wenn sich das Sujet von Klassikern wie altniederländischen Tafelstillleben oder gefälligen Landschaften des 19. Jahrhunderts wegbewegte, wurde es kompliziert. Die bisweilen bizarren Physiognomien auf den von drastischer Symbolik überbordenden Wimmelbildern des Hochmittelalters im Stile eines Hieronymus Bosch gestalteten jede Suche nach Unterschieden besonders schwierig. Da sehnte ich mich schon fast nach dem einen Schornstein zu viel in der Schachtelstadt eines Kubisten.
Bald waren die weggelassenen oder hinzugefügten Striche für mich eine reine Gedankenübung wie vergessene oder überflüssig gesetzte Kommata, die ich in einem Aufgabentext aus dem Deutschunterricht aufzufinden hatte. Allein, die einzig bekannte Regel, die dabei zur Anwendung kam, war mein seit frühester Kindheit ausgeprägter Spürsinn. Wie Carl mir später an diesem Nachmittag erklärte, als ich ihm davon erzählte, bildete ich mit dieser Praxis unbeabsichtigt mein Talent zur analytischen Kunstbetrachtung aus. Mit einem großen Vorteil den eigentlichen Fachleuten gegenüber: dass meine Herangehensweise völlig inhaltsfrei war, weil es sich lediglich um eine höchst detaillierte Analyse dessen handelte, was formal zu sehen war. Carl verwendete dafür den Begriff der, wie er es fast im Stakkato seiner Silben aussprach, Un-be-ein-druck-bar-keit.
„Du hast einen Blick auf die größten Meisterwerke, der von einer nahezu rebellischen Naivität geprägt ist. Du lässt dich nicht von den Namen blenden, die in den Museen unter dem Rahmen auf dem Schild an der Wand geschrieben stehen. Du schaust einfach nur auf das Bild und entzifferst genau, was es uns zeigt und wie. Dabei erfährst du etwas ganz anderes als das, was die vielen vermeintlich klugen Geister vor dir alles hineingelesen haben. Obwohl sie beim Nachbeten ihrer intellektuellen Hausgötter alle Register zu ziehen pflegen, kamen sie dem schöpferischen Kern nie so nah wie du in deiner trockensten Beschreibungsstunde.“
Und als ob er diese Ehrerbietung noch durch ein gut verstecktes Kompliment steigern wollte, zitierte er die Grabsteininschrift eines seiner Kunsthelden: „Hier ruht der Maler Paul Klee. Diesseitig bin ich gar nicht fassbar. Denn ich wohne grad so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nah genug.“
Ich bin mir nicht sicher, was passiert wäre, wenn ich mich in dem kritischen Moment im Kunstraum einfach über Carls bedeutsame Geste zum Stillschweigen hinweggesetzt und – auch von ihm unbeeindruckt – meine Stimme für Kirsten erhoben hätte. Ganz so, wie es mir meine moralische Natur als kaum zu unterdrückenden Impuls anempfohlen hatte. Aber ich werde es nie wissen, ob dann jemand mit mir aufgestanden und ihr hinterhergerannt wäre, um sie aufzuhalten. Ob wir sie noch draußen vor der Schule eingeholt hätten, um sie in einer fast schon filmischen Szene an beiden Armen festzuhalten, sie zu schütteln, ihr direkt in die Augen zu sehen und ihr zuzureden, dass alles nicht so schlimm und nur ein Missverständnis gewesen sei, um sie davon zu überzeugen, mit uns wieder in die Stunde zurückzukommen. Doch wer weiß? Dann hätte sich Carl gewiss gleich von mir abgewendet. Unabwendbar: die Tatsache, dass ein Verlust anzuzeigen war.
2
Blockzeichen
Wie etwas gemeint ist, darüber haben sich auch die klügsten Geister schon immer den Kopf zerbrochen. Jedes Mal, wenn ich einem Streit beiwohne, habe ich den Eindruck, dass alles Übel dieser Welt daher rührt, dass Menschen verschiedener Meinung sind. Aber damit nicht genug. Es kommt erschwerend hinzu, dass sie nicht einmal genau wissen, wie das, was ihr Gegenüber gesagt hat, tatsächlich gemeint war. Wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich in den seltensten Fällen bei einem Streit wirklich sagen kann, dass ich verstanden hätte, worum es den Einzelnen geht. Da sie von vornherein zu wissen glauben, wie etwas zu deuten ist, hören sie gar nicht mehr richtig zu, sondern schreien nur noch ihren eigenen Standpunkt in die Welt hinaus, als gewönne er durch Lautstärke an Gewicht.
Weil ich nichts mehr verachte als die stumpfe, gedankenlose Aggression, wie sie mir in solchen Auseinandersetzungen begegnet, hatte ich es mir schon früh zur Angewohnheit gemacht, meine Meinung nicht nur in solchen vergifteten Momenten für mich zu behalten. Im zweiten Schritt fragte ich mich, ob nicht die logische Schlussfolgerung daraus sein müsste, vollends und von vornherein auf die Bildung einer Meinung zu verzichten. Nicht nur, weil damit viel Zeit und Mühsal zu sparen ist. Sondern auch und vor allem wegen der unübersehbaren äußerlichen Folgen: Selbst in der Regel ausgeglichene Gesichter, deren Wesenszug sonst von stoischer Schönheit geprägt war, verzerrten sich durch jene Wortgefechte in schlimmste Fratzen des Entsetzens.
In dieser Hinsicht, und um Frau Hügel dieses fatale Los zu ersparen, war es fast schon von Vorteil, dass niemand ihrer Meinung widersprach respektive danach fragte, wie sie es denn anders als beleidigend gemeint haben könnte. Sie sammelte sich vielmehr, schüttelte den Kopf und ging gemessenen Schrittes, als habe sie sich bereits innerlich damit abgefunden, ausgerechnet die beste Schülerin ihres Kurses nun endgültig verloren zu haben, zur Tür und schloss diese behutsam, fast lautlos.
Ich hielt schon viel zu lange den Atem an, weil ich befürchtete, sie würde sofort wieder zu Kirstens Platz gehen, um das Bild noch einmal in Augenschein zu nehmen. Mit jedem Meter zurück durch den Raum in Richtung Tafel aber wurde klarer, dass sie völlig absichtlich nicht mehr auf die Zeichnung an sich zu sprechen kam, sondern eine ganze Kulturtheorie darüber auszubreiten begann, was sie eigentlich gemeint haben wollte, als sie so frei von Kirstens „Mut zur Hässlichkeit“ sprach.
»Ihr habt doch bestimmt in Französisch diesen berühmten Satz gehört, der unsere Vorstellungen von dem, was schön ist, sozusagen auf den Kopf gestellt hat und mit dem in meinen Augen die gesamte Moderne begann: Le beau est toujours bizarre. Nun war man immer sehr vorsichtig mit der Erklärung dessen, was Charles Baudelaire in seinem grandiosen Stück zur Weltausstellung 1855 in Paris mit dem Wort „bizarre“ gemeint haben könnte. Dabei ist es vieles, aber nicht allein fremd oder seltsam wie die Welt auf einem Album von Der Plan. Man muss nicht einmal zur Etymologie greifen, die Abstammung ist so exzentrisch und kurios wie das Wort selbst. Wie in jedem guten Essay sollten Sie wenigstens den Absatz bis zum Ende lesen, da erklärt Baudelaire es nämlich überdeutlich, und zwar in Abgrenzung eines Begriffs, der genau das beschreibt, was ihm am meisten verhasst ist: das Banale. Und als Verkörperungen des Bizarren stehen dagegen der Geschmack und die Individualität – kurzum der Stil. Und was ist das Hässliche mehr als das vermeintliche Gegenteil des Schönen, obwohl dieses erst durch jenes entsteht, sogar ein elementarer Bestandteil dessen ist.«
So hatte sie es also gemeint, natürlich ohne es zu sagen. Und auch jetzt vermied sie bewusst, es als Kompliment auszusprechen, selbst im Nachhinein konnte sie anscheinend dieses Eingeständnis nicht machen. So war es also um die vermeintliche Stärke der gefürchteten Frau Hügel bestellt, dass sie gleich im ersten Moment der Unsicherheit, in dem wir sie je erlebten, auswich und vermied, die Dinge beim Namen zu nennen.
Wenn es eine Qualität gibt, durch die sich Lehrer auszeichnen sollten, dann doch gerade die größtmögliche Unmissverständlichkeit: klare Aussagen, deutliche Worte, genaue Beschreibungen darüber, was sicher belegt und verbrieft ist. Sie sollten uns das Gefühl vermitteln, es gäbe ein Wissen, das sich anzueignen wert ist, weil es unverrückbar und felsenfest dasteht und nur darauf wartet, von uns verstanden und auswendig gelernt zu werden. Wie hatte es der Direktor des Gymnasiums in seiner flammenden Ansprache damals eindringlich gesagt? „Wir sind die Tinte, die in euren Füllern fließt, und jeder Tropfen, der sein Ziel auf dem Papier erreicht, wird von euch aufgesaugt, als würdet ihr ganz Löschblatt sein.“
Gerade weil das Bild schief war, behielt ich es in Erinnerung. Wenn man versuchte, es sich vorzustellen, sah man sich vor ein schier unauflösbares Rätsel gestellt. Waren wir nun das Löschblatt, oder führten wir den Füller mit der Lehrertinte auf dem Papier und zeigten so, was wir aus alldem machen konnten, das uns die Lehrer zur Verfügung stellten? Und nahm nicht jedes Löschblatt normalerweise nur das auf, was zu viel an Tinte auf dem Papier gelandet war und verschmieren würde, falls man es ausnahmsweise einmal nicht benutzte? Ging es am Ende für uns allein darum, das Überflüssige aufzunehmen, weil alles andere nur Illusion war, die darüber nicht hinwegzutäuschen vermochte, dass alles Lernen letztlich umsonst war? Und das Wissen sich darin erschöpfte, eben dies zu erkennen?
Als ich das erste Mal das Wort Löschblatt im Schreibwarengeschäft hörte, stellte ich mir darunter ohnehin etwas ganz anderes vor. Ich sah sogleich, wie sich das Geschriebene auf dem Papier durch Auflegen des Löschblattes langsam aufzulösen begann. Nach dem allmählichen Verschwinden der Buchstaben, ein wunderbarer Vorgang, der wie ein rückwärts abgespulter Film aussah, entstand eine ursprüngliche Reinheit, die mir ein Gefühl größter Genugtuung verschaffte, das ich zuvor nur vom Auswendiglernen oder Üben kannte.
Die unerbittlichen Exerzitien, welche ich als Klavierschüler in Form der Fingerübungen absolvierte und die alle anderen am Musikunterricht unerträglich fanden, beruhigten mich dank ihrer Monotonie fast so nachhaltig wie das Memorieren von Vokabeln. Der Zauber lag aber nicht nur in der Wiederholung der Tonfolgen, sondern in der absoluten Sicherheit der Erfüllung einer klar gestellten Aufgabe. Anders als beim Selbstporträt für Frau Hügel verlangte am Klavier niemand von mir, zu improvisieren. Denn das werkgetreue Nachspielen der Noten duldete im Grunde keinerlei Abweichung.
Genau das war es, wonach ich mich wie nichts sonst sehnte, weil Jugend an sich schon Zwielicht genug war, mit seiner Grauzone des Ungefähren, dieser unendlichen Dämmerstunde aus Andeutungen und lebensverachtender Ironie. Wem half es, dass Frau Hügel an dem Tag, als Kirsten verschwand, dank ihres kryptischen Vortrags eigentlich genau so war wie wir: auch nur eine Person mehr, die nicht sagte, was sie meinte oder dachte, unergründlich wie ein Tier?
Tiere haben mir immer Angst eingejagt. Wer tief genug in die Augen eines Tieres sieht, kommt nicht umhin zu erkennen, dass da in der Dunkelheit etwas ist, das wir nie ganz verstehen werden. Es ist das Getriebene ihrer Existenz, das sich besonders in dem Moment zeigt, wenn sie selbst in Panik geraten. Verdrehen sich dann ihre Augäpfel vor Furcht ins Weiße, tritt der Wahnsinn zutage, der sie im Inneren umtreibt. Und alles an Vertrautheit, was sich nach Jahren des Zusammenlebens mit einem Haustier aufgebaut hat, fällt plötzlich zusammen und weicht einer namenlosen Furcht vor dem Unberechenbaren.
Erst bei einem Besuch im Zoo fand ich das eine Tier, das mir entsprechen würde. Ob es an der Ruhe lag, die es ausstrahlte, oder der Langsamkeit seiner Bewegungen, kann ich bis heute nicht genau sagen. Jedenfalls war es mir sogar möglich, die seltsam ausgetrocknet wirkende Haut des Rüssels zu streicheln, ohne vor seinen tastenden Berührungen zurückzuschrecken, mit denen es sich für meine zärtliche Zuwendung bedankte. Wie mir Vater später erklärte, war der Elefant nicht nur das größte unter den Säugetieren an Land, sondern hatte auch keine Feinde in der Tierwelt. Doch darauf setzte er ein raunendes Wort an das Ende seines Satzes: oder?
Daran musste ich denken, als ich auf dem Umschlag von Carls Zeichenblock einen afrikanischen Elefanten mit Stoßzähnen und den riesigen, fast wie Flügel abstehenden Ohren entdeckte, worunter nun das Selbstporträt von Kirsten verborgen lag. Am Anfang der Stunde, bevor das Drama seinen Verlauf nahm, hatte ich mich einmal kurz nach ihr umgedreht, um sie nach einem Bleistift zu fragen. Meiner war abgebrochen, und auch die verzweifelten Versuche, seine Spitze durch emsiges Schälen der Holzspäne mit der stumpfen Klinge meiner veralteten Bleistiftmühle wieder zum Vorschein zu bringen, waren gescheitert. Da ich wusste, dass sie in ihrer Federmappe immer ein ganzes Arsenal an Stiften mit sich führte, traute ich mich, sie um Hilfe zu bitten.
„Ja klar, hier, greif zu. Ist noch von allem da. Was brauchst du: HB, B oder H?“
Ich weiß nicht, welcher Idiot aus der letzten Reihe es war, ich verachtete sie alle, aber einer, es war, glaube ich, Klotz, konnte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und sagte schneller, als ich je hätte antworten können: „Der Typ will dir ja wohl eher an den BH! Hahaha“.
Worauf er und alle Hinterbänkler mit ihm in ein lautes, dreckiges Lachen ausbrachen. Frau Hügel hatte für diese Art von Scherzen zum Glück weder Verständnis noch Geduld, wies Klotz mit einem aggressiven Zischen zurecht und verteilte an die ganze Reihe einen Gruppeneintrag.
Carl sah kurz angewidert nach hinten und wandte sich dann wieder seiner Zeichnung zu. Kirsten war puterrot im Gesicht und reichte mir alle drei Stifte, wobei sie die Augen niederschlug und ihren Kopf traurig senkte.
Ich habe die dunkelgrünen Faber-Castell-Bleistifte mit dem goldglänzenden Schriftzug und den fein ziselierten Zweigen hinter dem Namen nie mehr aus der Hand gegeben und hebe sie an einem besonderen Platz in meiner Schublade auf. Was es genau war, das mich darüber fantasieren hat lassen, ob sie auch auf einer Burg aufgewachsen sein könnte, vermag ich kaum zu sagen. Möglicherweise war es der Stammsitz der Faber-Castells seit 1761 auf der Innenseite des schmalen Metallkästleins, das ich von ihrem Tisch nach Ende der fatalen Kunststunde mitnahm, oder der Umstand, dass es von Kirsten kein einziges altes Foto für das Jahrbuch gab, weil ihre Familie sich allem, was mit der Gegenwart zu tun hatte, verweigerte. Sie besaßen, so ging das Gerücht, kein Auto, und die Reitstunde erreichte Kirsten angeblich von zu Hause aus mit dem Fahrrad.
Habe ich schon von ihrem Porträt gesprochen? Sie hatte sich mit schwarzem Reiterhelm gezeichnet, unter dem ihr skandinavisch geschnittenes Gesicht mit schrägem Blick nach rechts oben aus dem Bild sah.
Als kurz nach den letzten Worten von Frau Hügel die Klingel über die Flure schrill zum Schulende schellte, zuckte nicht nur ich entsetzt zusammen, als handele es sich um einen Probealarm. Alle wirkten schreckhaft und betreten, selbst die Hinterbänkler murmelten sich beim Herausgehen nur im Flüsterton ihre Verabredungen für den Nachmittag zu. Frau Hügel stand seltsam besorgt am Fenster und sah in den Hof hinunter, als hoffe sie, in der Menge irgendwo ihre verlorene Schülerin ausfindig machen zu können.
Nachdem ich meine Tasche gepackt hatte und mich zu Kirstens Platz umdrehte, fiel mir auf, dass sie wohl auch mit Buntstiften gearbeitet haben musste. Auf dem Löschblatt, das unter dem verschwundenen Porträt liegen geblieben war, hatte sie Farbprobenstriche in Gelb, Grün und Weiß wie kleine Blumensträuße verteilt. Weil ich Kirstens sogenannter Fehlpate war, was nichts weiter bedeutete, als dass wir für den anderen bei Abwesenheit Unterrichtsmaterial sammelten und uns gegenseitig die Hausaufgaben mitteilten, nahm ich ungefragt ihren Ranzen neben dem Stuhl und packte den Metallkasten für die Stifte dazu.
Als Carl seinen Zeichenblock zusammenraffte und sorgsam darauf achtete, dass das Blatt darunter nicht seinem Griff entglitt, wandte er sich kurz der Lehrerin zu: „Je nun. Auf Wiedersehen und bis morgen, es bleibt doch bei dem verabredeten Referat, nicht wahr, Frau Hügel?“
Sie drehte sich rasch zur Seite und sah uns entgeistert an. „Ganz genau. Bis morgen, Carl. Ich zähle dann auf Sie. Ah, ich sehe: Schön, dass sich jemand um Kirstens Sachen kümmert. Sie ist ja wohl schon gegangen und wird nach Hause gelangen. In diesem Sinn: bis morgen.“
Ohne dass ich es zuvor bemerkt hatte, waren wir die letzten im Kunstraum, und Carl nickte mit dem Kopf in Richtung der Tür. Es gehörte zu seinen wunderlichen Angewohnheiten, die Schulbücher nicht in einer Tasche zu transportieren, sondern mit einem alten Lederriemen zu umschnüren. Während wir durch das Steintreppenhaus nebeneinander nach unten gingen und das Bücherpäckchen an seiner Hand baumelte, begann er leise seine erste Unterhaltung mit mir.
„Sie ist uns nur vorausgegangen, was? Ich hätte nie vermutet, dass Frau Hügel sich für Mahler interessieren würde. Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen. Hast du auch gehört, was sie da gerade gesagt hast, oder habe ich jetzt Stimmen gehört und ins Dunkel gesehen?“
Weil ich nicht genau wusste, was er damit meinte, bejahte ich einfach und nickte ihm vorsichtig zu. „Es klang jedenfalls nicht nach ihrer üblichen Sprache. Irgendwie anders, so poetisch. Und dann wusste sie auch noch, dass Kirsten und ich Fehlpaten sind, obwohl wir bis jetzt immer beide da waren in ihrer Stunde.“
Carl sah mich ungläubig an, als hätte er mir eine Frage gestellt und ich etwas ganz anderes geantwortet. „Ach Fehlpate, wie niedlich. Was ihr alles hier habt. Deswegen trägst du also jetzt Kirsten ihre Sachen hinterher?“
Obwohl es abschätzig klang, war ich mir seltsam sicher, dass er es freundlich meinte, als Anerkennung meiner Fürsorge. „Ja, normalerweise.“
Er lächelte mich mit geschlossenem Mund von der Seite her an. „Und unnormalerweise? Würdest du eventuell in Erwägung ziehen, mir auf meinem Spaziergang nach Hause ein Stück weit Gesellschaft zu leisten?“
Da wir zwei in diesem Moment tatsächlich alles, was Kirsten an diesem Tag zur Schule gebracht und dort gemacht hatte, bei uns trugen, verband uns seit dem geschickten Manöver von Carl ein geheimes Band, das für mich mit jedem Schritt fester wurde. Weil auch das Wetter danach war, ein nahezu spätsommerlicher Frühherbststag, nahm ich die Einladung an und ging mit.
3
Weihrauch und Pfefferminz
Die Allee aus Kastanien führte schattenreich und schnurgerade in Richtung des Parks, der sich wie eine natürliche Begrenzung am östlichen Ende der Stadt entlangzog. Weil mich bald das ungute Gefühl beschlich, eigentlich alles, worüber wir uns hätten unterhalten können, sei schon gesagt, machte ich keinerlei Anstalten, unsere Unterhaltung fortzuführen, auch aus der Angst heraus, etwas Banales zu sagen und ihn damit zu enttäuschen, gleichsam seine Intelligenz zu beleidigen. Carl hatte es mit den wenigen Worten, die ich bis dahin aus seinem Mund gehört hatte, schon ganz zu Beginn in diesem zerbrechlichen Stadium unserer Freundschaft geschafft, mir tiefsten Respekt vor ihm zu verschaffen. Ich hatte den Eindruck, dass ich jegliches Geplänkel, das nicht wenigstens den Austausch von wichtigen Informationen betraf, gleich sein lassen konnte.
Alles, was Carl von sich gab, schien mir präzise in Gedanken vorformuliert zu sein, und jede seiner Sentenzen wirkte, als sei sie gesättigt mit mehreren Schichten an Bedeutung und aufschlussreichen Verweisen. Es verlieh ihm in meinen Augen den Charakter eines umherwandernden Orakels, das unentwegt Sinn in die Welt trug durch die Art, wie es sich äußerte. Aber er war auch dazu in der Lage, einem das Gefühl zu geben, Schweigen sei beredt genug. Es wäre also vollends in Ordnung, auf einem längeren Spaziergang eine Weile lang gar kein Wort miteinander zu wechseln, wie wir es an diesem Tag auf dem Weg zu ihm nach Hause taten. Es waren ja beileibe genügend Dinge geschehen, über die er genau wie ich, dessen war ich mir sicher, nachzudenken begonnen hatte. Die Stille hatte also nichts Künstliches oder Beklemmendes an sich, im Gegenteil, sie war der vollendete Ausdruck eines unausgesprochenen Einverständnisses.
Das Haus, in dem Carl wohnte, war an einem Platz gelegen, den vormals eine Straßenbahnlinie in der Mitte durchschnitten hatte. Obwohl die Schienen ringsherum schon lange Zeit überteert worden waren und das ganze Viertel zur verkehrsberuhigten Zone gehörte, war der Gleiskörper hier als Relikt einer anderen Zeit in die Architektur eingebunden. Mit einer Tafel gedachte man des Goldenen Zeitalters der Straßenbahn, die den angrenzenden Naherholungspark für die Bürger der Innenstadt problemlos und schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar gemacht hatte. Jetzt führten von zwei Seiten des Platzes Eingänge zu einer neuen U-Bahnstation hinunter, und ein altmodischer Zeitungskiosk mit klassizistischer Fassade stand inzwischen unter Denkmalschutz.
Als wir vor dem Haus Nummer sieben auf der Südseite zu stehen kamen, zeigte er zum Obergeschoss hinauf, dessen Fensterfront in der Mitte auf einen glasüberdachten Balkon führte.
„Fällt dir etwas auf?“, fragte er mit einem süffisanten Zug um den Mund.
Ich versuchte, nach Spuren seiner Präsenz in den Fenstern zu suchen, fand aber kaum etwas Bemerkenswertes. Über dem Dachgeschoss ruhte griechisch schlicht der Giebel, und vom Erdgeschoss aus führten zu beiden Seiten des Vorsprungs unter dem Balkon Säulenpfosten mit Kapillaren aufwärts, die durch blassroten Sandstein farblich von dem hellen Putz abgesetzt waren. In sparsam gesetzten Details schien klar die Vorliebe des Architekten für die Schlichtheit des dorischen Stils durch.
„Eigentlich kann man es auf den ersten Blick kaum erkennen. Siehst du den Architrav dort unter dem Balkon? Das Fensterpaar in der Mitte des ersten Stocks liegt deutlich niedriger als bei den Zimmern links und rechts. Ein Wunder, dass der Bauherr das damals so abgenommen hat.“
Ich verstand nicht gleich.
„Der Mezzanin schließt sich in der Regel eher dem Erdgeschoss an, aber zu meinem Glück gehört er hier zum zweiten Stock, in dem wir wohnen. Wenn du magst, zeige ich dir gleich, was ich meine.“
Wir betraten das kühle Steintreppenhaus, das mit seinem Mikroklima sofort eine beruhigende Wirkung auf mich ausübte, und stiegen flankiert von dem blank polierten Eichenholzhandlauf des Eisengeländers hinauf in den zweiten Stock. Doch als wir fast die letzte Biegung passiert hatten, blieb Carl vor einer gerahmten Fassung der „Zeichnenden Hände“ von M. C. Escher stehen. Eine Hand zeichnete darauf eine andere Hand, die wiederum die Hand zeichnete, von der sie gezeichnet wurde. Was mich an der Darstellung sogleich störte, war die Gleichgültigkeit des Schöpfers, mit der er über die Ungereimtheiten seines Werks hinweggesehen hatte. Es war der lieblose Übergang von den dreidimensional wirkenden Händen zu den nahezu völlig flachen Manschetten, an denen die beiden Hände zeichneten und die so eher einer mathematischen Figur als einem Hemdsärmel ähnelten. Carl hob das Bild, das auf Augenhöhe hing, vorsichtig an, und eine Art ausklappbarer Türgriff kam zum Vorschein. Erst dadurch fiel mir auf, dass die kassettierte Wand um das Bild herum die Form einer schmalen Tür entstehen ließ, die zu der verborgenen Abseite führte. Carl öffnete sie, duckte sich und bedeutete mit der Hand, ich möge ihm folgen.
„So, da wären wir. Introite, nam et hic dii sunt! Willkommen in meinem Kunstversteck! Nach dir, ich muss das Bild wieder aufhängen, damit wir auch ungestört bleiben.“
Bevor er mir Platz machte, betätigte er den Lichtschalter im Inneren, und ein mit kunstvoll abgeschliffenem Holz bis hin zur Decke vollends ausgekleideter Raum kam zum Vorschein, der wie eine alpine Miniatur-Blockhütte anmutete. In einer Ecke standen Kopf an Kopf zwei wild ornamentierte abgewetzte Ottomanen, auf dem gesamten Boden lagen mehrere karmesinrote Läufer übereinander, und ein mit giftgrünem Spieltischtuch eingefasster Servierwagen diente als Hausbar. Was mich am meisten beeindruckte, war der unvergleichlich angenehme Geruch des Raums, der offensichtlich keinerlei Fenster besaß. Es war eine Mischung aus Holz und kaltem süßlichen Weihrauch, die nach Honig, Wald, Tabak und Zeder zugleich duftete, mit einer zarten Note Terpentin und Ölfarbe, als habe ein Maler hier sein Atelier. Ich hörte, wie Carl die Tür mit sattem Klang zuzog, als schließe sich ein gut isoliertes Stoffportal.
„Gut, wie du siehst, kann man hier nicht wirklich stehen, aber wozu auch, wenn es sich so vorzüglich liegen lässt! Eines noch, ganz wie in Japan: Schuhe bleiben außen vor.“
Er verstaute sie sogleich im Vorraum, drückte mit der Hand gegen eines der Holzsegmente, und mit einem gedämpften Klicken öffnete es sich ihm entgegen, wodurch ein in die Wand eingelassenes Waschbecken mit indirekter Beleuchtung sichtbar wurde. „Vor dem Essen, nach dem Essen Hände waschen nicht vergessen, hat meine Großmutter immer gesagt. Und weil die Zeit für etwas Naschisch gekommen ist, gehe ich mal mit gutem Beispiel voran.“
Sogar gerollte Handtücher lagen wie in einem Hotel an der Seite bereit, und als er sich die Hände einschäumte, stieg mir sanft das Zitronengras-Aroma der Seife in die Nase. Während ich es ihm gleichtat, öffnete er eine andere Kassette in der Wand, und ein Kühlschrank tat sich auf. Bei einem Blick über die Schulter konnte ich erkennen, dass die drei Fächer darin mit Wasser, Sekt und dunkelgrünen Pralinenschachteln gleichermaßen befüllt waren. Er stellte eine davon, ich erkannte nun auch, dass es sich um After Eight-Pfefferminztafeln handelte, auf den Servierwagen und drückte ein weiteres Wandsegment auf, hinter dem sich ein polierter Samowar wie in einem japanischen Schrein verbarg.
„Weißt du, es gibt im gesamten 20. Jahrhundert eigentlich nur einen Künstler, den ich neben Max Beckmann ertragen kann, und das ist Balthus. Nach dem Grand Chalet, seinem letzten Wohnsitz und Malerschloss in Rossinière, habe ich diesen Raum hier gestaltet.“
Carl bemerkte, dass ich mich verwundert umsah.
„Ich weiß, kein Vergleich. Aber ich habe Kleine Helferlein zur Hand.“
Er zog ein hellblaues Pappschächtelchen mit Goldrändern und einem Pinsel-Emblem aus der Schublade des Servierwagens, auf dem in Versalien Atelier de Balthus geschrieben stand.
„Du hast doch hoffentlich nichts gegen Räucherstäbchen? Hier sind zwar, anders als im Chalet des 17. Jahrhunderts, keine 700 Kubikmeter Schweizer Tannenholz verbaut. Damals errichtete man so das größte Holzhaus in der Schweiz. Was indes den Wänden hier fehlt, ersetzt dieser exquisite Duft. Gleich wirst du riechen, was ich meine.“
Carl entzündete mit dem Streichholz eines der zerbrechlich wirkenden braunen Stäbchen, wartete, bis die Flamme emporloderte, wedelte sie mit der Hand aus und pustete danach so lange das glühende Ende an, bis es als orange leuchtendes Rund gleichmäßig Rauch in die Luft entließ. Der Wohlgeruch, der sich verbreitete, war in der Tat köstlich, auch wenn mir leicht übel davon wurde, als ob das schwere Parfum des öligen Malmittels einem wie das Original des Künstlers in seinem Alpenatelier den Atem verschlug.
Carl sah mich erwartungsvoll an: „Ein erstaunlicher Effekt, nicht? Wer die Augen schließt, sieht förmlich den Malerfürsten in seinem Holzpalast vor sich auferstehen mit allem, was ihn umgab; von der Ölfarbe über den Tabak bis zu den uralten Zitronenbäumen vor seinem Studio. Balthus war der Ansicht, der Künstler müsse als Handwerker ausschließlich der Natur dienen, und daher mit allen Mitteln versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden, so hat es einer seiner Interpreten einmal geschrieben. Einer Aufgabe, die zur größtmöglichen Demut vor der Natur erzieht, weil sie genuin als Frage der Moral zu begreifen ist. Wer sich in den Dienst des Sichtbaren stellt, kommt nicht umhin, das Naturschauspiel als dem Menschen überlegen zu erachten. Die Unsicherheit einer solchen Weltanbetung hat natürlich etwas von Kunstreligion. Balthus bemerkte in diesem Sinn, der göttliche Ursprung der Schönheit sei in der Schöpfung selbst offenbart, indem der Herr sich an der Natur als seinem Werk erfreue, Rilke würde sagen: Mir zur Feier. Eine Tasse Tee gefällig?“
Was Carl auch äußerte war wohlüberlegt und bedeutungsvoll formuliert. Ich war geblendet von der Allgegenwart seiner Gedanken, die nicht nur wie das geschriebene Wort klangen, sondern genug Sinn ergaben, um aus einem schlauen Buch stammen zu können. Weil ich nie zuvor einen Menschen so hatte reden hören, wurde mir allein von dem Versuch, seinen Ausführungen zu folgen, schwindlig. Fast schien es, als verfolge er mit jedem Wort, das er sagte, ein Ziel, auf das alles hinauslief, dessen Umrisse für mich jedoch umso weiter in einem dichter werdenden Nebel verschwanden, je länger ich über sie nachzusinnen imstande war.
Ich musste von der allgemeinen Verwirrung, in der ich mich befand, in einen Zustand derartiger Erschöpfung geraten sein, dass es mir peinlicherweise entgangen war, wie ich den Tee nurmehr schlürfend zu mir nehmen konnte. Aber auch diese unangenehme Situation vermochte Carl diplomatisch durchdacht zu entzerren, indem er mein Missgeschick als Ausdruck von Kennerschaft zu interpretieren vorgab: „Was vermag der Teetester an Gewürzen herauszuschmecken, wenn ich fragen darf?“
Ich war nie zuvor mit der anspruchsvollen Aufgabe betraut worden, Geschmacksnoten zu identifizieren, aber zum Glück erkannte ich wenigstens etwas, das mir bekannt vorkam: „Eine gehörige Portion Vanille, es schmeckt aber auch ein wenig nach Wiese.“
Er hob seine Augenbraue und nickte mir wohlwollend zu. „Gar nicht schlecht für den Anfang, was? Der Kompositeur dieses Grünen Tees hatte in der Tat gemalte Landschaften vor Augen, als er den Thé des Impressionnistes kreierte. Vanille, gewiss, aber auch einen Hauch Jasmin, weiße Blütenmeere, in denen Nuancen von Malve und Lavendel wogen. Manche freilich meinen, sogar Marshmallows schmecken zu können und verzichten daher gänzlich auf Zucker und Sahne.“
Als ich auf das schmale weiße Porzellanutensil deutete, in dem das Räucherstäbchen fast abgebrannt war, weil ich voller Sorge sah, wie sich ein schlieriger brauner Rand um den glühenden Stumpf gebildet hatte, winkte Carl ab: „Kein Grund zur Beunruhigung: Diese handgedrehten Kostbarkeiten sind von den Koh-shis auf der japanischen Insel Awaji fabriziert worden, die seit 1850 als Meister des Weihrauchs gelten. Sie hinterlassen auf dem Porzellan nach dem Auswischen der Halterung für die Stäbchen keinerlei Spuren. Hier, nimm doch lieber noch ein After Eight und mache es dir ein wenig bequem. Ich liebe sie eigentlich fast nur für die schwarz glänzenden Tütchen, in denen sie vor sich hinschlummern, bevor wir sie verzehren dürfen.“
Ich legte die Hülle, nachdem ich die Minztafel in meinen Mund hatte gleiten lassen, um sie langsam zum Schmelzen zu bringen, neben die Teetasse auf den Servierwagen und strich sie glatt, worauf Carl sanft protestierte: „Halt, es geht um das herrlich knisternde Geräusch: Hör mal hin!“.
Er zerknüllte eine Hülle und warf sie geschickt in seine leere Tasse. Dann nahm er sich die nächste.
„Sie machen sofort süchtig, diese kleinen Bösewichte. Und sieh dir die Musterung auf ihrer Oberfläche an. An was erinnert dich das? Sprich, Mnemosyne!“
Da mir an After Eight bis dahin nur aufgefallen war, dass jedes Mal, wenn sich die Packung dem Ende zuneigte, entgegen meiner Erwartung noch ein volles Tütchen zum Vorschein kam zwischen all den leer gegessenen, ich diese Beobachtung aber zu trivial fand, um sie mit Carl zu teilen, blieb ich lieber stumm.
„Wie dir vielleicht aufgefallen ist: After Eight hat in der Kekswelt einen fast ebenso wohlschmeckenden Doppelgänger: Afrika!“
Natürlich kannte ich die Waffelblätter mit Schokoladenüberzug, deren Musterung ich als Kind wegen des verheißungsvoll klingenden Namens immer als naturgetreues Abbild der Rinde eines Affenbrotbaums vor mir gesehen hatte. Erst dank Carl fiel mir auf, wie täuschend ähnlich es der welligen Struktur auf den Minzblättern tatsächlich war.
Er öffnete eine weitere Geheimtür, hinter der ein Schallplattenspieler zum Vorschein kam. Aber keines dieser eingestaubten Nostalgiegeräte, sondern ein Modell, das ich sonst eher mit Diskotheken verband: ein Technics SL 1200 MK7. Er setzte die Nadel auf die bereitliegende Platte, und wie in dem Schaufenster, wo ich das Gerät zum ersten Mal in Ruhe betrachtet hatte, konnte ich mich wieder nicht daran sattsehen, wie sich die Tempokästchen im orangefarbenen Seitenlicht am Plattentellerrand ganz langsam adjustierten, bevor sie gleichzeitig vor- und rückwärts zu laufen schienen.
Carl schloss die Tür, und bald hob aus sorgsam verborgenen Lautsprechern in leisen Akkorden eine erstaunlich melancholische Klangfolge an, die mir, wie ich erleichtert feststellte, nicht ganz unbekannt war.
„So, mein Lieber, nun sehen wir uns doch mal auf einem zu fragwürdigem Ruhm gelangten Selbstporträt an, wie Mut zur Hässlichkeit genau aussieht.“






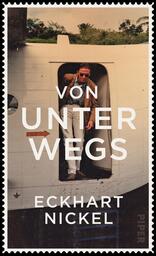
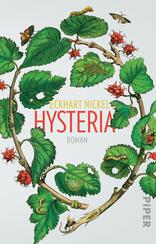












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.