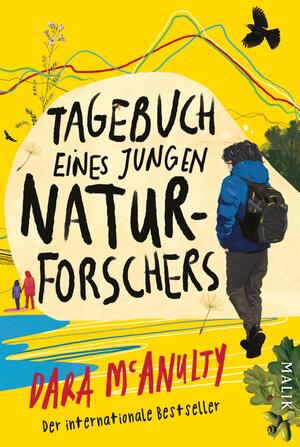
Tagebuch eines jungen Naturforschers - eBook-Ausgabe
Tagebuch eines jungen Naturforschers — Inhalt
Tagebuch eines außergewöhnlichen Teenagers
„Ich war fünf, als bei mir das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Mit sieben wusste ich, dass ich anders bin als andere. Ich hatte mich daran gewöhnt, für mich zu sein und nicht in die Welt derer durchzudringen, die sich über Fußball oder Minecraft unterhielten. Dann begann die Phase des Mobbing. Und die Natur wurde für mich überlebenswichtig.“
Der junge Autor, Autist und Umweltschützer aus Nordirland Dara McAnulty erzählt von einem Jahr mit und in der Natur. Wenn Dara (irisch für „Eiche“) über Seeigel, Schmetterlinge, Eisvögel oder das Moos an den Bäumen schreibt, findet er eine ganz eigene, berührende Sprache. Das kraftvoll-poetische Tagebuch dieses ungewöhnlichen Teenagers wurde in England zum Lieblingsbuch der LeserInnen und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Leseprobe zu „Tagebuch eines jungen Naturforschers“
Vorwort
Dieses Tagebuch hält fest, wie meine Welt sich verändert, von Frühling bis Winter, bei uns zu Hause, in der Wildnis, in meinem Kopf. Es begleitet mich vom County Fermanagh im nordirischen Westen ins County Down im Osten. Es zeigt die Entwurzelung durch den Umzug, den Wechsel von County und Landschaft und die zwischenzeitliche Heimatlosigkeit auch meiner Sinne und Gedanken. Mein Name ist Dara, im Irischen bedeutet das „Eiche“ und ist in meinem Fall ein Jungenname. Als Baby nannte Mum mich lon dubh, das heißt Amsel, was sie heute noch manchmal tut. [...]
Vorwort
Dieses Tagebuch hält fest, wie meine Welt sich verändert, von Frühling bis Winter, bei uns zu Hause, in der Wildnis, in meinem Kopf. Es begleitet mich vom County Fermanagh im nordirischen Westen ins County Down im Osten. Es zeigt die Entwurzelung durch den Umzug, den Wechsel von County und Landschaft und die zwischenzeitliche Heimatlosigkeit auch meiner Sinne und Gedanken. Mein Name ist Dara, im Irischen bedeutet das „Eiche“ und ist in meinem Fall ein Jungenname. Als Baby nannte Mum mich lon dubh, das heißt Amsel, was sie heute noch manchmal tut. Mein Herz ist das eines Naturforschers, mein Kopf der des Wissenschaftlers, der ich werden will, und meine Knochen sind alt und morsch und ächzen, wenn ich sehe, wie gleichgültig und grob wir mit der Natur umgehen. Der Fluss aus meiner Feder zeigt meine Verbundenheit mit Flora und Fauna, erklärt möglichst klar meine Sicht auf die Welt und erzählt, wie wir als Familie alle Stürme überstehen.
Ich begann mit dem Schreiben in einem sehr einfachen Bungalow, in einer Wohngegend mit vielen Familien, die ihre Kinder nie raus vor die Tür ließen, und älteren Leuten, deren Brut bereits ausgeflogen war, die ihren Garten und den Rasen mit einer Schere stutzten – ja, das habe ich tatsächlich gesehen. In dieser Umgebung bildeten sich langsam erste Sätze, dort rang auf dem Blatt die Verzückung mit dem Frust, und dort verwandelte sich in den Frühlings- und Sommermonaten unser Garten (anders als die anderen in unserem kleinen Straßenwinkel) in eine Wiese mit Wildblumen, Insekten und einem in den hohen Gräsern aufgestellten „Bee and Bee“-Schild für geflügelte Gäste, ein Ort, an dem unsere Familie stundenlang die Üppigkeit der Natur beobachtete, die anderen Gärten fehlte, ohne dass wir den Nachbarn, die hin und wieder mit hochgezogenen Brauen hinter ihren Vorhängen hervorschauten, irgendwelche Beachtung schenkten.
Seitdem sind wir umgezogen, haben das Land durchquert und haben uns – nicht zum ersten Mal – ein neues Zuhause eingerichtet. In meinem noch nicht so langen Leben waren wir Nomaden schon an vielen Orten zu Hause. Doch egal, wo wir uns niederlassen, unser Haus ist immer voll mit Büchern, Schädeln, Federn, Politik, heftigen Debatten, Tränen, Gelächter und Freude. Manche Menschen meinen, dass Wurzeln durch Steine und Mörtel entstehen, aber unsere wachsen wie unterirdische Pilzgeflechte in alle Richtungen, verbinden sich zu einem Grundstock gemeinsam gelebten Lebens, sodass wir, egal wohin wir gehen, immer verwurzelt bleiben.
Meine Eltern stammen beide aus dem Arbeitermilieu und waren in ihren Familien die erste Generation, die zur Uni ging und dort Abschlüsse machte, und sie folgen nach wie vor ihrem Ideal, diese Welt besser machen zu wollen. Das heißt, wir haben keinen materiellen Reichtum, aber sind, wie Mum sagt, „in anderer Hinsicht reich“. Dad ist – und war immer – ein Wissenschaftler (erst Meeresforschung, jetzt Naturschutz). Er hat das geheime Wissen der Wildnis für uns lebendig gemacht und uns die Rätsel der Natur erklärt. Mums berufliche Laufbahn ähnelt der Herangehensweise, wie man am besten einen Strom durchquert: nie gradlinig. Musikjournalismus, Freiwilligenarbeit, Uni – auch heute macht sie immer noch ein bisschen von alldem, während sie nebenbei meine neunjährige Schwester Bláthnaid zu Hause unterrichtet. Bláthnaids Name bedeutet „die Blühende“, und im Augenblick ist sie Expertin für Feen, kann aber auch viel zu Insekten sagen, hält sich Schnecken und repariert alle Elektrosachen im Haus (worüber Mum gewaltig staunt). Ich habe auch einen Bruder, Lorcan – „der wild Entschlossene“ –, der dreizehn ist. Lorcan hat sich selbst beigebracht, Musik zu machen, und erzeugt damit bei uns immer wieder große Verzückung und zugleich Verwirrung. Er ist außerdem ein Adrenalinjunkie – was bedeutet, er rennt Berge herunter, springt von Steilküsten ins Meer und geht überhaupt mit der Energie eines Neutronensterns durchs Leben. Dann ist da noch Rosie, eine vor dem Einschläfern gerettete Greyhound-Dame, die unter heftigen Blähungen leidet und die wir 2014 adoptiert haben. Ihr Fell ist gestreift, sie ist unsere Tigerhündin. Wir nennen sie auch „Kissen auf vier Beinen“, und sie ist eine großartige Gefährtin und Stresskillerin. Ich, nun ja, ich bin der Nachdenkliche, meine Hände sind immer schmutzig und meine Taschen vollgestopft mit toten Dingen und (manchmal) mit Tierkot.
Bevor ich mich hingesetzt und dieses Tagebuch verfasst habe, hatte ich bereits einen Blog im Internet geschrieben. Ein größeres Grüppchen Menschen mochte den und sagte mehr als einmal, ich sollte doch ein Buch schreiben. Was ziemlich erstaunlich ist, da ein Lehrer meinen Eltern einmal sagte, „Ihr Sohn wird Texte nie in ihrer Gänze verstehen, geschweige denn einen durchgehenden Absatz schreiben können.“ Und doch mache ich das jetzt. Meine Stimme brodelt und steigt auf, wie bei einem Vulkan, und all mein Frust und meine Leidenschaften können beim Schreiben ausbrechen – hinaus in die Welt.
Unsere Familie verbinden nicht nur Blutsbande, wir sind auch alle autistisch, alle bis auf Dad – er ist der Sonderling, und von ihm hängen wir ab, damit er uns nicht nur die Mysterien der Natur, sondern auch die des Menschen verrät. Zusammen sind wir ein verschrobener, chaotischer Haufen. Und sind wohl ganz schön beeindruckend. Dicht aneinandergeschmiegt wie die Otter ziehen wir zusammen hinaus in die Welt.
FRÜHLING
Mein Träumen in der Dunkelheit wird unterbrochen. Ich bin irgendwo zwischen Auftauchen und Atemschöpfen, als ein Flöten in mein Bewusstsein dringt. Die Wände meines Zimmers lösen sich auf. Der Raum zwischen Bett und Garten schrumpft, wird eins. Ich stehe auf, ohne mich zu rühren, gehalten von der Schwere des Schlafs. Die Töne rieseln weiterhin auf meine Brust. Jetzt sehe ich vor dem inneren Auge die Amsel: Ihre Reviersonaten schallen durch den frühen Morgen, die Testosteron-Pfeile schwirren. Eingetaucht in die Musik, rattern in meinem wachen, denkbereiten Hirn die Gedanken los.
Der Frühling ist von Raum zu Raum verschieden, aber für mich liegt der größte Zauber in allem Seh- und Hörbaren, das zwischen Himmel und Wurzeln meinen Alltag umgibt. Der Frühling ist die Froschfrau, die ganz zu Beginn unserer Zeit in diesem Haus unsere Pfade kreuzte – unsere erste Begegnung hatten wir mit einem Klecks rasch auf Asphalt gesetzten Laich, dessen unsichtbaren Weg die Moderne durchkreuzte. Besorgt schufen wir voller Hoffnung ein feuchtes Asyl: Wir setzten einen Eimer Wasser in die Erde und bestückten ihn zum Ein- und Ausstieg mit Tontopfscherben, Kieseln, Pflanzen und einigen Stöcken. Wir wussten nicht, ob es funktionieren würde. (Um tiefer zu graben, hätten wir für den Blocklehm, mit dem unser Vorortgarten in Enniskillen gesegnet war, einen Bagger gebraucht.) Im darauffolgenden Jahr kam es aber zu einer zweiten Begegnung, als nämlich unsere amphibische Freundin beschwingt durchs Gras tanzte, Gesellschaft von einem zweiten Frosch bekam und uns zum Geschenk eine Ladung Froschlaich im Asyl-Eimer hinterließ. Wir jubelten, und unsere Freude war bis an den Fuß des Hügels zu hören, wo sie einen Moment lang das Rauschen des Autoverkehrs nach Sligo oder Dublin übertönte und sogar das Rumpeln und Rattern des nahen Betonwerks.
Die Ebbe und Flut der Zeit bringt in vertrauter Folge alljährlich Wunder und Funde hervor wie zum allerersten Mal. Die prickelnde Erregung hört nie auf. Neues ist immer lieblich.
Hain-Veilchen kommen als Erste hervor, genau wenn die Sperlinge Moos aus den Regenrinnen herauswühlen und die Luft sich plustert wie die Brust eines Rotkehlchens. Löwenzahn und Butterblume scheinen auf wie Sonnenstrahlen, zeigen den Bienen, dass es nun sicher ist, endlich auch herauszukommen. Kommt der Frühling, will ich jedes Wiederaufleben sehen. Bláthnaid feiert ihn jeden Tag, indem sie die Gänseblümchen zählt, und wenn es ausreichend viele für einen Kranz sind, wird sie zur „Frühlingskönigin“ – und falls noch welche übrig sind, macht sie noch ein Armband und einen passenden Ring zur Vervollständigung der Dreifaltigkeit. Manchmal reichen, wie durch Zauberei, die Gänseblümchen für eine ganze Wochenproduktion an Schmuck und Amuletten, dann bedenkt sie, hier und dort, das ganze Haus mit ihren Gänseblümchengeschenken.
Mir wurde mehr als einmal erzählt, ich sei ein Aurorababy gewesen, das zum Tagesanbruch wach war. Ich kam im Frühling zur Welt, und meine ersten Morgen waren – dem wachsenden Körper und Geist zur Nahrung – begleitet von der Sonate der Amselmännchen. Vielleicht war ihr Gesang das erste Locken der Wildnis. Mein Ruf. Ich denke oft an den heiligen Kevin, Caoimhín, stelle mir vor, wie er dasteht, mit vorgestreckter Hand, und darin ein Amselnest hält, bis das eine Junge flügge ist. Caoimhín von Glendalough war ein Einsiedler, der Trost in der Natur suchte. Als ihn immer mehr Menschen aufsuchten, um sich bei ihm Rat zu holen und seine Lehre zu hören, bildete sich nach und nach eine Klostergemeinschaft.
Ich liebe die Geschichten von Caoimhín, vielleicht auch, weil Caoimhín der Heiligenname ist, den ich mir zur Konfirmation ausgesucht habe. Obwohl ich jetzt weiß, dass dies vor allem meinem Erwachsenwerden dienen sollte, ist mir der Name immer noch wichtig, umso mehr, da seine Geschichte zeigt, wie wir, auch wenn wir gar nicht wollen, die Wildnis stören und das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur verändern. Das Gefühl hatte Caoimhín, als ihm immer mehr Menschen folgten, vielleicht auch.
Die Fülle der Töne. Ich höre sie auch aus dem vollsten Luftraum heraus. Sie sind der Beginn von allem, das Erwachen von so vielem. Das Lied trägt mich weiter in die Vergangenheit: Ich bin drei und lebe entweder in meinem Kopf oder unter den kriechenden, krabbelnden, flatternden Dingen der Wildnis. Sie alle sind mir verständlich, anders als die Menschen. Ich warte darauf, dass die Morgenröte ins Schlafzimmer meiner Eltern scheint.
Lorcan liegt zwischen Mum und Dad eingebettet. Ich lausche auf die Töne, und sie beginnen, sobald die erste Portion Licht auf den Vorhang trifft. Goldene Schatten enthüllen die Gestalt, auf die ich gewartet hatte: die horchende Amsel auf dem Küchenanbau, ein prächtiger Bote auf dem Dach der Schlafenden und Wachenden.
Als die Amsel kam, konnte ich erleichtert aufseufzen. Es hieß, der Tag hatte wie alle anderen begonnen. Es gab Gleichmäßigkeit. Alles ging seinen festen Gang. Und jeden Morgen lauschte ich, berührte die Schatten und wollte weder die Vorhänge aufziehen noch jemanden wecken. Nie wollte ich den Moment zerstören. Ich konnte den Rest der Welt mit seinem Gehetze und Gewühle, seinem Krach und Trubel nicht hereinbitten. Also lauschte ich und beobachtete – die winzigen Bewegungen von Schnabel und Rumpf, die langen Linien der Telefondrähte, die dreißigsekündigen Pausen zwischen den Strophen.
Ich wusste, dass „mein“ Vogel das Männchen war, denn einmal, nur einmal, schlich ich die Treppe hinunter und schaute durch die Verandatüren hinauf. Dort saß es, starr und grau, doch war es dort und war immer dort. Ich zählte jeden Takt und prägte ihn mir ein, dann schlich ich die Treppe wieder hinauf und beobachtete wieder das Schattenspiel auf dem Vorhang. Das Amselmännchen war der Dirigent meines Tages, jeden Tag, für eine scheinbar lange Zeit. Dann hörte es auf, und ich dachte, meine Welt zerbricht. Ich musste mir eine neue Aufwachbeschäftigung suchen, und ich begann lesen zu lernen. Zunächst Bücher über Vögel, dann über alle wild lebenden Tiere. Die Bücher mussten naturgetreue Bilder und viele Informationen haben. Die Bücher halfen mir, eine Brücke zum Amseltraum zu bauen. Sie verbanden mich physisch mit dem Vogel. Ich lernte, dass nur Amselmännchen mit so viel Hingabe singen und dass Vögel singen, wenn sie einen Grund dazu haben, etwa um ihr Revier zu verteidigen oder das andere Geschlecht anzuziehen. Sie sangen nicht für mich oder irgendjemanden sonst. Das Ausbleiben des Gesangs im Herbst und Winter war traumatisch, doch das Lesen lehrte mich, die Amsel würde zurückkehren.
Der Frühling bewirkt etwas in uns. Alles schwebt. Man kann nicht anders, als sich nach oben und nach vorn zu bewegen. Es gibt mehr Licht, mehr Zeit, mehr zu tun. Jeder vergangene Frühling verschmilzt zu einer Collage und birgt so viel Materie in sich, so viel Gewicht. Der erste erinnerbare Frühling brannte sich tief und lebhaft in mich ein: Er war der Beginn einer Faszination für die Welt außerhalb von Wänden und Fenstern. Alles in ihm drängte mit zarter Kraft, bettelte, ich solle lauschen und verstehen. Die Welt wurde mehrdimensional, und erstmalig verstand ich sie. Ich spürte jedes Teilchen und konnte in sie hineinwachsen, bis es keine Unterscheidung mehr zwischen mir und dem Raum um mich herum gab. Würde sie doch nur nicht durchbohrt von Flugzeugen, Autos, Stimmen, Anweisungen, Fragen, sich wandelnden Gesichtszügen und schnellem Geplapper, mit dem ich nicht Schritt halten konnte. Ich zog mich vor diesem Lärm zurück und vor der Menschenwelt, die ihn machte; ich öffnete mich in Gesellschaft von Bäumen, Vögeln und an kleinen abgelegenen Orten, die meine Mum instinktiv in Parks, Wäldern und an Stränden regelmäßig für mich fand. An diesen Orten kam ich offensichtlich aus mir heraus: den Kopf konzentriert zur Seite geneigt, mit sehr ernstem Gesichtsausdruck sog ich ein, was ich sah, hörte.
Ich blende mich plötzlich aus und ein, merke, es liegt am Licht draußen, der morgendliche Chor ist verstummt. Der Zauber gebrochen. Es ist Zeit für die Schule. Heute fühlt es sich an, als würden die Dinge sich ändern. Bald werde ich mein vierzehntes Lebensjahr vollenden, und das Amselmännchen, der Dirigent meines Tages, ist genauso wichtig wie damals, als ich drei war. Ich bin immer noch versessen auf Gleichmäßigkeit. Alles muss seinen festen Gang gehen. Die einzige Veränderung ist eine andere Art des Erwachens: mein Bedürfnis, über die Tage zu schreiben, was ich sehe, wie ich mich fühle. Zum Ansturm des Lebens, zu den Prüfungen und Erwartungen (wobei die höchstens meine eigenen sind), kommt der Fluss aus meiner Feder hinzu, und der wird für mich zum verbindenden Zahnrad zwischen Wachheit und Schlaf und der sich drehenden Welt.
Mittwoch, 21. März
Wenn es März wird, kommen eigentlich Farben und Wärme, aber heute stehe ich bei uns im Garten wie eingeschlossen in eine Schneekugel. Die eisigen Flocken beißen, schnappen die gestrige Helligkeit fort. Die plötzliche Kälte bedeutet eine schwere Zeit für unsere Gartenvögel. Sie gehören für uns zum erweiterten Familienkreis, also laufe ich schnell zum Gartencenter die Straße runter, kaufe einen Nachschub an Mehlwürmern und fülle die Futterhäuschen vor dem Küchenfenster ganz auf; die Futterhäuschen hängen gute dreieinhalb Meter vom Haus entfernt, um eine klare Grenze zwischen nachbarschaftlicher Privatheit und Invasion zu ziehen. Nur wenige Tage zuvor haben unsere Blaumeisen die Nistkästen inspiziert, ihr Gezwitscher im Garten ist ein Konzert der Vorfreude gewesen. Und jetzt das. Vögel sind widerstandsfähig, aber dieser Temperaturabfall bereitet uns allen Sorgen.
Es ist schwer zu glauben, dass wir noch letzte Woche das Flüstern wärmerer Tage gespürt haben, als wir in den Ästen einer alten Eiche im Castle Archdale Country Park saßen, unweit von Dads Büro. Viele Menschen führen meine Liebe zur Natur auf ihn zurück. Er hat bestimmt viel zu meinem Wissen und meiner Achtung vor der Natur beigetragen, aber mein Gefühl sagt mir, dass die Verbindung bereits entstand, als ich noch in Mums Bauch war und die Nabelschnur mich nährte. Natur und Nahrung – es muss eine Mischung von beidem sein. Vielleicht ist Naturliebe angeboren, und ich kam damit zur Welt, aber ohne die Ermutigung durch Eltern und Lehrer und den Zugang zu etwas Wildnis gelangt sie nicht dauerhaft in den Alltag.
Mein Name, Dara, bedeutet im Irischen wie gesagt „Eiche“, und oben in den Ästen des majestätischen Baums spürte ich den Puls eines Lebens, das seit fast fünfhundert Jahren im Boden von Castle Archdale gewachsen ist, und klammerte mich an einen Zweig meiner Kindheit.
Bei uns im Garten beobachte ich einen Buchfinken mit Konfetti-Sprenkeln auf seiner silbernen Kappe. Er sitzt auf einem Ast unserer Zypresse, einem immergrünen, jetzt schneeweiß bepuderten Gewächs. Die pfirsichrote Brust des Buchfinken wölbt sich vor, als sich ein Girlitzpaar zu ihm gesellt – der eine zitrusgelb und schwarz, der andere fein getupft mit zierlich zinngelben Flecken. Das Rotkehlchen beherrscht die Szene, wie immer, stolziert prahlerisch herum, um alle Eindringlinge auf Distanz zu halten. Zuvor hatte es ein Geraufe zwischen vier Männchen und einem Weibchen gegeben, bei dem die Federn flogen und Köpfe gepickt wurden – Rotkehlchen sind so aggressiv, dass sie ihre Gegner angeblich am Genick verletzen, doch frage ich mich, ob sie das auch in Gärten tun, in denen es Samen, Nüsse und wunderbare Mehlwurmhäppchen in großer Menge gibt. Reichlich für alle.
Eine Singdrossel spielt Himmel und Hölle im Schnee, hüpft herum, holt sich die von uns verstreuten Samen. Das helle Rot halb gegessener Äpfel wird entdeckt: Die Drossel pickt, Saft kommt heraus, ich lächle. Die Zeiten im Jahr, zu denen die Drossel da ist, sind seltsam und in einer Weise unvorhersehbar, die mich in der Vergangenheit frustriert und gequält hätte. Doch jetzt habe ich gelernt, die unverlässliche Drossel zu rationalisieren und alle Begegnungen zu schätzen, ohne Bindung und Erwartungen. Na ja, so ungefähr.
Am Abend feiern wir Dads Geburtstag, als wäre es ein Wassailing, ein Wintersingen: Wir singen und tanzen und spielen (schlecht) auf unseren Tin Whistles, machen schrille Töne, erbitten das Ende der dunklen Tage und wünschen uns Licht. Mum hat für ihn gebacken – Victoria Sponge, seinen Lieblingskuchen.
Sonntag, 25. März
Ich finde den letzten Teil des Winters frustrierend, und die Warterei, bis wir durch das Tor hindurch in Farbe und Wärme reisen, kehrt meine schlimmste Eigenschaft hervor: Ungeduld! Heute aber können die Wärme der Luft und das Summen und Surren überall meine Unruhe lindern. Endlich scheint der Frühling den weichenden Schatten des Winters zu entkommen.
An diesem Morgen sind wir alle unterwegs zu einem unserer liebsten Orte: zum Big Dog Forest, einer Sitkafichten-Schonung nahe der irischen Grenze, etwa eine halbe Stunde von unserem Zuhause, oben in den Hügeln, mit Inseln von Weide, Erle, Lärche und im Mittsommer Sträuchern voller Heidelbeeren. Von den beiden Sandsteinhügeln – Little Dog und Big Dog – heißt es, sie wären durch einen Zauber aus Bran und Sceolan entstanden, den beiden riesigen Jagdhunden des legendären Fionn Mac Cumhaill, des Jäger-Kriegers und letzten Anführers der mythischen Fianna. Laut der Sage haben Fionns Hunde bei der Jagd die Fährte der bösen Hexe Mallacht aufgenommen und jagten ihr nach. Die Hexe floh und verwandelte sich in einen Hirsch, um schnell voranzukommen, doch das Bellen kam immer näher, weshalb Mallacht die beiden Hunde mit einem mächtigen Zauber in Little Dog und Big Dog verwandelte, die Hügel, die wir heute hier sehen.
Ich mag sehr, wie Namen Geschichten über das Land erzählen und wie durch alte Geschichten Vergangenheit lebendig bleibt. Genauso faszinieren mich wissenschaftliche Erklärungen, mit denen Geologen solche Mythen sprengen: Der Sandstein der Hügel ist härter als der umgebende Kalkstein, und als der Kalk durch Gletschererosion abgetragen wurde, blieb nur der Sandstein übrig und überragt jetzt das verbliebene Geschiebe der Eiszeit.
Ich entdecke Huflattich, Sonnenexplosionen im aufgewühlten Boden. Weißschwänzige Hummeln trinken und sammeln begierig. Löwenzahn, Gänseblümchen und ihre Verwandten aus dem Clan der Korbblütler sind oft die ersten Blütenpflanzen, die sich im Frühling zeigen, und sind für die Artenvielfalt unglaublich wichtig. Ich beknie jeden, den ich treffe, ein Fleckchen für diese Pflanzen im Garten brach zu lassen – das kostet nicht viel, und jeder kann es tun. Da die Natur an den Rand unserer zugebauten Welt gedrängt wird, sind kleine Inseln Wildnis eine gute Gegenaktion.
Manchmal scheinen Gedanken und Worte in meiner Brust festzusitzen – doch selbst wenn sie gehört und gelesen werden, wird das irgendetwas ändern? Die Vorstellung schmerzt mich und gesellt sich zu den anderen Gedanken, die immer in meinem Gehirn herumkämpfen und die Freude am Moment zerstören.
Das Klackern eines Schwarzkehlchens bringt mich dahin zurück, wo ich sein sollte, nämlich im Wald, und es sieht so aus, als ließe der Vogel winzige Schottersteinchen auf den Weg fallen. Ich starre auf den Weg, über den das Licht hinwegfährt, und merke, dass alles sich irgendwie regt. Sogar ein steiniger Pfad kann sich bewegen und durch den Lichteinfall und die Schatten vorbeifliegender Vögel verändern. Jeder Moment ist ein Bild, das es nie wieder genauso geben wird. Ich schaue, fasziniert, ohne mich darum zu kümmern, was Betrachter denken könnten, da wir üblicherweise den Ort hier für uns allein haben. Ich kann hier ich selbst sein. Wenn ich möchte, kann ich mich hinlegen und auf den Boden starren. Und während ich so starre, kommt mir zwangsläufig irgendein Lebewesen vor die Nase: Diesmal ist es eine Assel, die von nirgendwo nach irgendwo spaziert. Ich biete ihr die Spitze meines Fingers an, und sie kitzelt mich. Ich mag das Gefühl, ein Lebewesen in der Hand zu halten. Dabei geht es mir nicht um die Verbindung, die ich spüre, sondern um die Neugierde, die ich stillen kann. Sobald ich genau hinschaue, saugt der Augenblick mich ein – wieder und wieder ist es ein perfekter Moment. Aller Lärm verschwindet aus der Umgebung. Ich gehe zum Gras und senke behutsam meinen Finger in die Halme: Die Assel verschwindet im Gestrüpp.
Bláthnaid und Lorcan eilen voraus zur Kuppe des Hügels, der dahinter zum Lough Nabrickboy abfällt, während Dad, Mum und ich dahinspazieren, darüber plaudern, wie es wäre, an diesem besonderen Ort die Sitkafichten durch einheimische Bäume zu ersetzen. Letztes Jahr zur fast gleichen Zeit haben wir von der Hügelspitze den wunderschönen Anblick von vier Singschwänen gehabt – den einzigen wirklich wilden Schwänen. Die sanftmütigen, melancholischen Gestalten wippten anmutig mit hoch erhobenen Hälsen auf dem Wasser. Sie hätten die Kinder von Lír sein können: Aodh, Fionnuala, Fiachra und Conn, die von ihrer grausamen Stiefmutter Aoife dazu verflucht wurden, dreihundert Jahre auf Lough Derravaragh, dreihundert Jahre auf dem Nordkanal zwischen Irland und Schottland und dreihundert Jahre auf der Insel Inishglora zu verbringen.
Langsam und leise näherten wir uns dem Picknicktisch im Schatten der Weiden am See, und sie blieben bei uns, als wir uns in stiller Ehrfurcht und Verehrung hinsetzten. Wir fühlten uns sehr privilegiert. Mein Herz schlug schneller, mein Atem schien in meiner Brust gefangen. Die Vögel glitten geruhsam dahin, bis plötzlich das Schreien und Trompeten begann. Verdeckt von den nackten Zweigen einer Weide pirschte ich mich an, um sie besser zu sehen. Ich war still wie die Luft, beobachtete die sich ausweitenden Wellen der zum Fliegen sich aufschwingenden Vögel: Mit ausgebreiteten Flügeln, tief gehaltenen Häuptern, wild rotierenden Beinen stiegen sie auf, während die plumpen Paddelfüße sie schoben und hoben. Fort flogen sie, bliesen das Horn wie ein königlicher Konvoi. Sie verschwanden in nordwestlicher Richtung, vielleicht nach Island.
Auf eine Wiederholung dieser Begegnung auch nur zu hoffen, wäre unerhört, und als ich hinunter über den See schaue, erkenne ich, dass heute keine Singschwäne da sind. Er ist leer.
Ich bin etwas schwermütig, als wir hinunter zum Picknicktisch gehen. Ich finde einen günstigen Ort und warte auf die Kornweihen, reglos, bis das Licht schwindet. Als es Zeit wird zu gehen, schauen meine Eltern sich wissend an – und vermuten ganz richtig: Ich bin schlecht gelaunt für den Rest des Tages, schleiche, sobald wir zu Hause sind, in mein Zimmer, schreibe, suhle mich in Selbstmitleid. Keine Singschwäne heute. Keine Kornweihen.
Samstag, 31. März
Im Licht des späten Nachmittags, bei auflandigem Wind, fahren wir von Ballycastle an der nordöstlichen Küste mit der Fähre die wenigen Seemeilen nach Rathlin Island. Lummen und Möwen zerwühlen die Luft mit Schnattern und Kreischen. Ich bin heftig aufgeregt.
Heute ist mein Geburtstag, und ich lag heute Morgen bis zu meiner genauen Geburtszeit (11:20 Uhr) einige Stunden noch wach im Bett und lauschte einem schreienden Fuchs in der Ferne. Schon die ganze Woche war ich so heftig aufgeregt, nervös, aus Gründen, die ich nie richtig verstehen werde. Vielleicht weil ich neue Orte liebe und gleichzeitig hasse. Die Gerüche, die Geräusche. Dinge, die sonst niemand bemerkt. Auch die Menschen. Welche Dinge in Ordnung sind und welche nicht. Kleine Dinge, zum Beispiel, wie wir uns für die Fähre anstellten, was von mir auf Rathlin bei unserer Ankunft erwartet würde. Obwohl ich nach jeder Reise in meinem Kopf immer die übliche Aufräumaktion mache, zurückschaue und normalerweise denke, wie albern das alles war, strömen dennoch die Ängste herein. Mum beteuert, dass wir die Zeit auf Rathlin entweder draußen oder allein mit der Familie verbringen werden. „Alles wird gut“, sagt sie.
Bei unserer Ankunft versammeln sich Eiderenten im Hafen, und als wir uns zu der Hütte begeben, in der wir die nächsten paar Tage wohnen werden, mildert sich meine übliche Ablehnung neuer Umgebungen. Der Ort ist ein besonderer. Es fühlt sich hier so ruhig an. Die Luft ist frisch, die Landschaft in ihrem Überschwang außerirdisch. Kiebitze kreisen zu unserer Rechten, ein Bussard zu unserer Linken. Die Autofenster sind heruntergelassen, und die Geräusche durchziehen unsere Gliedmaßen, die von der dreistündigen Auto- und Fährfahrt ganz steif sind. Wir entspannen uns und strahlen, als in großer Zahl Hasen auftauchen und über uns Gänse schreien. Das Auto klettert über dem Meeresspiegel in den Westen der Insel hinauf.
Als wir unseren Schlafplatz erreichen, sieht er auf die Entfernung perfekt aus. Ein traditioneller Steinbau und meilenweit keine anderen Behausungen, und sobald wir da sind, springe ich aus dem Wagen, laufe herum und schaue mich um. Bald entdecke ich einen See mit Graugänsen und Reiherenten. Beim Umhergehen tauchen überall Hasen auf, meine Augen haben Mühe, mit all der Bewegung mitzukommen, und vor lauter Sinneseindrücken schwirrt mir das Gehirn.
Ich höre die Schreie der Seevögel in der Ferne. Tölpel fliegen am Horizont, das Kieksen von Klippenmöwen wird lauter. Ich bleibe stehen, schaue auf das Meer, wo sanft die Wellen strudeln, und durch den abendlich dämmernden Himmel fliegt eine Schar Blässgänse in Keilformation. Obwohl wir gerade erst hier angekommen sind und nur für ein paar Tage bleiben, mache ich mir schon Gedanken, wie leer ich mich fühlen werde, wenn es Zeit sein wird zu gehen. Ich spüre Panik.
Meine Kindheit, auch wenn sie wunderbar war, ist immer noch voller Fesseln. Ich bin nicht frei. Das tägliche Leben besteht aus vollen Straßen und Menschenmassen. Fahrplänen, Erwartungen, Stress. Ja, es gibt auch unbändige Freude, aber gerade jetzt und hier, an diesem außergewöhnlichen und schönen Ort, so voller Leben, wächst in meiner Brust eine schreckliche Angst. In Trance kehre ich zur Hütte zurück, sehe in goldenen Feldern Schatten huschen.
Nach dem Abendessen bricht aus allen Himmelsrichtungen Gesang hervor, wir halten im Halbdunkel inne und horchen. Sobald ich jede Melodie für sich heraushöre, fühle ich mich plötzlich verwurzelt. Spiralen der Feldlerche. Harmonien der Amsel. Sprudeln des Wiesenpiepers. Das Worfeln der Schnepfenflügel. Und immer dabei die Seevögelschreie. Wir sind in einer anderen Welt. Keine Autos. Keine Menschen. Nur wilde Tiere und die Großartigkeit der Natur.
Mein bester Geburtstag.
Und der Vollmond strahlt hinter den Wolken hervor, als wir über entfernten Häusern Venus beobachten, und ich stehe da mit tauben Händen und tauber Nase, aber loderndem Herzen. An solchen Orten kann ich glücklich sein. Ich wickle meinen Mantel eng um meine Brust, sauge das alles in mich ein, möchte noch nicht ins Bett, lagere diesen Moment in meinem Geheimversteck bei all den anderen Erinnerungen ein. Wenn die Armee der Ängste dann angestampft kommt und mich überfällt, bin ich bereit zum Kampf, bewaffnet mit den wilden Schreien von Rathlin Island.
Sonntag, 1. April
Nach einem Abend mit gutem Essen, Musik und Vogelgesang, der mir immer noch im Kopf schwirrt, erwache ich bei vielversprechendem Wetter: Zwischen den Wolken bricht es blau hervor. Die Morgensee ist glatt und blendend. Es ist Ostersonntag, und wir wollen heute zum RSPB Rathlin West Light Seabird Centre gehen, einem Vogelbeobachtungszentrum am Sitz der größten Seevogelkolonie in Nordirland – und zudem nicht weit von unserer Hütte entfernt.
Vor dem Frühstück renne ich mit Bláthnaid und Lorcan herum und suche die Schokoeier, die Mum und Dad in den Ritzen und Spalten einer Trockenmauer, unter Steinen und hinter Grasbüscheln versteckt haben. Hier ist es so anders als in unserem kleinen Vorstadtgarten, wo die Eier sich zu einfach finden lassen. Wir kreischen und rennen voll zügelloser Begeisterung. Hier müssen wir uns nicht kontrollieren: Niemand ist sonst da, meilenweit!
Wir wandern los nach Westen, Feldlerchen sind unser Sonntagschor, die Landschaft wie immer unser Andachtsort. Es ist böig, aber heiter. Ich entdecke zwei Graugänse, die am abgelegenen Ufer des Sees Gras rupfen und die, als wir dort entlangkommen, bereits zu acht sind und ganz in unserer Nähe herumwatscheln. Sie zeigen keine Scheu.
Bei unserer Ankunft am Vogelbeobachtungszentrum merken wir, dass wir eine halbe Stunde zu früh sind, so eilig haben wir es gehabt herzukommen. Wir treffen auf Hazel und Ric – die seit einem Jahr auf der Insel leben, unglaublich viel Wissen über die wilden Tiere haben, es mit Begeisterung teilen und sehr warmherzig und freundlich sind. Ich sage nicht viel, aber das ist bei mir nicht ungewöhnlich. Dafür lächle ich und nicke immer, außer wenn es um Vögel geht. Doch sogar dann, obwohl ich äußerlich entspannt wirke, bin ich es nicht. Ich fühle mich mittendrin eingeklemmt. Ich versuche, Gesprächen zu folgen, Nuancen zu beachten, Gesichtsausdrücke, Tonlagen. Das wird mir oft zu viel, dann drifte ich ab. Mein Herz schlägt zu schnell. Manchmal gehe ich von Leuten weg, ohne es zu merken. Das kann alles ganz schön peinlich sein.
Hazel und Ric gehen mit uns zu den Steinstufen, die zur Vogelkolonie hinunterführen. Mum und Dad lassen sich zu ausführlichem Erwachsenengeplauder mit Hazel und Ric hinreißen – alles unnötige Formeln und Hülsen, wie ich finde. Ich gehe ein Stück voraus, beginne mit den vierundneunzig sich schlängelnden Stufen, die langsam die Sicht auf eine zerklüftete Felswand freigeben, an der es von Klippenmöwen und kreisenden Eissturmvögeln wimmelt, die sich drehen, umherwerfen lassen und in der Luft tanzen. Der Anblick macht mich innerlich zappelig. In einem plötzlichen Anfall von Begeisterung renne ich die restlichen Stufen hinunter und hinüber zur Aussichtsplattform. Ich kann Unmengen von Lummen sehen! Die Schreie aufgeregter Vögel explodieren in meiner Brust. Mit zittrigen Händen leihe ich mir ein Stativ von Ric, setze mein Fernrohr auf und schaue angestrengt aufs Meer.
Nach nur wenigen Suchmomenten bekomme ich die schwarz-weiße Tracht eines Tordalks in den Fokus. Er wackelt auf den Wellen und bleibt erstaunlicherweise trotz der aufgewühlten See mit den anderen Vögeln seiner Gruppe in fester Formation. Diese Vögel sehen so klug aus, sogar wenn sie im Meer schwanken. Ich entdecke einen stromlinienförmigen Basstölpel (unseren größten Meeresvogel) am Himmel, der elegant herumschwenkt – er kann erstaunliche hundert Stundenkilometer schnell werden, wenn er sich auf der Jagd nach Nahrung ins Wasser stürzen lässt, aber dieses Schauspiel habe ich noch nie gesehen. Basstölpel sind schöne Vögel, haben bemerkenswerte Augen, jugendstilartige Linien und knapp zwei Meter Spannweite. Einen bekomme ich mit dem Fernrohr zu sehen, so halb. Überall erschallt das Kichern und Knarren der Eissturmvögel, als würden Hexen die Klippen und alles Getier darauf verfluchen. Sie sind ziemlich lustige Vögel, die ein widerliches, leuchtend gelbes Öl ausspeien, um Nesträuber abzuhalten. Mir erscheinen sie seltsam zart, und ich schaue ihnen gerne zu, wenn sie landen. Eine solche Landung ist faszinierend, hypnotisch. Der gekreischte Soundtrack passt perfekt dazu. Es gibt keine Papageientaucher, aber die hätte ich auch noch nicht erwartet.
Heute ist es unglaublich warm, und ich bin so froh, so in Frieden. Bláthnaid und Lorcan werden allerdings ein bisschen unruhig – nicht jeder hat für die Vogelbeobachtung Geduld. Ich bekomme die Möglichkeit, länger zu bleiben, aber gehe mit dem Rest der Familie zu einem Mittagspicknick. Es fällt mir so schwer wegzugehen, aber wir vereinbaren, dass wir noch mal zurückkommen, bevor wir die Insel verlassen.
Am Nachmittag wandern wir zum schönen Kebble Cliff. Pfotenabdrücke von Hasen im Schlamm zeigen ihre leicht- und tieffüßigen Kapriolen. Sie sind wieder überall. Geheimnisvoll tauchen sie hinter Grasbüscheln auf, sitzen eine Weile da, als nähmen sie uns in Augenschein, dann verschwinden sie. Bussarde und Raben kommen, zeitweise, suchen, kreisen, zu verschiedenen Tageszeiten, und ein Wanderfalke taucht auf, saust herab, ist nicht mehr zu sehen. Wir scheuchen beim Gehen Schnepfe und Waldschnepfe auf, ihr verängstigtes Fliehen überrascht und beglückt uns. Feldlerchen und Wiesenpieper schrauben sich weiter in die Lüfte, steigen auf, ihr Gesang reicht bis in jeden Teil meines Wesens, schlängelt sich empor. Alles, was jetzt noch fehlt, ist das Flattern von Schmetterlingen, das Vorbeischießen von Libellen. Das Summen des Frühlings. Ich bleibe still stehen, stelle mir vor, wie es klingen könnte. Ich gelobe zurückzukommen, wenn es wirklich so weit ist, im Mai. Was für ein Tag!
Müde vom Wandern und Erkunden fahren wir zum Pub, essen zu Abend und spielen Billard. Ich fange an, jeden Moment in meinem Kopf zu speichern, damit ich in einer Woche oder in einem Monat, zu irgendeinem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft, wenn ich das gute Gefühl mal wirklich brauche, mir die Details in Erinnerung rufen kann. Die fast nixenschwanzförmige Insel hat mich in ihren Sirenenbann geschlagen. Ich bin vollkommen bezaubert. Sie ist nur zehn Kilometer lang und anderthalb Kilometer breit, bietet aber so viel – und wir haben davon nur einen Bruchteil gesehen.
Mum und ich legen die letzten ein, zwei Kilometer vom Pub zur Hütte zu Fuß zurück, um nach dem seltenen Pyramiden-Günsel Ausschau zu halten, vergebens. Als ich unsere Hütte sehe und wie perfekt sie aussieht, tut mir das Herz weh. Morgen ist unser letzter ganzer Tag.
Montag, 2. April
Erholsamer Nachtschlaf ist für mich nichts Gewöhnliches. Mir fällt es schwer, so viel von unserer überwältigenden Welt zu verarbeiten und auszublenden. Die Farben auf Rathlin sind größtenteils natürlich und im Licht des Vorfrühlings noch gedeckt, also Farbtöne, die ich gut vertrage. Grelle Farben rufen eine Art Schmerz bei mir hervor, greifen meine Sinne körperlich an. Lärm kann unerträglich sein. Natürliche Geräusche sind leichter zu verarbeiten, und auf Rathlin gibt es nur solche. Mein Körper und mein Geist sind hier in einer Art Gleichgewicht. Das spüre ich sonst nicht so oft. Das heißt, ich kann mit mir und meiner Familie wieder in Kontakt kommen, was normalerweise schwierig ist, weil das Leben anstrengend und hektisch werden kann. Hier gehe ich gemächlich. Schaue mir stundenlang Vögel an, ganz ungestört. Ich kann gehen, wohin ich will. Kann forschen. Es gibt hier auch keinen Müll, nichts Unappetitliches – es sei denn, man findet Tierkacke ganz schlimm. Meine Neugierde zieht mich an Orte wie diesen, wo ich die Eierschalen geschlüpfter Lummen und Tordalke sammeln kann (die Beute des letzten Jahres wurde von den Raben gestohlen), Rocheneier, Muscheln und Knochen. Zu Hause haben wir die sogenannte „Fermanagh-Zeit“, in der das Leben langsamer zu sein scheint als an den meisten anderen Orten. Aber die Fermanagh-Zeit ist nichts im Vergleich zur Rathlin-Zeit, die noch angenehmer ist und noch freier fließt.
Der Wind und der graue Himmel, die uns am Morgen begrüßen, hindern Lorcan, Bláthnaid und mich nicht daran, doch hinauszurennen. Der Wind schlägt uns in die ungeschützten Gesichter, unsere Augen und Münder füllen sich mit Salz und Frische. Sogar der schwarz-graue Himmel enthält hier unheimlich viel Licht und Raum und Farbe. Er hat nicht die Schwere eines Vorstadthimmels, vielleicht einfach, weil er so viel Platz hat. Wir nehmen noch einmal genau den See unter die Lupe, an dem gestern die Graugänse waren. Wir rennen und rennen. Heute Morgen sehen wir keine Hasen. Sie hocken wahrscheinlich im Verborgenen, sitzen den Sturm aus. Der See bebt vor lauter Wind, ist aber frei von Vögeln.
Geknickt und atemlos kommen wir zurück zur Hütte und bekommen von Mum gesagt, dass keine Fähre fährt. Freude! Ich hoffe, das Wetter wird niemals besser werden, und träume davon, auf Rathlin gestrandet zu sein. Beim Frühstück erinnere ich alle an die Abmachung, noch einmal zum Vogelbeobachtungszentrum zurückzukehren, bevor wir die Insel verlassen, aber statt durch die Regenschauer zu laufen, sind wir uns einig, die kurze Strecke zu fahren.
Heute sind dort weniger Vögel: Eine kleine Gruppe Tordalke wackelt auf der turbulenten See, ein Paar Mantelmöwen. Trotz des schlechten Wetters hebe ich den Kopf zum Himmel und atme die kleinsten Einzelheiten ein. Ein einsamer Basstölpel senst durch den Himmel, und seine kanternden Schreie synchronisieren sich mit meinem Herzschlag – Orkadier (die Bewohner*innen der Orkneyinseln) nennen sie auch Sonnengans –, und auch im fallenden Regen spüre ich die Wärme seiner klagenden Rufe. Allzu bald legt sich Mums Hand auf meine Schulter – ich habe nicht gemerkt, wie viel Zeit vergangen ist.
Wir steigen zurück hinauf zum Vogelbeobachtungszentrum für einen heißen Kakao, und meine Haut wird knallrot und prickelt durch die Wärme drinnen. Während Mum und Dad mit Hazel und Ric sprechen, huschen meine Gedanken aus der Zeit und wieder hinein. Langsam entspannen sich meine Finger, ich fühle mich weniger taub, da erfahre ich aus dem Gespräch, dem ich gerade zu folgen anfange, dass es zurück hinaus in Wind und Regen geht, offenbar um nach Robben zu schauen. Die Fahrt zum Hafen dauert viel länger, als wir alle dachten. Bis wir da sind, fällt der Regen gemächlicher, statt aus Eimern nur aus Bechern, aber ich bin dankbar für den Regenmantel, als wir zu dem kleinen Strand vor McCuaig’s Bar gehen. Die Robben sind nicht schwer zu finden: Sechs von ihnen liegen in den anrollenden Wellen. Wir beobachten auch Eiderenten, wie sie dahintreiben. Anders als beim bescheiden geschmückten Weibchen wirkt das hervorstechende Gefieder des Männchens ziemlich außerirdisch. Während weiter draußen noch mehr Robbenköpfe wippen, picken Austernfischer, Rotschenkel und ein einzelner Sanderling im Seetang herum, tanzen lange, spindeldürre Beine durch die Brandungslinien. Eine Robbe hat eine seltsam hervorstehende Stelle im Fell: eine Wunde, verursacht durch ein unbekanntes Plastikobjekt, die zwar abgeheilt ist, bei der das Objekt aber immer noch drinsteckt. Der Anblick löst in mir eine Sonneneruption von Wut aus. Wie können wir mit den Tieren so umgehen?
Um uns alle etwas aufzuheitern, führen Mum und Dad uns in ein gemütliches Café, wo wir Crêpes verputzen, und erinnern uns daran, dass wir bald zur McFaul-Farm aufbrechen werden, wo wir eingeladen sind, später am Nachmittag die Lämmer zu füttern. Neben seiner Tätigkeit als Bauer ist Liam McFaul auch der Leiter des Vogelbeobachtungszentrums auf Rathlin Island und arbeitet mit vollem Einsatz daran, die Wiesenralle wieder anzusiedeln, eine überall in Irland stark gefährdete Spezies. Letztes Jahr rief ein Männchen, bekam aber keine Antwort. Liams Nesselbeete könnten dieses Jahr helfen, wie ich hoffe. Die Gedanken zur Wiesenralle und die Ansicht der verletzten Robbe erinnern mich daran, dass sogar dieser Ort hier, mitten in der Wildnis, nicht vor dem Einfluss des Menschen verschont bleibt. Überall gibt es Verluste. Lebensraum geht verloren, Arten und Lebensweisen gehen verloren. Obwohl hier und an vielen anderen Orten etwas dagegen getan wird, bleibt es eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ich fühle mich nicht qualifiziert, die Situation zu verstehen oder zu bewerten. Ich weiß aber, dass sie mich verunsichert. Das Gleichgewicht stimmt nirgendwo mehr so richtig.
Diese Gedanken beschäftigen mich bis in den Abend, beim Füttern der Lämmer auf der McFaul-Farm. Es fühlt sich gut an, sie zu füttern. Wir sind keine Bauern, aber wir alle lieben Tiere, und Bláthnaid spricht jetzt davon, dass sie später Tierärztin werden will.
Zurück bei der Hütte, lesen wir bei Kerzenschein. Als Erster liest Dad aus Dara Ó Conaolas Night Ructions („Krach in der Nacht“) vor, danach folgt Mum mit einigen Gedichten, bis wir nach und nach alle davonschlummern, geschützt vor den krachenden Wellen und dem Getöse draußen.
Mittwoch, 4. April
Still dämmert der Morgen. Der Wind hat sich gelegt, was bedeutet, dass wir abreisen. Das Aufräumen und Packen hält meine Gedanken beschäftigt, aber in meinem Inneren springt ein Gefühl wild im Kreis. Wir fahren eilig zur Fähre, sind spät dran. Schweren Herzens geht es hinaus aufs Meer. Kein Kichern, kein Deuten auf Dinge hinter den Wellen. Verhaltenes Schweigen. Im Irischen heißt dieses Gefühl uaigneas. Ein tiefes, tiefes Fühlen, ein Zustand von Einsamkeit.
Wir haben etwas gefunden und verloren, so schnell wieder. Vielleicht verliere ich auch einen Teil meiner Kindheit. In mir ist Raum für eine nixenschwanzförmige Rathlin-Insel, der wieder gefüllt werden muss.
Samstag, 7. April
An diesem Morgen und den ganzen Tag über lastet Bedrückung auf mir, schließt mich ein. Obwohl so viele gute Dinge passieren, draußen, in einem Garten voller Gesang und Leben, hängen meine Gedanken fest zwischen Schwermut und herzrasender Angst. Ich fühle mich in der Vorstadt gefangen. Wind und Rauschen, wie es sie in der Wildnis gibt, wirbeln durch meine Tagträume und meine nimmermüden Nachtgedanken. Die Armee der Ängste marschiert, und meine Verteidigung hat versagt. Ich taste herum im Nebel meines Gehirns, versuche verzweifelt eine Erinnerung zu finden, ein Bild, um Tränen, Verwirrung und Frust loszuwerden. Um alles zu ersticken, ziehe ich mir die Decke über den Kopf und falle wieder in unruhigen Schlaf.
Sonntag, 8. April
Ich hieve mich wieder in die Welt, widerwillig. Sogar die Verlockung des Claddagh-Naturreservats beruhigt nicht meine innere Angst. Und ich merke, dass meine Trübsal berechtigt war, da wir bei unserer Ankunft sehen, dass zwischen dem Fluss und dem dichten Bärlauchteppich, dort, wo normalerweise Anemonen blühen, ein Streifen aus Steinen und Schlamm den Boden bedeckt. Ich tobe innerlich. Ein Bagger, der verräterisch in einem nahe gelegenen Gebäude steht, liefert das noch fehlende Puzzleteil.
Wir gehen verärgert weiter, und obwohl ich Knospen an den Zweigen sehe und goldenes Milzkraut die hohen Hänge bedeckt, ist das nur ein schwacher Trost. Auch die Zilpzalpe zwitschern, aber ich ignoriere ihren Gesang.
Als es wärmer wird, beschließen wir, zum Gortmaconnell-Felsen zu gehen, einem wilden Ort, der zum Marble Arch Caves Global Geopark gehört. Dies ist einer der Flecken, die anscheinend nie jemand besucht, zumindest nicht, wenn wir da sind. Es gibt einige Orte in Fermanagh, die wir als unsere „Tummelplätze“ beanspruchen, und dieser gehört dazu. Ich erspähe meinen ersten Schmetterling des Jahres, ein ziemlich erschöpftes Tagpfauenauge. Aufregung tobt in meiner Brust, löst den Spannungsknoten. Ich kann wieder einfacher ein- und ausatmen. Ich renne von ganz unten bis ganz hinauf auf den Gortmaconnell-Gipfel und spüre den Wind meine Auflehnung brechen. Sie wogt davon in die Landschaft, und ich liege flach auf dem Boden und schaue in die Wolken. Ich schließe die Augen und spüre, eine Hand auf der Brust, einen regelmäßigeren Puls. Ich schlafe für eine Weile, alle lassen mich in Ruhe. Diese Viertelstunde ist erholsamer als all die zerstückelten Stunden Schlaf dieser Woche.
Mittwoch, 18. April
Das vierte Zwischenzeugnis dieses Jahr verhindert, dass meine Füße Boden und Gras berühren, und sperrt mich in eine Prüfungsphase ohne Freiheiten, wie sich zeigt. In der Schule sind die Klassenzimmer beengend. Durch die abgestandene Luft bombardieren mich Herumgerutsche, Geseufze, Gezappel und Rascheln laut wie Donner. Die Räume sind hell, so hell, dass alles Rot und Gelb sich in meine Netzhaut bohren. Neonlicht ertränkt Tageslicht. Ich kann nicht nach draußen sehen. Ich fühle mich eingepfercht, wie ein wildes Wesen im Käfig.
Obwohl ich den Spanischunterricht sehr mag, ist der Raum abscheulich und macht es unmöglich, sich zu konzentrieren. Fast in jeder Stunde muss ich rausgehen und mich draußen hinsetzen. Dort sitze ich still, atme ein und aus, verschwinde in einem Mahlstrom. Gott sei Dank gibt es den „Rückzugsraum“ – der ist für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen und für andere, die einen ruhigen Ort brauchen. Manche Leute glauben, ich bin da drin isoliert, das stimmt nicht. Ich bin in Sicherheit. Mein Gehirn kann sich ausdehnen und alles ausspucken, was ihm zu viel wurde.
Ich mag die Schule, will wirklich etwas lernen. Aber das Lernen ist so lahm und wenig inspirierend. Was wir lernen, ist so aufregend wie ein tropfender Wasserhahn, während sich die Welt draußen so viel einfacher erfassen und verstehen lässt. Man kann sich auf eine Sache fokussieren: eine Blume, einen Vogel, ein Geräusch, ein Insekt. Schule ist das Gegenteil. Ich kann nie klar denken. Mein Gehirn wird von Farbe und Lärm verworren und von dem Gedanken, sich organisieren zu müssen. Punkte von den Hirnlisten abhaken. Ständig die innere Unruhe im Zaum halten. Mich zusammenhalten.
Freitag, 20. April
Heute Morgen war ich nicht in der Schule, weil ich eingeladen wurde, im Rahmen vom Eco-Schools-Programm auf einer Lehrerkonferenz zu sprechen. Ich liebe diese Art von Arbeit. Sie passt zu meinem Anliegen, die Welt besser machen zu wollen. Ich muss es von allen Dächern rufen, wie wir mehr für unseren Planeten tun können, für unsere Flora und Fauna, wie wir etwas verändern können. Oft habe ich das Gefühl, mit meinem Kopf gegen eine Wand zu rennen.
Heute sind alle freundlich, aufmunternd und ernsthaft aufgeregt, hier dabei zu sein, um zu feiern, was viele Schulen mit so wenig Budget schaffen. Doch auf meinem Weg durch die gepflegten Gärten, hin zu dem Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfinden wird, steigt mir ein Güllegeruch in die Nase. Ich bin hier, um über Artenvielfalt zu sprechen, und genau die fehlt; weder der Geruch noch die aufgeräumten Gärten passen dazu.
Mein Herz beginnt zu pochen, als man mich bittet, aufzustehen und zu sprechen. Ich kann den hinteren Teil des Raums nicht sehen – aber der Blickkontakt mit einer weit entfernten leeren Wand ist für mich ein wichtiges Hilfsmittel, um mich öffentlich äußern zu können. Hier ist das Podium jedoch zu hoch. Ich fühle mich klein, versuche mich zu erheben. Der Raum beginnt sich aufzublähen. Ich fühle mich wie untergetaucht, unter Wasser. Während ich laut lese, ribbelt sich die Schnur, die mich hält, langsam auf. Ich drohe herunterzufallen. Ich lese weiter. Lächle. Posiere für Fotografen. Rede, so viel ich im Kreis von Unbekannten kann. Dann merke ich, dass ich immer noch meine Fleecejacke trage, was erklärt, warum mir der Schweiß den Hals runterläuft. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich mich so gefühlt habe. Und als ich diese Schicht endlich ausziehe, werde ich auf mich selbst sauer, da ich mein liebstes Undertones-T-Shirt trage. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Meine Unfähigkeit, mich zu organisieren und grundlegende Dinge zu tun – wie in einem warmen Raum meine Fleecejacke ausziehen –, geht mir echt auf die Nerven. Ich kann so was nicht einplanen. Offenbar komme ich nicht allein klar, ohne dass mir jemand alles souffliert (meistens Mum oder Dad). Andererseits ist das Soufflieren selbst noch viel nerviger.
Ich fahre mit Dad nach Hause zurück, und wir hören meine Lieblingsmusik. The Clash, The Buzzcocks und so weiter. Wir reden ein wenig, aber was ich eigentlich will, ist einschlafen, einfach den Tag wegsperren. Die Musik legt den Sinnesschalter um, die Klänge ziehen in mich hinein und lösen die innere Spannung.
Durch Musik fühle ich mich immer besser, und als wir zu Hause ankommen, bei Mums Fragen und ihrem Lächeln, ist meine zwingende Zusammenfassung des Tages schon fröhlicher. Danach fliehe ich mit meinem Fotoapparat in den Garten. Ich fotografiere nicht. Stattdessen döse ich ein. Kein Wunder, dass ich nachts nicht schlafen kann.
Donnerstag, 26. April
Als ich bei mir im Zimmer sitze und Hausaufgaben mache, spüre ich ein Kribbeln. Ich ziehe die Vorhänge und schiebe meine Türen auf. Ich lebe am Rand, am Rand unseres Hauses, weg von allen anderen, in der umgebauten Garage. Mum und Dad machen sich immer Sorgen, dass ich nachts nicht in ihrer Nähe bin, aber ich bin kein Baby, und ich finde es meistens gut. Ich stehe draußen, schaue mit schief gelegtem Kopf in den Himmel, und da ist es. Ein Kreischen. Ein Mauersegler-Weibchen! Erster Tag seines hunderttägigen Aufenthalts. Sie sind da! Den ganzen Weg von Afrika. Die muntersten und schwungvollsten unserer Sommergäste, schon höre ich ihre schrillen Rufe über unserem Haus.
Einer der wichtigsten Momente im Leben von Mauerseglern ist es, einen Nistplatz zu finden. Aber Leute wie meine Nachbarn machen ihre Gärten steril und bauen Vogelabwehrspitzen aus Plastik oder Metall an ihre Dachtraufen. Diese Haltung findet sich überall. Es ist die Norm, Wildvögel und andere Wildtiere davon abzuhalten, in den Ritzen und Winkeln unserer Wohn- und Bürohäuser zu leben. Und die ganze Kotgeschichte ist lächerlich! Das ist die Standardbeschwerde: Man sagt, wie schmutzig Vögel sind, und rechtfertigt damit den Verlust von Lebensraum direkt vor unserer Haustür.
Aber zunächst einmal wirbelt das einzelne Mauersegler-Weibchen jubilierend herum – eine Späherin, vielleicht auf der Suche nach Futter, noch unvergeben, auf Partnersuche, in Erwartung ihrer kreischenden Artgenossen, die um die Reviere raufen und rangeln werden. Es ist schwer zu glauben, dass viele Mauersegler-Babys einfach aus dem Nest fliegen und ihre gewaltige Reise ganz allein antreten. Erstaunlich ist das. Ich grüble darüber nach, wie sehr wir Menschen, um zu überleben, aufeinander angewiesen sind, und wie wilde Arten, um zu überleben, von unserer Gnade abhängen. Ich fröstele in der Kühle des Abends. Das Mauersegler-Weibchen ist weitergezogen, hinterlässt einen leeren Himmel, in dem sich die Nacht herabsenkt.
Bevor ich ins Bett gehe, entdecke ich einen zaghaften grünen Stängel, schüchtern neben dem forschen Löwenzahn, winzige rosa Knospen, die erste Kuckucksblume, das erste Wiesenschaumkraut. Früher waren ganze Felder damit bedeckt, und nach wie vor legen Aurorafalter ihre Eier bevorzugt am Wiesenschaumkraut ab. Winzige orangefarbene Pünktchen. Ich werde später im Jahr alle unsere grünen Stängel danach absuchen, aber bisher habe ich über Jahre hinweg noch keine gefunden. Vielleicht liegt es an dem neongüllegrünen Feld nebenan, das wir aus unserem Küchenfenster sehen.
Donnerstag, 10. Mai
Ich nehme meinen Fotoapparat mit in den Garten, um einen Löwenzahn zu verewigen, mit seinen auf links gedrehten Pusteblumen, die aussehen wie umgestülpte Schirme im Sturm. Sie waren mir aufgefallen, weil ich Löwenzahn liebe, mich an ihm erfreue wie an Sonnenschein. Mit etwas Geduld sieht man auf den geöffneten Blüten immer irgendein Wesen sitzen. Er ist eine unverzichtbare Lebensquelle für alle frisch hervorkommenden Bestäuber, und sein explodierendes Gelb erhellt mir auch die grauesten Tage. Hoch und stolz steht er da, anders als die windschwankenden anderen Frühblüher. Der Sonderling.
Auch Wiesenschaumkraut gibt es jetzt reichlich, und das erste Knabenkraut ist aus dem Boden gebrochen. Ich frage mich, ob es dieses Jahr mehr als die dreizehn wunderbaren Orchideen vom letzten Jahr werden. Mit einem Mal fällt Regen aus den wenigen Wolken über uns, und dicke Tropfen klatschen auf all die Pusteblumen. Die einzige Pflanze, die unversehrt davonkommt, ist die eine, die mir aufgefallen war.
Pusteblumen ähneln ein bisschen mir, wie ich mich von anderen abschirme, entweder weil so viel auf der Welt zu schmerzhaft ist, wenn man es sieht oder spürt, oder weil, wenn ich mich Leuten öffne, der Spott kommt. Das Mobbing. Fiese Beleidigungen wegen der großen Freude, die ich empfinde, wegen meiner Begeisterung, meiner Leidenschaft. Viele Jahre habe ich das für mich behalten, aber jetzt leaken diese Worte in die Welt.
Ich strecke mein Gesicht in den Regen, lasse mir Wolkenpartikel auf die Zunge fallen.
Freitag, 11. Mai
Das überall sprießende Leben – im Garten, auf dem Schulgelände, sogar auf den Straßen rund ums Haus – hebt meine Stimmung. Mein Herz wummert weniger gegen meine Brust. Ich fühle mich im Einklang mit der Natur, tauche jeden Moment wieder darin ein, lasse mich von jeder Welle treffen, versinke.
Nach den Pfadfindern beschließen wir, einen Spätabendspaziergang zu machen, in einem kleinen Park in Lisnaskea, einem Örtchen keine fünfundzwanzig Kilometer von Enniskillen entfernt. Es ist ein milder Abend, und das Licht ist vor lauter Gnitzen, die für uns ärgerlicherweise überall herumschwärmen, ganz verschwommen. Plötzlich hebt sich mit Wucht von den anderen Gesängen über Schilf und Bäumen einer ab, ein Schilfrohrsänger. Er durchdringt den Luftraum. Ich bleibe stehen und lausche. Einen Moment später beginnt ein Gespräch zwischen einem Schilfrohrsänger auf einem Stacheldrahtzaun und einem auf einem Weidenast. Einer sitzt im Schatten, der andere hat das Licht gewählt, die Musik ihres Zirpens beinhaltet all das taumelige Staunen, das ich spüre. Manchmal frage ich mich, wie andere Menschen auf diese Begegnungen reagieren. Fühlen sie sich ähnlich privilegiert, den Gesang eines Vogels wie dem Schilfrohrsänger zu hören? Nach einem ununterbrochenen Flug aus der Sahara landet er direkt hier, um unseren Sommer mit seiner knarrenden Ausgelassenheit zu verschönern.
Edward Thomas, der ein ganzes Dichterleben in zwei Jahre hineinpresste, bevor er in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs starb, hat diese Vögel perfekt beschrieben:
Ihr Gesang hat keine Worte, keine Melodie.
Doch für fast jede Süße hatte ich mehr Sympathie
Als für süße Stimmlein, die lieblich süße Worte singen.
Die kleinen braunen Vögel – brachten den Mai zum Klingen.
Denn wissend endlos wiederholen sie
Was niemand lernt, nicht in noch außerhalb der Schule.

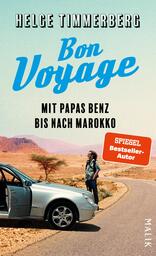








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.