

Tante Martl Tante Martl - eBook-Ausgabe
Roman
Ein Roman mitten aus dem Leben und in einer Sprache, die genau den angemessenen Ton trifft: witzig und doch respektvoll. - Kulturbowle
Tante Martl — Inhalt
Ohne Mann und Kinder, aber immer im Dienst der Familie: Lernen Sie Tante Martl kennen
Tante Martl ist scheinbar unscheinbar, in Wahrheit aber ganz besonders. Der Leser spürt es gleich an der Art, wie sie ihre Telefonanrufe eröffnet: mit einem Stöhnen, dem ein unerwarteter Satz folgt. Geboren als dritte Tochter eines Vaters, der nur Söhne wollte, ist Martl die ungeliebte Jüngste, die keinen Mann findet, dafür aber einen Beruf als Volksschullehrerin. Nie verlässt sie die westpfälzische Kleinstadt, in der sie geboren wurde, ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl sie ihren Vater jahrelang pflegt, während ihre Schwestern Familien gründen, bewahrt sie ihre Selbstständigkeit. Wie Tante Martl das schafft und in hohem Alter noch einen großen Fernsehauftritt bekommt, erzählt Ursula März mit staunender Empathie und widerständigem Humor.
„Einer der heitersten Beiträge zur Genderdebatte“ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Leseprobe zu „Tante Martl“
Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem lang gezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag.
Hatte sie sich über eine schnippische Verkäuferin geärgert, überwog die Sirene. Hatte der Hausarzt ihr geraten, sich für eine Untersuchung ins Krankenhaus einweisen zu lassen, schlug [...]
Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem lang gezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag.
Hatte sie sich über eine schnippische Verkäuferin geärgert, überwog die Sirene. Hatte der Hausarzt ihr geraten, sich für eine Untersuchung ins Krankenhaus einweisen zu lassen, schlug das Jammern durch. Bisweilen vertiefte sich das Stöhnen zu einem rollenden Brummen, als säße am anderen Ende der Leitung ein angriffslustiger Bär. Dann war meine Tante ernsthaft empört. Der Lieferant von Tiefkühlkost, der einmal im Monat mit seinem Kleinlaster vor ihrem Haus hielt, hatte die falsche Ware gebracht, aber unverschämt behauptet, es sei die richtige, und den Umtausch verweigert. In einer Fernsehsendung waren knapp bekleidete Frauen aufgetreten, und zwar nicht am späten Abend, wenn meine Tante längst schlafen gegangen war, sondern im unverdächtigen Nachmittagsprogramm.
Ein Daueranlass ihrer Empörung war der Showmaster Thomas Gottschalk. Er wurde von meiner Tante so verachtet, dass sie nicht einmal seinen Namen aussprach, sondern ihn nur „de dumm Lackaff“ nannte. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass „de dumm Lackaff“ in der Samstagabendshow des ZDF den Platz des von ihr hochgeschätzten Frank Elstner eingenommen hatte, was meine Tante als persönliche Geringschätzung von Menschen wie ihr, Menschen mit Anstand und seriösem Benehmen, interpretierte. Alles an Thomas Gottschalk fand sie vulgär, seine langen blonden Locken, seine Glitzeranzüge, seine Witze. Als sie in einer Fernsehzeitschrift las, wie viel Geld er für seine Shows erhielt, war sie außer sich. „Ursi“, schrie sie ins Telefon, „des sin Millione! Des isch doch net normal!“ Ich versuchte, sie zu beruhigen. Thomas Gottschalk, sagte ich, sei sicherlich Millionär und habe einigen Reichtum angehäuft. Dass er für einen einzigen Fernsehauftritt gleich ein paar Millionen einstriche, hielte ich jedoch für ausgeschlossen. „Du hascht doch ke Ahnung“, erwiderte sie brüsk, nun über meine Besserwisserei empört. Ich kannte mich in den Finanzverhältnissen von Thomas Gottschalk tatsächlich nicht aus und bog schnell zu einem anderen Thema ab. Wenn am Sonntagmorgen in meiner Wohnung in Berlin das Telefon klingelte, ich den Hörer abnahm und dem Empörungsstöhnen lauschte, war mir klar, dass am Abend zuvor „Wetten, dass …?“ ausgestrahlt worden war, meine Tante auf dem Bildschirm ihren Intimfeind gesehen und sofort umgeschaltet hatte.
Bis sie endlich zu erzählen begann, konnte eine Weile vergehen. Mit einer einzigen Stöhnouvertüre war es oft nicht getan. „Was ist denn passiert?“, fragte ich vorsichtig. „Geht’s dir nicht gut?“ Anstatt zu antworten, stöhnte sie erneut, und ich fuhr wieder mit einer Frage dazwischen. Je älter meine Tante wurde, desto häufiger geschah es, dass sie schon nach dem Ende des Stöhnens meinen Kommentar zu dem Ereignis erwartete, das sie veranlasst hatte, mich anzurufen. So, als hätte sie mir gerade davon erzählt. Es war ein heikler Moment unserer Telefonate. Dauer und Tonlage des Stöhnens verrieten mir die Stimmung, in der sich meine Tante befand. Aber was genau sie in diese Stimmung versetzt hatte, wusste ich natürlich nicht. Vielleicht hatte sie eine überhöhte Rechnung ihrer Autowerkstatt erhalten, die darauf spekulierte, eine betagte Frau würde den Wucher nicht bemerken. Vielleicht musste sie ihrem Ärger über ein im gegenüberliegenden Haus lebendes Ehepaar Luft machen, das an sieben Tagen die Woche um Punkt 11:30 Uhr in seinen Mercedes stieg, um in ein Restaurant zu fahren. „Die kenne esse, wo se wolle“, sagte meine Tante, „aber jede Tach ins Lokal gehe, des isch doch net normal.“ Sie war fest davon überzeugt, der Grund für die gehäuften Restaurantbesuche der Nachbarn, die schon bei dünnem Nieselregen die Rollläden vor den Fensterscheiben herunterzögen, läge in einem Reinlichkeitswahn, der es ihnen verbiete, ihre Küche durch das Zubereiten einer warmen Mahlzeit zu besudeln.
Mir blieb nichts anderes übrig, als mich mit vagen Beschwichtigungsfloskeln an das Ereignis heranzutasten, von dem meine Tante glaubte, sie hätte es mir eine Minute zuvor mitgeteilt. Oft bemerkte sie die Taktik und fühlte sich zurückgestoßen, weil es mir ihrer Ansicht nach an echtem Interesse für sie und ihre Nöte fehlte. „Isch stör dich, gell?“, sagte sie dann pikiert. „Bischt aufm Drücker?“ Aber nein, beteuerte ich, sie störe überhaupt nicht, ich mache ohnehin gerade eine kurze Arbeitspause und läge auf der Couch. „Ei, dann sach doch gleich, dass de schloofe willscht“, murrte sie weiter, „des kann isch jo net wisse. Isch sitz am Telefon und net am Fernrohr.“
Meine Tante war Lehrerin von Beruf. Sie heiratete nie und hatte keine Kinder. Außer ein paar Jahren während des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit verbrachte sie ihr gesamtes Leben in ihrem Elternhaus in der westpfälzischen Kleinstadt Zweibrücken. Der einzige Wechsel ergab sich nach dem Tod ihrer Eltern, als meine Tante aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss in das nun frei gewordene Obergeschoss zog. Danach verbrachte sie noch achtunddreißig Jahre allein in dem Haus, in dem sie an einem Junisonntag im Jahr 1925 geboren worden war. Sie war eine materiell unabhängige, interessierte und gebildete Frau, die schon in den Fünfzigerjahren ein eigenes Auto und immer ein eigenes Bankkonto besaß, die leidenschaftlich gern verreiste, mit kribbelnder Vorfreude ihre Touren in Mittelmeerländer, ins Gebirge und sogar ans Nordkap plante. Aber sie unternahm nie einen Versuch, sich vom Elternhaus zu lösen, zumal von einem Vater, der sie rücksichtslos spüren ließ, dass er sie nicht gewollt hatte.
In ihrer ersten Lebenswoche, genau von Montag bis Montag, galt meine Tante auf dem Papier als Person, vielmehr als Säugling, männlichen Geschlechts. Sieben Tage lang war ihr Vater nicht bereit, sich mit der Tatsache abzufinden, dass auch dieses Kind ein Mädchen geworden war. Zu seinem Verdruss das dritte. Schon das zweite Mädchen hätte, wären die Dinge seiner Ansicht nach richtig verlaufen, ein Junge sein müssen. Er verschmerzte es einigermaßen. Gegen ein drittes Geschöpf aber, das als Stammhalter ausfiel und ihm womöglich den Ruf eines Erzeugers eintrug, der nur eine Mädchenserie zustande brachte, stellte er sich stur. Bei seinen Enkeln war ihm das Geschlecht egal. Ich erinnere mich an keine Situation, keinen Satz und kein Geschenk, die darauf hingedeutet hätten, er bevorzuge meinen Bruder mir gegenüber. Bei seinen Kindern galten jedoch andere Prinzipien. Sieben Tage lang klammerte er sich an die wahnwitzige Illusion, der Natur durch schieres Beharren doch noch ein Chromosomenwunder abringen zu können. In den Verwaltungsakten des örtlichen Standesamtes gab es den Jungen ja schon, er hieß Martin.
Als sich mein Großvater am Montagmorgen vor dem Schreibtisch des Standesbeamten einfand und dieser ihn nach dem Geschlecht des neuen Erdenbürgers fragte, nickte er einfach. Er sprach das Wort „Junge“ nicht aus. Er wartete, bis dem verunsicherten Beamten, der die Spitze des Füllfederhalters bereits aufs Formular gesetzt hatte, nichts anderes übrig blieb, als die Frage zu konkretisieren, „isch e Bub?“, und er nur nicken musste. Im strengen Sinn gelogen, so beteuerte er noch nach Jahrzehnten, hatte er also nicht. Er hatte es lediglich verpasst, einer Variante der Wahrheit zu widersprechen, die ihm amtlicherseits nahegelegt wurde. Und was den falschen Namen anbetraf: Vielleicht hatte er den Vokal am Ende verschluckt, vielleicht hatte der Standesbeamte das „a“ überhört oder einfach den Stift zu früh abgesetzt und deshalb den Namen Martin eingetragen.
Ungefähr so lauteten die Ausreden, die er vorbrachte, als seine Frau ihm am Dienstag die Geburtsurkunde abknöpfte und schwarz auf weiß lesen musste, dass ihre neugeborene Tochter durch einen Trick, an dem sie das Herzlose noch mehr bestürzte als das Hirnrissige, vor dem Gesetz als Sohn galt. Zum Krachschlagen war sie zwei Tage nach der Entbindung zu erschöpft. Sie legte die Geburtsurkunde wortlos auf den Küchentisch und schwieg bis zum Einschlafen am Abend. Sie saß im Nachthemd auf ihrer Bettseite, rückte die Wiege nah zu sich heran, beugte sich darüber und prüfte, ob das gehäkelte Wolldeckchen straff genug um den Säugling gewickelt war, nicht nach oben rutschen und sich über sein Gesicht legen konnte. Dann schlüpfte sie unter ihr Federbett, wandte ihrem Mann den Rücken zu, streckte den Arm nach dem Schalthebel der kleinen Bakelitlampe auf dem Nachttisch aus und sagte im Dunklen nur einen einzigen Satz: „Du gescht da morge hin, gleich in der Früh.“
Meine Großmutter sparte auch sonst mit Worten. Sie handelte lieber. Wenn ich mir an einer Steinkante im Garten das Knie aufgeschlagen hatte und weinend zu ihr in die Küche humpelte, umflatterte sie mich nicht, wie meine Mutter es getan hätte, mit dramatischen Mitleidsbekundungen. Sie sauste zum Medizinschrank im Badezimmer, holte Verbandspflaster und ein Fläschchen mit stinkendem rostfarbenem Desinfektionsmittel. Nach der Verarztung griff sie in die Tasche ihrer Kittelschürze, zog einen Bonbon heraus und steckte ihn mir in den Mund.
Er ging nicht. Weder am Mittwoch noch am Donnerstag und am Freitag bequemte er sich zum Standesamt, um den Fehler zu korrigieren. Dass er nicht darum herumkomme, musste ihm als ordnungsliebenden Staatsbürger eigentlich klar sein, auch wenn er sich einbildete, das Geschlecht des Neugeborenen durch Zeitschinden doch noch in die ersehnte Richtung lenken zu können. Er drückte sich überhaupt gern vor Schwierigkeiten und überließ es seiner Frau, sie zu lösen. Nicht er, sondern sie handelte bei der Sparkasse den Kredit aus, den sie benötigten, um Ende der Zwanzigerjahre das zweistöckige Haus zu kaufen, in dessen oberem Stockwerk sie bis dahin zur Miete gewohnt hatten. Nicht er, sondern sie sah den Handwerkern auf die Finger, als unter dem Dach ein kleines Mansardenzimmer für die Töchter ausgebaut wurde. Und sie saß abends am Küchentisch und verrechnete das schmale Gehalt, das er als Gefängniswärter nach Hause brachte, mit den monatlichen Ausgaben. Sie war zuständig fürs Pragmatische und somit auch dafür, Wege aus verzwickten Situationen zu finden. Und in einer solchen befanden sie sich. Bereits am Samstagmorgen klingelten die ersten Gratulanten, die das Elternpaar doppelt beglückwünschten, zur Geburt eines gesunden Kindes und zur Geburt eines Söhnchens, mit dem ja auch endlich zu rechnen gewesen war. Martin hieß er, hatte man da richtig gehört? Oder Werner, wie der Vater? Seine Frau wimmelte die Besucher höflich ab und übergab ihnen ein Bündel mit Pflaumenmus gefüllter Krapfen, von denen sie in den Wochen vor der Geburt mehrere Bleche voll gebacken hatte. Das Kind ließ sie nicht sehen. Es sei, sagte sie, gerade eingeschlafen und solle nicht gestört werden.
Niemand hätte gewünscht, den Säugling als Nackedei zu besichtigen. Selbst seine Großeltern, die am Sonntagmorgen in ihrem Dorf loswanderten und nach einem zweistündigen Fußmarsch bei der Familie anlangten, wären nicht auf die Idee gekommen, sich mit eigenen Augen vom Geschlecht des neuen Enkelchens überzeugen zu wollen. Und so wenig wie das Gesicht hätte das Greinen des Babys verraten, dass hier nicht ein Martin, sondern eine Martina von Arm zu Arm gereicht wurde. Aber die Mutter rückte ihre Jüngste nicht heraus. Zum einen war es ihr zuwider, bei einer Schmierenkomödie mitzuspielen. Zum anderen betrachtete sie es von Beginn an als ihre Pflicht, dieses Kind, das in den Augen seines Vaters nichts anderes als ein Ärgernis darstellte, besonders zu schützen. Sie meinte es gut. Aber indem sie das Kind abschirmte, wies sie ihm ungewollt auch einen Platz im Hintergrund zu.
Den Canossagang zum Standesamt zu übernehmen, war sie nicht bereit. Am Sonntagmorgen drohte sie ihrem Mann: Wenn er nicht hinginge, und zwar sofort nach dem Frühstück am Montagmorgen, verschwände sie mit Sack und Pack und den drei Töchtern aus dem Haus. Es war der böseste Moment ihrer Ehe, und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich vom Dienst abzumelden und dem Standesamt einen zweiten Besuch abzustatten. Welche Argumente er sich dort einfallen ließ, um den kuriosen Umstand zu erklären, erst nach einer Woche den falschen Namen und die falsche Geschlechtsangabe auf der Geburtsurkunde bemerkt zu haben, darüber gab er niemals Auskunft. Dass es eine Schmach war, die ihm zugefügt wurde, ließ er sich allerdings empfindlich anmerken, als er mit der neuen Geburtsurkunde nach Hause kam, die nun einem Mädchen namens Martina galt. Die eigentliche Schmach erwartete ihn noch. Schneller als die frohe Botschaft von der Geburt eines gesunden Buben verbreitete sich nun, genau eine Woche später, die Komödie vom Bub, der gar keiner war, über die Gerüchtekanäle der Kleinstadt. Und die Stadt lachte. Die Gratulanten ließen sich die Krapfen schmecken und schlossen Wetten über die Anzahl der Mädchengeburten ab, die fürderhin zu absolvieren seien, bis die Eheleute endlich einen Treffer erzielten. Vier, fünf? Bei großem Fleiß womöglich sechs oder sieben? Das sollte doch genügen, um den Klapperstorch zu erweichen. Und wer nicht lachte, äußerte, was meinen Großvater mindestens so verdross, sein Bedauern mit dem armen Mann, der sich so verzweifelt einen Bub wünschte, dass ihm jedes Mittel recht war.
Es wurde Spätsommer, bis die Mutter mit allen dreien, die Vierjährige lief schon flott, die Zweijährige tapste an ihrer Hand, die Kleinste lag im Kinderwagen, einen Gang durch die Stadt unternahm, zum Einkaufen beim Bäcker und beim Metzger haltmachte und zuließ, dass sich fremde Köpfe über den Säugling beugten. Man tat ihr zuliebe so, als sei die Albernheit beim Standesamt nie vorgefallen. Aber vergessen wurde sie nicht. Sie war zu unterhaltsam, um dem Fundus an Kleinstadtklatsch verloren zu gehen und nicht durch die Generationen weitergereicht zu werden. Mir wurde erst spät bewusst, dass meine Tante immer damit rechnen musste, als die Frau Lehrerin betuschelt zu werden, die vom Vater zum Bub erzwungen werden sollte; die Unverheiratete mit der falschen Geburtsurkunde.
IN DER ERINNERUNG DER FAMILIE mischte sich der Vorfall unter andere Episoden, die wie zum Kannenboden abgesunkene Kaffeekörner im Gedächtnis ruhen und immer mal wieder aufgerührt werden. Aber in Wahrheit war es keine Geschichte wie andere. Nicht so harmlos wie das Missgeschick mit der Kommuniontorte, die der Mutter aus der Hand stürzte und löffelweise vom Küchenboden aufgeschabt wurde. Nicht so überholt wie der Konfessionsstreit, der ausgerechnet am Abend vor der Hochzeit der mittleren Tochter zwischen Katholiken und Protestanten ausbrach und beinahe die ganze Heirat verhindert hätte. Auch wenn sie zum Amüsement aufgetischt wurde, behielt die Geschichte von der falschen Geburtsurkunde einen bitteren Beigeschmack. Er enthielt nicht nur Scham über das Unrecht, das der Jüngsten ja doch zugefügt worden war, sondern auch einen Rest von der Enttäuschung, eine Familie ohne Sohn zu sein. Und hauchfein mischte sich in die Enttäuschung ein Vorwurf, der sich keineswegs gegen den Urheber des Skandals richtete, sondern gegen diejenige, die er für sein skandalöses Verhalten verantwortlich machte.
Und sie selbst? Die Frau, die von allen, von ihren Schwestern und ihren Eltern, aber auch von Nachbarn und Bekannten zeitlebens nur Tante Martl genannt wurde, als sei Tantesein kein verwandtschaftlicher Status, sondern eine Existenzform? Sie lachte auf eine etwas künstliche, übertrieben grelle Weise mit, wenn ihre „Martinwoche“ zur Sprache kam, und schüttelte den Kopf, „was für e Unfug sich die Leut ausdenke“. Nie ließ sie sich Schmerz oder Zorn anmerken. Erst in ihren zwei letzten Lebensjahren, als sie in einem Altenheim wohnte und die Demenz sich ihres Gehirns bemächtigte, löste sich der Gefühlsriegel. Sie war achtundachtzig Jahre alt und in eine aussichtslose Lage geraten. Zu hinfällig, um ohne Hilfe im Haus zu bleiben, wehrte sie sich dennoch rigoros gegen das Zusammenleben mit einer Pflegerin. Schon die Idee betrachtete sie als Verrat. „Isch war mei ganz Lebe allein“, schrie sie mich am Telefon an, „da bringscht du mir ke fremde Leut ins Haus!“ Um keinen Preis wollte sie, die auf so vieles verzichtet hatte, nun auch noch auf ihren letzten Wunsch verzichten, der in nichts Bescheidenerem bestand als darin, still und unbehelligt in ihrem Haus zu sein und dort zu sterben. Nach einem Krankenhausaufenthalt war sie so geschwächt, dass die Ärzte es ablehnten, die Verantwortung für ihre Rückkehr ins Haus zu übernehmen, sollte sie dort ohne Obhut sein. Selbst jetzt war es ihr lieber, in ein Heim zu gehen. Von zwei Katastrophen erschien ihr dies als die etwas weniger schlimme.
Wider Erwarten blühte sie in den ersten Wochen im Heim auf. „Es isch eischentlich wie im Hotel“, berichtete sie befriedigt. Die langen Zimmerflure, die in Gesellschaft einzunehmenden Mahlzeiten und das kleine Angebot an kulturellen und sportlichen Aktivitäten erinnerten sie an Hotelaufenthalte, und mir fiel ein Stein vom Herzen. Schon morgens hole sie eine ihrer guten Blusen für die nachmittägliche Kaffeetafel aus dem Schrank, „isch will jo doch bissche fein do sitze.“ Ich bestärkte sie sogar noch in der Hotelillusion und redete ihr zu, die urlaubsähnlichen Annehmlichkeiten voll auszuschöpfen. Beim nächsten oder übernächsten Telefonat merkte ich, dass das schmeichelhafte Deckbild von der Realität abgefallen war und meine Tante das Heim nun umso mehr als Verbannungsort empfand. Hotelgäste werden nicht vom Personal ermahnt, ihre Medikamente pünktlich einzunehmen, nicht morgens um sieben mit ihrem Rollator ins Badezimmer geschoben. „Do sitze erwachsene Leut beim Esse mit e Plastiklatz um de Hals, des isch doch net normal!“, rief sie entrüstet. „Des is wie im Kindergarte! Isch bin doch ke Kind, isch bin e alt Frau!“
In den Tunnel ihrer Verzweiflung drang nur noch für kurze Momente ein wenig Helligkeit. Sie litt unter dem Alleinsein in ihrem Zimmer und unter der Anwesenheit von Menschen. Sie litt unter Stille und unter dem kleinsten Geräusch, das aus dem Flur zu ihr drang. Die Verdunkelung ihrer Seele beschleunigte ihre geistige Verwirrung. Sie verwechselte die Pflegerinnen ebenso wie ihre Brillen. Tag für Tag wurde sie von neuem Entsetzen gepackt, wenn sie vom Bett aus mit der Lesebrille zum Fernsehmonitor an der gegenüberliegenden Zimmerwand blinzelte, nur noch verschwommene Bilder sah und sich für urplötzlich erblindet hielt. Sie wollte nichts mehr essen und hatte starkes Untergewicht. Nur mit Mühe konnte ich sie bei meinen Besuchen dazu bewegen, an einem Bahlsenkeks zu knabbern. Sie hatte Bahlsenkekse immer sehr geschätzt. „Isch will ke Firlefanz“, konstatierte sie jedes Mal, wenn sie im Supermarkt eine Packung Bahlsenkekse in den Einkaufswagen legte, „a gut Bahlsekeks is a einfache, ehrlische Sach. Wenn di Mensche genauso wärn, gäbs auf de Welt ke Streit und ke Kriesch.“
Je mehr sie verfiel, desto stärker drängte die Martingeschichte aus ihr heraus, die sie selbst ja nur vom Hörensagen kannte. Am Anfang klagte sie nur. Sobald jemand ihr Zimmer betrat, ob der Arzt, eine Pflegerin, die Putzfrau oder ihre Nichte, begann sie sich, unterbrochen von langem Stöhnen, über die gefälschte Geburtsurkunde zu beschweren. „Des gehört sisch doch net“, lautete eine ihrer wiederkehrenden Redewendungen, mit denen sie die Ungehörigkeit so darstellte, als ginge es um ein fremdes Kind, von dem sie in der Zeitung gelesen hatte. Nach ein paar Monaten steigerte sich die Klage zu wildem Zorn. „Was kann denn des Kind dafür, dass es kei Bub isch?“, kreischte sie in den Raum. „Gar nix! Und was mache die Leut? Gehe zum Standesamt und lass e Bub eintrage! Jetzt sag amol: Isch des e Sauerei oder net?“ Und schließlich, wiederum Monate später, zeigte sich der alte Schmerz unverhüllt. Meine Tante saß schluchzend auf dem Bettrand, ruderte mit den Füßen über den Linoleumboden, ziellos nach einem Gegenstand suchend, den ihr Gehirn nicht mehr als Hausschuh abzubilden vermochte. Ich setzte mich neben sie, um sie zu trösten, und sofort umklammerte sie mit einer Hand meinen Unterarm.
Wie das Stöhnen zählte diese Gebärde zu den Angewohnheiten, die ihr schon immer zu eigen gewesen waren und sich im Alter verstärkten. Wenn sie nach meinem Arm langte und zudrückte, wusste ich, dass sie zu einer Mitteilung ansetzte, die keinesfalls überhört werden durfte. Der Griff hieß: Aufpassen! Jetzt kommt was Wichtiges! Die Nummer ihres Schließfaches bei der Stadtsparkasse, den Aufbewahrungsort ihrer Lebensversicherung, aber auch das System ihrer Küchenmülltrennung hatte sie mir auf diese Weise eingeschärft. Als hätte ihr Wunsch nach Anteilnahme eines körperlichen Nachdrucks bedurft, streckte sie auch dann die Hand zum Arm ihres Gesprächspartners aus, wenn sie über Themen reden wollte, die sie gerade stark beschäftigten. Eine Diskussion über den, wie meine Tante fand, ziemlich unchristlichen Starkult um den polnischen Papst wurde vom Druck ihrer Hand begleitet, ebenso die Erörterung der Frage, ob es sinnvoll sei, auf einem Kreuzfahrtschiff eine Kabine mit Balkon zu buchen.
„Weischt du, was mir passiert ist?“, begann sie, als habe sie noch nie zuvor vom Drama ihrer Geburtsurkunde berichtet und lüfte just in diesem Moment ein ungeheuerliches Geheimnis. Dabei ließ sie ihren Oberkörper wie unter einer schweren Last nach vorne sinken, und ich musste zusehen, dass sie nicht kopfüber vom Bettrand fiel und mich mitzog. „Die habbe e Bub aus mir gemacht, aber isch war doch gar ke Bub.“ Ihr Gesicht nahm einen gequälten Ausdruck an, und meine Tante begann so bitterlich zu weinen, wie ich sie nur ein einziges Mal weinen gesehen hatte, viele Jahre zuvor. „Die ganz Stadt hat über misch gelacht, die ganz Stadt.“ Ihren Vater erwähnte sie merkwürdigerweise nicht. Er kam in ihrer Erzählung gar nicht vor. Er wurde von einer unspezifischen Macht vertreten, die sie als „die Leut“ oder „die Obere“ bezeichnete. Man hätte meinen können, im Sommer 1925 habe ein geheimes Gericht beschlossen, diese Martina für ihre Weigerung, ein Martin zu sein, anzuklagen und ordentlich büßen zu lassen. Denn unermüdlich beteuerte sie, nicht schuld daran zu sein, dass sie als Mädchen geboren worden war.
„Sieschte, da habbe wir doch was gemeinsam“, sagte meine Tante oft. Wir hätten eben beide, sollte das heißen, Anlass zur Enttäuschung geboten. „Isch war falsch, und du warscht hässlisch.“ Gern hörte ich das nicht, aber es stimmte wohl. Ich kam mit blau angelaufenem Gesicht auf die Welt, die Nabelschnur hatte sich um meinen Hals gewickelt. Die Wirkung des zombiehaften Anblicks soll durch die Töne, die ich von mir gab, noch gesteigert worden sein. Sie waren, so beteuerte meine Mutter, furchterregend. Nicht das hohe, herzergreifende Neugeborenenkrähen, wie es ringsum im Kreißsaal zu hören war und wie ich es bei der Geburt meiner Tochter selbst hörte, sondern ein tiefes Brummen. Ich hatte immer Zweifel, ob das physiologisch überhaupt möglich, der Kehlkopf eines vier Kilogramm wiegenden Menschleins in der Lage ist, das Gegrunze eines Urmenschen zu erzeugen, der aus seiner Höhle kommt. Ungefähr so soll es sich nämlich angehört haben.
Ich widersprach meiner Tante nicht, obwohl ich insgeheim ihren Fall für schwerwiegender hielt als meinen. Aber ich merkte, wie gut es ihr tat, sich mit mir in einer Schicksalsgemeinschaft zu wähnen. Sie war folglich nicht die Einzige in der Familie, die man sich beim Austritt aus dem Geburtskanal anders gewünscht hätte, eine Gemeinsamkeit, die durch ihre Patenschaft noch besiegelt wurde. Denn Martl war meine Patentante. Sie hielt mich in der Barockkirche der fränkischen Kleinstadt Herzogenaurach, in der ich geboren wurde und aufwuchs, übers Taufbecken. Sie kam zu meiner Einschulung, befüllte meine Schultüte mit Süßigkeiten, die zu kaufen sie Überwindung gekostet hatte. Sie schenkte mir mein erstes Fahrrad, es war rot und hatte eine luxuriöse Dreigangschaltung, und zur Kommunion eine wertvolle Armbanduhr. „Jetzt lass doch das Kind“, sagte sie beschwichtigend, sobald sich meine Mutter wieder einmal über meine Lautstärke beschwerte. Ihrer Meinung nach hatte sich das Säuglingsbrummen nämlich zu einem unvorteilhaften Wesenszug entwickelt, dem Lautsein. Ich redete, lachte, sang zu laut. In den Ohren meiner Mutter lief ich sogar zu laut. Wenn ich Geschirr spülte, wurde ich angefleht, keinen Polterabend zu veranstalten. Wenn ich eine Tür öffnete, fuhr meine Mutter mit gepeinigtem Gesichtsausdruck zusammen, als hätte ich sie bereits zugeknallt. Sie schätzte leise Menschen. Martl, mein Vater und ich zählten nicht dazu. Wir bildeten in der Familie die Fraktion der Lärmenden, von der sich die Fraktion der Leisen wohltuend abhob. Ihr gehörten meine Mutter, ihre ältere Schwester, deren Mann und mein Bruder an.






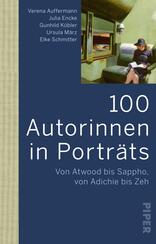







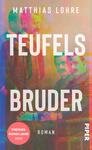
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.