

Tel Aviv - Berlin Tel Aviv - Berlin - eBook-Ausgabe
Geschichten von tausendundeiner Straße
„Ein Roadmovie mit Einblicken in die jüngste Vergangenheit.“ - Die Zeit
Tel Aviv - Berlin — Inhalt
Fredy Gareis hat sich einiges vorgenommen: eine Reise von Tel Aviv nach Berlin, mit einem alten Stahlrad, ohne jedes Training. 5000 Kilometer durch Länder wie Jordanien, Libanon und den Kosovo. Auf seiner Fahrt durch blühende und vernarbte Landschaften sammelt er die Geschichten der Bewohner mit über vierzig Konfessionen ein - manchmal lachend, manchmal verzweifelnd, immer mit Gespür für politische und geschichtliche Hintergründe. Er trifft Serife, die türkische Malerin, und fährt Rennen mit syrischen Flüchtlingskindern. Er übersteht Überfälle und Nahtoderlebnisse. Und wird schließlich zum philosophierenden Radnomaden und Asphaltcowboy.
Leseprobe zu „Tel Aviv - Berlin“
Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do.
MARK TWAIN
PROLOG
Die Sonne bringt die Luft zum Flirren, sie strahlt auf die judäischen Wüstenberge, sie brezelt auf meinen glatt rasierten Kopf, bringt mich zum Schwitzen: In Strömen läuft es an mir herunter, so viel Wasser sieht das Westjordanland nicht alle Tage. Ich muss kämpfen auf dieser steilen Straße zwischen Bethlehem und Ma’ale Adumim, zwischen palästinensischem Westjordanland und israelischem Siedlungsgebiet. Ich keuche, trete [...]
Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do.
MARK TWAIN
PROLOG
Die Sonne bringt die Luft zum Flirren, sie strahlt auf die judäischen Wüstenberge, sie brezelt auf meinen glatt rasierten Kopf, bringt mich zum Schwitzen: In Strömen läuft es an mir herunter, so viel Wasser sieht das Westjordanland nicht alle Tage. Ich muss kämpfen auf dieser steilen Straße zwischen Bethlehem und Ma’ale Adumim, zwischen palästinensischem Westjordanland und israelischem Siedlungsgebiet. Ich keuche, trete rhythmisch, bin aber so langsam, dass ich auch schieben könnte.
Der Verkehr röhrt an mir vorbei. Ich versuche, nicht auf die grauen Befestigungen des israelischen Checkpoints am Ende der Straße zu schauen, hefte meinen Blick auf den Asphalt, bewege mich auf meinem Rad von der einen zur anderen Seite, schwankend wie ein Wüstenkamel.
Ich konzentriere mich auf meine Atmung, auf die Muskeln in meinen Beinen, auf die Körnung des Asphalts.
Ein Auto schiebt sich von links in mein Blickfeld, eine schwarze Skoda-Limousine, sie schneidet mir den Weg ab und kommt direkt vor mir zum Stehen. Zwei Männer steigen aus. Zwei bleiben im Fond und werfen mir durch das Rückfenster Blicke zu, die scharf sind wie gewetzte Messer. „POLICE!“, schreit einer der Ausgestiegenen, ein breitschultriger Mann mit Schnauzer und schwarzem, dreckigem T-Shirt. Sein Unterarm ist voller Tätowierungen, primitiven Stechereien, ohne Maschine in die Haut geritzt.
Police my ass.
Sein Kollege geht um mich herum, schneidet mir den Fluchtweg ab. Er legt die Hand an die Hüfte, als wäre er bereit, ein Messer, eine Knarre zu ziehen. Er ist schmal und hat einen krummen Rücken, schulterlange, fettige Haare. Hinterhältig sieht er aus, fies wie ein Schurke aus „Tausendundeiner Nacht“.
Schnauzer tritt dicht an mich ran. Er rüttelt an meiner Lenkertasche. „Can I see ID?“, frage ich und weiß doch, dass ich keine sehen werde.
Schnauzer rüttelt weiter an der Lenkertasche, er will sie aufreißen, scheitert am Ortlieb-System. Er schreit mich wieder an: „MONEY! TELEPHONE!“ Ich rieche seinen fauligen Atem.
Meine Scheiße, wie bin ich bloß auf diese verrückte Idee gekommen, hier durchzufahren?
Ah ja, ich wollte ein Abenteuer. Nach zwei Jahren als Korrespondent im Nahen Osten war ich konfliktmüde, nach sieben Jahren als freier Journalist medienmüde. Fühlte mich wie ein Parasit, der nur von den Geschichten der anderen lebt. Aber wo war meine eigene dabei geblieben? Wann hatte ich zum letzten Mal meiner Stimme zuhören können? Immer übertönt vom Grundrauschen des Arbeitsalltags. Vor Jahren hatte ich über ein paar sehr mutige Frauen geschrieben. Eine von ihnen war Roz Savage (wie großartig ist denn dieser Nachname?), eine Bankerin in der Londoner Hochfinanz, sie hatte Haus, Auto, Mann und noch eine Menge mehr, aber eines Tages, in Sichtweite ihres 40. Geburtstages, setzte sie sich hin und seufzte. Sollte das alles sein? Sie schrieb auf ihrem teuren, persönlichen Papier ihren Nachruf. Sie las die kurzen Zeilen, sie zerknüllte das Blatt, sie machte einen neuen Versuch. Diesmal flossen die Zeilen nur so aufs Papier. Roz schrieb auf, wie man sich an sie erinnern sollte.
Sie kündigte ihren Job. Ruderte die Themse runter. Dann überquerte sie den Atlantik. Dann den Pazifik. Alles alleine.
Ich traf sie auf Hawaii. Roz hatte ihre sandblonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und packte Lebensmittel in ihr Boot für die letzte Etappe nach Australien. Zu Hause sagten Freunde, wie geil, dass dich jemand dafür bezahlt, ein Interview auf Hawaii, Mensch, Journalisten haben vielleicht ein Leben. Dabei wäre ich am liebsten mit in das Boot gehüpft und hätte mich in den nächsten Monaten von Erdnussbutter und Sardinen aus der Dose ernährt und dem Schlagrhythmus der Ruder hingegeben.
Der Redakteur kam mit diesem Wechsel von der Hochfinanz auf einen niedrigen Rudersitz überhaupt nicht klar. „Warum“, fragte er immer wieder, „warum macht die das? Ist die verrückt?“ Manche verstehen einfach nicht, dass es um mehr geht, als das Leben nur der Länge nach abzuleben. Auch die Breite will genutzt werden. Die Gedanken waren mir nicht neu. Aber dann frisst der Alltag dich auf. Die Wochen und Monate vergehen – und kommen nie wieder zurück. Es ist so, wie der römische Philosoph Seneca einst geschrieben hat: „Nur ein kleiner Teil des Lebens ist es, den wir leben. Die gesamte übrige Spanne ist nicht Leben, sondern Zeit.“ True, true.
Etwas für den Körper wäre gut, sagte ich mir. Den Kopf defragmentieren. Sich des ganzen digitalen Mülls entledigen, der sinnlosen Nachrichten, Posts, Tweets. Zu viel Oberfläche, zu wenig Tiefe. Mir zumindest frittiert die Datenflut das Gehirn. Ich muss raus, muss auf Infodiät.
Nur, was tun? Rudern wie Roz oder wandern wie Wolfgang Büscher? Ich dachte an meine Reise nach Russland, schon ein paar Jahre her, und an Björn, meinen dänischen Freund – zwei Meter groß, Bart, Typ Wikinger –, den ich in Odessa getroffen hatte. Ich war auf dem Rückweg von Sibirien, wo ich meiner Familiengeschichte bis ins ehemalige Straflager meiner Oma gefolgt war, an den Himbeersee und den Ort gleichen Namens, in der Nähe der kasachischen Grenze. Dorthin war meine Oma mit ihrer Familie deportiert worden, hatte zehn Jahre für Stalin im Winter gefrorenes Soda aus den kleinen, wirklich himbeerfarbenen Seen in der Umgebung brechen müssen. Russlanddeutsche, die zwangsrepatriiert worden waren.
Björn war damals gerade unterwegs in den Iran. Mit dem Rad. Sein Bart war so buschig, dass er ein Vogelnest darin hätte verstecken können.
Abends in der Nähe der Potemkinschen Treppe saßen wir in einer Bar, vor uns eine Karaffe Wodka, eine Karaffe Wasser, getrockneter Fisch, und Björn erzählte mir von dem Dorf in der Ukraine, wo ihn die Lokalzeitung auf die Titelseite gezerrt hatte, mit einem Zwei-Kilo-Stück Speck, Geschenk der Gemeinde, abgelichtet hatte. Er erzählte von der Familie in der Nähe von Tschernobyl, die ihn für ein paar Tage aufgenommen hatte. Der Vater redete von den Kindern, die die Eltern hatten wegschicken müssen, damit sie nicht in der Strahlung aufwuchsen. Die Familie teilte mit Björn Essen und Tränen. Im Kaukasus war er Menschen begegnet, die mit Kalaschnikows in den Bäumen saßen und ihn schon von Weitem mit seinem Rad kommen sahen.
„Es gibt keine bessere Art zu reisen“, sagte Björn.
„Warum?“
„Entweder denken die Leute, du bist harmlos, und das noch in der gefährlichsten Gegend. Oder sie haben einfach so viel Mitleid mit dem armen Tropf, der sich keinen anderen Transport leisten kann, dass sie dir Tür und Tor öffnen.“
„MONEY!! TELEPHONE!!“ Der Schnauzer schreit immer noch, Krummrücken hält die Umgebung im Blick. Die beiden sind nicht im Geringsten nervös. Die haben schon viel Schlimmeres gemacht, denke ich mir. Ich verhalte mich ruhig, kann sowieso weder vor noch zurück. So viel zu Mitleid mit dem armen Tropf.
Der Verkehr fließt weiter an mir, an uns vorbei. Wie sieht diese Szene wohl aus den Autofenstern aus? Mein Herz schlägt schnell, ich kann es hören in meiner Brust, laut und deutlich. Obwohl die Typen mich eingekeilt haben, denke ich an Flucht. Soll ich es wagen? Die Straße in entgegengesetzter Richtung runterrasen?
Was dann?
Ich bin nicht naiv. Ich habe damit gerechnet, überfallen zu werden. Aber doch nicht hier. Nicht in meinem Revier.
Über mir der azurblaue Himmel. Neben mir die sandbraunen Wüstenberge. Unter mir die graue Straße. Vor mir der Schnauzer. „MONEY!!! TELEPHONE!!!“, schreit er zum wiederholten Mal, und ich fühle seinen Speichel auf meinem Gesicht. Er reißt an der Lenkertasche, endlich hat er sie offen, von hinten tritt Krummrücken näher ran, ich schaue zu den grauen Befestigungstürmen des israelischen Checkpoints. Sie sind verdammt weit weg. Super Urlaub.
KAPITEL I
„Junge, du bist doch bescheuert!“
Wo, bitte, geht’s denn hier zum Nahostkonflikt?
Schlaflose Nächte in den letzten Tagen. Geträumt von wilden Hunden, geplatzten Reifen und Überfällen in der einsamen Wüste. Ich habe ein bisschen Angst vor der ganzen Sache. Aber nur ein bisschen. Is’ klar.
Doch jetzt stehe ich hier, in Tel Aviv am Strand bei 25 Grad, und umarme meine Freundin. Ich drücke ihr die Luft aus dem schmalen Körper und verstecke meine Nase in ihren blonden Haaren.
Sie weint ein wenig, mein Herz klopft, und vor mir liegen etwa 5000 Kilometer mit dem Rad nach Berlin. Zumindest haben das meine amateurhaften Berechnungen ergeben.
Ich küsse meine Freundin. Wische ihr eine Träne aus dem rechten Auge. Die Sonne über dem Mittelmeer wirft ein Schlaglicht auf uns. „Geh jetzt, bitte“, sagt mein Liebling.
Zwischen all den Menschen, die Bier trinken, Strandball spielen, sich in der Sonne aalen und lachen, steige ich auf mein mit fünf Taschen bepacktes Rad – und sage einfach Tschüss.
Als würden wir uns morgen, spätestens übermorgen wiedersehen.
Das ist dieser erste sprichwörtliche Schritt. Hoch auf den Ledersattel, der sich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten meinem Arsch anpassen wird. Hoffentlich.
Mein Rad fühlt sich schwer an unter mir. Es ist ein solides Teil aus Stahl mit zwölf Gängen, noch gebaut in Westdeutschland. Die Kette, die Reifen – alles noch original, also mehr als 20 Jahre alt. Dafür hat es nur 90 Euro gekostet. Ich habe es auf eBay geschossen. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, navigiere es wie einen schweren Tanker durch das sanft dahinwogende Meer aus Menschen, ihre mediterrane Bräune leuchtet im hellen Schein der Januarsonne.
Wenn das Meir Dizengoff, der erste Bürgermeister Tel Avivs, sehen könnte, diesen puren Hedonismus, diese friedvolle Strandbesatzung. Der wollte nämlich das Gelände am liebsten industriell erschließen. Weil er sich nicht vorstellen konnte, warum Juden Interesse am Baden zeigen sollten. Der Journalist Sholem Asch hingegen schrieb 1937: „Jeder Jude hat zwei Bitten an Gott: einen Platz im Paradies im Jenseits – und im Diesseits einen Platz am Strand von Tel Aviv.“ Die Stadt als leuchtender Gegenentwurf zu den grauen und ärmlichen Schteteln im östlichen Europa.
Tel Aviv, der „Frühlingshügel“, ist gerade mal 104 Jahre alt. Israelis nennen die Stadt mit ihrer 24-Stunden-Kultur auch gerne The Bubble, die Blase. Weil du hier alle Sorgen vergessen kannst. Der Strand ist 14 Kilometer lang, die Biergläser sind immer voll und eiskalt, die Frauen filmhaft schön, die Nächte feucht und dampfend.
Über mir fliegen Kampfhubschrauber Richtung Gaza. Es sind gerade mal 60 Kilometer dorthin, und doch ist es Welten entfernt. In Tel Aviv ist man hedonistisch liberal, gerade weil die Konflikte in der Region gefühlt so weit weg sind. Während die Linken am Strand zu Bronzestatuen werden, Volleyball spielen oder das neueste Restaurant belagern, betreiben die Rechten in Jerusalem knallharte Politik, rühren die Trommeln gegen die Flüchtlinge aus Afrika, gegen die Palästinenser, gegen den Iran.
Theoretisch könnte ich diese wundervolle Küste immer Richtung Norden entlangfahren, durch den Libanon, durch Syrien, und ratz, fatz wäre ich schon in der Türkei.
Theoretisch. Alles nicht so leicht im Nahen Osten. Grenzen sind hier noch echte Hindernisse.
Ich fahre vorbei an den Segelbooten in der Marina, den ganzen Restaurants. Denke nur: shit, shit, shit. Weil mir klar wird, dass ich nicht morgen und auch nicht übermorgen zurück sein werde. Weil das nur die ersten Pedaltritte von Millionen sind. Weil ich mich frage, wann ich meine Freundin wiedersehen werde. Werde ich sie überhaupt wiedersehen? Die Region ist nicht gerade bekannt für ihre rücksichtsvollen Autofahrer.
Links schwappt das Meer sanft an den Strand, rechts in den Gassen zwischen den Häusern regieren die Katzen, ganze Banden marodieren durch die Straßen, mit vernarbten Gesichtern, abgebissenen Ohren, lahmen Beinen. Abends warten sie an den Ecken auf die alten Frauen, die in der Dunkelheit, damit sie keiner dabei erwischt, kleine Türmchen aus Trockenfutter auf dem Bürgersteig errichten. Tel Aviv riecht salzig nach Meer und sauer nach Katzenpisse.
Im Norden der Stadt biege ich auf den Radweg am Yarkon-Fluss ab, fahre unter den Kronen von Platanen und Eukalyptusbäumen entlang, atme die Luft dieser grünen Lungen, die um diese Jahreszeit noch frisch ist.
Der Fluss liegt faul in seinem Bett, ein türkisgrünes Eldorado für Moskitos. Im Altertum war der Yarkon die Grenze zwischen den Stämmen Ephraim und Dan, zwei von den zwölfen, aus denen sich Jahwes auserwähltes Volk zusammensetzte. Jetzt führt er mich aus der „Weißen Stadt“. Der Name kommt von den etwa 4000 Gebäuden im Bauhausstil. Schüler von Gropius und Mies van der Rohe flohen vor den Nazis und ließen hier in der neuen Heimat ihre Ideen von Aufbruch, Modernität und Weltbürgertum in die Architektur Tel Avivs einfließen.
Immer am Fluss entlang, raus aus diesem Großstadtknäuel, in dem 42 Prozent der israelischen Bevölkerung leben, lieben und sterben.
Vor zwei Jahren bin ich in Israel aus dem Flugzeug gestiegen, die Grenzbeamtin strich ihre schwarzen Locken nach hinten, und während ich noch dachte, ganz hübsch, die Kleine, blaffte sie mich an:
„Was willst du hier?“
In der Tat, was wollte ich hier?Eigentlich hatte ich keinen Schimmer von Israel. Ich schaute auf den kaugummikauenden Mund der Beamtin (hatte ich jemals in Deutschland ein so schönes Wesen im Staatsdienst gesehen?) und sagte:
„Ich bin Journalist. Ich werde für die deutschen Medien berichten.“Wichtig schob ich nach: „Als Korrespondent“ und zeigte ihr das entsprechende Schreiben einer deutschen Redaktion.
Ja, Korrespondent, das hatte einen guten Klang. Das wollte ich immer werden, seit ich mir mit 16 Jahren von meinem ersten selbst verdienten Geld (Zeitungen austragen – allerdings muss ich beichten, dass ich die Zeitungen auch oft einfach zur nächsten Papiertonne „ausgetragen“ habe) ein Abo der Zeitschrift Geo geleistet hatte.
Sie warf einen Blick auf meine Papiere, dann einen auf mich und sagte: „Ah, großartig, noch mehr Journalisten.“
Mag sein, Israel brauchte mich also nicht. Aber ich brauchte Israel. Denn in Berlin gab es für mich als Journalisten keine Perspektive, Deutschland ist irgendwie so … fertig. Die letzte wirklich große Sache war doch die Wende; Menschen, die eine Mauer, ein System zum Einsturz brachten. Da war ich erst 15 und hätte vor dem Fernseher Rotz und Wasser geheult. Wenn meine Mutter nicht neben mir gesessen hätte. Kann doch nicht vor der Mutter flennen.
Israel also.




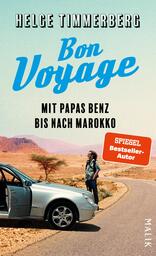








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.