


Terror gegen Juden Terror gegen Juden Terror gegen Juden - eBook-Ausgabe
Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt
— Eine Anklage: alarmierende Reportage, aktualisiert seit dem 7. Oktober 2023 – mit einer Chronik antisemitischer Gewalt„Ein erschütterndes Dokument der Gleichgültigkeit.“ - Der Tagesspiegel
Terror gegen Juden — Inhalt
Zeit, dass Polizei und Justiz aufwachen!
In Deutschland hat man sich an Zustände gewöhnt, an die man sich niemals gewöhnen darf: Jüdische Schulen müssen von Bewaffneten bewacht werden, jüdischer Gottesdienst findet unter Polizeischutz statt, Bedrohungen sind alltäglich. Der Staat hat zugelassen, dass es so weit kommt - durch eine Polizei, die diese Gefahr nicht effektiv abwehrt, sondern verwaltet; durch eine Justiz, die immer wieder beschönigt.
Der jüdische Autor Ronen Steinke, selbst Jurist, ist durch Deutschland gereist und erzählt von jüdischem Leben im Belagerungszustand. Er trifft Rabbinerinnen und Polizisten, konfrontiert Staatsschützer, Geheimdienstler und Minister mit dem Staatsversagen. Viel muss sich ändern in Deutschland. Was zu tun wäre, erklärt dieses Buch.
Leseprobe zu „Terror gegen Juden“
Eyes wide shut
Wie ein Dunkelfeld entsteht
„Der Polizist meinte dann nur, dafür seien sie nicht zuständig, das sei die Abteilung Staatsschutz. Da könne er mir zwar die Nummer geben, aber er würde mir das nicht empfehlen, denn das sei eine ›größere Sache‹. Ich solle das lieber sein lassen, denn sonst hätte ich wochenlang Ärger.“
Die jüdische Psychotherapeutin Ramona Ambs über den Versuch, in Heidelberg eine Strafanzeige zu erstatten, nachdem jemand ein Hakenkreuz an ihre Wohnungstür geschmiert hatte
„Mein Grundvertrauen ist erschüttert“: Der [...]
Eyes wide shut
Wie ein Dunkelfeld entsteht
„Der Polizist meinte dann nur, dafür seien sie nicht zuständig, das sei die Abteilung Staatsschutz. Da könne er mir zwar die Nummer geben, aber er würde mir das nicht empfehlen, denn das sei eine ›größere Sache‹. Ich solle das lieber sein lassen, denn sonst hätte ich wochenlang Ärger.“
Die jüdische Psychotherapeutin Ramona Ambs über den Versuch, in Heidelberg eine Strafanzeige zu erstatten, nachdem jemand ein Hakenkreuz an ihre Wohnungstür geschmiert hatte
„Mein Grundvertrauen ist erschüttert“: Der Restaurantbetreiber
Was Resignation bedeutet, kann man bei Hähnchenbrüsten auf Orangensoße in einem Restaurant am Chemnitzer Schönherrpark erfahren. Der Wirt sitzt an einem Tisch, das weiße Hemd spannt.
Zehn Jahre lang hat Uwe Dziuballa es einfach aufgegeben, die Polizei anzurufen, zehn Jahre lang hatte er keine Lust mehr, die immer gleichen Strafanzeigen zu erstatten, wegen Steinwürfen auf sein Lokal, das koschere „Schalom“, wegen Hakenkreuz-Schmierereien oder Drohanrufen. „Wenn du 45 Anzeigen machst über die Jahre, und es wird nichts aufgeklärt, dann sagst du dir irgendwann: Das ist verschwendete Lebenszeit.“
Er hat sogar einen Brief geschrieben damals, in dem er der Polizei in Chemnitz dramatisch die „Zusammenarbeit“ aufkündigte: „Wenn wir uns überhaupt noch einmal sprechen sollten, dann nur über schmackhafte Latkes oder eine feine Hühnersuppe und solche Dinge“, schrieb der Gastronom an die Beamten – „hochachtungsvoll“.
Im Sommer 2008 war das. Heute sei ihm das ein bisschen unangenehm, „das war sehr emotional“, sagt er entschuldigend, und damals führte es auch nur dazu, dass einige Polizisten ein Argument mehr an der Hand hatten, um ihn als Querulanten abzutun. „Als Hysteriker, der nur die Nachbarschaft schlechtredet“, wie Dziuballa selbst sagt. „Ach, der Herr Dziuballa“, sagte eine Sprecherin der Polizei, als sich einige Zeit später ein Journalist nach den Attacken auf das koschere Restaurant erkundigte.
Dabei hätte dieser Brief es verdient, an Polizeihochschulen studiert zu werden. Was der Gastronom dort an Gefühlen ausdrückte und was er auch an handfesten Erlebnissen beschrieb, das bekommt die Polizei nur selten so deutlich gesagt. Uwe Dziuballa, 55 Jahre alt, zeigt mir Fotos. Von den vier zerstochenen Reifen an seinem Lieferwagen, von Hakenkreuz-Graffitis an seiner Außenwand. Von einem Schweinekopf mit einem draufgeschmierten Davidstern, den sie ihm einmal vor die Tür legten und dessen Blut in den Schnee tropfte. An jenem Wintermorgen rief er die Polizei an. Der Beamte am Telefon sagte: „Können Sie uns den Kopf vorbeibringen? Es hat heute Morgen geschneit, und wir haben sehr viele Verkehrsunfälle …“
Eine halbe Stunde später kam dann doch noch eine Polizeistreife. Ob er einen Müllsack habe, wurde der Gastronom gefragt, man habe vergessen, welche mitzubringen. Ein paar Tage später ein Anruf eines Mitarbeiters vom Staatsschutz. Es sei ihm peinlich, aber es gebe keine Fotos von Fundort und Schweinekopf, weil die Kamera nicht funktioniert habe. Man könne sich das auch nicht erklären. Also sandte Uwe Dziuballa seine Fotos.
Wieder vergingen Wochen, in denen er nicht über den Fortgang der Ermittlungen unterrichtet wurde. Also rief er erneut an. Und traute seinen Ohren nicht. Die Ermittlungen seien nicht fortgesetzt worden, weil der Schweinekopf nicht bei der Kriminaltechnik gelandet sei, sondern aus Versehen in der städtischen Tierkörperverwertung.
Danach reichte es ihm. Von da an tat Uwe Dziuballa, was er schon immer getan hatte in seinem Restaurant, Glasscherben aufsammeln, Pöbler verscheuchen, mit dem Wasserschlauch Urin aus dem Briefkasten waschen. Den Weg zur Polizei sparte er sich. Und wenn heute wieder einer anruft, „Verdammtes Judenschwein“ brüllt, das Lokal für Hitlers Geburtstag reservieren will oder einfach in den Hörer keucht, dann legt er auf und holt eine Strichliste heraus. Das nüchterne Ritual hält den Schrecken etwas auf Abstand. Es sind in zehn Jahren 1492 Striche geworden.
Nur die wenigsten antisemitischen Straftaten werden hierzulande überhaupt gemeldet. Nur 24 Prozent waren es in einer Studie, die im April 2017 von der Unabhängigen Expertenkommission Antisemitismus des Bundestags veröffentlicht wurde. Das war sogar noch großzügig gerechnet. Denn unter dem Wort „gemeldet“ hatten die Forscher bewusst alles Mögliche mitgezählt, selbst bloße Hinweise an die eigene Gemeinde. Sonst wäre die Zahl noch niedriger ausgefallen.
Denselben Befund hatte schon 2013 eine Studie der Europäischen Grundrechteagentur ergeben, für die unter anderem 500 Jüdinnen und Juden in Deutschland befragt wurden. Die Studie wurde 2018 wiederholt, da hatte sich – so sind die Zeiten – die Bereitschaft, Anzeige zu erstatten, noch einmal verschlechtert.
Und frappierend ist auch, zu welchen Reaktionen auf antisemitische Attacken sich viele stattdessen veranlasst sehen. „Ich verberge seitdem in der Öffentlichkeit, dass ich jüdisch bin“: Diesem traurigen Satz stimmten 40 Prozent der Befragten zu. Das sind mehr als jene, die bereit waren, zur Polizei zu gehen.
Im Grunde ist das ein Misstrauensvotum gegen die Polizei, ein Zustand, der dem Rechtsstaat keine Ruhe lassen darf. Schutz vor Gewalt, das ist kein bloßes Serviceangebot des Staates nach dem Prinzip von take it or leave it, oder: Wer nicht will, der hat schon. Wenn der Herr Dziuballa uns nicht mehr anruft, dann braucht er uns wohl nicht mehr.
Ein Rechtsstaat beruht auf dem Anspruch, dass zwischen Menschen nicht einfach das Recht des Stärkeren herrscht, und wenn eine ganze Gruppe der Gesellschaft weithin davon absieht, den Apparat aus Polizei und Justiz zu ihrem Schutz zu nutzen, dann versagt der Staat an diesem Anspruch.
Weil so wenige der antisemitischen Straftaten hierzulande angezeigt werden, dürfe man die Statistik der Polizei „nicht als Abbild der Realität missverstehen“, schreibt der Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus trocken, es müsse mit einer „systematischen Unterschätzung antisemitischer Vorfälle“ gerechnet werden, mit anderen Worten: mit einem riesigen Dunkelfeld. Man könnte allerdings auch ein anderes, dramatischeres Wort wählen. Die Folge ist nicht nur ein Dunkelfeld. Die Folge ist auch ein riesiger Raum der Straflosigkeit für die Täter, ein Raum, in dem ihr Hochmut noch wächst.
Zehn Jahre sind vergangen, als Uwe Dziuballa am 27. August 2018 doch noch einmal die Polizei anruft. Ein neuer Versuch, es ist etwas vorgefallen, das ihn erschüttert hat, „noch nie hatte ich so große Angst wie in diesem Moment“, erinnert er sich. Es ist halb zehn Uhr abends, er räumt gerade sein Restaurant auf, auch die Stühle draußen, als er ein Geräusch hört.
Mehrere schwarz gekleidete Männer stehen dort, im nächsten Moment prasseln Steine, Flaschen und ein abgesägtes Stahlrohr auf Dziuballa ein, und er hört, wie ein Mann ruft: „Hau ab aus Deutschland, du Judensau!“
„Ich stand unter Schock“, sagt Dziuballa. Die Polizei habe sich seine Schilderung in Ruhe angehört und einzelne Gegenstände gesichert, er erstattete eine Anzeige. Doch danach passierte erst mal nichts. Der Gastronom erfuhr, dass sein Fall in den Polizeibericht des Tages gar nicht aufgenommen worden war, später lief das Ganze erst einmal unter versuchter Sachbeschädigung.
Erst nach zehn Tagen kamen Beamte, um die Schäden an seinem Lokal in Augenschein zu nehmen und Wurfgegenstände sicherzustellen. Warum habe er denn die Spuren vom Aufprall an der Fassade und einer Scheibe schon weggewischt, fragten sie, das seien doch Beweismittel?
„Entschuldigung, das hier ist ein Lokal“, antwortete der Wirt.
Einmal, so erinnert sich Uwe Dziuballa, habe ein Polizist zu ihm gesagt: Wenn Sie ein Restaurant betreiben mit so einem Logo – einem Davidstern –, dann müssen Sie mit solchen Attacken rechnen. Dziuballa findet: „Das darf ein Polizist meinetwegen denken. Aber das darf er nicht sagen.“ Und geärgert hat ihn auch der Vorwurf, er würde die Vorfälle letztlich nutzen, um in den Medien Werbung für sein Restaurant zu machen. „Das leuchtet mir nicht so recht ein“, sagt er. „Wenn ich mit meiner Frau schön essen gehen möchte, dann suche ich mir nicht unbedingt das Lokal aus, das mit Fäkalien beschmiert worden ist. Aber vielleicht ist das nur mein persönliches Empfinden.“ Nach einer solchen Tat wie am 27. August 2018 denke man ja, nun kümmert sich der Staat und versucht, die Täter zu erwischen. „Da dies augenscheinlich nicht so war, ist mein Grundvertrauen schon ein bisschen erschüttert.“
Inzwischen ist die Aufmerksamkeit wieder verflogen, in Chemnitz und auch in der Republik, und inzwischen hat Dziuballa einen Brief von der Staatsanwaltschaft erhalten. Der Ermittler teilt ihm mit, in dem Fall mit dem Aktenzeichen 373 UJs 9/18 „habe ich mit Verfügung vom 11.04.2019 folgende Entscheidung getroffen: Das Ermittlungsverfahren wird gemäß Paragraf 170 Absatz 2 StPO eingestellt.“ Sprich, aus Mangel an Beweismitteln.
„Es macht die Sache noch schlimmer“: Die Journalistin
Dinah Riese ist 30 Jahre alt, Redakteurin der taz, sie schreibt über Feminismus und Flüchtlinge, für ein Treffen hat sie ein Café in Berlin-Neukölln vorgeschlagen, in dem die Kellnerin vegane Milch empfiehlt. Dass sie Jüdin ist, habe in ihrer Jugend eigentlich kaum eine Rolle gespielt, sagt sie, die nächste Synagoge war fern. Aber nach der Sache mit der „jüdischen Kriegserklärung“ und nach allem, was das auslöste, änderte sich etwas.
Dinah Riese war zehn Jahre alt, da erschien ein antisemitischer Leserbrief in der Lokalzeitung in der hessischen Kleinstadt, in der sie lebte. Einer der wichtigsten Bürger im Ort, der Senior einer Hutfabrik, 88 Jahre alt, schrieb immer wieder solche Briefe. Hitler habe ein gutes Recht gehabt, gegen Juden vorzugehen, stand da diesmal. Die Juden hätten angefangen, mit einer „jüdischen Kriegserklärung“; eine von Antisemiten immer wieder bemühte Legende. So druckte es im Jahr 1999 der Lauterbacher Anzeiger ab, für alle im Ort zu lesen.
Damit begann etwas. Die Journalisten der Lokalzeitung: protestierten nicht. Die Kommunalpolitik: protestierte nicht. Der einzige Mensch im Ort, der vernehmbar widersprach, war Dinah Rieses Vater. Er schrieb einen Gegen-Leserbrief, „die böswillige antisemitische Absicht springt ins Auge“, hielt er dem Hutfabrikanten darin entgegen. Die Zeitung druckte auch das.
Danach kam eine Menge Post. Beleidigungen, Drohungen, einmal holte Dinah Riese eine Karte aus dem Briefkasten, auf der ausgeschnittene Buchstaben aufgeklebt waren. „Meine Mutter schaute mich erschrocken an und nahm mir die Karte weg“, erinnert sie sich.
Ihr Vater, derart bedroht und beschimpft, fand sich wenig später auch noch in einem Gerichtssaal auf der Anklagebank wieder. Der Hutfabrikant wollte sich das Wort „Antisemit“ verbitten als angebliche Verleumdung, der Prozess war „gut besucht“, schrieb die Lokalzeitung, der Hutfabrikant hatte Freunde mitgebracht, eine Gruppe älterer Männer, die sich hinten im Saal verteilten.
Das war der Preis der Courage: Die Rechten hatten den Spieß umgedreht. Michael Riese sollte bestraft werden. Und nicht der alte Hutfabrikant selbst erhob diese Anklage, nicht er las jetzt Paragrafenketten vor und forderte stehend und vor aller Öffentlichkeit eine Strafe (was niemanden groß erschüttert hätte). Sondern auf seinen Antrag hin tat dies die Staatsanwaltschaft. Und der Richter am Amtsgericht ließ diese Anklage zu.
Das hatte Dinah Rieses Vater nun davon, so sah die Reaktion des Rechtsstaats auf Antisemitismus aus, die erste, an die Dinah Riese sich erinnern kann. Der Richter sprach ihren Vater zwar frei. Er verzichtete aber nicht darauf, sich zuerst haarklein die „persönliche Betroffenheit des Angeklagten“ erklären zu lassen, wie eine Gerichtsreporterin der Frankfurter Rundschau notierte. Michael Riese sträubte sich, ehe er die Verfolgung seiner Familie durch die Nazis erläuterte, vorgehabt hatte er so etwas nicht.
„Was tut das denn zur Sache?“, ärgert sich noch heute seine Tochter Dinah. „Das klingt so, als sei er irgendwie von seinen Emotionen gesteuert, nicht von seinem Verstand.“ Ihr Großvater hatte sich 1937 nach Palästina retten können. Ihre Urgroßeltern hatten es nicht mehr geschafft und wurden von ihrer deutschen Heimat aus nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Es kann nach hinten losgehen, das hat Dinah Riese damals gelernt, und genau das ist eine Sorge, die immer wieder benannt wird in Umfragen unter Jüdinnen und Juden, wenn es um die Frage geht, warum sie antisemitische Übergriffe so selten anzeigen. Wer sich aufregt über antisemitische Hetze oder Übergriffe, wer protestiert und damit die Sicherheitsbehörden in Bewegung versetzt, der steht unter Umständen danach noch stärker als Außenseiter da. Jedenfalls wenn es so läuft, wie es viel zu oft läuft. In der Kriminologie gibt es dafür einen eigenen Ausdruck: sekundäre Viktimisierung. Es ist das erniedrigende Signal von Polizei und Justiz an den, der etwas problematisiert: Das habe wohl mit ihm persönlich zu tun, dass er dies als Problem sehe.
Es ist schon schwierig genug, sich bei Hasskriminalität überhaupt zu wehren und an die Autoritäten zu wenden, nicht nur für Juden. Das geht Muslimen, Schwarzen, Homosexuellen genauso. Immer ist da die Sorge, dass man die Täter erst recht auf sich aufmerksam macht. Man ist als Opfer nicht wegen der eigenen Persönlichkeit ausgewählt worden, sondern als bloßes Exemplar eines Kollektivs. Es liegt eine besondere Erniedrigung darin, derart entindividualisiert zu werden. Es bedeutet aber auch: Will ich diesen Kampf wirklich aufnehmen? Womöglich werde ich dann erst recht zur Zielscheibe. In der Regel sind die Täter nicht allein, sie sind eingebettet in ein soziales Umfeld, das sie anfeuert und das ihnen zur Seite springen könnte.
Theoretisch gibt es die Möglichkeit, als Opfer bei einer Strafanzeige die eigene private Adresse geheim zu halten, damit sie nicht in den Akten auftaucht und in die Hände der Täter oder ihrer Gesinnungsgenossen gerät. Nach Paragraf 68 der Strafprozessordnung ist es erlaubt, „statt des Wohnorts seinen Geschäfts- oder Dienstort oder eine andere ladungsfähige Anschrift anzugeben, wenn ein begründeter Anlass zu der Besorgnis besteht“, dass man sonst in Gefahr gerät. In der Praxis bleibt das aber eine Frage des Vertrauens: Ob die Sicherheitsbehörden wirklich sorgfältig mit den persönlichen Daten umgehen, darauf mag mancher Mensch nicht die Sicherheit seiner Familie verwetten.
Dieses Vertrauen ist eher noch brüchiger geworden in den vergangenen Jahren, der Fall der Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız in Frankfurt am Main hat da eine Kerbe geschlagen, sie und ihre Familie wurden rassistisch beleidigt und mit dem Tod bedroht. Unterzeichnet waren die Drohschreiben mit „NSU 2.0“. Darin standen Namen von Familienmitgliedern und private Adressen. Wie sich herausstellte, waren die persönlichen Daten der Anwältin kurz zuvor in einem Polizeicomputer abgefragt worden.
Wenn der in Kiew geborene, in Leipzig lebende Schriftsteller Dmitrij Kapitelman heute schreibt: „75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz können wir nicht sicher sein, ob die Beamten, die unsere Synagogen bewachen (müssen), nicht nebenbei Hitler-Bilder in WhatsApp-Gruppen teilen“, dann beschreibt er eine Unsicherheit, die zwar nicht ganz neu ist. Aber dann macht nur wenige Tage danach, im Februar 2020, die Meldung die Runde, dass zwei Polizisten in Aachen über Polizeifunk „Sieg Heil“-Rufe verbreitet haben sollen, während sie exakt vor der Synagoge parkten. Das Problem liegt heute so deutlich zutage wie lange nicht.
In Heidelberg erzählt die jüdische Psychotherapeutin Ramona Ambs, wie einmal unbekannte Täter ihre Wohnungstür mit einem Hakenkreuz markiert hatten und wie sie daraufhin zur Polizei ging, um Anzeige zu erstatten. Was der Beamte ihr dort sagte, das erzählt sie so: Zuständig sei die Abteilung Staatsschutz. „Da könne er mir zwar die Nummer geben, aber er würde mir das nicht empfehlen, denn das sei eine ›größere Sache‹. Ich solle das lieber sein lassen, denn sonst hätte ich wochenlang Ärger. Jedenfalls hat er es mir ausgeredet.“
Die Therapeutin hatte Angst davor, dass nach dem Hakenkreuz weitere Angriffe folgen würden, sie sorgte sich um ihre Kinder, sie sprach dann zumindest ihre Nachbarn im Haus an und bat sie, wachsam zu sein. „Einige waren sehr betroffen“, erzählt sie, „und haben uns gesagt, ja, sie halten die Ohren und Augen offen.“ Bei anderen habe sie das Gefühl gehabt, sie nähmen es ihr persönlich übel, dass sie jetzt irgendwie Ärger hätten.
Dinah Riese blickt im Café in Berlin-Neukölln aus dem Fenster, um ihren Hals baumelt eine dünne silberne Kette mit einer Hamsa, einem nahöstlichen Glücksbringer in der Form einer Hand. Das kann jüdisch, kann genauso aber auch türkisch sein. Ein eindeutiges Symbol wie den Davidstern trägt sie nur selten. Damals in Hessen, als ihr Vater vor Gericht stand, kam sie gerade aufs Gymnasium. Ob die Erwachsenen sie anders ansahen, nachdem sie als seine Tochter überall als jüdisch geoutet war und nachdem ihr Vater öffentlichkeitswirksam vor Gericht gestellt worden war, kurz gesagt beschuldigt, es übertrieben zu haben mit seiner Antisemitismus-Sensibilität?
Langes Schweigen. „Schwer zu sagen.“
„In Deutschland brennen wieder Synagogen und Asylantenheime“, sagte ihr Vater noch vor Gericht in der hessischen Kleinstadt, als Angeklagter hatte er das letzte Wort, man kann das in alten Zeitungsberichten nachlesen. „Angesichts dieser Entwicklung hat Ignatz Bubis resigniert. Er wollte nicht mal in Deutschland beerdigt werden. Und da werde ich angeklagt, weil ich mich gegen antisemitische Beleidigungen wehre? Es ist absurd.“
„Ich bin so aufgewachsen, dass man nicht zur Polizei geht“: Der Professor
Ein Professor im gestreiften Pullover sitzt unter den Dachschrägen eines alten Barockhauses in Potsdam. Er ist Politikwissenschaftler, ein Fachmann für die Gewalt von alten und neuen Rechtsextremen. Gideon Botsch ist als jüdischer Junge in Westberlin aufgewachsen, in den 1980er-Jahren war er Teenager, in den 1990er-Jahren hat er studiert. „Aber auch noch in meiner Generation ist es sehr präsent gewesen“, sagt er. „Ich bin so aufgewachsen, dass man nicht zur Polizei geht.“
Gideon Botsch ist mit alten Geschichten aus der Weimarer Zeit aufgewachsen, sie sind in seiner Familie immer weitergereicht worden, etwa die Geschichte seines Ururgroßvaters, eines Getreidehändlers in der brandenburgischen Neumark. In den 1920er-Jahren war das, als schon einmal eine Boykottwelle gegen Juden durch die ostelbischen Gebiete rollte, als also Geschäftsleute an das Ressentiment der Massen appellierten, um ihre jüdischen Wettbewerber zu ruinieren.
Botschs Ururgroßvater wandte sich hilfesuchend an die Justiz, wurde dort aber noch zusätzlich bloßgestellt. Das sei nicht ungewöhnlich, viele Familien hätten ähnliche Geschichten zu erzählen, sagt Gideon Botsch. Es gebe da eine „Tradierung im jüdischen Bewusstsein“. Wer aus der Geschichte gelernt hat, dass auch in den staatlichen Institutionen Antisemiten sitzen, für den ist eine Hinwendung zu diesem Staat nicht so einfach die Lösung. Vor allem, weil es nicht 1945 plötzlich zu Ende war.
Gideon Botsch blickt über die Altstadt von Potsdam: Kopfsteinpflaster, alter preußischer Prunk, dazwischen eine Brache, auf der schon seit vielen Jahren eine Synagoge wiederaufgebaut werden soll. „Über Generationen erhält sich das Wissen, dass nach dem Holocaust viele Täter nicht verfolgt wurden“, sagt er, und dieses Wissen habe das Vertrauen in staatliche Institutionen erheblich gemindert.
Ein Anschlag auf Juden, ein Anschlag auf eine Synagoge ruft heute sofort Bilder aus der deutschen Vergangenheit wach. Ganz automatisch, nicht nur bei Politikern wie Frank-Walter Steinmeier, die dann vor der Holztür der Synagoge in Halle stehen und Sätze sagen wie: „Die Geschichte mahnt uns, die Gegenwart fordert uns“, und dass ihn entsetze, dass so etwas „in diesem, unserem Land – einem Land mit dieser Geschichte –“ geschehen ist.
Auch die Betroffenen erinnern sich natürlich. Als bei dem Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in München im Jahr 1970 sieben Menschen getötet wurden, unter ihnen zwei Überlebende der Konzentrationslager, sagte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Maximilian Tauchner, auf dem kleinen Israelitischen Friedhof in Freimann: „Was in den Gaskammern nicht vollbracht werden konnte, ist im Altersheim 25 Jahre später zu Ende geführt worden.“
Es verwundert dann nicht, dass den Betroffenen in einem solchen Moment schnell präsent ist, wie hartnäckig auch die bundesrepublikanischen Ermittlungsbehörden lange die Augen verschlossen, wie demonstrativ desinteressiert sie sich an einer Aufklärung dieser Vergangenheit zeigten. Die Justiz der Nachkriegszeit hat alte braune Kameraden häufiger in Positionen der Verantwortung als Richter oder Staatsanwälte gebracht als auf die Anklagebank.
Es war ja nicht so, dass die Justiz nicht anders gekonnt hätte, die Gerichte der frühen Bundesrepublik waren effizient, die Juristen schon wieder bienenfleißig. Wer als Bürger einen Taschendieb oder Trickbetrüger anzeigte, der wurde ernst genommen. Bei den wenigen Überlebenden des Holocaust hingegen, die Verbrechen viel größeren Ausmaßes ansprachen, war das anders. Die Ermittler sahen vielfach weg, die Justiz wiegelte ab. Ihr zählt nicht: Dies ist das Signal gewesen, das die Justiz den davongekommenen Juden unterschwellig sendete.
Während die Überlebenden der Konzentrationslager anfangs noch froh waren um jede Chance, sich Gerichten als Zeugen zur Verfügung zu stellen, waren viele schon bald ernüchtert. Ein Zeitzeuge hat das 1959 in einem bitteren Brief zum Ausdruck gebracht, Norbert Wollheim, der als Einziger seiner Familie Auschwitz überlebt hatte und nach dem Krieg die erste Musterklage eines Zwangsarbeiters gegen ein deutsches Unternehmen führte. Wenn er weiter erlebe, wie die Gerichte nach Begründungen suchten, um NS-Täter laufen zu lassen, so schrieb er an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, „dann muss unter meinen früheren Leidensgefährten die Bereitschaft zur Mitarbeit dem nie völlig ausgeräumten Misstrauen in die Praxis der dortigen Gerichte bei der Beurteilung solcher Massenverbrechen weichen“.
Auch die Polizei der Nachkriegszeit zeigt, als sie auf die wenigen Davongekommenen des Holocaust trifft, wenig Hemmungen. In München hat es die US-Militärpolizei gebraucht, um zu verhindern, dass Polizisten im Jahr 1949 einen Aufzug von mehr als tausend Juden zusammenschossen, die gegen neu aufkeimenden Antisemitismus demonstrieren wollten. Angeschossen wurden dann „nur“ drei von ihnen, und hinterher hat der Polizeivizepräsident noch gegrollt, es sei leider die „endgültige Säuberung des Aufruhrortes“ verhindert worden. In der Geschichte Münchens ist das eine Randnotiz geblieben. In der Historie der Münchner Juden nicht.
Etwa 8000 jüdische Displaced Persons waren damals in der Stadt untergekommen, Menschen, die aus Osteuropa vor neuer Lebensgefahr flohen, besonders vor antisemitischen Pogromen in Polen, sowie Menschen, die als Zwangsarbeiter oder KZ-Insassen verschleppt worden waren, traumatisiert und ausgezehrt, und die jetzt von internationalen Hilfsorganisationen betreut wurden.
In der Möhlstraße war ein kleiner jüdischer Mikrokosmos entstanden, mehr als hundert Geschäfte und Cafés drängten sich aneinander, ein jüdischer Kindergarten, eine jüdische Schule, eine jüdische Apotheke, koschere Restaurants – und ein fliegender Handel, der häufig mit dem untergegangenen Kleinhandelsviertel Warschaus in der Nalewkistraße verglichen wurde.
Als „Pestbeule für Münchens Stadtbild“ bezeichnete ein interner Bericht des Polizeireviers 21 noch im Jahr 1951 diesen Ort, wie die Historikerin Lilly Maier erforscht hat. Man treffe dort „lichtscheues Gesindel mit Verbrecher-Physiognomie“. Für viele Jüdinnen und Juden hat sich die innere Distanz zu Polizei und Justiz in diesen Jahren nicht aufgelöst, sondern eher verfestigt.
In Potsdam erzählt Gideon Botsch, wie es vor ein paar Jahren gleich drei Mal in einer Nacht brannte. Erstens in einem Kulturzentrum in der Potsdamer Innenstadt, zurück blieben verkohlte Möbel, rußschwarze Wände, die Gästetoiletten und die Teeküche vollständig zerstört, wie man auf Bildern sehen kann. Wenige Stunden zuvor hatte hier Botschs Chef, der Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien, Julius H. Schoeps, sein neues Buch über Antisemitismus vorgestellt, Feindbild Judentum.
Zweitens war eine unbewohnte Flüchtlingsunterkunft in Flammen aufgegangen. Drittens gleich um die Ecke das Restaurant Goldmund, vormals Fajngold, in der Potsdamer Charlottenstraße. Womöglich galt die Attacke dort auch dem dahintergelegenen jüdischen Jugendtreff mit dem hübschen Namen Kibbuz (Kultur-, Integrations- und Begegnungszentrum), leicht zu erkennen an seinem Logo mit dem siebenarmigen Leuchter.
Alles Zufall, erklärte die Potsdamer Polizei am nächsten Morgen, dem 26. Mai 2009, von einem Zusammenhang der drei Taten sei „nicht auszugehen“. Auch für einen politischen Hintergrund sehe man in keinem der Fälle Anzeichen, so zitierte die Lokalzeitung den Sprecher der Polizei. Alles nur Zufall, wiegelte auch der Oberbürgermeister ab, ein SPD-Mann, er tat das schriftlich in einem Brief, den Gideon Botsch über all die Jahre aufgehoben hat, so sehr hat er ihn staunen lassen.
Es gebe „keine Hinweise auf politisch motivierte Hintergründe“, schrieb der Oberbürgermeister. Denn „die sonst üblichen Bekennerschreiben oder Hinweise im Internet“ würden fehlen. Die Polizei könne einen Zusammenhang zwischen den drei Brandstiftungen „ausschließen“, beschied der Politiker sogar. Und zwar „eindeutig“. Muss man erwähnen, dass die drei Brandstiftungen dann nie aufgeklärt worden sind?
Gideon Botsch ließ nicht locker damals, er schrieb zurück, dass Attentäter aus der rechten Szene keineswegs immer Bekennerschreiben hinterlassen würden, „schon damals entsprach das nicht den Erfahrungen mit rechtsextremen Anschlägen“, sagt er heute. Schon damals war in den Schriften der Neonazi-Gruppe Blood & Honour von „führerlosem Widerstand“ die Rede, Terroristen im „Rassenkampf“ sollten in Deckung bleiben, möglichst lautlos. „Insbesondere bei antisemitischen Vorkommnissen“ seien Bekennerschreiben sogar eher selten, schrieb Botsch an den Oberbürgermeister und an die Polizei. Ohne Erfolg.
Die Annahme, „echte“ Rechtsextreme würden immer Bekennerschreiben hinterlassen, war mit ein Grund, weshalb die Ermittler auch dem NSU nicht auf die Schliche kamen, ja dessen Mordserie nicht einmal als rassistisch einordneten. In der Debatte um den NSU fiel anschließend immer wieder der Ausdruck des „migrantisch situierten Wissens“. Gemeint war eine gewisse Erfahrung im Umgang mit den Behörden, die innerhalb einer Gemeinschaft weitergereicht wird.
So etwas gebe es auch unter Juden, sagt Gideon Botsch. Wenn er heute als Jude angegriffen würde, so sagt dieser deutsche Professor, dann würde er sich gut überlegen, ob er zur Polizei geht. „Und ich weiß auch nicht, ob ich es meinen Kindern empfehlen würde.“
„Das war normal für mich“: Der jüdische Polizist
In einem ruhigen, sonnigen Raum im Berliner Landeskriminalamt erinnert sich ein Polizist an seine Jugend, zwischen Fußballplätzen und Tischtennisplatten. Damals sei auch er ein paarmal als Jude angegriffen worden, sagt er. Aber er wäre nie auf die Idee gekommen, das anzuzeigen. „Ich muss auch sagen – so blöd es klingt –, das war normal für mich.“
Vielleicht ist das die schlimmste Form von Resignation. „Ich hatte das einfach akzeptiert, als Zustand. Die Mentalität war: Man muss immer aufpassen, ob man sagt, dass man Jude ist. Es kann sein, dass man Schläge kriegt oder abgezogen wird oder sonst etwas.“
Aaron B., heute 35 Jahre alt, ist im Stadtteil Charlottenburg aufgewachsen, mit Freunden aus türkischen oder arabischen Familien, wie er erzählt. Einmal, als er etwa 13 Jahre alt war, fing einer aus diesem Freundeskreis von einem Tag auf den anderen an, ihn zu schubsen, anzuspucken, mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen und zu treten. Er war größer und älter als Aaron B., und als die anderen aus der Gruppe ihn fragten, was sein Problem sei, sagte er, in Palästina sei seine Familie von israelischen Soldaten angegriffen worden.
Ein anderer Junge fragte: Und was hat Aaron damit zu tun?
Der Größere sagte: Nichts. Aber das sei egal.
„Das war ein sehr prägendes Ereignis“, sagt Aaron B. heute, „ich habe nicht zurückgeschlagen, das wäre auch nicht gut ausgegangen, und irgendwann hat er aufgehört.“ Danach habe er sich aus diesem Freundeskreis zurückgezogen, auch weil er gesehen habe, dass die anderen ihn nicht verteidigten, sondern eher mit Gleichgültigkeit reagierten.
Und danach hörte es nicht auf, nicht im Fußballverein, wo ihn seine Eltern nach dem Training abholen mussten, weil einige aus dem Verein gedroht hatten, ihm, dem Juden, aufzulauern und ihn zu verprügeln. Da war er 15. Und auch nicht beim nächsten Sportverein, wieder in Charlottenburg, wo er die U-Bahn mied, weil er wusste, dass an einem bestimmten Bahnhof arabische Jugendliche herumhingen, die auch wussten, dass er Jude war, und ihm gedroht hatten. „Da bin ich eine halbe Stunde Umweg gefahren mit dem Bus, um sie zu umgehen.“
Heute ist Aaron B. Kampfsportler, sein Dienstausweis am Schlüsselband ruht auf einer breiten Brust. Jahrelang hat er auf der Straße gearbeitet, in Uniform, in Einsatzhundertschaften, aber auch undercover als Drogenermittler am Alexanderplatz. „Das hat ganz gut gepasst“, sagt er. „Wenn man dunklere Haare hat wie ich, fällt man weniger auf bei der entsprechenden Klientel.“ In seinem jüdischen Bekanntenkreis löse der Beruf noch immer Argwohn aus, sagt er. „Da gibt es oft noch ein historisch belastetes Bild davon, was für ein Geist angeblich innerhalb der Polizei herrscht.“ Aaron B. kennt aber auch die Beschwerden, die sich rein auf die Gegenwart beziehen.
An einem Abend im Juli 2016 hatte ein Mann im Berliner U-Bahnhof Steglitz „Scheiß Juden“ gerufen, „die Juden sind an allem schuld“. Als ein Passant ihn aufforderte, den Mund zu halten, zückte er ein Messer. Der Täter schimpfte weiter über Juden, er schrie, er werde dem Passanten ein Tattoo herausschneiden. Aber als die Polizei eintraf, war diese Tirade für sie „zweitrangig, nebensächlich“, so hat sich das Opfer später erinnert.
Der Polizist „notierte sich nur die Angaben wie Aussehen, Kleidung und so weiter über den Täter“, an den judenfeindlichen Sätzen habe er kein Interesse gezeigt. Die Begründung: Volksverhetzung wiege ohnehin geringer als versuchte gefährliche Körperverletzung. Der Fall wurde von der Polizei dann überhaupt nicht als politisch motivierte Kriminalität eingestuft, die Spezialisten des Staatsschutzes wurden nicht informiert, wie die Berliner Opferberatungsstelle Rias später herausfand.
Klar, das sei „nicht zielführend“, sagt Aaron B.
Gewalt wiegt natürlich schwerer als Worte. Dennoch verlieren Worte wie „Scheiß Juden“ nicht ihre Relevanz neben einer Messerattacke. Sie verraten das Motiv, „also das, worum es bei der Tat eigentlich geht“, wie der Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn sagt, der seit Jahren zu solchen Vorfällen forscht. Es sei das, worum es auch dem Erstatter einer Anzeige gehe. „Gäbe es den Antisemitismus nicht, dann gäbe es diese Tat nicht.“ Wenn die Polizei dies ausblende, dann ergebe die ganze Strafverfolgung für die Betroffenen oft wenig Sinn.
Um Juden zu ermutigen, mehr Straftaten anzuzeigen, hat die Polizei in Berlin jetzt einen Antisemitismusbeauftragten berufen, einen erfahrenen Beamten. Wolfram Pemp leitete vorher Ermittlungen gegen Islamisten. In seinem kleinen, dunklen Büro im Landeskriminalamt hängen Erinnerungsfotos an diese Zeit, aber auch bunte Kärtchen mit Davidstern-Motiven. Chanukka-Grußkarten. Pemp ist selbst nicht jüdisch, bemüht sich aber, auf Feiern in der Gemeinde gesehen zu werden und ansprechbar zu sein.
In Berlin gibt es ein vergleichbares Erfolgsmodell: Für Menschen, die aus homo-, trans- oder queerfeindlichen Motiven attackiert werden, hat die Polizei schon seit den 1990er-Jahren Ansprechpartner. „Die Folge ist, dass Berlin drei Viertel aller LGBTIQ-feindlichen Straftaten deutschlandweit zählt“, sagt Pemp, und er hofft, dass es auch daran liege, dass man hier das Dunkelfeld etwas besser aufhelle. Berliner Polizeichefs schneiden den Regenbogenkuchen an, sie hissen die Regenbogenflagge, die Generalstaatsanwältin erzählt im queeren Onlinemagazin Siegessäule, wie sie im beruflichen Umfeld ihr Coming-out hatte, „sowohl in der Morgenlage als auch in der obersten Führungsebene der Polizei“. Die Folge ist, dass sich Schwule und Lesben von der Polizei in der Hauptstadt mehr Respekt erhoffen als anderswo – und dass zumindest in einigen Fällen die Hemmschwelle für sie sinkt, sich ihr anzuvertrauen.
Wobei es – um bei der Parallele zu bleiben – interessanterweise Lesben schwerer fällt, „weil dabei eine doppelte Hürde überwunden werden muss“, beobachtet die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, „nämlich sich als Frau und als Lesbe an die Polizei zu wenden, die traditionell als männerdominiert und machohaft wahrgenommen wird“.
Etwas Ähnliches gibt es auch in der jüdischen Community. Jüdische Frauen überwinden sich seltener dazu, sich vor Behörden als jüdisch zu erkennen zu geben. Sie wenden sich als Opfer einer antisemitischen Tat noch seltener an die Polizei. Das hat die schon erwähnte Studie des Expertenkreises Antisemitismus im Jahr 2017 gezeigt, und sie hat auch gezeigt: Juden, die in der Sowjetunion geboren wurden, sind hierzulande am wenigsten dazu bereit, antisemitische Vorfälle anzuzeigen. Migrant zu sein ist eine weitere Hürde.
Neulich war Aaron B., der Polizist, privat mit seiner Familie auf einer Bar-Mitzwa-Party eingeladen, es gab einen DJ, Tanz, eine offene Bar. In Berlin gibt es das jedes Wochenende irgendwo, die Stadt hat eine der größten jüdischen Gemeinden im Land, neben Frankfurt am Main, Düsseldorf und München.
Eine jüdische Mutter sprach Aaron B. an, die über seine Schwiegermutter gehört hatte, dass er Polizist sei. Es ging um ihren 14 Jahre alten Sohn. Im Bereich des Wannsees gibt es einige Bahnhöfe, an denen viele arabische Jugendliche die Abende verbringen. An einer Stelle war ihr Sohn als Jude geoutet worden, so erinnert sich Aaron B. „Da hat es aus der Masse heraus einen Faustschlag in sein Gesicht gegeben.“
Der Junge habe über Instagram sogar den Namen des mutmaßlichen Schlägers herausbekommen können, aber er habe „natürlich“ große Angst, die Sache zur Anzeige zu bringen, sagte die Mutter. Deshalb sei sie zu Aaron B. gekommen. Was er jetzt tun würde.
„Ich habe ihr geraten, das zur Anzeige zu bringen“, erzählt er. Vorab habe er mit den Kollegen bei der zuständigen Kriminaldienststelle telefoniert. Die hätten ohnehin gerade begonnen, sich die Jugendgruppen an den Bahnhöfen beim Wannsee näher anzusehen. Und seien dankbar gewesen.
„Vertrauen aufbauen“: Die Antisemitismusbeauftragte
Auch die Generalstaatsanwältin in Berlin hat 2018 eine Antisemitismusbeauftragte berufen, eine junge Oberstaatsanwältin, Claudia Vanoni. Schon das war eine Botschaft: Man habe verstanden. Auch Vanoni zeigt das. „Anfangs habe ich mein Ziel so formuliert: Vertrauen stärken“, sagt sie. „Inzwischen würde ich sagen: Vertrauen aufbauen.“ Nach vielen Gesprächen in der jüdischen Community sei ihr klar geworden, wie wenig man sich dort noch erwarte von den Strafverfolgern.
Vanonis kleines Büro liegt in einem Prachtbau voller Marmorsäulen, auf den Gängen hallt es, das Kammergericht wurde einst von dem Nazi-Juristen Roland Freisler für seinen Volksgerichtshof genutzt. Claudia Vanonis schwarze Robe bleibt im Schrank, sie geht nicht mehr in Gerichtsverhandlungen. Sie verfolgt das Geschehen in der Hauptstadt.
Sie beobachtet Strafverfahren und Prozesse. Sie kritisiert, wenn Richter etwa um den heißen Brei herumreden, wie es leider oft geschehe. In einem Fall im Jahr 2019 zum Beispiel ließ ein Jugendgericht in seinem Urteil zwar keinen Zweifel daran, dass die Täter aus einer „diskriminierenden Geisteshaltung“ heraus gehandelt hatten. Das Wort Antisemitismus aber verwendete es nicht.
Ein Mann war attackiert worden, weil er ein Lied über die Stadt Tel Aviv gespielt hatte. Die jugendlichen Angreifer waren in wüste Beschimpfungen ausgebrochen, hatten ihn judenfeindlich beleidigt, bedroht und schließlich geschlagen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil protestiert und ist in Berufung gegangen. „Wenn es Antisemitismus ist, muss man es auch aussprechen“, findet Vanoni. Man müsse die Probleme beim Namen nennen, das sei auch für die Betroffenen wichtig.
Auf Kritik an Entscheidungen ihrer eigenen Staatsanwaltskollegen indessen schweigt sie. Das gilt sowohl für den Umgang der Berliner Staatsanwaltschaft mit Schmähparolen wie „Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein“, welche die Staatsanwälte im Juli 2014 für straflos erklärten, weil die Chancen auf eine Verurteilung wegen Volksverhetzung vor Gericht zu gering seien.
Es gilt auch für Beschimpfungen wie „Ich spuck dir in dein Zionsgesicht“ und „Solche Personen haben mehr als Spucke im Gesicht verdient“: Das sei keine Volksverhetzung und keine Beleidigung, so argumentierte die Berliner Staatsanwaltschaft in einem Einstellungsbescheid vom 21. Juli 2017. Denn diese Beschimpfung richte sich „nicht gegen eine konkrete inländische Bevölkerungsgruppe, sondern allenfalls pauschal gegen Menschen jüdischen Glaubens“. Allenfalls. Außerdem sei nicht klar, ob es sich um bloßes „Wunschdenken“ des Täters gehandelt habe oder um eine wirklich ernst gemeinte Drohung.
Die Antisemitismusbeauftragte Vanoni ist nicht in einer Position, dass sie ihren Kollegen konkrete Anweisungen geben könnte. Anders ist das in Frankfurt am Main oder auch in München, dort ist jemand zum Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft bestimmt worden, der zugleich der Chef aller Staatsschutzermittler ist, Andreas Franck. Am Telefon wird er gleich konkret: „Alle großen Ankündigungen, dass wir konsequent gegen Antisemitismus vorgehen wollen, könnten wir uns glatt sparen, wenn wir im nächsten Atemzug Briefe verschicken, in denen wir Betroffenen mitteilen, dass wir ihren Fall für geringfügig halten oder sie auf den Weg der Privatklage verweisen wollen.“ Er hat deshalb angekündigt, Straftaten aus antisemitischer Motivation nie aus Ermessensgründen einzustellen.
Und er fügt noch etwas Zweites hinzu: Man müsse manchmal auch in Zweifelsfällen anklagen. Auch wenn die Staatsanwälte einmal unsicher seien, ob zum Beispiel eine Schmähung als Volksverhetzung zu werten sei – die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ja auch für Fachleute manchmal schwer vorauszusehen –, man müsse es zumindest versuchen und einen Richter entscheiden lassen.
Oft, sagt Andreas Franck, entstehe bei den Betroffenen der fatale Eindruck, dass Strafverfolger nur schön daherreden würden, aber nicht wirklich motiviert seien, etwas gegen den Hass zu tun. „Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass wir es wirklich, wirklich wollen. Wir müssen das auch in unserem gesamten Verhalten als Strafverfolger ausstrahlen.“ Er erzählt dann noch von einem Gespräch neulich mit Charlotte Knobloch, der oft an der Justiz verzweifelnden Präsidentin der jüdischen Gemeinde in München. Beiläufig habe sie zu ihm gesagt: Es ist ein gutes Gefühl, nicht allein zu sein.
„Darum geht es doch am Ende!“, sagt Franck. „Wir als Justiz müssen vermitteln, dass wir auf der Seite der Betroffenen stehen. Wir müssen uns bemühen, dass wir auch so wahrgenommen werden.“ Nur dann würden Jüdinnen und Juden auch häufiger einen Sinn darin sehen, Vorfälle zur Anzeige zu bringen.
Einige andere Strafverfolger in der Republik denken derzeit ebenfalls in diese Richtung, einer von ihnen ist der Dortmunder Polizeipräsident, Gregor Lange. Er hat sich nicht damit abgefunden, dass die Gerichte es den Neonazis in seiner Stadt erlaubten, „Nie wieder Israel“ zu skandieren – ohne Bezug zum Nahen Osten, dafür aber nur wenige Tage nach dem Terroranschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge.
Selbst wenn das Oberverwaltungsgericht erst vor zwei Jahren frisch geurteilt hatte, dass die Parole zulässig und keine versteckte Hetze gegen Juden sei, versuchte er es erneut mit einem Verbot.
Notfalls werde er bis zum Bundesverfassungsgericht ziehen, sagt Lange. „Wenn man eine Linie verfolgt, muss man die auch durchhalten, durchfechten, auch Risiken eingehen, es darauf ankommen lassen.“ Entweder man meine es ernst oder nicht. Er empfiehlt das auch anderen: „Wenn in vorauseilendem Gehorsam immer nur eine Rechtsprechung fortgeschrieben wird, dann kann der wehrhafte Rechtsstaat nicht den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung tragen.“
Claudia Vanoni in Berlin ist da zurückhaltender, die Antisemitismusbeauftragte in der Hauptstadt mit ihrer großen jüdischen Gemeinde, ihrer großen arabischstämmigen Community und dem jährlichen Al-Quds-Marsch für die „Befreiung“ Palästinas von den Juden will zunächst dafür werben, dass in der Justiz die einheitliche Definition von Antisemitismus bekannt wird, wie sie von der International Holocaust Remembrance Alliance aufgestellt wurde. In deren Sicht ist Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass ausdrücken kann, in Worten oder Taten. Bislang lege jede Polizeidienststelle, jede Staatsanwaltschaft und jede Strafkammer mehr oder weniger eigene Maßstäbe an, sagt Vanoni.
Auf Nachfrage hin deutet aber ihre Chefin, Margarete Koppers, an, den Schmähruf „Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein“ würde sie heute womöglich nicht mehr hinnehmen, wie dies noch 2014 getan wurde, bevor sie 2018 in das Amt der Generalstaatsanwältin kam. Wenn so eine Parole noch einmal vorkomme, würde sie sie „möglicherweise anders bewerten“. Sie sei überzeugt, sagt Koppers, „Auftrag der Staatsanwaltschaften ist es auch, dazu beizutragen, dass sich Rechtsprechung weiterentwickelt“. Das hieße, es zumindest zu versuchen mit einer Anklage wegen Volksverhetzung.
„Sehr empfehlenswert!“
„Sehr mitreißend und sehr überzeugend“
"Berechtigt und bedrückend zugleich"
„Eine Pflichtlektüre, deren bündige Kürze umgekehrt proportional ist zur Fassungslosigkeit, die sie bei den Lesern hinterlässt.“
„Steinke zeigt schonungslos auf, dass Antisemitismus kein Randproblem der Gesellschaft ist.“
„Ein erschütterndes Dokument der Gleichgültigkeit.“
„Ronen Steinkes Buch ›Terror gegen Juden‹ versteht sich als Anklage. Es ist mehr als das: eine messerscharfe Analyse und eine beklemmende Bestandsaufnahme.“
"Steinke zeigt, dass der Antisemitismus überall seine hässliche Fratze zeigt."
„Eindrücklich“
"brillant geschrieben und gut sortiert"
„Ronen Steinke belegt in seinem eindrucksvoll, dass der Staat, dessen Aufgabe es ist für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, beim Schutz seiner jüdischen Bürger versagt.“
„Ronen Steinke hat eine gefällige Art zu schreiben. Er skizziert die Angst der Juden im heutigen Deutschland und spricht die Probleme schonungslos an.“
"Ronken Steinke führt den Leser durch ein verstörendes Deutschland, in dem der Antisemitismus sozusagen zum Alltag gehört."
„Erstaunlich genug, dass es bis heute keine zentrale amtliche Statistik über antisemitische Gewalttaten in Deutschland gibt, sondern dass der Autor Ronen Steinke durch eigene Recherchen erstmals eine solche Chronik liefert, die allein 100 Seiten umfasst.“
„Ein lesenswertes Buch“
„Für die Debatte zum Umgang mit antisemitischer Gewalt stellt sein Buch einen wichtigen und sehr lesenswerten Beitrag dar.“
“Ein ebenso wütendes wie sachliches Buch, das muss man erst einmal hinbekommen.“
„Ronen Steinke (…) leistet nun einen – um es vorweg zu nehmen - gelungenen Beitrag zum intellektuellen Verständnis des Schicksals der Juden im Deutschland des 21. Jahrhunderts.“
„Exekutive und Judikative erweisen sich seit Jahrzehnten unfähig bis unwillig, gegen antisemitische Gewalt wirkungsvoll vorzugehen, wie Ronen Steinke in seinem jüngst erschienenen Buch ›Terror gegen Juden‹ erschreckend eindrucksvoll dokumentiert.“
„Steinke hat mit ›Terror gegen Juden‹ nicht nur ein erschütterndes, sondern auch unbedingt lesenswertes Buch vorgelegt.“
„Es zeichnet dieses Buch aus, dass es sich beständig, doch nie wahl- oder ziellos, zwischen verschiedenen Ebenen bewegt.“
„Ronen Steinke belegt in seinem Buch eindrucksvoll, dass der Staat, dessen Aufgabe es ist, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, beim Schutz seiner jüdischen Bürger versagt.“


















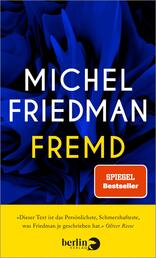

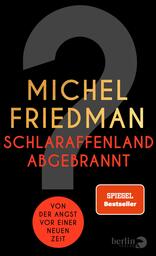

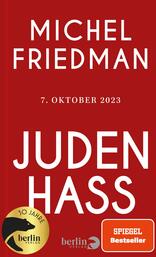







DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.