
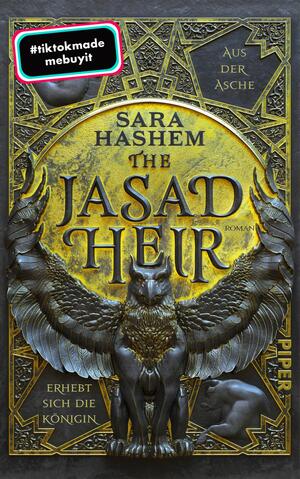
The Jasad Heir (The Jasad Heir 1) The Jasad Heir (The Jasad Heir 1) - eBook-Ausgabe
Roman
— Mit limitiertem Farbschnitt | Slow Burn zwischen der Thronerbin von Jasad und ihrem ErzfeindThe Jasad Heir (The Jasad Heir 1) — Inhalt
Eine Thronerbin.
Ihr Erzfeind.
Und tödliche Spiele.
Mit zehn Jahren floh Sylvia aus dem niedergebrannten Jasad und lebt seitdem unter falscher Identität im Reich des Feindes. Als dessen Thronerbe Arin ihre magischen Kräfte entdeckt, macht er sie zum Champion der königlichen Spiele, um mit Sylvia die Rebellen der Jasad anzulocken. Arin ahnt nicht, dass Sylvia Jasads wahre Thronerbin ist. Ihr Geheimnis muss Sylvia um jeden Preis wahren und sich zwischen ihrem Leben und der Treue zu ihrem Volk entscheiden. Währenddessen kommt sie beim täglichen Training Arin immer näher, was ihren sicheren Tod bedeuten könnte.
Leseprobe zu „The Jasad Heir (The Jasad Heir 1)“
Kapitel 1
Zwei Dinge standen zwischen mir und einer erholsamen Nachtruhe, und nur eines davon durfte ich töten.
Ich stapfte am moosbewachsenen Ufer des Flusses Hirun umher und hielt blinzelnd nach irgendeiner Bewegung Ausschau. Der Dreck, die späten Arbeitsstunden – damit hatte ich gerechnet. Alle Lehrlinge im Dorf mussten damit fertigwerden. Nur auf die Frösche war ich nicht vorbereitet gewesen.
„Sagt Lebewohl, ihr unnützen Plagegeister“, rief ich. Die Frösche hatten eine Verteidigungsstrategie entwickelt, die sie jedes Mal anwandten, wenn ich in ihre [...]
Kapitel 1
Zwei Dinge standen zwischen mir und einer erholsamen Nachtruhe, und nur eines davon durfte ich töten.
Ich stapfte am moosbewachsenen Ufer des Flusses Hirun umher und hielt blinzelnd nach irgendeiner Bewegung Ausschau. Der Dreck, die späten Arbeitsstunden – damit hatte ich gerechnet. Alle Lehrlinge im Dorf mussten damit fertigwerden. Nur auf die Frösche war ich nicht vorbereitet gewesen.
„Sagt Lebewohl, ihr unnützen Plagegeister“, rief ich. Die Frösche hatten eine Verteidigungsstrategie entwickelt, die sie jedes Mal anwandten, wenn ich in ihre Nähe kam. Zuerst quakte der Wachposten einen Alarm. Die anderen warfen sich daraufhin in den Fluss. Schließlich hüpfte der mutige Wächter um sein Leben. Eine ebenso bewundernswerte wie vergebliche Bemühung.
Unter meinen Fingernägeln hatte sich Dreck festgesetzt. Durch die skelettartigen Baumkronen drang Mondlicht, und für einen Augenblick sah meine Hand wie die einer anderen Person aus. Wie eine viel gepflegtere und ein wenig zartere Hand. Eine von Niphrans Händen. Hände, die neben dem kräftigsten Holzfäller eine Axt hatten schwingen können, die einen Sturm von Locken zu zarten Zöpfen flechten und Speere in die Schlünde von Ungeheuern hatten treiben können. Während der ersten fünf Jahre meines Lebens, bevor sich die Trauer über die Ermordung meines Vaters wie Fäulnis in Niphran ausgebreitet hatte, bevor ihr Verstand in sich zusammengebrochen war, hatte es nichts gegeben, was die Hände meiner Mutter nicht hatten tun können.
Ach, wenn sie mich jetzt hätte sehen können! Voller Dreck und von quakenden Flusskakerlaken überlistet.
Der Hirun atmete seinen dichten Nebel aus und hauchte den Winterknochen des Essam-Waldes Leben ein. Ich wusch mir im Fluss die Hände und schob energisch alle Gedanken an die Toten beiseite.
Verzweifeltes Quaken ertönte hinter einer Baumwurzel. Ich flitzte los und hob den um sich tretenden Wachposten hoch. Ah, es waren nie die Tapferen, die entkamen. Ich hielt ihn mir dicht vors Gesicht. „Deine Freunde jagen Grillen, und du bist hier. Waren sie es wert?“
Seufzend ließ ich den erschlafften Frosch in den Eimer fallen. Zehn fehlten noch, was bedeutete, dass ich eine weitere Runde im Kreis rennen musste, in der Hoffnung, dass der Schlamm nicht durch das Loch in meinem rechten Stiefel eindrang. Die Tatsache, dass Rory ein angesehener Apotheker war, beeindruckte mich nicht, genauso wenig wie diese begehrte Lehrstelle. Was mich davon abhielt, den Eimer hinzuschmeißen und zu Rayas Unterkunft zurückzugehen, wo eine warme Mahlzeit und ein bequemes Bett auf mich warteten, war eine Bringschuld.
Rory hatte keine Fragen gestellt, als ich vor fünf Jahren blutüberströmt und zitternd vor seiner Haustür aufgetaucht war. Er hatte meine Wunden verarztet und mich zu Raya gebracht. Damit hatte er eine fünfzehnjährige Waise ohne Vorgeschichte vor einem Leben als Herumtreiberin bewahrt.
Als plötzlich ein Ast knackte, spannten sich alle meine Muskeln an. Ich schob eine Hand in die Tasche und schlang die Finger um den Griff meines Dolchs. Da Nizahls Soldaten uns gerne ohne Anlass durchsuchten, trug ich meine Klinge normalerweise in meinem Stiefel, aber ich hatte damit meinen Fuß aus einem Gewirr von Farnen befreit und sie danach in meiner Tasche gelassen. Ein schneller Blick auf die schwankenden Äste offenbarte nichts. Ich versuchte, nicht zu lange in die leeren schwarzen Bereiche zwischen den Bäumen zu starren. Zu viel Grauen hatte ich schon aus der Dunkelheit kommen sehen, als dass ich dieser Stille jemals trauen würde.
Mein Blick wanderte zu der Stelle, vor der mir am meisten graute: der Reihe von Bäumen hinter mir, in der jeder Baum mit dem gleichen, erschreckend präzisen, schwarzen Zeichen versehen war. Das Symbol eines Raben mit ausgebreiteten Schwingen war in die Bäume geritzt worden, die Mahairs Grenze bildeten. Mitten in den schlammigen Wäldern waren diese Raben makellos. Wer die mit dem Raben markierten Bäume ohne Erlaubnis passierte, wurde mit Gefängnis oder Schlimmerem bestraft. Und in den ärmeren, unwichtigen Dörfern, wo die Anführer des Königreichs bereits geneigt waren, ein Auge zuzudrücken, wenn Nizahls Soldaten sich Freiheiten herausnahmen, war Schlimmeres meist nur der Anfang.
Ich steckte den Dolch wieder ein und ging bis an den Rand des Areals. Mit dem Daumennagel zeichnete ich den ausgestreckten Flügel eines Raben nach. Gern hätte ich alle Frösche in meinem Eimer geopfert, wenn ich dafür den Mut bekommen hätte, das Symbol mit meinen Fingernägeln abzukratzen. Vielleicht würde ich in demselben Anflug von Mut sogar mit meinem Dolch eine Kerbe in die Rinde ritzen und die Symbole von Nizahls Macht verunstalten. Es waren keine Mauern oder Schwerter, die uns wie Tiere eingepfercht hielten, sondern eine einfache Schnitzerei. Die Macht eines anderen Königreichs schwebte über uns wie vergiftete Luft und kontrollierte alles, was sie berührte.
Ich warf einen Blick auf den Wächterfrosch in meinem Eimer und ließ die Hand sinken. Um diesen Preis – und bei dem Risiko, sich einen Splitter einzuziehen – lohnte sich Tapferkeit nicht.
Eine dicke Frostschicht bedeckte die Straße, die zurück nach Mahair führte. Als ich die Mauer überquert hatte, die Mahair vom Essam-Wald trennte, zog ich mir die Kapuze fast bis zur Nase herunter. Statt mich auf die exponierte Hauptstraße zu wagen – auf der es zu regelmäßigen Patrouillen kam –, bog ich in eine Gasse ein und schlängelte mich zu Rorys Laden durch. Dunkelheit umfing mich, sobald ich in die Gasse trat. Ich hielt mich mit einer Hand an der Mauer fest und ließ mich von dem durchdringenden Gestank nach Fäkalien leiten. Eine Katze kauerte fauchend unter einem Stapel von Kisten über dem halb aufgefressenen Kadaver einer Ratte.
„Ich habe schon zu Abend gegessen, aber danke für das Angebot“, flüsterte ich und sprang aus der Reichweite ihrer Krallen.
Zwanzig Minuten später knallte ich den vollen Eimer vor Rorys Füße. „Ich verlange eine Neuverhandlung meines Lohns.“
Rory schaute nicht von seiner Liste auf. „Verlang du nur. Ich bin da drüben.“
Er verschwand ins Hinterzimmer. Mit finsterem Blick überlegte ich, ob ich ihm hinter den Vorhang folgen und ihn mit Froschkadavern traktieren sollte. Der Gestank nach Schlamm und Moder haftete dauerhaft an meiner Haut. Das Mindeste, was er tun konnte, war, extra für die Seife zu bezahlen, die ich brauchte, um ihn zu überdecken.
Vorerst sortierte ich aber Salben und verschloss jedes Gefäß sorgfältig, bevor ich es in den Korb stellte. Einmal hatte ich vergessen, die Salben richtig zu verschließen, bevor ich Yulis Jungen mit ihnen losgeschickt hatte. Dadurch hatte ich ausnahmsweise Rorys Zorn auf mich gezogen. An dem Tag hatte ich genauso viel über die Ausbreitung von Krankheiten gelernt wie über Rorys strenge Prinzipien.
Rory kam zurück. „Verschwinde endlich. Geh schlafen. Nicht dass der Anblick deines Gesichts mir morgen meine Kunden vergrault.“ Er stocherte in dem Eimer herum und drehte einige der Frösche um. Das Alter hatte Rorys schmales, braunes Gesicht gezeichnet. Seine langen Finger wiesen ständig Flecken in der Farbe seines letzten Tonikums auf, und zwischen seinen buschigen Brauen saß eine bleibende Falte. Ich nannte sie seinen „Zorn-Zeiger“, weil ich seinen Zorn immer an der Anzahl der Furchen ablesen konnte, die sich über seiner Nase bildeten. Trotz einer alten Verletzung an der Hüfte zeugte seine schlanke Gestalt nicht von Gebrechlichkeit. Bei den seltenen Gelegenheiten, in denen Rory lächelte, wurde deutlich, dass er in seiner Jugend ein hübscher Kerl gewesen sein musste. „Wenn ich herausfinde, dass du den Boden des Eimers wieder mit Dreck aufgefüllt hast, vergifte ich deinen Tee.“
Er drückte mir ein achtlos eingewickeltes Bündel in die Arme. „Hier.“
Verwirrt drehte ich das Päckchen um. „Für mich?“
Er wedelte mit dem Gehstock in seinem leeren Laden herum. „Stimmt was nicht mit deinem Kopf, Kind?“
Da ich fast erwartete, dass der Inhalt explodieren würde, zog ich den Stoff vorsichtig zurück, bis ich ein Paar wunderschöne, goldene Handschuhe aufdeckte. Sie waren weicher als die Schwingen einer Taube und wahrscheinlich kostbarer als alles, was ich mir selbst hätte kaufen können. Ich hob einen der Handschuhe ehrfürchtig hoch. „Rory, das ist zu viel.“
Nur mit Mühe konnte ich mich davon abhalten, sie anzuziehen. Ich legte sie behutsam auf den Tresen und wollte mir schnell die dreckigen Hände säubern. Doch es waren keine sauberen Tücher mehr da, also wischte ich mir die Hände an Rorys Tunika ab und kassierte dafür einen Klaps.
Die Handschuhe passten perfekt. Weich und geschmeidig gaben sie jeder Bewegung meiner Finger nach.
Ich hob die Hände zur Laterne hoch, um sie mir genauer anzusehen. Diese Handschuhe würden auf dem Markt bestimmt einen hübschen Preis erzielen. Was natürlich nicht hieß, dass ich sie sofort verkaufen würde. Rory tat gern so, als hätte er die emotionale Tiefe eines Löffels, aber er wäre gekränkt, wenn ich sein Geschenk schon wenige Tage später verhökern würde. Märkte waren in Omal nicht schwer zu finden. Die ärmeren Dörfer brauchten immer Lebensmittel und andere Vorräte. Untereinander zu handeln, war einfacher, als im Palast um Almosen zu betteln.
Der alte Mann lächelte flüchtig. „Alles Gute zum Geburtstag, Sylvia.“
Sylvia. Meine erste und liebste Lüge. Ich presste die Hände zusammen. „Ein Trostpreis für die alte Jungfer?“ In den letzten fünf Jahren hatte Rory es kein einziges Mal versäumt, sich an mein erfundenes Geburtsdatum zu erinnern.
„Ich glaube kaum, dass man mit zwanzig Jahren die Schwelle zur alten Jungfer überschreiten kann.“
In Wahrheit war ich schon auf halbem Weg zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag. Eine weitere Lüge.
„Du bist so alt wie die Zeit selbst. Die Jahre unter hundert sehen für dich sicher alle gleich aus.“
Er pikste mich mit seinem Gehstock. „Für alte Jungfern ist es zu spät, um sich noch draußen herumzutreiben.“
Als ich den Laden verließ, hatte ich bessere Laune. Nachdem ich mir den Umhang fest um die Schultern geschlungen hatte, verknotete ich mir die Kapuze unter dem Kinn. Ich musste noch eine weitere Aufgabe erfüllen, bevor ich mein Bett endlich wiedersehen konnte, und dazu musste ich tiefer in das stille Dorf vordringen. Das waren die Stunden, in denen die Gedanken frei wanderten, in denen das hohle Mauerwerk zum Flüstern hungriger Schaitane wurde und das Scharren von krabbelndem Ungeziefer zu den Lauten der ruhelosen Toten.
Ich wusste, wie geschickt die Angst Schatten zu grausigen Formen vermengte. Seit vielen Jahren hatte ich keine Nacht mehr durchgeschlafen, und es gab Tage, an denen ich nur dem Atem in meiner Brust und dem Boden unter meinen Füßen vertraute. Der Unterschied zwischen den Dorfbewohnern und mir war, dass ich die Namen meiner Ungeheuer kannte. Ich wusste, wie sie aussehen würden, wenn sie mich fanden, und ich musste mir nicht ausmalen, was für ein Schicksal mich erwartete.
Mahair war ein winziges Dorf, aber es hatte eine lange Geschichte. Seine Kinder kannten die Sagen, die ihre Mütter, Väter und Großeltern erzählten. Der Aberglaube erhielt Mahair am Leben, noch lange nachdem die Zeit für seine Bewohner eine neue Seite aufgeschlagen hatte.
Dieser Aberglaube sorgte auch dafür, dass ich im Geschäft blieb.
Statt nach rechts zu Rayas Unterkunft abzubiegen, huschte ich in die Straße der Vagabunden. Honiggetränkte Teigkrümel und Fettflecken zeigten, wo auf der Betonstufe des elterlichen Süßwarenladens die Töchter des Halawani zwischen ihren Botengängen genascht hatten. Ich wich den Hunden aus, die am Fett schnüffelten, und hielt Ausschau nach Personen, die Rory über meine Schritte informieren konnten. Rory und ich hatten es zur Gewohnheit werden lassen, uns gegenseitig zu verzeihen. Falls er jedoch herausfand, dass ich unter seinem Namen Omaler behandelte und unnütze Mixturen an abergläubische Menschen verkaufte – nun, ich bezweifelte, dass Rory mir eine solche Missetat verzeihen würde. Die „Heilmittel“, die ich für meine Kunden zusammenbraute, waren harmlos. Zerstoßene Kräuter und verdünnte Spirituosen. Meistens waren die Krankheiten, gegen die sie helfen sollten, lächerlicher als alles, was ich in eine Flasche füllen konnte.
Das Haus, das ich suchte, lag zehn Gehminuten hinter Rayas Unterkunft. Unangenehm nah. Wasser tröpfelte vom Rand des durchgesackten Dachs, wo eine leere Wäscheleine zwischen zwei Haken gespannt war. Ein paar Unterkleider waren zu Boden geflattert. Ich stieß sie mit dem Fuß außer Sichtweite. Raya hatte mir vor Jahren beigebracht, wie man Unterwäsche auf der Wäscheleine versteckte, indem man sie hinter ein größeres Kleidungsstück klemmte. Den Grund für so viel Heimlichtuerei hatte ich nicht verstanden. Das tat ich immer noch nicht. Aber heute Abend war die Zeit knapp, und ich wollte sie nicht damit verschwenden, die schamhaften Omaler zu trösten, weil jetzt der endgültige Beweis vorlag, dass sie Unterwäsche trugen.
Die Tür wurde aufgerissen. „Sylvia, Gott sei Dank“, sagte Zeinab. „Es geht ihr heute noch schlechter.“
Ich klopfte meine schlammverkrusteten Stiefel am Türrahmen ab und trat ein.
„Wo ist sie?“
Zeinab führte mich in den letzten Raum, der von dem kurzen Flur abging. Eine Weihrauchwolke wehte über uns hinweg, als sie die Tür öffnete. Ich fächelte den weißen Dunst weg, der in der Luft hing. Eine verhutzelte alte Frau wiegte sich auf dem Boden hin und her, tiefe, blutige Spuren an den Armen, die sie sich mit ihren Nägeln zugefügt hatte. Zeinab schloss die Tür und hielt einen Sicherheitsabstand. Tränen schwammen in ihren großen, haselnussbraunen Augen. „Ich habe versucht, sie zu baden, und sie hat das hier getan.“ Zeinab schob den Ärmel ihrer Abaya hoch und entblößte zahlreiche rote Kratzspuren.
„Verstehe.“ Ich legte meine Tasche auf den Tisch. „Wenn ich fertig bin, rufe ich dich.“
Es war nicht schwer, die alte Frau mit einem Trank zu bändigen. Ich trat hinter sie und legte ihr einen Arm um den Hals. Sie zerrte an meinem Ärmel, den Mund beim Keuchen geöffnet. Schnell kippte ich ihr den Trank in die Kehle und lockerte meinen Würgegriff so weit, dass sie schlucken konnte. Als ich mir sicher war, dass sie die Flüssigkeit nicht mehr ausspucken würde, ließ ich sie los und zupfte meinen Ärmel zurecht. Sie spuckte mir vor die Füße und fletschte blutige Zähne, da sie sich die Lippe aufgerissen hatte.
Es dauerte ein paar Minuten. Mein Talent, so zweifelhaft es auch sein mochte, lag in der effizienten und flüchtigen Täuschung. An der Tür erlaubte ich Zeinab, mir ein paar Münzen in die Tasche meines Umhangs zu schmuggeln, und tat so, als wäre ich überrascht. Ich würde die Omaler und ihre geheuchelte Bescheidenheit nie verstehen. „Denk dran …“
Zeinab nickte ungeduldig. „Ja, ja, ich werde kein Wort darüber verlieren. Es sind jetzt schon Jahre, Sylvia. Wenn der Apotheker es jemals herausfindet, dann hat er es nicht von mir.“
Sie war ziemlich selbstsicher für eine Frau, die sich nie die Mühe machte zu fragen, was in dem Trank war, den ich ihrer Mutter regelmäßig in den Rachen kippte. Zerstreut erwiderte ich Zeinabs Winken und schob meinen Dolch in dieselbe Tasche wie die Münzen. In übel riechenden Pfützen kräuselte sich das Regenwasser auf der löchrigen Lehmstraße. Die meisten der Häuser hier waren eher Hütten. Über den aus Lehm und groben Ziegelsteinen zusammengefügten Wänden zitterten Strohdächer. Ich wich einer Spur von grünem Maultiermist aus, dessen nasser, grasiger Geruch mir in die Nase stach.
Gab es in den Oberstädten von Omal Exkremente in den Straßen?
Zeinabs Nachbarin hatte Hühnerfedern vor ihrer Tür verstreut, um den Nachbarn ihr Glück zu demonstrieren. Ihre Tochter hatte einen Kaufmann aus Dawar geheiratet, und die Mitgift reichte aus, um den ganzen Monat lang Hühnchen zu essen. Von nun an würden feinste Kleider ihren Körper schmücken. Das erlesenste Fleisch und das am schwierigsten zu züchtende Gemüse würden auf ihrem Teller landen. Sie würde nie wieder in Mahair Maultiermist ausweichen müssen.
Als ich um die Ecke bog und abwesend die Münzen in meiner Tasche zählte, stieß ich mit jemandem zusammen.
Stolpernd fing ich mich an einem Haufen kaputter Ziegelsteine ab. Der Soldat aus Nizahl rührte sich kaum, sondern runzelte nur noch finsterer die Stirn.
„Gib dich zu erkennen.“
Panik stieg mit schweren, flatternden Flügeln in meiner Kehle auf. Obwohl wir im Dorf nicht durch eine offizielle Ausgangssperre eingeschränkt waren, wagte kaum jemand hier einen nächtlichen Spaziergang. Die Soldaten aus Nizahl patrouillierten in der Regel zu zweit, was bedeutete, dass der Kamerad dieses Mannes wahrscheinlich gerade irgendjemanden auf der anderen Seite des Dorfes schikanierte.
Ich unterdrückte die Panik und brach ihr die Schwingen. Panik war eine Pest. Ihr einziger Zweck war es, sich auszubreiten, bis sie jeden Gedanken, jeden Instinkt gefressen hatte.
Sofort senkte ich den Blick. Einem nizahlischen Soldaten in die Augen zu schauen, brachte nur Ärger.
„Mein Name ist Sylvia. Ich lebe in Rayas Unterkunft und bin das Lehrmädchen des Apothekers Rory. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich dich erschreckt habe. Eine ältere Frau brauchte dringend Hilfe, und mein Arbeitgeber ist unpässlich.“
Den Falten in seinem Gesicht nach zu urteilen, war der Soldat etwa Ende vierzig. Wenn er ein omalischer Patrouillengänger gewesen wäre, hätte sein Alter wenig bedeutet. Aber die Soldaten aus Nizahl starben in der Regel jung und auf blutige Weise. Dass dieser Mann so lange überlebt hatte, dass man die Furchen auf seiner Stirn sehen konnte, bedeutete, dass er entweder ein tödlicher Gegner oder ein Feigling war.
„Wie lautet der Name deines Vaters?“
„Ich bin ein Mündel in Rayas Haus“, wiederholte ich. Er musste neu in Mahair sein. Jeder kannte Rayas Waisenhaus auf dem Hügel. „Ich habe weder Mutter noch Vater.“
Er ging nicht weiter auf das Thema ein. „Hast du Aktivitäten beobachtet, die zur Gefangennahme eines Jasadi führen könnten?“ Obwohl das eine Standardfrage der Soldaten war, mit der die Wachsamkeit für alle Anzeichen von Magie gefördert werden sollte, zuckte ich innerlich zusammen. Die letzte Verhaftung eines Jasadi war erst vor einem Monat in unserem Nachbardorf erfolgt. Aus dem Gemunkel hatte ich herausgehört, ein Mädchen hätte gemeldet, ihre Freundin habe einen Riss im Dielenbrett mit einer Handbewegung repariert. Ich hatte mitbekommen, wie das Mädchen für ihren Mut gelobt wurde, weil sie die Fünfzehnjährige angezeigt hatte. Gelobt und beneidet – sie konnten es kaum erwarten, selbst zum Helden zu werden.
„Nein, das habe ich nicht.“ Ich hatte seit fünf Jahren keinen anderen Jasadi mehr gesehen.
Er schürzte die Lippen. „Der Name der älteren Frau?“
„Aya, ihre Tochter Zeinab ist ihre Pflegerin. Ich könnte dir den Weg zu ihnen weisen, wenn du möchtest.“ Zeinab war gerissen. Sie würde eine Lüge für einen solchen Fall parat haben.
„Nicht nötig.“ Er wedelte mit einer Hand hinter sich. „Fort mit dir. Halte dich von der Vagabundenstraße fern.“
Einen Vorteil hatten die älteren Soldaten aus Nizahl – sie hatten weniger Lust, zu prahlen oder die Verhörtaktiken ihrer jüngeren Kameraden anzuwenden. Ich senkte dankbar den Kopf und eilte an ihm vorbei.
Ein paar Minuten später schlüpfte ich in Rayas Haus. Dem Geruch des erkaltenden Wachses nach zu urteilen, war das letzte Mädchen erst vor Kurzem ins Bett gegangen. Erleichtert darüber, dass mein Geburtstag vergessen worden war, schlüpfte ich an der Tür aus meinen Stiefeln. Raya hatte sich heute mit den Stoffhändlern getroffen. Vom Feilschen mit ihnen bekam sie immer miserable Laune. Die einzige Würdigung meines Geburtstags würde ein Frühstück mit knusprigem, buttrigem Fetir und Sirup am Morgen sein.
Als ich meine Tür aufdrückte, schlug mir warme Luft entgegen. Bei Bairas gesegnetem Haar, nicht schon wieder. „Raya wird euch die Haut abziehen. In einer Woche ist die Walima.“
Marek schien ganz in die Feuergrube vertieft zu sein und stocherte mit einem dünnen Stock in den Kohlen herum. Sein goldenes Haar schimmerte im Schein der Flammen. Unter Sefas Nähutensilien lagen ein Haufen Stoff und die Anfänge eines Kleides. „Genau“, sagte Sefa und tunkte ein Stück verkohltes Rindfleisch in ihre Brühe. „Ich ertränke meine Sorgen wegen der verdammten Walima in gestohlener Brühe. Seht euch dieses Gewand an! Das ist ein Kleid, über das alle anderen Kleider lachen.“
„Was macht er da mit dem Feuer?“, fragte ich und beschloss, ihr Kleidungsproblem zu ignorieren. Morgen früh würde Sefa Raya mit einem gewinnenden Lächeln und blutunterlaufenen Augen ein perfektes Gewand überreichen. Eine Lehre bei der besten Schneiderin in Omal war nichts für Leute, die unter Druck zusammenbrachen.
„Er versucht, seine verdammten Samenkörner zu rösten.“ Sefa schniefte. „Wegen uns riecht dein Zimmer jetzt wie eine Tavernenküche. Entschuldige. Zu unserer Verteidigung: Wir haben uns versammelt, um ein schreckliches Ableben zu betrauern.“
„Ein Ableben?“ Ich setzte mich neben die steinerne Grube und rieb mir über den knisternden Flammen die Hände.
Marek reichte mir einen von Rayas privaten Kelchen. Die Frau würde uns das Fell abziehen. „Beachte sie gar nicht. Wir wollten nur deine Herdstelle missbrauchen“, fügte er hinzu. „Ich bin davon überzeugt, dass Yuli seiner Herde beibringt, mich umzubringen. Sie hätten mich heute fast in einen Kanal getrieben.“
„Hast du irgendetwas getan, das Yuli oder die Ochsen verärgert hat?“
„Nein“, antwortete Marek betrübt.
Ich drehte den Kelch zwischen den Händen und kniff die Augen zusammen. „Marek.“
„Ich habe die Pferdeställe vielleicht dazu benutzt …, jemanden zu unterhalten …“ Er stieß einen gequälten Seufzer aus. „Seine Tochter.“
Sefa und ich stöhnten gleichzeitig. Es war nicht das erste Mal, dass Marek einem verschämten Lächeln oder einem freundlichen Wort hinterhergejagt war und sich in Schwierigkeiten gebracht hatte. Er war auf geradezu absurde Weise hübsch, mit hellem Haar, grünen Augen und einer schlanken Gestalt, der man seine Kraft nicht ansah. Um dem entgegenzuwirken, hatte er sich dafür entschieden, bei Yuli in die Lehre zu gehen, Mahairs anspruchsvollstem Bauern. Indem er den ganzen Tag lang Wagen belud und Ochsen hütete, machte sich Marek für jeden Handeltreibenden im Dorf unentbehrlich. Er arbeitete, um sich ihren Respekt zu verdienen, denn es gab nur wenige Dinge, die in Mahair höher geschätzt wurden als schwielige Hände und Schweiß auf der Stirn.
Das war auch der Grund, warum man die Schar gebrochener Herzen duldete, die er hinterließ.
Um nicht länger ignoriert zu werden, fuhr Sefa fort: „Aber deine Jugend, Sylvia, wir trauern um deine Jugend. Mit zwanzig hast du weniger Abenteuer erlebt als die Dorfkinder.“
Ich trank das Wasser aus und reichte Marek den Kelch, damit er mir nachschenkte. „Ich erlebe jede Menge Abenteuer.“
„Ich rede nicht davon, wie oft du dein Feigenbäumchen umbringen kannst, bevor es wirklich tot bleibt“, spottete Sefa. „Wenn du letzte Woche einfach mitgekommen wärst, um die Hähne in Nadias Gehege freizulassen …“
„Nadia hat dir für immer Hausverbot erteilt“, warf Marek ein. Mutig von ihm, Sefa mitten in einer ihrer Tiraden zu unterbrechen. Er nahm ein geschwärztes Samenkorn und warf es zum Abkühlen von einer Hand in die andere. „Lass Sylvia in Ruhe. Abenteuer gibt es in allen möglichen Formen.“
Sefas Nasenflügel blähten sich, aber Marek verzog keine Miene. Sie kommunizierten miteinander auf diese seltsame, wortlose Art von Menschen, die etwas verband, das dicker war als Blut und stärker als das gemeinsame Aufwachsen. Im Laufe der letzten fünf Jahre hatte ich Hunderte von ihren stummen Gesprächen erlebt.
„Und ich bringe mein Feigenbäumchen nicht um“, erklärte ich beim Aufstehen. „Ich fördere seinen Kampfgeist.“
„Hör auf, mich so anzufunkeln“, sagte Marek seufzend zu Sefa. „Es tut mir leid, dass ich euch unterbrochen habe.“
Er hielt ihr ein aufgeplatztes Samenkorn hin.
Sefa ließ seine Hand vierzig Sekunden lang in der Luft schweben, bevor sie das Samenkorn entgegennahm. „Hilfst du mir, diesen Ärmel zu säumen?“
Mit einem verlegenen Grinsen hob Marek seine rußbedeckten Hände. Sefa verdrehte die Augen. Ich beobachtete diesen letzten Wortwechsel voller Verwirrung. Es erstaunte mich immer wieder, wie unkompliziert sie miteinander umgingen. Ihre ungewöhnliche Verbundenheit hatte dazu geführt, dass die anderen Mündel im Haus Fragen stellten. Marek hatte sich kaputtgelacht, als ihn das erste Mal ein jüngeres Mädchen fragte, ob er und Sefa heiraten wollten. „Sefa wird niemanden heiraten. Wir lieben einander auf andere Art.“
Das Mündel hatte mit den Wimpern geklimpert, weil Marek der einzige Junge in der Unterkunft war und ein Gesicht hatte, das ihn zu einem Leben voller wehmütiger Seufzer verdammte, die ihm auf Schritt und Tritt folgten.
„Was ist mit dir?“, hatte das Mündel gefragt. Sefa, die lächelnd in der Ecke gesessen und gestrickt hatte, war ernst geworden. Nur Raya und ich hatten den bekümmerten Blick gesehen, den sie Marek zugeworfen hatte, und die Schuldgefühle in ihren braunen Augen.
„Sefa und ich sind im Geiste verbunden, wenn auch nicht in der Ehe.“ Marek hatte dem Mündel das Haar verwuschelt. Das Mädchen hatte gekreischt und nach Marek geschlagen. „Ich folge ihr, wo immer sie hingeht.“
Um ihre Verrücktheit noch zu unterstreichen, hatten die beiden sofort Gefallen an mir gefunden, als Rory mich vor Rayas Haustür abgesetzt hatte. Damals war ich fast eine Wilde gewesen und hatte kaum für Freundschaften getaugt, aber das hatte die beiden nicht abgehalten. In diesem omalischen Dorf hatte ich mich nur schwer eingelebt und war von den einfachsten Bräuchen befremdet gewesen. Wenn man sich die Stelle zwischen den Schultern rieb, starb man angeblich früher. Am ersten Tag des Monats durfte man nur mit der linken Hand essen; in Gegenwart Älterer nicht die Beine übereinanderschlagen; man sollte der Letzte sein, der am Tisch saß, und der Erste, der ihn wieder verließ. Es hatte auch nicht geholfen, dass meine bronzefarbene Haut mehrere Schattierungen dunkler war als das hier typische Olivbraun. Ich passte besser zu den Orbanern, da das Königreich im Norden seine Tage meist unter der Sonne verbrachte. Als Sefa bemerkt hatte, dass ich es vermied, Weiß zu tragen, hatte sie ihre dunklere Hand neben meine gehalten und gesagt: „Sie sind nur neidisch, weil wir ihre ganze Farbe aufgesaugt haben.“
In unserer Unterkunft war es auch nicht viel einfacher. Alle im Haus hatten eine hässliche Vergangenheit, die sie selbst im Schlaf verfolgte. Ich hatte mir keinen Gefallen getan, als ich einem anderen Mündel fast die Nase platt geschlagen hatte, als es versucht hatte, mich zu umarmen. Trotz der zweistündigen Strafpredigt von Raya, die ich über mich ergehen lassen musste, hatte dieser Vorfall meine Abneigung gegen Berührungen nur noch gefestigt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund ließen Sefa und Marek sich trotzdem nicht abschrecken. Sefa war allerdings ziemlich verstimmt wegen ihrer Nase gewesen.
Ich hängte meinen Umhang ordentlich in den Schrank und strich mit dem Daumen über den mottenzerfressenen Kragen. Er würde keinen weiteren Winter überstehen, aber bei dem Gedanken, den Umhang wegzuwerfen, bildete sich ein Kloß in der Kehle. Jemand in meiner Lage konnte sich nur wenige emotionale Bindungen erlauben. Jeden Augenblick konnte ein Schwert auf mich gerichtet werden, und der Aufschrei „Jasadi“ würde dieser Identität und dem Leben, das ich mir damit aufgebaut hatte, ein Ende machen. Ich ballte die Hand zur Faust. Aber dann riss ich die Traurigkeit unverzüglich mit Stiel und Stumpf aus mir heraus, bevor sie wuchern konnte. Eine gewöhnliche Waise aus Mahair durfte sich an diesen müden Umhang klammern – das Erste, was sie sich mit ihrem eigenen, sauer verdienten Geld gekauft hatte.
Ein Flüchtling aus dem verbrannten Königreich durfte das nicht.
Ich drehte die Handflächen nach oben und prüfte die silbernen Reifen um meine Handgelenke. Obwohl die Armbänder für kein Auge außer dem meinen sichtbar waren, hatte es lange gedauert, bis mein Verfolgungswahn nachließ, wenn jemand den Blick länger auf meine Handgelenke richtete. Die Armbänder machten alle meine Bewegungen mit wie eine zweite Haut. Nur meine gefangene Magie konnte sie wecken und sie nach Belieben enger ziehen.
Die Magie kennzeichnete mich als Jasadi. Magie war der Grund dafür, dass Nizahl Grenzen um die Wälder zog und seine Soldaten durch die Königreiche schickte. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich meine Armbänder gehasst. Wie konnte es gerecht sein, dass Jasadis wegen ihrer Magie verurteilt wurden, ich aber nicht einmal Zugang zu der Sache hatte, die mich verdammte? Meine Magie war seit meiner Kindheit hinter diesen Reifen gefangen. Meine Großeltern hatten wohl nicht ahnen können, dass sie sterben und ich für immer mit diesen Armbändern geschlagen sein würde.
Ich versteckte Rorys Geschenk im Kleiderschrank, unter den Bahnen meines längsten Gewandes. Die Mädchen riskierten nur selten Rayas Zorn, indem sie stahlen, aber ein schlimmer Winter konnte jeden zum Dieb machen. Ich strich über einen der Handschuhe, und in meiner Brust wurde es warm vor Zuneigung. Wie viel hatte Rory wohl dafür ausgegeben, obwohl er wusste, dass ich nur wenige Gelegenheiten haben würde, sie zu tragen?
„Wir wollten dir etwas zeigen“, sagte Marek. Seine Stimme holte mich in die Realität zurück. Ich knallte die Schranktüren zu und runzelte über mich selbst die Stirn. Was spielte es für eine Rolle, wie viel Geld Rory ausgegeben hatte? Alles, was ich nicht zum Überleben brauchte, würde irgendwann weggeworfen oder verkauft werden, und mit diesen Handschuhen verhielt es sich nicht anders.
Sefa stand auf und klopfte sich Stoffreste vom Schoß. Sie schnaubte bei meinem Gesichtsausdruck. „Bei Rovials verderbtem Grab, sieh sie dir an, Marek. Man könnte denken, wir hätten vor, sie im Wald zu verscharren.“
Marek runzelte die Stirn. „Haben wir das denn nicht vor?“
„Ihr seid beide aus meinem Zimmer verbannt. Für immer.“
Ich folgte ihnen nach draußen, vorbei an den Reihen flatternder Wäscheleinen und dem kläglichen Kräutergarten. Rayas Waisenhaus war oben auf einem grasbewachsenen Hang erbaut worden und bot einen Blick über das ganze Dorf bis hin zur Hauptstraße. Die meisten Häuser in Mahair waren gedrungene, zweistöckige Bauten mit bröckelnden Wänden und Rissen im Lehmputz. Auf den Dächern züchteten die Dorfbewohner Hühner und Kaninchen, um die ewige Lebensmittelknappheit zu überstehen. Vieh wanderte auf den Feldern am Rand des Essam-Waldes umher, eingezäunt von der viele Meilen langen Mauer rund um Mahair.
Hinter der Mauer breitete sich dunkel der Essam-Wald aus. Das Mondlicht verschwand über den Bäumen, die sich dem schwarzen Horizont entgegenstreckten.
Vor mir wandten Marek und Sefa den Blick vom Wald ab. Sie waren zwei Jahre vor mir als Sechzehnjährige nach Mahair gekommen. Daher konnte ich nicht sagen, ob sie die merkwürdigen Bräuche von Mahair einfach übernommen hatten oder ob diese Bräuche weiter verbreitet waren, als ich dachte.
Nachdem ich damals den Essam-Wald verlassen hatte und bei Raya untergekommen war, hatte ich die Nacht auf dem Hügel verbracht und die Stelle beobachtet, an der Mahairs Laternen sich in der Finsternis des Waldes verloren. Die Flucht aus Essam hatte mich fast umgebracht. Ich hatte mir selbst bestätigen wollen, dass dieses Dorf und das Dach über meinem Kopf kein grausamer Traum waren. Dass ich, wenn ich die Augen schloss und sie wieder öffnete, keine Äste sehen würde, die unter einem sternlosen Himmel raschelten.
Raya war in ihrem Nachtgewand nach draußen gestürmt und hatte mich ins Haus gezerrt, wo ich mir anhören musste, dass es gefährlich sei, in den Essam-Wald zu starren und damit böse Geister aus der Dunkelheit zu locken. Als hätte allein meine Beachtung sie heraufbeschwören können.
Ich hatte fünf Jahre in diesen Wäldern verbracht. Ihre Dunkelheit fürchtete ich nicht. Allem außerhalb von Essam konnte ich nicht vertrauen.
„Seht!“, rief Sefa jetzt und deutete schwungvoll auf ein Gewirr von Pflanzen. Wir hielten hinter dem Haus inne, wo ich verbotenerweise das Feigenbäumchen eingepflanzt hatte, das ich beim letzten Markt einem Händler aus Lukub abgekauft hatte. Ich war mir nicht sicher, warum. Mich um eine Pflanze zu kümmern, die mich an Jasad erinnerte, um etwas, das Wurzeln schlug und das ich im Notfall nicht mitnehmen konnte, war peinlich. Ein weiteres Zeichen der Schwäche, der ich Raum gegeben hatte.
Die Blätter meiner Feigenpflanze hingen schlaff und traurig herunter. Ich stocherte in der Erde herum. Machten sie sich über meine Pflanztechnik lustig?
„Es gefällt ihr nicht. Ich habe dir gesagt, wir hätten ihr lieber einen neuen Umhang kaufen sollen“, seufzte Marek.
„Von welchem Lohn? Bist du plötzlich ein wohlhabender Mann geworden?“ Sefa spähte zu mir herüber. „Es gefällt dir nicht?“
Ich betrachtete blinzelnd die Pflanze. Hatten sie sie gegossen, während ich fort gewesen war? Was sollte mir hier gefallen? Sefa machte ein langes Gesicht, daher sagte ich hastig: „Ich finde es großartig! Es ist, ähm, wunderbar, wirklich. Vielen Dank.“
„Oh. Du kannst ihn nicht sehen, oder?“ Marek lachte. „Sefa hat vergessen, dass sie selbst nur so groß ist wie ein Fingerhut, und hat ihn außerhalb deiner Sichtweite versteckt.“
„Ich bin ganz normal groß! Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich mich mit einer Frau angefreundet habe, die so groß ist, dass sie den Mond kitzeln könnte“, protestierte Sefa.
Ich hockte mich neben die Pflanze. Hinter ihrem Vorhang aus vergilbten Blättern stand ein geflochtener Strohkorb mit einem Dutzend Stückchen Sesamkonfekt. Ich liebte diese brüchigen Quadrate, an denen man sich die Zähne ausbeißen konnte. Wenn ich genug gespart hatte, um sie mir leisten zu können, holte ich mir am Markttag immer welche.
„Sie haben den guten Honig verwendet, nicht den gipsartigen“, sagte Marek.
„Alles Gute zum Geburtstag, Sylvia“, ergänzte Sefa. „Aus Höflichkeit werde ich darauf verzichten, dich zu umarmen.“
Zuerst Rory und jetzt das hier? Ich räusperte mich. In einem Dorf mit leeren Mägen und vertrockneten Feldern hatte jede Freundlichkeit ihren Preis. „Ihr wollt mich nur mit Sesam zwischen den Zähnen lächeln sehen.“
Marek feixte. „Ah ja, unser großartiger Plan ist aufgeflogen. Wir wollten das Lächeln ruinieren, das bei dir alle fünfzehn Jahre einmal zum Vorschein kommt.“
Ich gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. Es war das Äußerste an körperlicher Berührung, das ich ertragen konnte, aber es brachte meine Dankbarkeit zum Ausdruck. Wir gingen zurück ins Haus und setzten uns wieder um die inzwischen erloschene Feuerstelle. Marek wühlte in der Asche nach Samenkörnern, die noch nicht verbrannt waren. Sefa legte sich auf den Boden, die Füße auf Mareks Bein gestützt. „Arin oder Felix?“
Ich ließ mich auf mein Bett fallen und machte mich an die mühsame Aufgabe, meine Locken aus dem verfilzten Zopf zu befreien. Das Sesamkonfekt war sicher in meinem Kleiderschrank verstaut. Diese Geschenke hätten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Sobald Sefa und Marek eingeschlafen waren, würde ich alles zusammensuchen, was ich für meinen Weg zurück in den Wald brauchte.
„Sind die Namen der Thronerben von Nizahl und Omal.“
„Sylvia“, begann Sefa in einem schmeichelnden Ton und warf mir ein Samenkorn an die Stirn. „Du bist dazu auserwählt worden, als Begleiterin eines der Thronerben am Ball des Siegers teilzunehmen. Arin oder Felix?“
Marek stöhnte und hielt sich den Arm vor die Augen. Seine Mundwinkel waren rußverschmiert. Wir verstanden beide nicht, warum Sefa es liebte, sich irgendwelche Geschichten über ferne Höfe auszudenken. Sie behauptete, dass ihr schöne Liebesgeschichten gefallen würden, selbst wenn sie persönlich nicht an sie glaubte. Schon in jungen Jahren hatte sie sich dem Abenteuer verschrieben, als sie gemerkt hatte, dass die Torheiten von Lust und Liebe keine Macht über sie besaßen.
Ich seufzte und ließ mich auf Sefas Spielchen ein. Felix von Omal würde einen harten Arbeitstag nicht mal dann erkennen, wenn er vor seinen polierten Stiefeln kniete. Ich hatte mir seine Ansprache nach einer besonders schlimmen Ernte angehört. Er war mit seinen handgesponnenen Gewändern und vergoldeten Kutschen gekommen und hatte Worte gesprochen, die so leer waren wie der Raum zwischen seinen Ohren. Schlimmer noch, er hatte Nizahls Soldaten freie Hand gelassen und leistete nur Widerstand gegen ihre Einmischung, wenn es um die omalische Oberschicht ging.
„Felix ist unfähig und feige, und er denkt, in den ärmeren Dörfern gäbe es nur Grobiane“, spottete Marek und gab damit meine unausgesprochene Meinung wieder. „Ich würde zögern, ihm auch nur das Kommando über kochendes Wasser zu überlassen. Die anderen Thronerben sind wenigstens schlau, wenn auch genauso verabscheuenswert.“
Bei „verabscheuenswert“ wanderten meine Gedanken zu Arin von Nizahl, dem einzigen Sohn des Obersten Herrschers Rawain.
Silberhaarig und skrupellos, Thronerbe und Kommandant der unschlagbaren Truppen von Nizahl. Schon mit dreizehn Jahren hatte er Soldaten ausgebildet, die doppelt so alt waren wie er. Ich hatte immer gedacht, der Blutdurst des Obersten Herrschers Rawain würde seinesgleichen suchen, denn sicher war nicht sein gütiges Herz verantwortlich für die Ermordung meiner Familie oder dafür, dass Jasad niedergebrannt worden war und alle überlebenden Jasadis untertauchen mussten. Aber wenn die Gerüchte über den Thronerben der Wahrheit entsprachen, konnte ich nur dankbar sein, dass Arin während des Feldzugs gegen Jasad noch ein halbwüchsiger Junge gewesen war. Ich bezweifelte, dass auch nur ein einziger Jasadi es lebend herausgeschafft hätte, wenn er den Angriff angeführt hätte.
Alle vier Königreiche hatten sich an die ständige Präsenz der Soldaten aus Nizahl gewöhnt. Sie war ein unheilbares Symptom der militärischen Vorherrschaft von Nizahl. Aber wenn der nizahlische Thronerbe außerhalb seines eigenen Landes auftauchte, verhieß das Unheil: Es bedeutete, dass er eine Gruppe von Jasadis gefunden hatte oder Magie größeren Ausmaßes. Ich hatte Mühe, ein Schaudern zu unterdrücken. Wenn Arin von Nizahl jemals in die Nähe von Mahair käme, wäre ich schneller weg als Schnaps bei einer Beerdigung.
„Sylvia?“, fragte Marek. Marek und Sylvia runzelten beide auf die mir vertraute, besorgte Art die Stirn. Ein paar schwarze Strähnen waren mir beim Lösen des Zopfs auf den Schoß gefallen. Ich rollte sie zusammen und warf das Knäuel ins Feuer, wo ich zusah, wie es zu Asche zerfiel.
„Tut mir leid“, sagte ich. „Ich habe die Frage vergessen.“
Wie immer schlug der Gedanke an Nizahl Krallen des Hasses in meinen Bauch. Ich war nicht mehr in der Lage, im Affekt Magie fließen zu lassen. Mir blieb nur noch die Fantasie. Ich stellte mir vor, den Obersten Herrscher Rawain in dem Königreich zu treffen, das er verwüstet hatte. Ich würde ihm sein Zepter durch den weichsten Teil seines Bauches rammen und beobachten, wie die Grausamkeit aus seinen blauen Augen abfloss. Ich würde ihn auf die Stufen des gefallenen Palastes legen, damit sich die Geister der Toten von Jasad an ihm satt fressen konnten.
„Ach ja, ein Thronerbe.“ Ich hielt inne. „Sorn.“
„Der Erbe Orbans?“ Sefa zog die Brauen hoch. „Du magst es eher primitiv? Suchst du die Gefahr?“
Ich zwinkerte ihr zu. „Wie gefährlich kann so ein primitiver Klotz schon sein?“



















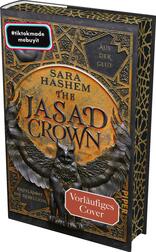
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.