

The Vienna Writers – Sie schrieben um ihr Leben The Vienna Writers – Sie schrieben um ihr Leben - eBook-Ausgabe
Roman
— Holocaust-Roman vor dem Hintergrund der Judenverfolgung„J. C. Maetis hat mit ›Vienna Writers‹ einen wendungsreichen, atmosphärisch dichten, packenden Page-Turner geschrieben, der den Leser bis zum Schluss nicht mehr loslässt.“ - (A) OÖ Nachrichten
The Vienna Writers – Sie schrieben um ihr Leben — Inhalt
Sie versteckten sich vor den Augen der Welt
Wien 1938: Nach dem Anschluss Österreichs vergiften die Verordnungen der Nazis das Klima auf bisher ungekannte Weise. Auch die jüdischen Cousins Mathias Kraemer und Johannes Namal müssen als in der Öffentlichkeit stehende Schriftsteller um das Wohl ihrer Familien bangen. Weil sie die Stadt nicht verlassen möchten, entschließen sie sich zur Flucht nach vorn: Unter falschen Namen und Identitäten verstecken sie sich direkt vor den Augen der SS. Dabei sind sie auf die Unterstützung hilfsbereiter Mitmenschen angewiesen. Doch SS-Scharführer Schnabel ist ihnen bereits dicht auf den Fersen.
Ein Holocaust-Roman, der auf ergreifende Weise vom Überlebenskampf zweier Familien während der Judenverfolgung im Wien des Dritten Reichs erzählt.
„Eine Geschichte über Loyalität, Liebe und Mut, die ich nur jedem empfehlen kann.“ Tova Friedman, Holocaust-Überlebende
„Ein eindrucksvolles Buch über Courage, Familie und das Überleben. In herzzerreißenden Szenen erzählt Maetis von der Verzweiflung, im Angesicht des Todes die eigenen Geheimnisse zu wahren.“ Booklist
„Die Heldentaten der ›versteckten Juden‹ zeigen, wie schreckliche Ereignisse gewöhnliche Menschen dazu bringen, außergewöhnlichen Entscheidungen zu treffen.“ The Times of Israel
Leseprobe zu „The Vienna Writers – Sie schrieben um ihr Leben“
Kapitel 1
„Was die Erkenntnis des Geistes angeht, sind Dichter
uns gewöhnlichen Menschen überlegen; sie trinken
an Strömen, die wir der Wissenschaft noch nicht
zugänglich gemacht haben.“
Sigmund Freud
Mathias Wien, März 1938
Ich, Mathias Kraemer, erinnere mich noch gut an die erste ernst zu nehmende Warnung. Das war, als ein SS-Mann ins Café Mozart kam und wissen wollte, ob Juden anwesend seien und welche Juden das Café regelmäßig frequentieren.
Ich saß mit Johannes knapp zehn Meter von der Theke entfernt, an der der SS-Mann zwei junge Kellner angesprochen [...]
Kapitel 1
„Was die Erkenntnis des Geistes angeht, sind Dichter
uns gewöhnlichen Menschen überlegen; sie trinken
an Strömen, die wir der Wissenschaft noch nicht
zugänglich gemacht haben.“
Sigmund Freud
Mathias Wien, März 1938
Ich, Mathias Kraemer, erinnere mich noch gut an die erste ernst zu nehmende Warnung. Das war, als ein SS-Mann ins Café Mozart kam und wissen wollte, ob Juden anwesend seien und welche Juden das Café regelmäßig frequentieren.
Ich saß mit Johannes knapp zehn Meter von der Theke entfernt, an der der SS-Mann zwei junge Kellner angesprochen hatte. Glücklicherweise standen zwischen ihm und uns noch zwei Tische, andernfalls hätte sein Blick direkt auf uns fallen können.
Wir hätten besser auf Sigmund Freud gehört, der uns beim letzten Treffen des „Kreises“ gewarnt hatte, dass es nach dem Anschluss eng werden könnte.
Von Wiens zahlreichen prachtvollen Cafés war uns das Mozart am liebsten, es war nicht zu prätentiös. Zwar waren das Sperl oder auch das Landtmann opulenter und nobler ausgestattet, doch für uns waren das Helle und Offene des Mozart das wesentlichere Element. Im Mozart war man auf beinahe jedem Platz in Licht getaucht und konnte noch dazu beobachten, was auf der Straße vor sich ging. Durch die große Fensterfront hatten wir so auch den SS-Mann kommen sehen. Als er mit den Kellnern sprach, hätten wir uns jedoch einen Ort mit dunkleren Ecken gewünscht.
So gut wie jede Woche trafen wir uns hier zur gleichen Zeit, dienstags um achtzehn Uhr, zusammen mit Büroangestellten und Verkaufspersonal, die nach der Arbeit erschienen, sowie Besuchern, die sich vor Beginn der Oper, eines Konzerts oder eines Theaterstücks einfanden. Häufig gesellte sich auch unser Literaturagent Julian Reisner zu uns. Dann unterhielten wir uns über die Fortschritte unserer Buchprojekte, den Buchmarkt und die Welt im Allgemeinen.
Johannes hatte soeben seinen zweiunddreißigsten Geburtstag gefeiert, ein beträchtlicher Altersunterschied also zu mir, der ich siebenundvierzig Jahre alt war. Dennoch standen wir uns so nahe wie Brüder, nicht nur wie Cousins. Vielleicht führte der Umstand, dass wir den gleichen Beruf gewählt hatten, zu dieser besonderen Verbindung. Ich schrieb seit sechzehn Jahren Kriminalromane, Johannes seit fünf. Zudem hatte ich Johannes bei Julian eingeführt. Es war nicht nur ein Gefallen gewesen, den ich einem Familienmitglied getan hatte, vielmehr war ich von Johannes’ schriftstellerischen Fähigkeiten überzeugt. Julian war der gleichen Meinung. Mit seinen einundvierzig Jahren überbrückte er den Altersunterschied zwischen Johannes und mir, davon abgesehen fungierte er als unser Mentor und Ratgeber.
„Ich wünschte, Julian wäre bei uns“, murmelte Johannes. „Er würde die richtigen Worte finden, um uns zu beruhigen.“
„Ich glaube, ebendeshalb kann er jetzt nicht bei uns sein. Nicht nach dem letzten Treffen des Kreises. Der Anschluss war vor drei Tagen, und Julian betreut noch andere, die in der gleichen Lage wie wir sind.“ Meine Stimme war nicht mehr als ein leises Zischen, und angesichts des nicht weit entfernten SS-Mannes vermied ich das Wort „Juden“. „Hinzu kommen eine Reihe politische Autoren und potenziell Subversive. Als ich mit ihm gesprochen habe, sagte er, er sei unentwegt am Telefon und versuche, das jüngste Geschehen und seine Bedeutung nicht nur mir, sondern auch einer Menge anderer Leute zu erklären.“
Bei diesem Anschluss – oder der Übernahme und Eingliederung Österreichs in das nationalsozialistische Deutsche Reich – war kaum ein Schuss gefallen.
Der Grund für diesen fehlenden Widerstand lag in einer gemeinsamen Vision und Identität der Österreicher und Deutschen; die Tatsache, dass Adolf Hitler, der Kanzler des Deutschen Reichs, gebürtiger Österreicher war, spielte eine untergeordnete Rolle. Und ebenso wie in Deutschland hatte es in Österreich schon seit einer Weile einen schwelenden Antisemitismus gegeben. Der Anschluss und das Erscheinen eines SS-Mannes im Café Mozart waren lediglich die letzten Beweise. Nun war es offiziell.
Die beiden Kellner setzten nichtssagende Mienen auf, zuckten mit den Schultern und sagten, sie hätten keine Ahnung, welcher ihrer Gäste jüdisch sei und welcher nicht.
„Kommen Sie“, erwiderte der SS-Mann, „das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Seit wann arbeiten Sie hier?“ Er dürfte höchstens Anfang dreißig gewesen sein, befleißigte sich jedoch der Strenge eines viel älteren Mannes und fixierte die beiden Kellner mit seinen blauen Augen. „Wenn Sie nicht ehrlich sind, könnte es für Sie schlimm ausgehen.“
Einer der Kellner wirkte nun unsicher und sah aus, als wollte er etwas sagen. In dem Augenblick meldete sich von hinten eine Stimme.
„Es ist absolut korrekt, wenn mein Personal Ihnen erklärt, dass es in dieser Hinsicht keine Ahnung hat.“ Es war Otto Karner, der Inhaber des Café Mozart, der dem SS-Mann nun mutig entgegentrat. „Auch ich könnte es Ihnen nicht sagen, und ich führe dieses Etablissement bereits seit neun Jahren.“
„Ist es nicht ein wenig nachlässig, nicht zu wissen, wer Ihre Gäste sind?“
„Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, die Herkunft unserer Gäste zu erforschen“, entgegnete Karner und lächelte schmallippig. „Wir bieten ihnen lediglich den besten Kaffee sowie die besten Torten und Mehlspeisen der Stadt.“
Der SS-Mann taxierte Karner so verächtlich, als könnte dieser selbst Jude sein, immerhin hatte Karner dunkles Haar – aber das war auch schon alles. Im Übrigen trug er einen Oberlippenbart à la Chaplin oder Hitler – ein solcher Bart war zurzeit Mode –, hatte eine Stupsnase und war beleibt wie ein Fleischer oder Opernsänger. In der Regel drückte seine Leibesfülle gegen einen silbergrauen oder weißen Leinenanzug, als führte Karner ein Café in Marokko oder Panama, nicht in Wien. Eine kleine schwarze oder marineblaue Fliege bildete den einzigen Kontrast zu dieser Bekleidung.
„Der Besitzer des Café Central hat gesagt, für ihn sei es kein Problem, uns seine jüdischen Gäste zu nennen.“ Um den Mund des SS-Mannes huschte etwas Gefährliches. „Warum wollen Sie es für sich schwierig machen, indem Sie sich widersetzen?“
„In Wien ist das Central Hitlers Lieblingscafé.“ Karner zuckte mit den Schultern. „Vielleicht will man dort einfach sichergehen, dass keine Juden anwesend sind, sollte der Führer das Café noch einmal mit seinem Besuch beehren. Oder man hat Ihnen das gesagt, was Sie hören wollten.“
Wie kühn Karner war. Ich nahm einen Schluck Kaffee, um mein Lächeln zu verbergen.
„Wie Sie wollen.“ Um die aufsteigende Zornesröte auf seinem Gesicht durch herrisches Gebaren wettzumachen, stieß der SS-Mann Karner mit der Hand zur Seite und warf sich in Positur, als wäre plötzlich er der Chef des Café Mozart. „Ich werde eine Ankündigung machen.“
Mit scharfem Blick nahm er die Gästeschar ins Visier und rief: „Alle mal herhören!“ Er wartete einen Moment, bis das sanfte Gemurmel der Gespräche und das Klappern des Bestecks verebbte. „Ich bin Heinrich Schnabel, Scharführer der österreichischen SS. Alle Juden in diesem Raum werden sich mir nun zu erkennen geben – ohne Ausnahme!“
Mir war, als wäre mir der nächste Schluck Kaffee auf dem Weg nach unten in der Kehle stecken geblieben. Angst packte mich, während Schnabels Blick das Café durchkämmte. Hatte er womöglich Fotos des Kreises gesehen und konnte uns herauspicken?
Seit fünf Jahren waren wir Mitglieder von Freuds Kreis, einer einzigartigen Zusammenkunft von Wissenschaftlern, Philosophen, Psychiatern, Mathematikern und Schriftstellern, die Sigmund Freud, Moritz Schlick und Edgar Zilsel Ende der Zwanzigerjahre ins Leben gerufen hatten. Unser Eintritt in diesen Kreis war über zwei Schienen erfolgt: meinen Onkel Samuel Namal, der Johannes’ Vater war und als einer der führenden Statistiker und reinen Mathematiker zum ursprünglichen Wiener Kreis gehört hatte, und Julian Reisner, der bei einigen Werken Freuds dessen Agent gewesen war. Bei dem letzten Treffen vor vier Tagen hatte Freud über die Sicherheit sowohl seiner Familie als auch der Mitglieder des Kreises gesprochen. Es ging um die Frage, ob sie und wir nach dem Anschluss überhaupt noch die Wahl hätten, Österreich zu verlassen. Ebenso hatte er hinsichtlich früherer Fotos der jüdischen Kreismitglieder Bedenken geäußert. Seine Sorge war, dass die Nationalsozialisten sie benutzen könnten, um jeden von uns zu identifizieren und aufzuspüren.
Ich warf Johannes einen Blick zu. Er suchte bei dem halb verzehrten Stück Schokoladentorte auf seinem Teller Zuflucht. Seine Kuchengabel spielte mit dem nächsten Bissen, ohne ihn zum Mund zu führen. Vielleicht hatte auch er Schluckbeschwerden.
Ich sah jüdischer aus als Johannes, hatte dunkelbraunes Haar und braune Augen. Johannes’ Haar war hellbraun, seine Augen grünlich-braun. Er hätte ohne Weiteres als österreichischer Katholik oder Protestant durchgehen können. Sein Vater, mein Onkel Samuel – der leider vor vier Jahren gestorben war –, hatte eine blonde, katholische Österreicherin geheiratet, die ihre Gene an Johannes weitergegeben hatte. Aufgrund unseres unterschiedlichen Aussehens wären nur wenige im Café auf die Idee gekommen, dass wir Verwandte waren.
Sekunden verstrichen und fühlten sich an wie ein ganzes Leben.
Einen Moment später setzte das Stimmengemurmel wieder ein, klang jedoch gekünstelt und unruhig.
„Was denn, niemand?“, rief Schnabel aufgebracht.
In Wien lebten gegenwärtig hundertneunzigtausend Juden, mehr als zehn Prozent der Stadtbevölkerung. Es schien kaum vorstellbar, dass in einem Café mit gut vierzig Gästen kein einziger Jude sein sollte. Schnabel holte Luft. „Vielleicht sollte ich Sie daran erinnern, dass wir zurzeit noch eine Amnestie gewähren. Die Juden, die sich mir zu erkennen geben, werde ich zwar pflichtgemäß namentlich notieren, doch mehr wird daraus nicht. Sollte aber jemand mit seiner jüdischen Identität hinter dem Berg halten, und das über die Amnestieperiode hinaus, wird es für denjenigen unerfreulich werden.“
Ich spürte, wie mein Mut sank, wünschte beinahe, ich selbst würde ebenfalls sinken, am besten durch den Fußboden, um unsichtbar zu werden. Würde dieser Scharführer Schnabel mich vielleicht irgendwann wiedererkennen und mir meinen Ungehorsam ankreiden?
„Niemand?“ Schnabel musterte die Gäste mit durchdringendem Blick und wirkte skeptisch, nein, ungläubig.
Während die nächsten Sekunden verstrichen, überlegte ich, ob ich aufzeigen sollte, um als eine Art Opferlamm alle anderen Gäste aus dieser unerträglich angespannten Atmosphäre zu erlösen. Immerhin hatte Schnabel erklärt, es werde nichts geschehen – mehr wird daraus nicht … Und dann war der Moment vorbei.
„Na schön. Sie hatten Ihre Chance.“ Schnabel wandte sich ab und durchquerte das Café. An der Tür drehte er sich noch einmal kurz um. „Sollte jemand seine Meinung ändern, kann er sich bis morgen um Mitternacht auf dem Karmelitermarkt melden – dann läuft die Amnestie aus. Und danach ist es zu spät.“
Sowie Schnabel verschwunden war, kam Otto Karner zu unserem Tisch spaziert und schnitt eine Grimasse. „Ich fürchte, der kommt wieder.“
Ich nickte beklommen. „Das fürchte ich auch. Was meinen Sie, kann man sich auf die Amnestie verlassen, die er erwähnt hat?“
„Nein. Sie können sich noch mal erkundigen, wenn Sie möchten, aber ich halte das für eine Falle und Augenwischerei. Denken Sie daran, wie es mit Hitler war. Erst vor zwei Jahren hat er in einer Rede verkündet, dass Deutschland nicht die Absicht habe, sich in die inneren Angelegenheiten Österreichs einzumischen, geschweige denn, unser Land zu annektieren. Und jetzt das!“ Karner machte eine hilflose Handbewegung.
„Wir rechnen also damit, dass Schnabel zurückkehrt“, sagte Johannes. „Meinen Sie nicht, dass es dann für uns hier noch brenzliger werden könnte? Und somit auch für Sie? Wäre es nicht besser, wir kämen nicht mehr?“
„Das meine ich ganz und gar nicht.“ Johannes’ Vorschlag schien Karner zu verärgern. „Falls Schnabel sich hier wieder blicken lässt, werde ich das Gleiche wie heute sagen und Sie schützen.“ Er lächelte schief. „Wie wir gerade erfahren haben, sind Sie hier weitaus besser aufgehoben als im Café Central, wo man Sie sofort entlarven würde, um den Führer glücklich zu machen. Bei mir sind Sie sicherer, es sei denn, Sie entscheiden sich, nie mehr außerhalb Ihres Hauses Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen …“ Karners Stimme versickerte. Er hatte die vielsagende Kopfgeste eines Kellners registriert.
Karner folgte dem Blick des Kellners hinaus zu Schnabel, der mit einem Paar an einem der Tische draußen sprach und dann durch die Fensterfront zu uns schaute.
Kapitel 2
»Juden werden nicht länger als Reichsbürger betrachtet. Sie sind weder berechtigt, an deutschen Reichstagswahlen, noch, an der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich teilzunehmen.«
Johannes
Während ich den Rest meines Abendessens verzehrte, das Hannah gekocht hatte, warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr.
„Schmeckt es dir?“, fragte Hannah.
In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich das Essen einfach hinuntergeschlungen hatte. Auf den letzten Bissen konzentrierte ich mich: Lammgulasch mit süßer Paprika und Kartoffeln. „Wunderbar – wie immer.“ Hannah war eine gute Köchin, doch ihr Repertoire beschränkte sich auf acht oder neun Gerichte, die sie regelmäßig rotieren ließ.
„Gut, Momma.“ Elena stimmte mir mit einem breiten Lächeln zu. Sie war unsere Jüngste, gerade mal vier Jahre alt. Als wir uns am Tisch niederließen, hatte Hannah das Lamm für sie in kleine Stücke gewürfelt. Elena hatte sich beschwert. „Ich bin kein Baby mehr – das musst du nicht tun.“
Stefan, unserer Ältester, war neun Jahre alt. Er lächelte nur und nickte. Nichts durfte das Mahl unterbrechen, das er mit Windeseile verputzte, jedoch nicht, weil er dringend fortmusste, sondern weil er es so köstlich fand.
Ich war in Gedanken schon halb bei dem Vorhaben, das ich früher am Tag mit Mathias erörtert hatte.
Wir hatten besprochen, einer von uns sollte sich näher über die „Amnestie“ informieren, die Scharführer Schnabel erwähnt hatte. Und dann hatten wir beschlossen, dass ich derjenige sein sollte, da ich weniger jüdisch aussah; wenn man es genau nehmen wollte, war ich nicht einmal jüdisch. Mein Vater war Jude gewesen, doch meine Mutter war Katholikin, und nach jüdischem Religionsgesetz gilt nur der als Jude, der Kind einer jüdischen Mutter ist. Das Problem war jedoch, dass mein Vater in Österreich eine bedeutende Persönlichkeit gewesen war, einer der führenden Statistiker und ein stolzes und bekennendes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, die die größte Opposition zu den Nationalsozialisten darstellte. Folglich würde man mich sowohl als „Halbjuden“ als auch als Aufwiegler betrachten.
Ich hatte meinen Vater einmal gefragt, ob seine Entscheidung, eine Nichtjüdin zu heiraten, mit seinem ebenfalls offenkundigen Atheismus zu tun gehabt habe – mein Vater machte nie halbe Sachen –, doch er lächelte nur milde. „Nein, deine Mutter war bloß das hübscheste Mädchen, das mir an der Uni begegnet ist. So einfach.“
Da ich in dieser Hinsicht ganz der Sohn meines Vaters war, der Apfel fällt schließlich nicht weit vom Stamm und so weiter, trat ich in seine Fußstapfen, als ich Hannah begegnete. Sie war so schön, die Farbe ihres Haars wie sonnengebleichter Weizen, die Augen ein reines Grün. Wie hätte ich ihr widerstehen können?
Dennoch hätte ich gern gewusst, ob im Unterbewusstsein meines Vaters noch etwas eine Rolle gespielt hatte – damals war ich nicht mutig genug, ihn danach zu fragen – und er seine Abstammung nur deshalb zur Hälfte auf seine Kinder übertragen hatte, um uns vor dem Stigma zu bewahren, mit dem Juden in Österreich seit den Zwanzigerjahren zunehmend konfrontiert wurden. Und dann tat ich das Gleiche, indem ich Hannah heiratete, wodurch ich dieses Stigma noch mehr verwässerte und meine Kinder noch sicherer machte.
Ich betrachtete meine perfekte österreichische Familie: Elenas Haar war beinahe so blond wie das ihrer Mutter. Stefan mit dem hellbraunen Haar und den haselnussbraunen Augen kam mehr nach mir. Mir war, als wäre es erst gestern gewesen, dass mein Vater die Kinder auf dem Schoß hatte oder sie stolz hochhob und liebevoll auf die Stirn küsste. Dabei ist es schon gut vier Jahre her, dass er im Alter von vierundsechzig Jahren dem Krebs erlag, der ihn aufgezehrt hatte.
Das Einzige, was mich über seinen Tod hinwegtröstete, war die Gewissheit, dass ihn der Irrsinn des Anschlusses und des nun hemmungslos gewordenen Nationalsozialismus in unserem Land ohnehin umgebracht hätte. Na schön, das war ein Widerspruch in sich. Es entlockte mir ein kleines Lächeln.
Um Hannah, die Kinder und mich zu verewigen, hatten wir vor einem Jahr eines jener klassischen Familienfotos in Sepia aufnehmen lassen. Inzwischen stand es auf unserer Anrichte ganz vorn: die perfekte österreichische Familie. Selbst der überzeugteste arische Nationalsozialist würde beim Anblick des Fotos sagen: „Ach, was für eine reizende Familie.“
Während Hannah noch dabei war, die Kinder zu Bett zu bringen, klingelte das Telefon. Mathias.
„Du bist noch nicht weg?“
„Nein, aber so gut wie. Ich wollte warten, bis es dunkel ist. Warum fragst du?“
Am anderen Ende atmete Mathias langsam aus. „Ich überlege, ob du wirklich hingehen sollst. Vielleicht hat Karner recht, und es ist eine Falle.“
„Das können wir erst wissen, wenn sich einer von uns schlau gemacht hat. Mir passiert schon nichts, ich werde mich als Beobachter im Hintergrund halten.“ Ich schlug einen unbeschwerten Ton an. „Außerdem sehe ich arischer aus als … als Hitler.“
Mathias gluckste. Das war alles, was uns geblieben war: der Versuch, diesen aufkommenden dunklen und bedrohlichen Sturm auf die leichte Schulter zu nehmen. „Pass auf dich auf“, sagte er. „Geh keine Risiken ein. Das sind Hitler und die Nazis nicht wert.“
Als ich im Flur meinen Mantel überstreifte und meinen Hut aufsetzte, kam Hannah und fragte: „Ist alles in Ordnung?“
„Alles bestens. Das war Mathias, mit dem ich gesprochen habe.“ Ich nahm an, dass Hannah von dem Gespräch nichts mitbekommen hatte. Sie war noch mit den Kindern zugange gewesen. Und warum sollte ich sie unnötig aufregen, wenn es doch um eine Lappalie ging?
„Mathias hat mich an die neue Schriftstellergruppe erinnert. Ich hatte ihm versprochen, mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Ich bleibe nicht lange – nicht länger als eine Stunde oder so.“ Ich lächelte beschwichtigend.
„Gut. Dann bis später.“
Doch als Hannah mein Lächeln erwiderte und sich zu mir vorbeugte, um mich zum Abschied zu küssen, schien sich unter diesen Gesten Beunruhigung zu verbergen. Und ich fragte mich, ob sie womöglich doch einen Teil meines Telefonats mit Mathias mitgehört hatte.
***
Die Bewohner des Karmeliterviertels von Wien waren überwiegend jüdisch. Der Markt stellte den Kern dieses Viertels dar, eine große, kopfsteingepflasterte Fläche, die in der Woche jedem Händler zur Verfügung stand. Die jüdischen Händler traf man hauptsächlich mittwochs und sonntags an. Doch stets bekam man eine bunte Vielfalt an Obst und Gemüse von den Bauernhöfen im Umland geboten, auch lebendes Geflügel in kleinen Käfigen und manchmal ein angebundenes ganzes Lamm. Die jüdischen Markttage erkannte man daran, dass es an diesen mehr eingelegten Fisch, Oliven und süße Leckereien wie Baklava und Halva gab.
Mein Vater hatte am Rand dieses Viertel gewohnt. Ich lebte mit meiner Familie einen guten Kilometer südwestlich davon. Es war, als hätte ich mich sowohl durch meine Heirat als auch geografisch von meiner jüdischen Herkunft distanzieren wollen.
Ich beschloss, den Weg zum Karmelitermarkt zu Fuß zurückzulegen. Es war besser, die Straßenbahnen und Busse zu meiden, dort hätte man meinen Ausweis verlangen können. Auch wenn ich streng genommen kein Jude war, handelte es sich bei „Namal“ um einen gebräuchlichen österreichisch-jüdischen Namen. Vielleicht würde sich dann einer an meinen Vater erinnern. Ach, der Sohn von Samuel Namal, dem bekannten jüdischen Sozialisten und Gegner der NSDAP. Ich kenne jemanden, der Ihnen gern ein paar Fragen stellen würde. Kommen Sie mit.
Je mehr ich mich dem Karmeliterviertel näherte, desto unbehaglicher wurde mir zumute. Wenigstens drei der Geschäfte, an denen ich vorbeiging, waren mit Brettern vernagelt. Soweit ich mich erinnern konnte, war das, als ich vor zwei Wochen hier war, nicht der Fall gewesen. Bei zwei weiteren Geschäften bot sich mir das gleiche Bild. Waren das jüdische Geschäfte gewesen? Auf dem Schild des letzten Ladens stand „Marx“. Zwei gelbe Striche führten durch den Namen zu einem gelben Judenstern, und schon hatte ich die Antwort. Ich schluckte. Die Dinge entwickelten sich doch um einiges schneller, als ich gedacht hatte.
Ich bog in die nächste Straße ein. Wieder waren zwei Geschäfte verbarrikadiert. Dann noch eines, knapp zwanzig Meter weiter auf der anderen Straßenseite. Dort hatte man einen Teil der Bretter wieder abgerissen und das Schaufenster dahinter eingeschlagen.
Vom Ende der Straße her drang Stimmengewirr. Der Markt war vielleicht noch fünfzig Meter entfernt und offenbar gut besucht. Ein Paar mittleren Alters kam mir mit eingezogenen Köpfen entgegen. Beide blickten starr geradeaus, sahen mich nicht an. Hinter ihnen erschienen in kurzer Distanz zwei Männer Anfang zwanzig. Sie warfen mir einen Blick zu, bevor sie an mir vorbeigingen.
Ich drehte mich kurz nach ihnen um. Folgten sie dem Paar? Plötzlich raschelte und bewegte sich etwas. Ich fuhr zusammen, und sofort schlug mir das Herz bis zum Hals. Es waren aber nur zwei Katzen, die einen Müllsack mit sich gezerrt hatten und nun davonflitzten. Für einen Moment schloss ich die Augen und wartete, bis mein Herzschlag sich wieder beruhigte. Ich hätte nicht kommen sollen. Vielleicht sollte ich umkehren, bevor es zu spät war.
Doch das Stimmengewirr und ein hell scheinendes Licht verlockten mich, weiterzugehen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.
An der Mauer, an der ich nun vorbeikam, war ein antifaschistischer Slogan hastig überpinselt worden. Offenbar hatte man dazu dieselbe gelbe Farbe wie für die Schmierereien bei dem Namen „Marx“ verwendet, doch inzwischen war sie schwächer geworden, sodass der Slogan durchschimmerte. Darüber war in fetter schwarzer Schrift „Amnestie-Treffen“ zu lesen, und ein Pfeil wies auf den Marktplatz.
Als sich der Platz vor mir öffnete, erschloss sich mir die Quelle des hellen Lichts. Es waren hohe Bogenlampen, die an jedem Ende eines großen Tapeziertisches standen. Über die Längsseite des Tischs zog sich ein Banner mit der Aufschrift „Amnestie-Treffen“.
Ich hielt mich zurück, so wie ich es Mathias versprochen hatte, blieb hinten auf dem Platz im Dunkeln und sah mir alles an. Es gab keine Marktstände, weder Obst, Gemüse, Oliven, Baklava und Halva noch Geflügel in kleinen Käfigen. Es gab nur den großen, angestrahlten Tisch. Hinter dem Tisch standen eine Handvoll Wehrmachtsoldaten und vor ihnen Zivilisten, bei denen es sich vermutlich um Juden handelte. Das Ganze machte einen überaus geordneten Eindruck.
Zwei der Wehrmachtsoldaten schienen persönliche Angaben der vor ihnen Stehenden aufzunehmen. Hin und wieder nickten sie. Dann stempelten sie ein Dokument, und der Nächste trat vor. Ich sah, dass die Juden, die ihre Dokumente hatten stempeln lassen, am Rand Grüppchen bildeten. Auch da waren Soldaten, schienen sich jedoch freundlich mit den Juden zu unterhalten – nirgendwo das Anzeichen eines Unbehagens oder eines Zwangs, geschweige denn einer Festnahme. Vielleicht hatte Schnabel doch die Wahrheit gesagt. In einer Ecke des Marktplatzes hatte eine Gruppe ein kleines Lagerfeuer entfacht. Zuerst dachte ich, die Leute wollten sich wärmen, dann fiel mir auf, dass einer eine Hakenkreuzfahne schwenkte, und ich erkannte, was sie ins Feuer warfen: nicht nur Brennholz, Pappe und Papier, sondern auch Bücher.
Ich näherte mich dem Feuer, wollte sehen, um wessen Bücher es sich handelte – Bernstein, Freud, Schnitzler, Remarque, Werfel, Zweig –, allesamt jüdische oder regimekritische Autoren!
Der Soldat, der dieser Gruppe am nächsten stand, rief: „Das sollt ihr doch bleiben lassen!“
„Wie sollen wir diesen jüdischen Hunden denn anders klarmachen, dass sie in Wien unerwünscht sind?“, brüllte einer zurück.
Nun verstand ich, was hier vor sich ging. Es hatte sich herumgesprochen, dass Juden auf dem Karmelitermarkt Amnestie gewährt wurde, und eine Nazigruppe war aufgetaucht, um die Juden einzuschüchtern.
Hauptmann, Einstein … Roth … Salten.
Als die Flammen über den Büchern höherschlugen, begriff ich, warum der Soldat gegen das Feuer gewesen war. Zwei Busse auf der anderen Seite des Marktplatzes, die bisher außerhalb des grellen Lichts der Bogenlampen in der Dunkelheit gestanden hatten, wurden durch die Flammen erhellt. In einem von ihnen klopfte eine alte Frau an die Fensterscheibe und deutete auf etwas auf dem Platz, als hätte sie dort etwas vergessen. Auch am Bus stand ein Soldat, der nun vehement den Kopf schüttelte. Es war, als wollte er sagen: Du bist im Bus, und raus kommst du nicht mehr.
Karner hatte recht gehabt. Es war eine Falle.
Ich zuckte zurück, nicht nur vor der Hitze der Flammen, sondern auch vor dem, was sie repräsentierten. Als ich wieder im Halbdunkel stand, fielen mir die nächsten Bücher auf, die ins Feuer geworfen wurden. Selbst wenn ich die Einbände nicht erkannt hätte, der Name des Autors prangte fett auf der Vorderseite. Mathias Kraemer. Und als eines der Bücher aufklappte, wurde das Bild auf dem Vorsatzblatt sichtbar: Mathias’ Schattenriss als moderner Sherlock Holmes.
Keines meiner Bücher wurde Opfer der Flammen, Gott sei Dank, aber ich war auch nicht einmal ansatzweise so berühmt wie mein Cousin. Wahrscheinlich war dies einer der seltenen Augenblicke, in denen ich froh war, keine größere Leserschaft zu besitzen. Ich verfolgte, wie sich die Seiten von Mathias’ Büchern aufrollten und Flammen aus ihnen hochzüngelten. So gebannt war ich, dass ich wohl länger als gedacht verharrte. Denn als ich aufsah, stand am anderen Ende des Tapeziertischs jemand, den ich kannte: Scharführer Heinrich Schnabel. Er schien mich im selben Moment zu entdecken und sich zu erinnern, wo er mich schon einmal gesehen hatte. Er hob die Hand zum Gruß.
Rasch wich ich weiter zurück und spürte, wie mich jemand mit eisernem Griff am Arm packte – ein SS-Mann wahrscheinlich, dem Schnabel ein Zeichen gegeben hatte – und tiefer in die Dunkelheit zerrte.
„Ein Genuss par excellence - mit ›The Vienna Writers - Sie schrieben um ihr Leben‹ gelingt J.C. Maetis Literatur mit Bestsellerpotenzial.“
„J. C. Maetis hat mit ›Vienna Writers‹ einen wendungsreichen, atmosphärisch dichten, packenden Page-Turner geschrieben, der den Leser bis zum Schluss nicht mehr loslässt.“
„Ein Buch, das man gelesen haben muss. In einer Reihe zu nennen mit dem ›Tätowierer von Auschwitz‹, inspiriert von Maetis eigener Familiengeschichte.“
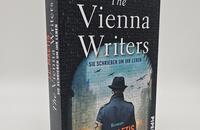





















Nach dem Anschluss Österreichs 1938 werden die Übergriffe der Nazis auf nicht arische Menschen immer schlimmer und gefährlicher. Auch die jüdischen Cousins Mathias Kramer und Johannes Namal samt ihrer Familien spüren die gefährlichen Auswirkungen. Beide als Schriftsteller bekannt und zum besonderen, aber gesuchten Kreis, bestehend aus Wissenschaftlern, Philosophen, Schriftstellern, Psychiatern und Mathematikern, des als aufrührerisch bezeichneten Sigmund Freud gehörend, müssen sie um ihre Sicherheit bangen. Durch ein gigantisches, raffiniertes Netz entscheiden sie sich für einen Identitätswechsel samt körperlicher Veränderungen, direkt vor den Augen der Feinde lebend, da es keine Alternativen gibt. Wäre da nicht der sadistische, machthungrige Scharführer Heinrich Schnabel, der immer einen Schritt voraus ist und sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Kreis auffliegen zu lassen. Ich habe jetzt schon einige Bücher über den Holocaust und die politischen Geschehnisse gelesen und bin mal wieder überrascht, eine völlig andere Seite kennengelernt zu haben. Dieser Roman des Thrillerautors John Matthews, der dieses Buch unter dem jüdischen Familiennamen seines Vaters und zum Gedenken zahlreicher Familienmitglieder, die dem Holocaust zum Opfer fielen, schrieb, zeigt eine neue Sichtweise auf die dunkle Epoche. Der Druck, die Herkunft verbergen zu müssen, weil die Sanktionen so einschneidend, demütigend und in den meisten Fällen mit dem Tod endeten, haben auch viele Familien zerrüttet und auseinandergerissen. Auch die Möglichkeit der Identitätsveränderung, um diesem Schicksal zu entgehen war für mich völlig neu. Man konnte die Angst der beiden Familienväter spüren, sowohl um die Familie als auch die eigene Sicherheit. Die Darstellung der Einschränkungen und die erniedrigende, widerwärtige Vorgehensweise hat mich innerlich viele Male zerrissen. Was hab ich mitgefiebert, mitgelitten und trotz der Unterstützung des hilfsbereiten Kommissars Josef Weber war es ein Katz und Maus Spiel. Abwechselnd wird aus der Sicht von Mathias und Johannes erzählt, zwischendurch auch aus der Beobachterperspektive über die Abläufe der SS, im Konzentrationslager Sobibór und dem Netz aus Helfern, die sich unter Lebensgefahr auf verschiedenste Weise für die Opfer eingesetzt haben. Jedes Kapitel wird mit einem Zitat Sigmund Freuds oder einem neuen gesetzlichen Erlass gegen andere Rassen eingeleitet. Die Geschichte beginnt langsam, gibt nach und nach Einblicke in die jeweiligen Familien, deren Verbindungen, die drohende Gefahr und nimmt immer mehr Fahrt auf. Mit etlichen unerwarteten Wendungen, Dramatik pur und Nervenkitzel schafft es der Autor, die Anspannung im weiteren Verlauf zu steigern, einen bis an die Grenzen zu katapultieren, wie eine nicht endende Achterbahnfahrt. Dabei werden Fragen nach der eigenen Courage aufgegriffen, was ist man bereit für seine Familie und das eigene Leben zu riskieren, wie bestechlich ist man und zeigt in verschiedenen sehr nahe gehenden Szenen die Menschlichkeit aber auch dem gegenüber die krasse Unmenschlichkeit auf. Man beginnt sogar, sich selbst dabei zu hinterfragen, wie man in bestimmten Situationen und der ganzen Ausweglosigkeit reagiert hätte. Das Buch muss man wirken lassen, es ist toll recherchiert und bietet eine weitere für mich neue Sichtweise auf dieses menschenunwürdige Geschehen unserer Geschichte. Ich habe vor Wut und Entsetzen aufgrund der ganzen Ungerechtigkeit und Vorgehensweise einige Male mit den Tränen gekämpft. Es mag vielleicht etwas nüchtern wirken und man muss sich etwas an die verschiedenen und neuen Namen gewöhnen, doch die Charakterzeichnung war eindrucksvoll, zeigt Schwächen, die schiere Verzweiflung, ebenso wie die Hoffnung auf den kleinsten Hauch des Überlebens und dem Drahtseilakt zwischen Vertrauen und Vorsicht. Ein ganz starkes Buch, gegen das Vergessen, für die Menschlichkeit und Nächstenliebe.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.