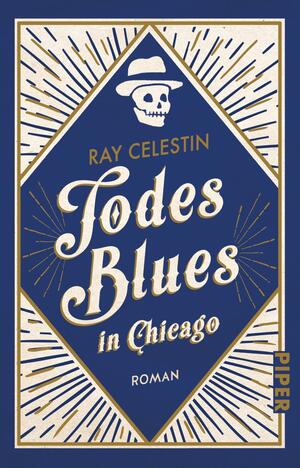
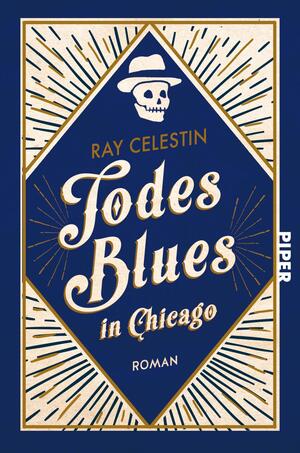
Todesblues in Chicago (City-Blues-Reihe 2) Todesblues in Chicago (City-Blues-Reihe 2) - eBook-Ausgabe
Roman
„Eine spannende Mischung aus Krimi, Zeitkolorit und Musik.“ - Recklinghäuser Zeitung
Todesblues in Chicago (City-Blues-Reihe 2) — Inhalt
Wenn Al Capone einen Auftrag erteilt, sollte man ihn lieber annehmen ...
Sommer 1928. Aus den Flüsterkneipen dringen neue Jazzklänge, während die Bewohner Chicagos vor Hitze fast wahnsinnig werden. Gleich drei Verbrechen halten die Stadt in Atem: die Entführung einer Fabrikantenerbin, der Gifttod mehrerer Mitglieder der High Society und ein Mord im Rotlichtviertel, dessen Opfer die Augen aus den Höhlen entfernt wurden. Die Pinkerton-Detektive Ida Davis und Michael Talbot ermitteln – und folgen einer gefährlichen Spur, die sie direkt in die Kreise des größten Mafiabosses aller Zeiten führt: Al Capone.
Leseprobe zu „Todesblues in Chicago (City-Blues-Reihe 2)“
Prolog
Kadenz
New Orleans, August 1922
Louis Armstrong hastete den Bahnsteig hinunter, denn der Panama Limited war schon angerollt, den Pappkoffer in der einen, den Kornettkasten und die Fahrkarte in der anderen Hand. Mit Letzterer winkte er dem Bahnsteigschaffner, doch der würdigte sie keines Blickes. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, über den jungen Mann zu lachen, der sich, pausbäckig, verschwitzt und mit Gepäck überladen, abmühte, an den Waggons mit der Aufschrift Nur für Weiße vorbeizulaufen, um zu denen zu gelangen, auf die er aufspringen [...]
Prolog
Kadenz
New Orleans, August 1922
Louis Armstrong hastete den Bahnsteig hinunter, denn der Panama Limited war schon angerollt, den Pappkoffer in der einen, den Kornettkasten und die Fahrkarte in der anderen Hand. Mit Letzterer winkte er dem Bahnsteigschaffner, doch der würdigte sie keines Blickes. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, über den jungen Mann zu lachen, der sich, pausbäckig, verschwitzt und mit Gepäck überladen, abmühte, an den Waggons mit der Aufschrift Nur für Weiße vorbeizulaufen, um zu denen zu gelangen, auf die er aufspringen konnte, ohne Prügel fürchten zu müssen.
Der Zug pfiff, und Louis verdoppelte seine Anstrengungen, flitzte an einem Gepäckstapel und an einem amüsiert dreinblickenden Gepäckträger vorbei, erreichte den ersten Waggon, der mit dem Hinweis Für Farbige beschriftet war, schleuderte seinen Koffer hinein, nahm die Fahrkarte zwischen die Lippen, packte den Handlauf und schwang sich in den Zug. Just in diesem Augenblick gab der Lokführer ordentlich Dampf auf die Zylinder, und der Zug rollte stampfend aus dem Bahnhof hinaus ins Freie, wo der südliche Himmel in Flammen zu stehen schien.
Erschöpft hockte sich Louis auf den Boden und blieb einen Moment sitzen, um wieder zu Atem zu kommen. Seine Lunge brannte von zu wenig Bewegung und zu vielen Zigaretten. Er kramte nach einem Taschentuch, wischte sich damit den Schweiß vom Gesicht, um einigermaßen präsentabel auszusehen, und machte sich dann auf den Weg in sein Abteil. Als er es gefunden hatte, musste er feststellen, dass es eng und überfüllt war, in Beschlag genommen von einer großen Frau und einer ganzen Brut kleiner Kinder, die sich auf den beiden nackten Brettern aneinanderdrängten, die als Sitze dienten. Louis bedachte die Frau mit einem Lächeln, und sie fuhr die Kinder an, ihm Platz zu machen. Er schwang seinen Koffer in das Sisalnetz über den Sitzen.
„Wie heißt du, Junge?“, fragte die Frau, als Louis sich in eine Ecke gezwängt hatte.
„Louis Armstrong, Ma’am.“
„Bist du Mayanns Sohn?“
„Ja.“
„Ich kenne deine Mutter seit Jahren.“ Ihr Tonfall deutete an, dass sie aus irgendeinem Grund stolz auf diese Tatsache war. „Wo fährst du hin?“
„Nach Chicago.“
„Wir auch. Hast du da Arbeit?“
„Ja, Ma’am. Ich spiele in Joe Olivers Band. Das zweite Kornett.“
„Joe Oliver?“, wiederholte die Frau und schob den Namen ein paar Sekunden in ihrem Gedächtnis hin und her, um zu schauen, ob er ihr etwas sagte. Dann zuckte sie die Achseln. „Na, dann wünsch ich dir viel Glück. Hast du schon was gegessen?“
„Nein, Ma’am.“
„Hast du was zu essen dabei?“
„Nein, Ma’am.“
Er hatte es so eilig gehabt, zum Bahnhof zu kommen, dass er keine Zeit gehabt hatte, sich irgendwo etwas zu kaufen. Die Frau sah ihn jetzt mit zusammengekniffenen Augen an. Der Zug hatte drei Speisewagen, einer servierte französische Gerichte à la carte, in einem anderen gab es eine Selbstbedienungstheke, und der dritte bot eine Auswahl kleiner Snacks, doch Schwarzen war in keinem von ihnen der Zutritt erlaubt. Die Frau machte „Ts, ts, ts“, dann rief sie dem ältesten Kind zu, es solle den Korb holen, und als das Kind ihn aus dem Netz gehievt und mitten im Abteil auf den Boden gestellt hatte, nahm sie das karierte Tuch herunter und verteilte Stücke von gebratenem Hühnchen und Wels, Maiskolben, panierte Okrabällchen, Maispfannkuchen und Limonadenflaschen. Kaum war er fünf Minuten aus New Orleans raus, hatte Louis schon das Gefühl, eine neue Familie gefunden zu haben.
Nachdem sie gegessen hatten, packten sie die Reste zurück in den Korb, und Louis spielte mit den Kindern, blickte aus dem Fenster, plauderte, rauchte, und dann schlief er ein, und der Tag wurde zur Nacht, und als er irgendwann aufwachte, sah er eine Galaxie von Stadtlichtern am Fenster vorbeifliegen, neonhelle Kleckse in der Dunkelheit, erahnte das dichte Gedränge unten auf den Straßen und dann das Summen der Natriumdampflampen in der Central Station an der 12th Street in Chicago.
Louis half der Frau aus dem Zug, und sie folgten dem Bahnsteig in die Bahnhofshalle. Er sah sich um, betrachtete die Menschen, bemerkte, wie schnell sie sich bewegten, wie sehr sie in Eile waren, wie elegant sie sich kleideten und wie schnittig, glatt und modern alles wirkte. Er fragte sich, ob er sich das alles einbildete, und drehte sich zum Zug um, zu den vielen Südstaatlern, die ihr Gepäck zusammenrafften, und der Unterschied sprang ihm förmlich ins Auge: die abgerissenen, altmodischen Kleider, die ramponierten Koffer, alles mit Armut überkrustet und mit dem Staub der Prärien des Südens.
Im Vergleich zu den Chicagoern sahen Louis’ Leute aus wie Flüchtlinge aus irgendeinem abgelegenen, Notleidenden Land, und in diesem Augenblick wurde ihm klar, dass seine Ansichten über seine Heimat in dieser neuen Umgebung auf eine harte Probe gestellt werden würden, dass es ein Kampf werden würde, sich von dem Kontrast nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Den Süden zu verlassen war schwer genug: Es waren schon Schwarze gelyncht worden, bloß weil man gesehen hatte, wie sie am Schalter standen und eine Zugfahrkarte nach Norden kauften. In dem Irrglauben, es würde Jagdhunde von ihrer Fährte abbringen, streuten Mütter Pfeffer in die Schuhe ihrer Kinder, wenn die eine solche Reise unternahmen. Doch jetzt spürte Louis, dass diesen Menschen ein weiterer Kampf bevorstand, der Kampf, sich einzufügen, sich nicht übervorteilen zu lassen und sich selbst in dem Bemühen darum nicht zu verlieren.
„Und du weißt auch bestimmt, wo du hinmusst?“, fragte die Frau.
„Sicher, Ma’am. Joe Oliver schickt jemanden, der mich abholt“, antwortete Louis.
So, wie die Frau ihn anstarrte, war sie wohl nicht recht überzeugt. Doch dann nickte sie, sammelte ihre Kinder ein und wünschte ihm viel Glück. Sie war kaum in der Menschenmenge verschwunden, da bereute Louis auch schon, dass er sie angelogen hatte. Er drehte sich um und nahm die Unermesslichkeit des Bahnhofs und der Stadt in sich auf und erinnerte sich an die Geschichten über Jazzmusiker, die New Orleans verlassen hatten und an seltsamen Orten gestrandet waren. Übers Ohr gehauen von Veranstaltern und Schallplattenproduzenten, ohne einen Freund und ohne einen einzigen Cent, mussten sie auf der Straße betteln, um sich eine Zugfahrkarte nach Hause zu kaufen.
Er schüttelte den Gedanken ab und sah sich nach einer Toilette um, um sich frisch zu machen, damit er die Reise annähernd mit einem Gefühl von Sauberkeit fortsetzen konnte. Er entdeckte ein Schild und folgte dem Pfeil zu einigen Marmorstufen, die zu zwei Türen hinunterführten, auf denen die gewohnten Symbole für Männer und Frauen waren. Doch er konnte keinen Hinweis darauf finden, ob die Toiletten für Weiße oder für Farbige waren, und so stand er zögernd eine Minute lang da.
„Junge, du siehst verlorener aus als eine Schneeflocke in der Hölle“, sagte eine Stimme hinter ihm, und als er sich umdrehte, stand da ein alter Schwarzer in der Uniform eines Bahnhofsgepäckträgers und grinste. Etwas an dem Verhalten und den Worten des Mannes verriet Louis, dass er so eine Situation schon öfter erlebt hatte, dass er öfter Neuankömmlingen aus dem Süden half, die von dem, was sie gerade erlebten, wie benommen waren.
„Wo kommst du her?“
„New Orleans.“
„New Orleans?“, wiederholte der Mann mit sauertöpfischer Miene. „Für New Orleans hab ich nicht viel übrig. Finde den Biergeruch unausstehlich.“
Louis war unsicher, was er von der Bemerkung halten sollte.
„Wohin musst du?“, fragte der Mann.
„Southside.“
„Alle Schwarzen, die aus diesen gottverdammten Zügen steigen, wollen nach Southside, Junge. Wo in Southside, das ist die Frage.“
„Ins Lincoln Gardens. Ich werde in Joe Olivers Band spielen.“
„King Oliver?“ Der Mann wurde plötzlich munter. „Bist du etwa der neue Kornettspieler, von dem alle reden?“
Louis runzelte die Stirn. Das konnte nur eine Verwechslung sein, denn seit wann wurde Papa Joe King genannt?
Der Gepäckträger führte ihn nach draußen, setzte ihn in ein Taxi und wies den Fahrer an, ihn direkt zum Lincoln Gardens Café zu bringen. Louis saß auf der Kante des Sitzes und sah die Stadt vorüberziehen. Sie fuhren aus dem Bahnhof, die State Street hinunter, an etwas vorbei, das aussah wie ein Rotlichtbezirk, und im Handumdrehen hatte Louis das Gefühl, dass sie im Herzen der Southside waren, dem Black Belt, der neuen Heimat des Jazz. Es war nach zehn, mitten in der Woche, und die Straßen waren so voll und belebt wie an einem Samstag in der Bourbon Street. Das Taxi fuhr an Jazzclubs und Bluesbars vorbei, an Chop-Suey-Läden und Billardsalons, Kinos und Varietés, hell erleuchtet von Neonreklamen in allen erdenklichen Farben, die grell in die Dunkelheit strahlten.
Sie fuhren unter Hochbahnen hindurch und an Straßenbahnen entlang, und in der Ferne leuchteten endlose Reihen von Wolkenkratzern in der Nacht, was Louis das Gefühl gab, die ganze Stadt würde auf einer Sternschnuppe reiten und vor Elektrizität, Chrom und Tempo nur so glühen. Von den Schwarzen, die in eleganten Anzügen und Kleidern durch die Straßen eilten, über den Verkehr und die vorbeirauschenden Züge bis hin zu den blinkenden Neonschildern – alles pulsierte vor unzähligen neuen Möglichkeiten.
Das Taxi bog links auf die 31st Street und setzte ihn vor dem Lincoln Gardens ab. Louis blickte an dem Gebäude hinauf und entdeckte das Schild über dem Eingang:
KING OLIVER UND SEINE CREOLE JAZZ BAND
Und dann hörte er den unverwechselbaren Klang des Kornetts seines alten Mentors, der durch die Mauern des Gebäudes drang und in der Straße aufstieg. Es war derselbe gefühlvolle Blues wie zu Hause, doch irgendwie anders. Louis brauchte einen Augenblick, bis er es verstand: Das Tempo war viel, viel schneller – genau wie die Menschen, die er durch die Straßen hatte eilen sehen, hatte die Musik etwas Hektisches, fast Halsbrecherisches, was exakt in diese Stadt passte.
„Das ist der neue Junge vom King“, rief der Taxifahrer einem Türsteher über den Straßenlärm hinweg zu und wies mit dem Daumen auf Louis. Der Türsteher war ein Riese, der trotz der Hitze einen Wollmantel mit Samtaufschlägen und Pelzkragen trug. Unter seinen neugierigen Blicken stieg Louis aus, und wieder schämte er sich wegen seiner Kleider und seines ramponierten Pappkoffers.
Er bezahlte den Fahrer, und als das Taxi davonpreschte, betrachtete Louis die Männer, die auf dem Bürgersteig hin und her gingen und Gin feilboten oder kleine Päckchen mit Marihuana, Heroin oder Kokain. In der Schlange vor dem Club entdeckte er etwas, was ihn innehalten ließ: Weiße. Eine Gruppe gelehrt aussehender, linkischer junger Männer, die scheu der Musik lauschten, als lauschten sie einem Gott.
Der Türsteher starrte Louis an und neigte den Kopf wenige Millimeter in Richtung Eingang. Louis ging an der Schlange vorbei nach vorn, der Riese riss die Tür auf, und da schlug ihm die Musik erst richtig entgegen, wie ein Güterzug, ohrenbetäubend laut und unerbittlich.
Sie gingen durch das Foyer auf die Tanzfläche, und Louis sah, dass sich dort Hunderte junger Schickimickis dicht gedrängt zu der schrägen Musik von Papa Joe verrenkten, dessen Horn knurrte und stöhnte und Klänge und Töne verzerrte. Der Saal dröhnte vor Jazz, in einem Strudel aus Lebensbejahung und Vergnügungssucht, aufgeputscht vom Hier und Jetzt. In diesem Augenblick blitzte in Louis eine Erkenntnis auf: Obwohl das Tempo ein anderes war, strömten diese blasierten Nordstaatler doch in Scharen hierher, um die Musik aus dem Süden zu hören, Musik aus New Orleans, seine Musik. Und er dachte an die zerlumpte Armee von Flüchtlingen, die am Bahnhof an der 12th Street aus dem Zug gestiegen war. Sie mochten arm sein, doch sie gaben der Stadt etwas, wonach diese sich sehnte, ja, was sie geradezu anbetete.
Da spielte ein Lächeln um seine Lippen. Er spürte, dass hier eine Art Austausch stattfand, zwischen Menschen aus verschiedenen Ecken des Landes, zwischen schnell und langsam, Schwarz und Weiß, alt und modern – etwas Neues und Wichtiges entstand hier in Chicago, und Louis grinste von einem Ohr zum andern, weil es so schön war und so bizarr.
Teil 1
Erster Chorus
„Wir leben in einer Zeit, in der ein Polizist besser zunächst mal ein paar Kugeln auf einen Mann abfeuert und ihm erst danach Fragen stellt. Es herrscht Krieg. Und im Krieg schießt man zuerst und redet dann.“
Detective William Shoemaker, Polizei Chicago, 1925
„Das einzige geltende Gesetz in Chicago ist das der Gewalt, ausgeübt von Ganoven und Mördern. Der schlechte Ruf von Chicago verbreitet sich in der ganzen Welt und bringt Schande über die Amerikaner, die wünschten, sie könnten stolz sein auf diese Stadt. Doch sie sind gezwungen, sich für Amerikas zweitgrößte Stadt zu entschuldigen und zu erklären, dass es ein seltsamer Ort ist.“
Washington Post, 1928
1
Chicago, Juni 1928
Tausende drängten sich in den Straßen, legten den Verkehr lahm und riegelten ganze Viertel ab. Der größte Teil des Tumults konzentrierte sich auf das Bestattungsinstitut Sbarbaro & Co. in der 708 North Wells Street. Unzählige Menschen standen auf der Straße und auf den Bürgersteigen um das Gebäude, andere säumten die Prozessionsstrecke, weitere bezogen Stellung an den Toren zum Mount Carmel, kletterten auf Laternenpfähle oder hängten sich an Markisen. In den oberen Etagen rückten Familien Stühle an die Fenster, sodass ein schwarzer Flaum von Trauernden wie Schimmel entlang der Dächer wuchs und die Vorgänge unten auf der Straße krönte.
Die Allerwenigsten hatten den Verstorbenen tatsächlich gekannt, einen hochrangigen Politiker, dem Verbindungen zur Mafia nachgesagt wurden. Seine Anzüge hatten besonders große Taschen gehabt, damit die dicken Geldbündel hineinpassten, und an Weihnachten hatte er Truthähne und Kohlen an die Armen verteilt, sogar an Schwarze. Und die Beisetzung eines Gangsters war ein großes Spektakel: Tausende in den Straßen, Berühmtheiten und Politiker, eine Parade aus Blumen und Luxuslimousinen, ein Sarg, der mehr kostete als die Häuser der meisten Menschen, Gangster, die sich an jedem anderen Tag gegenseitig kaltmachen würden, gingen Seite an Seite und respektierten den Waffenstillstand. Und so wurde die Zeremonie zu einem Ereignis: Chicago, die ruhelose Stadt, Dynamo, Heimat der Wolkenkratzer und der Fabriken, in denen rund um die Uhr gearbeitet wurde, hielt einzig und allein für die Beerdigung eines Gangsters inne.
In der Menschenmenge, die an diesem Morgen die Straßen säumte, ging ein Mann den Umstehenden besonders auf die Nerven, denn er drängte sich, wenn auch höflich, vorbei – Verzeihung … Entschuldigen Sie bitte, Ma’am … Ich störe Sie nur ungern … Dürfte ich … In einem möglichst geraden Kurs eilte er auf das Zentrum des Spinnennetzes zu, die Eingangstür von Judge John Sbarbaros Bestattungsinstitut. Die Menschen, an denen er sich vorbeischob, sahen ihn neugierig an und fragten sich, ob er eine Einladung zu der Zeremonie hatte. Er sah weder aus wie ein Gangster noch wie ein Politiker, und er besaß zwar das gute Aussehen eines Filmstars, doch niemand konnte sich an sein Gesicht von den Leinwänden im Uptown, Tivoli oder Norshore Theatre erinnern. Zudem war er nicht wirklich für eine Beerdigung gekleidet, sondern trug einen Sommeranzug aus buttermilchfarbenem Leinen, der zwar ein wenig zerknittert, aber makellos geschnitten war.
Der Mann, Dante Sanfelippo, war Anfang dreißig, mittelgroß und schlank, er hatte mediterrane Züge und eindrucksvolle Augen. Er trug eine lederne Reisetasche über einer Schulter, und er hatte das müde, leicht benommene Aussehen eines Reisenden, war er doch nur wenige Stunden zuvor aus dem Twentieth Century Limited – dem Nachtzug aus New York – gestiegen und hatte sich nach einem kurzen Halt im Metropole Hotel durch das Gedränge auf den Weg nach Norden gemacht.
In New York war Dante Alkoholschmuggler gewesen, Spieler, Schwarzbrenner, Drogenabhängiger, einer, der wusste, wie man Probleme löste – ein Mann mit vielen Bekannten und sehr wenigen Freunden. Aufgewachsen war er in Chicago, doch er war vor sechs Jahren aus der Stadt geflohen, und heute war er zum ersten Mal wieder in seiner Heimat; einer Stadt, die für ihn, wie er in den wenigen Stunden seit seiner Rückkehr begriffen hatte, jetzt nur noch eine Geisterstadt war.
Nachdem er sich noch ein paar Minuten durch das Gedränge gekämpft hatte, gelangte er schließlich an die Absperrung, die um den Block errichtet worden war, in dem das Bestattungsinstitut lag. Ganze Horden von Straßenkindern wurden gegen die Barrikaden gedrückt, Bengel, die den ganzen Tag Zeit gehabt hatten, sich eine Stelle zu suchen, von der aus sie einen Blick auf die legendären Gangster erhaschen konnten, deren Namen in der Stadt nur geflüstert wurden oder in Schüssen hallten. Für diese Kinder waren Capone, Moran, O’Banion und Genna gewissermaßen Adlige, die größten, glamourösesten Männer ihrer jeweiligen Viertel.
Dante musterte sie einen Augenblick, dann drehte er sich um, um über die Absperrung zu blicken, und war schockiert von dem, was er sah: Vor dem Gebäude erstreckte sich ein Meer blauer Blüten. Vom Asphalt war kein Zentimeter mehr zu sehen. Ein ganzer Gebäudeblock verschwand unter Kränzen, Gestecken und Sträußen. Die blaue Flut drang durch die Geländer zwischen den Ladenfronten, floss an Hydranten, Laternenpfosten und Mülleimern vorbei und schlug gegen Veranden und Mauern. Sämtliche blaue Blumen, deren man im Staat Illinois hatte habhaft werden können, waren zu zahllosen Achtungsbezeigungen arrangiert, deren Bestellung, Arrangement und Lieferung sicher Zehntausende Dollar gekostet hatte.
Dante stieß einen beeindruckten Pfiff aus, dann schaute er, ob es einen Weg durch das Blumenmeer gab, und nach einem Augenblick entdeckte er ihn: ein schmaler Streifen Pflastersteine, der zu den Eingangsstufen des Bestattungsinstituts führte, vor dem drei Bewaffnete in Anzügen mit ausdruckslosen Mienen Wache hielten. Mit einem Seufzer duckte Dante sich unter der Absperrung durch, und die Menschen keuchten auf, denn sie vermuteten, dass er unbefugt weiter vordrang, ein Irrer, einer mit Selbstmordgedanken.
Er warf sich die Tasche über die Schulter und schlenderte durch das Feld von Kornblumen, Glockenblumen und Vergissmeinnicht. Als er sich den Bewaffneten näherte, erstarrten sie; ihre nachlässige Haltung war verschwunden, ihre Hände fuhren in die Jacketts. Wenige Schritte vor den Stufen blieb Dante stehen und nickte.
„Ich bin hier, um Mr Capone zu sehen“, sagte er, und der Bewaffnete, der ihm am nächsten stand, musterte ihn eindringlich von oben bis unten.
„Er ist beschäftigt“, erwiderte der Mann, jedes Wort wie ein Hammerschlag.
„Sagen Sie ihm, Dante the Gent ist da.“
Bei der Erwähnung dieses Namens runzelte der Bewaffnete die Stirn, als hätte sich ihm gerade ein Geist vorgestellt, dann schien ihm etwas zu dämmern, und kurz darauf zeigte sich Besorgnis auf seinen Zügen. Er nickte einem seiner Kollegen zu, der seinerseits nickte und durch die Glastür im Bestattungsinstitut verschwand.
Dante schenkte den Wachmännern ein Lächeln und zündete sich eine Zigarette an. Plötzlich hörte er ein Dröhnen, und zusammen mit der Menschenmenge blickte er nach oben und entdeckte zwei Flugzeuge, die wie ein gellender Schrei in den Himmel schossen. Die Leute schnappten nach Luft, und die Menge wogte, als die Flugzeuge herabfegten; dann steuerten die Piloten ihre Maschinen wieder hinauf in Richtung Sonne und verschwanden in ihrem grellen Schein.
Dante richtete den Blick wieder auf die Erde, nahm den Hut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hoffte, dass der Bewaffnete bald zurück war und man ihn hineinließ, damit er aus der Hitze herauskam. Als er New York verließ, war er froh gewesen, der drückenden Hitze dort zu entgehen, doch es sah so aus, als wäre es in Chicago in diesem Sommer noch heißer.
Vor vier Tagen war Dante auf seinem Schmugglerschiff vor Long Island unterwegs gewesen. Seit dem Beginn der Prohibition hatte sich drei Meilen vor der Küste – gerade weit genug von ihr entfernt, um in internationalen Gewässern zu sein – eine Kette von Schiffen etabliert, die Alkohol verkauften. Unter dem Namen Rum Row – Schnapsstraße – reichte sie von Florida im Süden bis nach Maine im Norden, und der wichtigste Knotenpunkt in der ganzen Kette war die Rendezvous, zu der die Restaurant- und Kabarettbesitzer auf der Suche nach hochwertigem importiertem Alkohol jeden Abend mit ihren Schnellbooten von New York hinausfuhren.
Dantes Schiff gehörte zu der Flottille von Booten, aus denen die Rendezvous bestand, und er genoss den Ruf, den besten Alkohol von allen zu verkaufen. Er probierte persönlich jedes Fass – was angesichts der giftigen Brühen, die als Alkohol verkauft wurden, ein großes Risiko war. Dort, vor Long Island, mitten zwischen den schwimmenden Schnapsläden, hatte sich eines Nachts ein Motorboot genähert, und die Männer darauf hatten Dante informiert, sein alter Freund Mr Capone wünsche seine Anwesenheit in Chicago. In Windeseile waren Dantes Gedanken in die Stadt seiner Geburt geeilt, eine Stadt, die in Flammen stand, mit Unterweltmorden und Bombenanschlägen, ein Fanal städtischen Chaos, lodernd wie ein Sonnenuntergang über den Ebenen des Mittleren Westens. Er übergab seine Geschäfte in die Hände der beiden Männer, mit denen er sich das Boot teilte – einem grauhaarigen ehemaligen Krabbenfischer aus Florida und dessen Enkel –, packte seine Tasche und fuhr nach Chicago.
Als er vier Tage später vor dem Bestattungsinstitut Sbarbaro & Co. stand, hatte er immer noch keinen blassen Schimmer, was Capone von ihm wollte. Vor seiner Abreise hatte er in New York behutsam die Fühler ausgestreckt, um abzuschätzen, was dahintersteckte, doch das, was er erfahren hatte, war ihm nichts Neues – nach den Wahlen im Frühling hatte es nicht mehr so viele Bombenanschläge und Morde gegeben, Capone und Bugs Moran hatten ihren tödlichen Bandenkrieg eingestellt, die Stadt durfte auf einen Waffenstillstand hoffen, auch wenn sie immer noch aufgeteilt war zwischen den beiden Männern, deren Armeen in Bereitschaft standen. Und jetzt war Dante von einem Kommando, vor dem er sich unmöglich drücken konnte, mitten hineingezogen worden.
Während er darüber nachdachte, ging die Tür zum Bestattungsinstitut auf, der Bewaffnete kam heraus, nickte seinem Kollegen zu, und der richtete den Blick auf Dante.
„Mr Capone wird Sie jetzt empfangen.“
2
Ida Davis stand am Fenster ihres Büros im achten Stock des Gebäudes der Pinkerton National Detective Agency und versuchte einen Hauch der lauen Brise zu erhaschen, die von draußen hereinwehte. Ein dünner Schweißfilm kribbelte auf der Haut zwischen ihren Schulterblättern und drohte den Rücken hinunterzurinnen und die Baumwolle ihrer Bluse zu durchtränken. Die Sonne war erst vor wenigen Stunden über den Horizont gestiegen, doch schon jetzt war der Himmel seidig vor Hitze, die Stadt schmorte und musste einen weiteren Tag der endlosen Hitzewelle erdulden, die sich durch den Sommer zog.
Weit unten auf der Straße kroch der morgendliche Verkehr vorbei. Sonnenschein funkelte auf Trittbrettern und Kühlergrills, und selbst der Asphalt strahlte unerbittlich, ein Band aus Licht, das sich in beide Richtungen erstreckte und so grell war, dass Ida die Augen zusammenkneifen musste.
An der gegenüberliegenden Ecke schrie eine obdachlose Schwarze mit kratziger, müder Stimme, die unnatürliche Hitze des Sommers sei der Anfang vom Ende der Zeiten, Chicago – das moderne Gomorrha, Stadt der bösen und gierigen Männer – werde unter der feurigen Klinge des Erzengels Gabriel brennen. Auf dem Bürgersteig näherten sich ihr zwei Streifenpolizisten, die Hände auf den Knüppeln, die Schultern hochgezogen wie Boxer.
Ida schloss kurz die Augen und wünschte sich ein Ende der Hitzeperiode herbei, die Kühle des Herbstes, das blaue Licht des Winters. Irgendwo hörte sie eine Kirchenglocke neun Uhr schlagen, leise gegen das Dröhnen der Stadt. Seit fast zehn Jahren lebte sie jetzt in Chicago, doch an den unablässigen Lärm der Metropole, an ihr unheimliches Knurren, konnte sie sich einfach nicht gewöhnen.
Dann hörte sie aus der Ferne ein mechanisches Wimmern, und als sie den Blick hob, entdeckte Ida zwei Flugzeuge, die durch den Himmel schossen wie ein Paar stählerner Turteltauben. Mit gerunzelter Stirn beobachtete Ida sie einen Augenblick lang, dann schaute sie wieder nach unten, um zu sehen, was aus der Prophetin mit der heiseren Stimme geworden war, doch sie konnte weder die Frau noch die Polizisten erkennen, nur den unaufhaltsamen Strom der Fußgänger auf den Bürgersteigen, den Verkehr, der seine schmutzigen Abgase in die Luft spie, wo sie herumwirbelten, in der Hitze schimmerten und den Blick verzerrten.
„Alles in Ordnung?“, fragte eine Stimme aus dem Büro.
Ida drehte sich um. Michael saß an seinem Tisch und hatte den Blick von seinen Papieren gehoben.
Sie nickte. „Ich atme nur ein paar Autoabgase ein.“
Michael lächelte. Es klopfte an der Tür, und die beiden richteten sich auf.
„Mrs Van Haren“, erklärte die Empfangsdame, die den Kopf zur Tür hereingesteckt hatte. Sie zog sich zurück, und eine große, dünne Frau mittleren Alters betrat das Büro. Sie trug ein stahlgraues Kostüm, das an ihr hing, als hätte sie in letzter Zeit abgenommen, als hätte sie getrauert. Auf ihrem Kopf saß ein Glockenhut, an dem eine Pfauenfeder steckte, und als sie näher kam, wippte die Feder fröhlich im Rhythmus ihrer Schritte – ein seltsamer Kontrast zu ihrem ernsten Auftreten.
„Mrs Van Haren.“ Michael stand auf und wies mit der Hand auf die beiden Stühle ihm gegenüber.
Die Frau setzte sich auf einen Stuhl, und Ida nahm auf dem anderen Platz, und als sie saßen, sahen die drei sich verlegen an.
„Ich bin Michael Talbot, und dies ist meine Kollegin, Ida Davis“, sagte Michael, und die Frau betrachtete die beiden. Dann zog ein verwirrtes Lächeln über ihr Gesicht. Ida kannte diesen Ausdruck; die Frau wusste nicht recht, wie sie sich verhalten sollte. Vermutlich hatte sie noch nie mit so sonderbaren Personen wie Detektiven verkehrt, besonders nicht mit solchen, die auch noch ein so ungewöhnliches Paar abgaben wie Michael und Ida.
„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen“, sagte die Frau mit einer Stimme, die so formell war wie ihre äußere Erscheinung. „Stört es Sie, wenn ich rauche?“
Michael schüttelte den Kopf. Als Mrs Van Haren ein Zigarettenetui aus ihrer Handtasche holte, betrachtete Ida die Platinringe und die manikürten Fingernägel der Frau. Mit zitternder Hand zündete sie sich die Zigarette an und zog kräftig daran. Sie hatte etwas Kaltes an sich, etwas Selbstsicheres und Strenges, eine äußerliche Härte, mit der sie ihre Nervosität zu überspielen versuchte.
Als sie am Tag zuvor erfahren hatten, dass eine gewisse Mrs Van Haren einen Termin bei ihnen ausgemacht hatte, hatte Ida ein wenig nachgeforscht und herausgefunden, dass sie zu den Van Harens gehörte – einer der vornehmsten Familien Chicagos und bis vor Kurzem auch einer der reichsten. Die Handelsblätter sprachen davon, dass die Familiengeschäfte schlecht geführt wurden, von sinkenden Aktiengewinnen war zu lesen, Gewinnwarnungen, nervösen Anlegern. Die Gesellschaftsseiten berichteten von der Verlobung der Familienerbin mit einem gewissen Charles Coulton junior, einem Mann aus einer Familie von größerem Wohlstand. Dass dieser Wohlstand noch recht jungen Datums war, war wohl der Grund, warum die Artikel, die Ida gelesen hatte, durchsetzt waren von Hohn und Snobismus.
„Sind Sie die Detektive, die die Brandt-Entführung aufgeklärt haben?“, fragte Mrs Van Haren, und Michael nickte.
„Und den Goldraub in der First National?“, fuhr sie fort, und wieder nickte Michael. Sie hatten im Laufe der Jahre in Chicago auch noch Dutzende anderer Fälle aufgeklärt – Erpressungen, Diebstähle, Morde, Raubüberfälle –, von denen die meisten, sehr zu Idas Erleichterung, nie in die Zeitung gelangt waren. Die Frau hatte wohl jemanden nach den besten Detektiven in Chicago gefragt, und man hatte sie an sie verwiesen. Und jetzt versuchte sie die beiden merkwürdigen Südstaatler, zwischen denen sie saß, mit dem Bild in Einklang zu bringen, das sie sich nach der Lektüre der Zeitungsberichte von ihnen gemacht hatte.
Michael – der echte, nicht der aus ihren Fantasien – war etwas über fünfzig Jahre alt und genauso groß und dünn wie Mrs Van Haren. Sein Gesicht war von Pockennarben schwer gezeichnet, wodurch er in einem bestimmten Licht ein wenig gruselig aussah, in anderem Licht bedauernswert, doch es hatte den Vorteil, dass es ihm etwas seltsam Altersloses gab. Ida war achtundzwanzig und außergewöhnlich schön, wenn auch ein wenig unbeholfen – das wesentliche Merkmal der jungen Frau war, dass sie eine so hellhäutige Schwarze war, dass sie leicht als Weiße durchging. Den größten Teil ihres Lebens hatte sie sich deswegen wie eine Außenseiterin gefühlt. Die beiden sprachen mit dem Akzent von New Orleans, dessen fließender Rhythmus sie als Immigranten aus dieser dunklen Stadt am anderen Ende des Mississippi kennzeichnete. Sie waren auf demselben Fluss nach Chicago gekommen, der vor ihnen Voodoo und Jazz, Choleraepidemien und Zehntausende Arme aus dem Süden gebracht hatte.
Ida begegnete dem Blick der Frau, als dieser über sie strich. Sie lächelte, und die Frau erwiderte ihr Lächeln mit einiger Anstrengung, bevor sie noch einmal kräftig an ihrer Zigarette zog und der graue Rauch vor ihrem grauen Kleid vorüberstrich. Normalerweise fühlte Ida sich in der Gegenwart von Menschen, die reich zur Welt gekommen waren, nicht besonders wohl; ihrer Erfahrung nach lauerte hinter der Vornehmheit stets Verachtung, ein Gefühl berechtigter Ansprüche, ein selbstbewusster Glaube daran, dass die Welt für sie reserviert war. Doch bei dieser Frau war sie sich da nicht so sicher.
„Meine Tochter ist verschwunden“, sagte Mrs Van Haren schließlich, ein Zittern in der Stimme.
„Wann?“, fragte Michael.
„Vor drei Wochen.“
„Und die Polizei?“
„Die ist bis jetzt mit der Suche keinen Schritt vorangekommen, und so, wie ich die Polizei in dieser Stadt kenne, habe ich meine Zweifel, dass sie das je wird.“
Michael und Ida tauschten einen Blick. Mit Inkompetenz und Faulheit seitens der Polizei war in Chicago zu rechnen – aber nicht, wenn es um eine Familie wie die Van Harens ging.
„Wo wurde sie das letzte Mal gesehen?“, fragte Ida.
„Marshall Field’s. Einer unserer Chauffeure hat sie vor dem Kaufhaus abgesetzt; das war das letzte Mal, dass jemand sie gesehen hat.“
„Hat sie sich in den Tagen vor ihrem Verschwinden irgendwie anders verhalten?“, fragte Michael.
„Nein, Mr Talbot“, sagte die Frau. „Sie war weder unglücklich noch gereizt, noch ängstlich.“
Ida dachte daran, was sie am Tag zuvor in den Gesellschaftsseiten gelesen hatte. Den Artikeln zufolge schien die Tochter ihre Zeit aufzuteilen zwischen den üblichen High-Society-Veranstaltungen und Wohltätigkeitsarbeit, langen Schichten im Jane Addams House und bei einer Initiative in Hyde Park, die junge Schwarze aus der Southside unterstützte.
Auf den Fotos hatte Ida etwas Merkwürdiges entdeckt – es hatte mit der Kleidung der vermissten Tochter zu tun –, was für sie nun die Frage aufwarf, ob Mrs Van Haren bezüglich ihres Verschwindens die Wahrheit sagte.
„Meine Tochter sollte bald heiraten“, fuhr die Frau fort. „Und das ist vielleicht das Seltsamste an der ganzen Sache: Ihr Verlobter ist ebenfalls verschwunden.“
„Glauben Sie, sie sind zusammen weggelaufen?“, fragte Michael.
Mrs Van Haren schüttelte den Kopf.
„Wir sind mit der Verbindung einverstanden. Die Hochzeit sollte einer der Höhepunkte des Sommers werden. Und wenige Wochen vor dem Fest verschwinden die beiden. An verschiedenen Orten. Am selben Tag.“
„Und der Verlobte?“
„Wird ebenfalls noch immer vermisst“, antwortete sie ausdruckslos und richtete den Blick auf die Zigarette in ihrer Hand. „Ich bin es eine Million Mal durchgegangen. Wenn es eine Entführung war, warum gibt es dann keine Lösegeldforderung? Wenn sie im Krankenhaus oder, Gott behüte, einem Leichenschauhaus geendet wäre, warum wurde sie dort nicht erkannt? Wenn sie erpresst wurde, warum hat sie uns dann nicht um Geld gebeten? Wenn sie mit einem Liebhaber durchgebrannt ist, warum ist ihr Verlobter dann ebenfalls verschwunden? Es ergibt einfach keinen Sinn. Wie kann eine der reichsten, schönsten jungen Frauen in der Stadt mitten am Tag auf einem Bürgersteig verschwinden?“
Mrs Van Haren sah sie an, als hätte sie ihnen eine Denksportaufgabe vorgelegt, eine Frage aus einem Kreuzworträtsel, das sie in den Wahnsinn trieb.
„Das ergibt einfach keinen Sinn“, wiederholte sie verzweifelt. Sie murmelte etwas, dann fing sie an zu zittern, und Ida sah, dass das Eis brach. Einen Augenblick später begann sie zu weinen, und ihr graues Gesicht rötete sich. Sie holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche, mehr um sich dahinter zu verstecken, als um die Tränen fortzuwischen, und Ida beugte sich vor und legte ihr den Arm um die Schultern. Die Frau bebte am ganzen Körper.
„Gwendolyn ist mein einziges Kind“, fuhr sie fort. „Können Sie sich vorstellen, wie schrecklich es ist, nicht zu wissen, was ihr zugestoßen ist?“
Sie öffnete ihre Handtasche, holte ein Foto heraus und reichte es Ida. Es war eine Studioaufnahme von einer Frau Anfang zwanzig, die vor einem blumenbedruckten Paravent saß. Sie trug ein Kleid aus bedrucktem Crêpe, das Haar zu einer Welle frisiert und mit Perlen besetzt. Ida erkannte die junge Frau von den Gesellschaftsseiten der Zeitungen. Gwendolyn Van Haren war umwerfend schön – eine elegante Schönheit, die in den hohen Wangenknochen und dem offenen Blick einen Hauch von Kraft verriet.
Sie schob das Foto zu Michael hinüber, der es einige Sekunden lang betrachtete und dann die Zeigefinger zusammenlegte. Ida, die das Zeichen erkannte, nickte ihm zu.
„Wir werden uns um das Verschwinden Ihrer Tochter kümmern“, sagte er, woraufhin Mrs Van Haren ihn sehr lange ansah, fast ein wenig ungläubig. Dann zog ein Lächeln über ihr Gesicht, ein mattes Lächeln, das wenig Übung verriet, unsicher auf den Füßen, ein Lächeln, mit dem sie Idas Mitgefühl gewann, allein deswegen, weil es so viel Mühe hatte, überhaupt zustande zu kommen.
„Vielen Dank, Mr Talbot, Miss Davis.“ Ihre Stimme hatte jetzt einen warmen, hoffnungsvollen Klang. „Vielen Dank.“
Sie schniefte und tupfte noch einmal ihre Tränen fort, und die Pfauenfeder auf ihrem Hut hüpfte fröhlich dazu. Ida hob den Blick, und das Auge in der Mitte der Feder schien sie vorwurfsvoll anzustarren.
„Darf ich fragen, wo Ihr Mann ist?“, fragte Michael.
„Er ist fort, im Westen, um sich um seine Geschäfte zu kümmern“, antwortete sie steif.
Ida fragte sich, was sie damit meinte. Die Familie hatte ihr Geld mit Eisenbahnen gemacht und war daran beteiligt gewesen, Chicago als wichtigsten Verkehrsknotenpunkt des Landes zu etablieren. Doch inzwischen steckten die Van Harens ihr Geld nur noch in Investitionen – und in schlechte obendrein –, sodass Ida sich fragte, welche Geschäfte für einen Mann wichtiger sein konnten als die Aufgabe, seine Tochter zu finden und seine aufgelöste Frau zu trösten.
„Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?“, fragte Mrs Van Haren.
„Wir schauen, was sich aus den Polizeiberichten ergibt, und machen von da aus weiter.“
„Sie konsultieren die Polizei in dieser Angelegenheit?“ Zum ersten Mal lag Schärfe in der Stimme der Frau, und das Taschentuch in ihrer Hand zitterte noch ein wenig mehr.
„Wir haben Freunde bei der Polizei“, sagte Michael, indem er einen möglichst vagen Begriff für das Heer von korrupten Polizisten benutzte, mit denen die Agentur Vereinbarungen hatte. „Ich bin mir sicher, dass sie unter den gegebenen Umständen bereit sind, uns Zugang zu den Fallakten zu gewähren.“
Er lächelte, und Mrs Van Haren lächelte unsicher zurück.
„Ich möchte Sie um allergrößte Diskretion bitten“, sagte sie. „Die Polizei hat, bei all ihren Unzulänglichkeiten, bisher doch den Mund gehalten.“
„Alle Mandanteninformationen sind vertraulich“, sagte Michael, und Mrs Van Haren nickte.
„Nachdem uns klar geworden war, dass sie verschwunden ist“, sagte sie, „haben wir – also mein Mann und ich – eine Belohnung auf ihre sichere Rückkehr ausgesetzt. Fünfzigtausend Dollar. Wir wollten uns damit an die Presse wenden, aber die Polizei war dagegen. Dieses Geld ist immer noch für denjenigen bestimmt, der meine Tochter findet, auch für Sie. Ich muss wissen, was ihr zugestoßen ist“, sagte sie, und ihre Stimme hatte wieder etwas Flehentliches. „Ich muss wissen, wo sie ist.“
„Das ist ein großzügiges Angebot, Mrs Van Haren“, sagte Michael, „aber es ist gegen die Firmenpolitik, solche Anreize anzunehmen.“
Sie nickte und kramte in ihrer Handtasche nach einer weiteren Zigarette.
Nachdem Ida und Michael noch ein paar Fakten abgefragt hatten, standen alle drei ein paar Minuten später auf, um sich zu verabschieden, und Mrs Van Haren ging hinaus. Ihr Gesicht war wieder aschgrau, und die Feder tanzte entschlossen auf ihrem Hut.
„Was meinst du?“, fragte Michael, nachdem sie fort war.
„Sie verheimlicht etwas“, sagte Ida. „Und ich vermute, dass die fünfzigtausend, von denen sie sprach, als Schweigegeld gedacht sind. Sie will nicht, dass wir die Polizei hinzuziehen, und ihr Mann ist verdächtig abwesend.“
„Genau wie der Verlobte.“
Ida nickte und trat ans Fenster, um noch eine frische Brise zu erhaschen. Sie dachte wieder an die Fotos von Gwendolyn Van Haren, die sie in den Zeitschriften gesehen hatte und die nicht zu der Geschichte passten, die ihre Mutter erzählt hatte. Sie blickte kurz aus dem Fenster und war froh, als sie sah, dass die wohnungslose Frau wieder an der Straßenecke stand und über das Öffnen der sieben Siegel, den Thron Gottes und die verwüstete Erde räsonierte.
Ida drehte sich um, setzte sich auf die Fensterbank und sah Michael an.
„Wie kann sich eine von Chicagos berühmtesten Erbinnen einfach so in Luft auflösen?“
„Ich weiß es nicht“, sagte Michael. „Finden wir es heraus.“
„Hochspannend ist dieser Roman, der authentisch in das von Korruption und Gangstertum gepeinigte Chicago entführt. … dieses Buch lohnt sich.“
„spannend konstruierte Story.“
„Eine spannende Mischung aus Krimi, Zeitkolorit und Musik.“
„›Todesblues in Chicago‹ gehört zu den absoluten Krimihighlights dieses Jahres. ... Vor dieser Meisterleistung eines Ausnahmetalents unter Großbritanniens Schriftstellern kann man nur den Hut ziehen. Chapeau!“
„Ray Celestin nimmt sich viel Zeit dafür, die damalige Zeit in Worte zu fassen und lässt uns in die 20er Jahre reisen, indem er auf fast schon meisterhafte Weise reelle Ereignisse und Personen mit fiktiver Handlung verknüpft.“

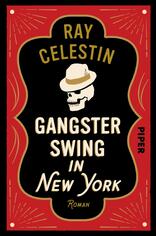










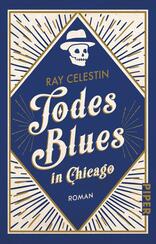
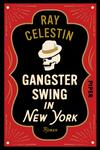


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.