

Tödliche Geliebte (Alexander-Gerlach-Reihe 11) Tödliche Geliebte (Alexander-Gerlach-Reihe 11) - eBook-Ausgabe
Ein Fall für Alexander Gerlach
„Gerlach ist der sympathischste Beamte, den je ein Autor erfunden hat!“ - Rhein-Neckar-Zeitung
Tödliche Geliebte (Alexander-Gerlach-Reihe 11) — Inhalt
Kripochef Alexander Gerlach – verständnisvoll und knallhart
Ein neuer Fall stellt Kripochef Alexander Gerlach vor ein Rätsel: Ein junger Wissenschaftler wurde erschossen. Der Täter scheint Feuer gelegt zu haben, doch der Brand wurde kurz darauf im Keim erstickt. Wie passt das zusammen? Und was hat es mit der scheuen Freundin des Toten auf sich, die plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist? Ist sie die Täterin? Als Gerlach beginnt, nach ihr zu suchen, sticht er in ein Wespennest. Offenbar ist nicht nur die Polizei hinter ihr her …
„Gerlach ist der sympathischste Beamte, den je ein Autor erfunden hat!“ Rhein-Neckar-Zeitung
Preisgekrönte Spannung in Krimiserie!
Mit „Heidelberger Requiem“ legte Wolfgang Burger 2005 ein fulminantes Krimi-Debüt vor, das sich aus dem Stand zur neuen Obsession der Fans des Ermittlerkrimis mauserte. Seine Bücher waren bereits mehrfach für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, so auch der achtzehnte Band „Am Ende des Zorns“.
Leseprobe zu „Tödliche Geliebte (Alexander-Gerlach-Reihe 11)“
1
Was, um Himmels willen, tat ich hier? Hatte ich den ersten schönen Früh-lingsabend des Jahres nicht genießen wollen? Meinem winterträgen Kör-per endlich wieder ein wenig Bewegung und frische Luft verschaffen? Mich später für meine Charakterstärke vielleicht mit einem Bierchen im letzten Abendlicht auf einer gemütlichen Terrasse belohnen?
Stattdessen stand ich vor der schäbigen Tür einer tristen Dachge-schosswohnung und telefonierte nach der Feuerwehr, obwohl es nicht einmal brannte.
Als frostklarer Montagmorgen mit blitzsauberem Himmel hatte der zehnte [...]
1
Was, um Himmels willen, tat ich hier? Hatte ich den ersten schönen Früh-lingsabend des Jahres nicht genießen wollen? Meinem winterträgen Kör-per endlich wieder ein wenig Bewegung und frische Luft verschaffen? Mich später für meine Charakterstärke vielleicht mit einem Bierchen im letzten Abendlicht auf einer gemütlichen Terrasse belohnen?
Stattdessen stand ich vor der schäbigen Tür einer tristen Dachge-schosswohnung und telefonierte nach der Feuerwehr, obwohl es nicht einmal brannte.
Als frostklarer Montagmorgen mit blitzsauberem Himmel hatte der zehnte März begonnen. Im Büro hatten mich weder schlechte Nachrichten noch neue verzwickte Fälle erwartet. Keine unangenehmen Termine trübten meinen Tagesablauf, und die Leitende Oberstaatsanwältin Frau Dr. Steinbeißer hatte mich bei unserer nachmittäglichen Routinebesprechung sogar gelobt. Die Frühlingssonne hörte nicht auf zu strahlen, warm und wärmer war es im Lauf des Tages geworden, und so hatte ich mich schon um halb fünf verkrümelt, um den ersten milden Abend des Jahres für private Zwecke zu nutzen.
Auf den Straßen herrschte auch um diese Uhrzeit noch farbenfrohes Treiben, mutige junge Damen zeigten wieder Bein, und die Vögel in den noch blattlosen Bäumen zwitscherten, tschilpten und sangen ihre Lebens-freude heraus. Noch am Schreibtisch hatte ich beschlossen, dass die Zeit der Faulheit nun definitiv zu Ende sei. Heute würde ich endlich beginnen, meinen Winterspeck zu bekämpfen.
„Herr Gerlach!“, hörte ich eine aufgeregte Frauenstimme von der an-deren Straßenseite rufen, wenige Schritte bevor ich das Haus erreichte, in dem ich mit meinen Töchtern zusammen lebte. „Wie gut, dass ich Sie treffe!“
Mein erster Impuls war, mich taub zu stellen. Die Stimme der Frau klang nicht, als hätte sie Erfreuliches zu erzählen. Aber dann blieb ich doch stehen und wandte mich um. Schließlich war man ein deutscher Beamter.
Die Ruferin kam eilig über die Straße gehumpelt. Sie war frühlingsbunt gekleidet, schon weit über sechzig, hatte aber noch beneidenswert volles, lockiges Haar. Ihr von der Anstrengung und vielleicht auch Aufregung gerötetes Gesicht war noch fast faltenfrei, stellte ich fest, als sie näher kam.
„Verzeihen Sie“, keuchte sie und streckte mir ihre schmale, kühle Rechte entgegen. „Verzeihen Sie, dass ich Sie so einfach auf der Straße überfalle. Aber bevor ich die Polizei anrufe, habe ich gedacht, und wo Sie ja praktischerweise mein Nachbar sind, da darf ich vielleicht ausnahms-weise …“
„Worum geht es denn?“, fragte ich nicht übermäßig freundlich.
Sie atmete tief durch.
„In unserem Haus“, sagte sie dann mit fester Stimme und sah mir ge-rade in die Augen. „Es riecht so komisch.“
Sie deutete auf ein erst kürzlich restauriertes, vierstöckiges Gebäude, schräg gegenüber von dem Haus, in dem unsere großzügige Vierzimmer-altbauwohnung lag. Ich sah auf die Uhr. Viertel vor fünf. Ein paar Minu-ten konnte ich meinen Bewegungsdrang wohl noch zügeln.
„Wonach riecht es denn?“, fragte ich in distanziertem Ton.
„Nach Benzin.“
„Das ist natürlich nicht so gut, Frau …?“
Sie lächelte unsicher. „Kennen Sie mich denn nicht?“
Mein Personengedächtnis war immer schon miserabel gewesen, und mit zunehmendem Alter wurde es nicht besser. „Doch. Ich meine fast … Wir haben uns mal beim Bäcker getroffen, richtig?“
Ihr Lächeln wurde nachsichtig. „Schon mehr als einmal, Herr Gerlach. Aber macht ja nichts …“ Entschlossen streckte sie mir ein zweites Mal ihre bunt beringte Rechte entgegen. „Bernadette Hitzleben, Erdgeschoss rechts.“
„Kommt der Geruch aus dem Keller?“, fragte ich, während wir im Kurgasttempo die ruhige und schmale Kleinschmidtstraße überquerten.
„Im Gegenteil. Aus einer der Dachwohnungen.“
„Und seit wann?“
Wir mussten um eine kleine, sorgfältig abgesperrte Baustelle herumge-hen, wo ein tiefes Loch gähnte. Vermutlich war wieder einmal eine Was-serleitung undicht und musste geflickt werden.
„Vorgestern, am Samstag, habe ich es zum ersten Mal bemerkt. An-fangs habe ich gedacht, irgendwer hat was verschüttet, und der Geruch verliert sich wieder. Aber es hört nicht auf. Es muss ziemlich viel Benzin sein. Und Benzin in einer Wohnung, das ist doch gefährlich, oder was sagen Sie?“
Auf einem sauber gefegten Plattenweg durchquerten wir ein Vorgärt-chen, wo würdige alte Rosenbüsche Knospen trieben, Krokusse lila blüh-ten und frühe Narzissen stolz die Köpfe reckten. Frau Hitzleben schloss mit nervösen Bewegungen die schön geschnitzte Haustür auf. Der Ben-zingeruch war sofort wahrzunehmen. Sie lächelte mich entschuldigend an, ein schönes Lächeln, durch das ein klein wenig Traurigkeit und Resigna-tion schimmerte. „Ganz oben, leider, unterm Dach. Die rechte Tür. Sie sind mir nicht böse, wenn ich nicht mit hinaufgehe? Mein Bein ist die letzten Tage wieder so schlimm. Wie gut, dass es jetzt endlich wärmer wird.“
Während ich die Treppen hinaufstieg, blieb sie unten stehen, um die Ergebnisse meiner polizeilichen Ermittlungen abzuwarten. Als die letzten Stufen hinter mir lagen und ich im Dämmerlicht vor den beiden Dachge-schosswohnungen stand, war ich so außer Atem, dass ich für einen Mo-ment die Augen schließen musste. Es wurde wirklich Zeit, etwas für mei-nen Kreislauf zu tun. Von den beiden Holztüren blätterte an vielen Stellen schon die hellgraue Farbe. Die Verglasung bestand aus billigem Milchglas. Vermutlich hatte man in der Wohnungsnot nach dem Krieg – wie in vielen Häusern – eilig und billig das Dachgeschoss ausgebaut. Immerhin gab es Sicherheitsschlösser. Rechts, hatte sie gesagt.
„Und?“, kam es erwartungsvoll von unten.
Sicherheitshalber schnüffelte ich auch an der anderen Tür, aber die Quelle des Geruchs war eindeutig rechts. Und es war tatsächlich Benzin, was durch die Ritzen stank. Eine Menge Benzin, wenn es nach Tagen immer noch so durchdringend roch. Von innen hörte ich leise Musik. Vielleicht ein Radio. Und da war noch etwas anderes in der Luft. Ein Geruch, der mir als Chef der Kriminalpolizei leider nur zu bekannt war. Es stank nach Verwesung.
Ich klopfte – keine Reaktion.
Ich klopfte kräftiger – nichts.
Erst sacht, dann stärker drückte ich gegen die Tür. Sie gab nicht nach. Den Klingelknopf zu drücken wollte ich nicht riskieren. Die Benzindämpfe könnten sich entzünden, und dann würde ich möglicherweise ziemlich lange nicht mehr joggen gehen.
„Sie hatten recht“, rief ich nach unten. „Ich rufe die Feuerwehr.“
Zwanzig Minuten später war die graue Tür offen, und zwei Feuerwehr-männer in voller Montur betraten mit zögernden Schritten den dunklen, schmalen Flur der Wohnung. Der vordere hatte Ähnlichkeit mit Bud Spencer in seinen besten Jahren, der hintere war kleiner und schmaler und wurde von seinem schwergewichtigen Kollegen Guido genannt. Die Musik war jetzt viel lauter. Bob Dylan plärrte aus billigen Lautsprechern: „The answer, my friend, ist blowin’ in the wind.“
„Das stinkt ja vielleicht!“, brummte Bud Spencer, der einen schweren Feuerlöscher mit sich führte, und blieb im nächsten Moment so abrupt stehen, dass Guido auf ihn auflief. Für eine lange Schrecksekunde standen die beiden reglos da. Ich konnte nichts sehen, da die Männer mir die Sicht versperrten. Über uns gurrte eine schläfrige Taube. Bud Spencer ließ die Schultern sinken, stellte den Feuerlöscher behutsam ab und sah über die breite Schulter.
„Ich fürchte, Herr Gerlach“, sagte er heiser, „das fällt eher in Ihr Ress-ort.“
2
Die beiden traten zur Seite, soweit der enge Flur es erlaubte, und nun sah auch ich die Bescherung: Wenige Schritte von der Tür entfernt lag ein Mensch am Boden. Die Füße zeigten in meine Richtung. Nach der Schuhgröße zu schließen, war es ein Mann. Ein ziemlich junger Mann. Dick war er, stellte ich fest, als ich näher trat. Um nicht zu sagen, fett. Der runde Kopf mit hellblonder Wuschelfrisur lag in einer Blutlache. Die Nase war ein blutiger Brei. Der weiche Mund stand blöde offen. Die hellen Augen starrten ins Nichts.
Guido begann plötzlich zu keuchen, stieß mich unsanft zur Seite und riss eine Tür auf, links von mir, hinter der er wohl das Bad vermutete. Die Tür knallte zu, und Augenblicke später hörte ich eindeutige Geräusche. Bud Spencer grinste mitleidig.
Der Tote lag mit den Füßen im Flur und mit dem Kopf in einem Zim-mer. Dieses Zimmer hatte schräge Wände und schien der Wohn- und Arbeitsraum zu sein.
„Ich mach mal die Fenster auf“, sagte Bud Spencer. „Ich darf doch?“
Offenbar hatte er schon hie und da mit der Kripo zu tun gehabt und kannte die Spielregeln: Am Tatort nicht unnötig herumtrampeln, nichts verändern, nichts anfassen, was nicht unbedingt angefasst werden muss. Der übliche Griff zur Halsschlagader erübrigte sich hier: Dieser junge Mann war so tot, wie ein Mensch nur tot sein konnte.
Mit dem Rücken zur Wand quetschte sich der Feuerwehrmann an der Leiche vorbei und vermied dabei sorgfältig, in die Blutlache zu treten. Dann verschwand er aus meinem Sichtfeld. Ich hörte, wie er zwei Fenster öffnete. Eines davon klemmte ein wenig und knarrte empört. Dann ent-stand Durchzug, und Sekunden später konnte man wieder fast normal atmen.
„Licht?“, fragte ich, als er wieder erschien. „Darf man jetzt Licht ma-chen?“
Er reckte fachmännisch die Nase in die Luft und nickte. Guido würgte immer noch im Bad. Ich drückte den Schalter. Es wurde hell. Ansonsten geschah nichts. Ich entspannte mich und trat näher an den Toten heran. Das Blut im Gesicht und auf dem schäbigen Teppich war schwarz und schon komplett eingetrocknet. Er musste bereits seit mehreren Tagen tot sein. Die Würgegeräusche im Bad schienen schwächer zu werden.
Das Geschoss hatte den Toten mitten im Gesicht getroffen, dabei die Nase zerschmettert und war vermutlich am Hinterkopf wieder ausgetreten.
„Gucken Sie mal!“ Bud Spencer deutete auf die Füße des Toten, die in Puma-Sportschuhen steckten, deren alarmrote Schnürsenkel nicht gebun-den waren. „Der Killer hat versucht, den armen Kerl auch noch anzuzün-den!“
Er hatte recht: Die Beine der hellgrünen Jogginghose waren angekokelt, teilweise schon komplett verbrannt. An diesen Stellen war die Haut schwarz und aufgeplatzt. Rechts, unter einer altertümlichen Garderobe, an der eine Outdoor-jacke und ein zerknittertes schwarzes Cordjackett baumelten, lag eine blaue Dose mit Schraubdeckel und eindeutiger Auf-schrift: Waschbenzin. Darum herum hatte sich eine große Pfütze gebildet. Vermutlich hatte der Täter in der Hektik den Deckel nicht richtig zuge-schraubt.
Im Bad schien die Lage sich nun endgültig zum Guten gewendet zu haben. Ich hörte den nervenschwachen Guido noch ein wenig husten und rascheln. Dann ertönte ein Klappergeräusch, und schließlich öffnete sich die Tür. Guido war so weiß im Gesicht wie die Kacheln an den Wänden des Badezimmers in seinem Rücken.
„So ein Mist!“, schimpfte er und zog erschöpft die Nase hoch. „Und dann kein Wasser! Ist mir echt so peinlich.“
Angestrengt vermied er es, nach unten zu sehen. Ich verließ mit ihm zusammen die Wohnung, um Verstärkung anzufordern.
„Schicken Sie auch gleich die Spurensicherung“, wies ich den Kollegen an, der in der Notrufzentrale der Polizeidirektion das Telefon abnahm. „Außerdem brauchen wir einen Brandsachverständigen.“
„Er hat gelöscht“, sagte Bud Spencer, als ich das Handy wieder ein-steckte, und deutete auf eine babyblaue Wolldecke, die nicht weit von der Benzindose zusammengeknüllt am Boden lag. „Erst knallt er den Kerl ab und zündet ihn an und dann löscht er gleich wieder. Der hat anscheinend nicht gewusst, was er will.“
Nach einem Einbruch sah es hier jedenfalls nicht aus. Das Türschloss war unbeschädigt, die Wohnung wirkte nicht durchwühlt.
Hier handelte es sich um Mord.
„Vielleicht sind sie zu zweit gewesen?“, überlegte Guido. „Der eine hat gesagt: Komm, zünden wir den Typ an, vielleicht hat er Spuren verwi-schen wollen, aber der andere ist dagegen gewesen? Ein Glück, übrigens. Bei so einem Altbau ist ein Dachstuhlbrand eine Katastrophe. Alles Holz um uns herum.“
Bud Spencer mochte recht haben: Hier hatte jemand nicht gewusst, was er wollte. Der Täter hatte vielleicht in Panik gehandelt. Andererseits sah das Ganze nach einer regelrechten Hinrichtung aus. Das Opfer hatte dem Täter die Tür geöffnet und in den Lauf einer Waffe geblickt, war zwei, drei Schritte rückwärtsgegangen und …
„Wie kann einer bloß ohne Wasser leben?“, fragte Guido, immer noch fassungslos, dessen Gesicht inzwischen wieder ein wenig Farbe ange-nommen hatte. „Keine Klospülung, keine Dusche, also echt …“
Wenn man die Wohnung betrat, kam gleich links das Badezimmer. Daran schloss sich die Küche an, deren Tür offen stand. Die Musik, die immer noch lief, kam aus einem kleinen, würfelförmigen Radio, das im Wohn- und Arbeitszimmer auf einer umgestülpten roten Plastikkiste stand. Im Moment spielten die Eagles „Hotel California“. Den Blickfang des lange nicht aufgeräumten und selten abgestaubten Raums bildete ein bequem aussehendes, rotes Sofa. Unter einem der beiden Gaubenfenster stand ein mit Papierkram und einem breiten Computermonitor hoff-nungslos überladener Schreibtisch aus Pressspan und davor ein überra-schend hochwertiger, lederbezogener Schreibtischsessel. An der gegen-überliegenden Wand ein großer Flachbildfernseher. Alles machte den Eindruck, als hätte der Tote allein hier gelebt und wenig Wert auf Stil und Wohnlichkeit gelegt.
Rechts, gegenüber der Küche, lag das Schlafzimmer. Hier stand in der Ecke unter einer Schrägwand ein breites, zerwühltes Bett. Darauf lagen zwei Kopfkissen einträchtig nebeneinander. Am Fußende hockten drei freundlich grinsende Teddybären unterschiedlicher Größe, die zur selben Familie zu gehören schienen. Vater, Mutter, Kind. Zwischen den Kissen saß sehr aufrecht und ernst eine kleine, schon ziemlich lädierte Puppe, etwa dreißig Zentimeter groß, die eine ländlich bunte Tracht trug. Sie saß da, als stünde ihr ein Ehrenplatz zu. Auf dem Kopf trug sie eine weiße Haube, deren Ränder liebevoll mit farbig besticktem Band verziert waren. Auch die Bluse war bunt und hatte weite Ärmel.
Über einem alten und staubigen Sessel lagen achtlos hingeworfen einige Kleidungsstücke. Ein paar Jeans sah ich, bunte Boxershorts in Größe XL, daneben ein Nichts aus schwarzem Stoff. Ein Stringtanga, der gewiss nicht an den Körper des Toten passte.
„Was ist denn hier los?“, fragte eine raue Männerstimme mit leicht an-gelsächsischem Akzent von draußen.
Ich verließ eilig das Schlafzimmer, um den neugierigen Frager daran zu hindern, die Wohnung zu betreten. In der Wohnungstür erschien ein schlaksiger Kerl mit langem, ratlosem Pferdegesicht, fast zwei Meter groß und mindestens so sehr außer Atem, wie ich es nach dem Aufstieg gewe-sen war. Seine Miene changierte zwischen Neugierde und Besorgnis.
„Sie sind …?“, fragte ich freundlich.
„Andrew Weber“, stellte er sich vor und fuhr mit der flachen Hand über seine hohe Stirn. „Ich wohne da.“ Er deutete auf die gegenüberliegende graue Tür. „Was ist mit Andi? Und was riecht hier so …“
„Ihr Nachbar ist tot. Es tut mir leid.“
Die schlimme Nachricht ließ den schnaufenden Riesen seltsam unbe-rührt. Der junge Mann trug einen olivgrünen, schon arg verschlissenen Parka, an dessen Ärmel ein rotes Ahornblatt auf weißem Grund prangte. Auf seiner kräftigen Nase saß eine runde Nickelbrille.
„Tot?“, fragte er begriffsstutzig. „Aber wieso … Darf ich?“
„Es ist kein schöner Anblick“, sagte ich warnend und zu spät, denn er war schon halb an mir vorbei. „Er wurde erschossen.“
Andrew Weber warf einen langen Blick in den Flur seines Nachbarn. Schauderte, nickte schließlich, als hätte er so etwas seit Langem erwartet.
„Wie heißt Ihr Nachbar?“
Weder am Klingelknopf noch an der Tür befand sich ein Namensschild.
Er nickte noch einmal mit leerem Blick. Fuhr sich wieder über die ver-schwitzte Stirn. Über sein Gesicht irrlichterten die verschiedensten Gefühle.
„Andi … aber … wer tut denn so was?“
„Andi – und wie weiter?“
Er schluckte krampfhaft, kam allmählich wieder zu sich, sah mir ins Gesicht. „Dierksen. Andreas Dierksen.“
Im Gegensatz zu Guido war er durch den Schreck nicht blass geworden, sondern krebsrot. Mit fahrigen Bewegungen riss er sich den schweren Parka vom Leib und warf ihn achtlos vor seine Wohnungstür. Sein blassgelbes und viel zu weites T-Shirt hätte er schon vor Tagen in die Waschmaschine stopfen sollen. An den langen Beinen labberte eine ver-waschene Jeans, die ihm nur wegen des straff gezogenen schwarzen Le-dergürtels nicht auf die Knöchel rutschte. An den Füßen trug er Springer-stiefel.
„Haben Sie Herrn Dierksen gut gekannt?“
Unten wurde es laut. Die Haustür fiel ins Schloss. Eilige Schritte kamen die Treppe herauf. Eine Frau lachte kieksend. Die Verstärkung rückte an. Andrew Weber nickte zum dritten Mal, sah irritiert übers hölzerne Treppengeländer nach unten.
„Können wir uns irgendwo setzen und in Ruhe unterhalten?“, fragte ich den schwitzenden und dadurch nicht besser riechenden Zwei-Meter-Mann.
„Setzen?“, fragte er verständnislos zurück.
„In Ihre Wohnung vielleicht? Ich würde gerne mehr über Ihren Nach-barn erfahren.“
„In meine Wohnung, nein, das geht gar nicht.“ Erschrocken, fast pa-nisch schüttelte er den Kopf. „Ich bin nicht gerade ein Star im Putzen, und … ich … nein, Wohnung, das geht nicht.“
„Sie dürfen sich gerne bei mir reinsetzen“, rief Frau Hitzleben drei Stockwerke tiefer, der ich den ganzen Schlamassel verdankte und die offenbar trotz ihres Alters noch über ein vorzügliches Gehör verfügte.
„Sie kommen aus Kanada?“, fragte ich meinen Begleiter, als wir die Treppen hinabstiegen. In der Wohnung unterhalb der des Toten schienen Renovierungsarbeiten im Gang zu sein. Neben der Tür waren Säcke voller Gips oder Zement gestapelt. Kartons mit Fliesen standen daneben. An der Wand lehnten grüne Platten. Der Boden vor der Tür war mit einer feinen weißen Staubschicht überpudert, in der eine Vielzahl von Schuhabdrü-cken zu erkennen war. Vielleicht, mit etwas Glück, auch die des Mörders.
Zwei sportliche Kollegen kamen uns eilig entgegen, gefolgt von einer blonden Kollegin vom Kriminaldauerdienst. Die drei nickten mir zu, während sie vorbeihasteten. „Abend, Herr Kriminaloberrat“, rief die Frau fröhlich über die Schulter. „Immer noch im Dienst?“
„Spusi ist unterwegs“, ergänzte einer ihrer Kollegen, der immer zwei Stufen auf einmal nahm. „Der Brandmensch kommt später.“
„Calgary“, beantwortete Andrew Weber meine schon halb vergessene Frage. „Ich mache hier an der weltberühmten Ruprecht-Karls-Universität meinen Ph.D.“
„Sie sprechen sehr gut Deutsch.“
Er gluckste wie ein verschämter Teenager. „Mein Vater. Er stammt aus Dortmund.“
Mein Handy trillerte. Sarah, las ich auf dem Display, eine meiner Töchter. Ich drückte das Gespräch weg. Im Erdgeschoss hielt uns Frau Hitzleben schon die Tür zu ihrer nach Blumen und Kardamom duftenden Wohnung auf, und kurze Zeit später saßen wir auf schweren, lederbezo-genen Stühlen um einen weiß lackierten Tisch mit geschwungenen Beinen herum. Frau Hitzleben schien Antiquitäten zu lieben.
„Darf ich dabeibleiben?“, fragte sie mit glänzenden Augen.
Ich nickte. So konnte sie ihr Wissen über den toten Herrn Dierksen auch gleich beisteuern. Eine kostbar aussehende Kaminuhr tickte lebhaft auf einem in Farbe und Stil zum Tisch passenden Vertiko. Sonst war es still.
„Jetzt erzählen Sie einfach mal.“ Ich lehnte mich bequem zurück, um eine etwas entspanntere Atmosphäre zu schaffen. „Wer ist Herr Dierksen? Wo kommt er her? Was arbeitet er?“
„Nun.“ Andrew Weber räusperte sich und sah mit konzentrierter Miene an mir vorbei an die Wand. „Andi arbeitet in Karlsruhe an einem For-schungsinstitut. Den Namen habe ich vergessen. Sie machen da etwas mit solchen … radioaktiven Sachen. Darauf ist Andi ziemlich stolz gewesen. Das hat mich gewundert, weil ich dachte, dass diese Atomsachen in Deutschland nicht so beliebt sind. Das Institut ist in diesem Dings … einem Forschungszentrum. Was genau er dort treibt, hat er mir mal zu erklären versucht, aber ich habe es nicht begriffen. Andi war Chemiker. Mein Fach ist die Volkswirtschaft.“
Ein betretenes Achselzucken beendete seinen Vortrag.
„Er war also Wissenschaftler? War er promoviert?“
Weber kratzte sich im Gesicht. „Nein, Andi war auch noch nicht fertig mit seiner Doktorarbeit. Aber in vier Wochen hätte er Abgabetermin bei seinem Prof gehabt.“
„Er hat nicht allein in seiner Wohnung gelebt“, bemerkte ich und dachte an die zwei Kopfkissen, die Puppe, die Teddybären, den Stringtanga.
„Doch“, sagte Frau Hitzleben.
„Nein“, widersprach der angehende Volkswirt. „Andi hatte seit einiger Zeit eine Freundin.“
Frau Hitzleben sah ihn ungläubig an. „Die kleine Rothaarige etwa?“
„Rothaarig ist sie, ja. Sie hat da oben aber nicht so richtig gewohnt. Mal war sie da, mal war sie nicht da. Oft ist sie über Nacht geblieben. Und die Wände in diesem Haus sind leider ziemlich dünn.“ Der junge Mann errötete bis an die Haarwurzeln. „Und manchmal war es ganz schön laut nebenan.“
„Haben die beiden sich gestritten?“
„Das auch. Vor allem in der letzten Woche. Tina – so heißt sie – kann ganz schön energisch werden, wenn ihr etwas nicht passt. Von Andi habe ich nicht so viel gehört. Meistens haben sie sich aber rasch wieder ver-söhnt. Und dann hat bei mir wieder mal das Geschirr im Schrank geklirrt.“ Er zog ein Gesicht, als hätte er sich auf die Zunge gebissen.
„Ich hab sie nur zwei- oder dreimal gesehen“, sagte Frau Hitzleben nachdenklich. „Sie ist ein bisschen scheu, war mein Eindruck. Wie ein Geist ist sie immer an mir vorbeigehuscht. Hat einem nicht ins Gesicht gesehen und kaum gegrüßt. Und eine Sonnenbrille hat sie immer aufge-habt, sogar wenn es geregnet hat. Arg jung ist sie mir vorgekommen. Ein bisschen zu jung für den Herrn Dierksen. Sie musste ja zu einem von Ihnen da oben gehören, habe ich mir gedacht, sonst leben ja nur alte Leute im Haus. Ich dachte aber eigentlich, sie will zu Ihnen, Herr Weber.“
Der Angesprochene gluckste geschmeichelt und errötete schon wieder. „Schön wär’s. Tina ist nicht gerade hässlich.“
„Hat Herr Dierksen sie Ihnen nicht vorgestellt?“, fragte ich.
Weber schüttelte wieder einmal den großen Kopf. „So eng waren wir auch wieder nicht. Ich habe nur mehrfach gehört, dass Andi sie Tina nannte. Wir haben hin und wieder ein bisschen gesprochen, wenn wir uns auf der Treppe trafen. Er hat mir erzählt, was er arbeitet, und umgekehrt. Mehr war da nicht. Ich habe mal vorgeschlagen, wir sollten zusammen einen trinken gehen. Andi fand das eine gute Idee, aber es ist dann ir-gendwie nichts daraus geworden. Wir fanden es lustig, dass wir ähnliche Vornamen haben, Andreas und Andrew. Hatten, wollte ich sagen.“
Er presste die Lippen fest zusammen. Vielleicht wurde ihm erst in dieser Sekunde wirklich bewusst, dass er nie wieder mit Andreas Dierksen auf der Treppe ein Schwätzchen halten würde.
„Herr Dierksen hat ja sonst eigentlich nie Besuch gehabt“, überlegte Frau Hitzleben mit krauser Stirn. „Jedenfalls kann ich mich nicht …“
Mein Handy legte erneut los. Wieder war es Sarah. Wieder drückte ich den roten Knopf.
„Drum habe ich doch auch gedacht, die kleine Rothaarige gehört zu Ihnen, Herr Weber.“
„Wie alt ist sie?“, fragte ich.
„So, wie sie aussieht …“ Sie sah mich ratlos an, die Stirn immer noch kraus. „Noch keine achtzehn.“
Andrew Weber hob die knochigen Schultern und zog eine unglückliche Grimasse. Aus irgendeinem Grund konnte er mir nicht in die Augen sehen.
Ich fragte, woher Dierksen stammte. Ob es Geschwister gab. Ob seine Eltern noch lebten.
„Mir hat er mal erzählt, er sei in Leer aufgewachsen“, berichtete Frau Hitzleben. „In Ostfriesland oben. Seine Eltern haben da einen großen Bauernhof. Von einer Schwester ist auch die Rede gewesen. Die ist ver-heiratet und hat fünf Kinder. Oder waren es sechs? Viele, jedenfalls.“
Andrew Weber wusste zu diesem Punkt nichts zu berichten.
Ein kurzes Brummen meines Handys meldete eine neue SMS. Ich ver-suchte, meinen beiden Gesprächspartnern noch mehr Informationen zu entlocken, sah aber bald ein, dass es zwecklos war.
„Wie er eingezogen ist“, erinnerte sich Frau Hitzleben noch, „norma-lerweise macht man doch eine Runde durchs Haus und stellt sich vor. Aber der Herr Dierksen … Eines Tages, vor knapp drei Jahren, ist ein weißer Lieferwagen vorgefahren, er hat sein bisschen Zeug die Treppen hochgeschleppt, ganz allein, keiner hat ihm geholfen. Und dann ist er da gewesen. Wenn man ihn getroffen hat, hat er Guten Tag gesagt, und das war alles. Ich habe ein paarmal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kom-men, aber – wie soll ich sagen? Es war schwierig.“
„Das stimmt.“ Andrew Weber faltete die großen Hände auf dem Tisch. „Um Andi war so eine unsichtbare Wand. Sobald es persönlich wurde, war da so etwas … wie eine gläserne Wand, ja.“
Ich erhob mich und bedankte mich bei der Gastgeberin. Weber sprang ebenfalls auf und schien erleichtert zu sein, dass es vorbei war.
„In der Wohnung oben gibt es kein Wasser“, sagte ich zu dem schlak-sigen Kanadier, als wir wieder im Treppenhaus standen.
„Die Wasserleitung.“ Er fuhr sich mit beiden Händen durchs wider-borstige Haar. „Die Handwerker, die in der Wohnung darunter arbeiten, haben ein Rohr angebohrt. Sollte eigentlich längst erledigt sein. Ich weiß auch nicht …“
„Wie überlebt man zwei Wochen ohne fließendes Wasser?“
„Andi hat einen Schlüssel zur Wohnung darunter bekommen. Zu der Wohnung, die renoviert wird. Das Bad dort ist schon fertig. Und das darf … also, durfte er … benutzen.“
Wir verabschiedeten uns, und es ließ sich nicht vermeiden, dass ich seine klebrige Hand drückte. Als ich in die kühle Abendluft hinaustrat, nahm ich das Handy zur Hand.
„Ruf an!!!“, hatte meine Älteste geschrieben. Meine Töchter waren eineiige Zwillinge, sechzehn Jahre alt. Aber Sarah war eine halbe Stunde vor Louise zur Welt gekommen. „Omaalarm!!!!!!“
Den Rückruf ersparte ich mir, da ich ja nur die Straße überqueren musste, um mir von meiner Tochter persönlich erklären zu lassen, was das merkwürdige Wort bedeutete. Meine Eltern hatten ihren Wohnsitz in den Süden Portugals an die Algarve verlegt, nachdem Vater das Pensionsalter erreicht hatte. Das war nun schon einige Jahre her, und seither hatten wir uns nur selten gesehen. Mutter flog nicht gern, und ich auch nicht. So beschränkte sich der Kontakt auf gelegentliche Telefonate und bunte Karten zu Geburtstagen und hohen Feiertagen. In den vergangenen Mo-naten hatten sich die Anrufe meiner Mutter allerdings gehäuft. Ich hatte gespürt, dass ihr etwas auf der Seele lag. Sie weigerte sich jedoch zäh, den Grund ihrer ungewohnten Anhänglichkeit zu nennen. Hoffentlich war niemand krank geworden. Oder Schlimmeres. Ich beschleunigte meinen Schritt, und in meinem Magen machte sich ein mulmiges Gefühl breit.
Dabei hatte dieser Montag so friedlich begonnen …
„Gerlach ist der sympathischste Beamte, den je ein Autor erfunden hat!“
„Burger führt eine flotte Feder, verfügt über Witz und Ironie, schreibt lebensechte Dialoge und kann mit knappen Strichen plastisch Charaktere in ihrem Lebensumfeld darstellen.“
„Die Geschichte um den Heidelberger Kommissar Gerlach und sein Team ist gut konstruiert.“













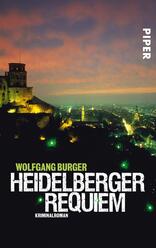


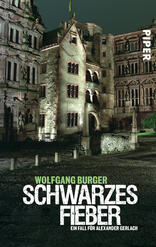
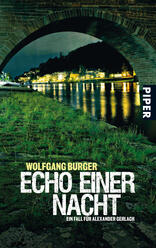













DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.