


Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht - eBook-Ausgabe
Mit Bike und Ruderboot von Paris nach Vancouver
— Klimaneutral um die halbe Welt: der Zero-Emission Traveler„Was er in seinem winzigen Ruderboot erlebte, (...) das alles schildert der gebürtige Kölner in seinem wirklich lesenswerten Buch ›Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht‹“ - Badische Zeitung
Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht — Inhalt
200 Tage, 22.000 Kilometer, 0 Emissionen
Emissionsfreie Langstreckenreisen sind unmöglich? Von wegen, denkt sich Julen Sánchez. Um ein Statement für den Klimaschutz zu setzen, schwingt er sich auf sein Fahrrad und radelt von Paris bis nach Portugal, wo sein Ruderboot schon auf ihn wartet.
Solo über den Atlantik
Ganz allein sticht Julen in See und kommt auf dem Atlantik zwischen Wind und Wellen an seine Grenzen, trotzt Stürmen und flickt notdürftig ein Leck am Boot. Wale begleiten ihn auf seinem Weg, und in der Nacht leuchtet um ihn herum das Plankton.
Wenn das Unmögliche plötzlich möglich wird
Nach 131 Tagen erreicht Julen das floridianische Festland, radelt weiter nach Pittsburgh – und bis an die kanadische Pazifikküste. Insgesamt legt er 22.000 Kilometer aus eigener Kraft zurück und beweist: Wir können jedes Ziel nachhaltig erreichen!
Leseprobe zu „Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht“
TEIL 1: EUROPA
Kapitel 1: Der Zero-Emission-Traveler
In der Notaufnahme komme ich mir dann doch fehl am Platz vor. Schließlich schwebe ich ja nicht in akuter Lebensgefahr. Vor wenigen Stunden habe ich mir beim Training an den Klimmzugstangen auf dem Sportplatz meiner Universität eine Verletzung am Bauch zugezogen. Zwar klang der Schmerz auf dem Nachhauseweg bereits ab, allerdings war mir auf dem Fahrrad ungewohnt schwummrig. Zu Hause in meiner Studenten-WG stellte ich beim Gang auf die Toilette fest, dass ich innere Blutungen habe.
Im Wartezimmer des [...]
TEIL 1: EUROPA
Kapitel 1: Der Zero-Emission-Traveler
In der Notaufnahme komme ich mir dann doch fehl am Platz vor. Schließlich schwebe ich ja nicht in akuter Lebensgefahr. Vor wenigen Stunden habe ich mir beim Training an den Klimmzugstangen auf dem Sportplatz meiner Universität eine Verletzung am Bauch zugezogen. Zwar klang der Schmerz auf dem Nachhauseweg bereits ab, allerdings war mir auf dem Fahrrad ungewohnt schwummrig. Zu Hause in meiner Studenten-WG stellte ich beim Gang auf die Toilette fest, dass ich innere Blutungen habe.
Im Wartezimmer des nächstgelegenen Krankenhauses wird mein Name schon nach wenigen Minuten aufgerufen. Hastig fülle ich noch schnell die letzten Zeilen des Anamnesebogens aus und lasse mich zu einem der Behandlungsräume mit Ultraschallgeräten führen. Die junge Ärztin, die dort auf mich wartet, empfängt mich mit einem freundlichen Lächeln und streckt mir ihre Hand entgegen.
„Sie hatten einen kleinen Sportunfall, habe ich gehört“, sagt sie und lädt mich ein, auf der Liege Platz zu nehmen. Dann schmiert sie kaltes Gel auf meinen Bauch, schaltet den Bildschirm ein und greift voller Tatendrang zur Ultraschallsonde. Ihr freundliches Lächeln weicht einem konzentrierten Gesichtsausdruck, und sie runzelt leicht die Stirn. „Einen Moment bitte“, sagt sie plötzlich und verlässt eiligen Schrittes das Behandlungszimmer.
Als sich die Tür wieder öffnet, betritt gleich ein ganzes Dutzend weißer Kittel den Raum. Ein älterer Arzt nimmt auf dem Stuhl neben mir Platz und hebt behutsam das Ultraschallgerät aus der Halterung. Ein Flüstern geht durch die Gruppe, doch ich verstehe kein Wort. Wortlos fährt der Mann, auf dessen Namensschild ich das Wort „Chefarzt“ ausmachen kann, mit der Sonde über meine Magengegend. Die Sekunden verstreichen, und ich spüre, dass die Zeit für netten Small Talk vorbei ist. Alles ist still, und so langsam frage ich mich, welchem Grund ich die Vielzahl neuer Bekanntschaften im Raum zu verdanken habe. Dann nickt der Chefarzt der jungen Ärztin kurz zu. Alle schauen mich an. Die junge Ärztin weint.
Schockdiagnose
„Blasenkrebs“, murmelt der Chefarzt, und seine Worte treffen mich völlig unvorbereitet. „In Ihrem Alter … Sehr unüblich. Wie alt sind Sie noch gleich? Zweiundzwanzig? Solche Erkrankungen treten nur selten vor dem sechzigsten Geburtstag auf. Ich persönlich kenne keinen dokumentierten Fall unter dreißig. So ungern ich das sage: Sie haben einen Tumor von der Größe eines Golfballs in Ihrer Blase. Diese Art Karzinom ist bösartig und aggressiv. Beim mutmaßlichen Stadium dieses Tumors müssen wir sofort mit einer Strahlentherapie beginnen.“
Er hält inne und scheint kurz zu überlegen: „Wir geben Ihnen dazu eine Therapiebroschüre mit, sodass Sie sich zu Hause noch einmal alles in Ruhe durchlesen können. Allerdings sollten wir nicht lange warten. Wenn Sie wollen, können wir Sie direkt für die erste OP am Montagmorgen eintragen, um den Befund so schnell wie möglich ins Labor zu schicken. Doch Sie sollten wissen, dass die Lebenserwartung bei metastasierten Tumoren dieser Größe in neun von zehn Fällen weniger als ein Jahr beträgt. Machen Sie sich also bitte keine falschen Hoffnungen. Es tut mir wirklich leid.“
Regungslos verharre ich auf meiner Liege. Ich versuche zu nicken, doch mein Körper scheint sich in einer Schockstarre zu befinden. Ich spüre nichts. Es fühlt sich an, als wäre ich ein Zuschauer in meinem eigenen Film. Mein Kopf ist leer, und der erste Impuls, der mir kommt, ist absurd: Es muss sich hier um eine Verwechslung handeln. Wenn ich bloß genügend schlau klingende Fragen über Prävalenz- und Genesungsraten stelle, bemerken die Ärzte vielleicht, dass dies alles überhaupt nicht sein kann. Ich höre meiner eigenen Stimme dabei zu, wie sie in ruhigem und sachlichem Ton mit den Ärzten redet, doch ich nehme keines der gesprochenen Worte bewusst wahr. Meine Worte scheinen sich verselbstständigt zu haben, sodass mein Kopf nicht begreifen muss, was hier gerade passiert. Die Ärzte tauschen verwunderte Blicke aus, als ob sie sich sorgten, dass ich sie nicht richtig verstanden hätte. Schließlich entscheiden sie sich dazu, mir das Kapitel über Blasenkarzinome aus dem Buch der World Health Organization zu kopieren, sodass ich meine Genesungswahrscheinlichkeiten zumindest in den eigenen Händen halten kann.
Weiterhin bin ich unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen oder jegliche Emotion zu spüren. Ich will einfach nur aus diesem Albtraum erwachen. Erst als ich mich mit einer Handvoll Zettel auf dem Vierersitz eines Regionalexpresses wiederfinde, trifft mich die Nachricht wie ein Schlag. Die Worte der Ärzte hallen immer wieder durch meinen Kopf, doch erst jetzt dringen sie zu mir durch. Es ist, als hätte ich plötzlich die richtige Frequenz auf einem schlecht eingestellten Radio gefunden. „Wir können uns auch nicht erklären, wie Sie als junger Nichtraucher in der Form Ihres Lebens Blasenkrebs haben können.“ Wie ein Schlag trifft mich ein tiefes Gefühl der Verzweiflung und Trauer.
Dies ist kein Albtraum, sondern Realität. Klar, als junger Mensch kann man sich sowieso nicht richtig vorstellen, eines Tages wirklich alt zu werden. Aber 22 ist doch kein Alter. Wie kann es sein, dass mir vermutlich kein ganzes Jahr mehr bleibt, wenn ich doch weder Schmerzen noch sonstige Beschwerden habe? Ich überfliege immer wieder denselben Abschnitt auf der ersten Seite der Behandlungsbroschüre, ohne auch nur ein einziges Wort davon zu verstehen. Dann kann ich wegen all der Tränen die Schrift nicht mehr entziffern und starre fassungslos aus dem Fenster. Die grauen Innenstädte des Ruhrgebiets spenden mir keinen besonders tauglichen Trost.
Ich habe Angst, was auf die Diagnose und die Operation in zwei Tagen folgen wird. Werden dies die letzten normalen Tage meines Lebens, so wie ich es kenne? Meine Gedanken überschlagen sich. Ich möchte hinaus in die weite Welt, die Pyramiden sehen. Oder Machu Picchu. Es gibt noch so viele Orte, die ich in meinem kurzen Erwachsenenleben nicht erkunden konnte. Dann verfliegt der Gedanke wieder, so schnell wie er kam. So ein Unsinn, denke ich mir. Wonach ich mich tatsächlich sehne, ist, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mich lieben. Mit meinen Eltern. Meinem Bruder. Meinen Freund:innen, den Großeltern und Cousins. Und mit meiner Uroma, die bald ihren 97. Geburtstag in ihrem Haus am Rhein feiern wird.
Ich denke an all die schönen Dinge, die ich in der Welt schon erleben durfte. Wie ein Film laufen Erinnerungen meiner Reisen in verschiedenste Teile der Welt durch meinen Kopf. Vor meinem inneren Auge sehe ich das majestätische Flügelschlagen der Mantarochen, mit denen ich geschwommen bin. Dann sehe ich die Tour auf einem dreißig Jahre alten Motorrad durch unberührte Teile Asiens und schließlich die drei verschiedenfarbigen Vulkanseen des Mount Kelimutu, welche je nach Tagesform mal purpurrot, marineblau oder schwefelgelb leuchten können. Für all diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar. Zwar habe ich so manche Arbeit und Beziehung für meine Liebe zum Reisen aufgegeben, doch die Gewissheit, immer meinen Träumen gefolgt zu sein, spendet mir in dieser schwierigen Situation Trost. Einzig meinen größten Traum werde ich nun nicht mehr in die Realität umsetzen können – der Traum, der mich 24 Stunden am Tag in seinen Bann zieht.
Ohne Rücksicht auf Verluste
Die Geschichte meines großen Traumes beginnt mit dieser Glückswoche in meinem ersten Unisemester. Während ich es mir nach meinem morgendlichen Work-out mit einem Proteinshake auf den Sitzen des Hörsaals bequem mache, schweift mein Geist mal wieder in ferne Länder. Die Planung zukünftiger Abenteuer hat mich schon zu meiner Schulzeit fasziniert und ließ mich verträumt aus dem Fenster starren, anstatt dem Unterricht zu folgen. Im fensterlosen Vorlesungssaal widme ich mich neben den Träumen von der Ferne auch der Umsetzung meiner Reisefantasien. Meine neue Paradedisziplin ist das Suchen und Buchen von unschlagbar günstigen Flügen zu spannenden Reisezielen.
Täglich durchforste ich dazu verschiedene Webseiten von Airlines, Flugsuchmaschinen und Schnäppchenjägern. Einmal konnte ich auf diese Art und Weise einen Flug und ein Arbeitsvisum für Australien zum Minijob-Gehalt ergattern. Seitdem versuche ich, mit meinem Ersparten aus Australien preiswert zu reisen, um möglichst viele verschiedene Kulturen und Länder kennenlernen zu können. Diese Woche werde ich bei meiner Suche gleich doppelt fündig. Meinen ersten großen Schnapper lande ich während der Statistikvorlesung: Noch bevor die Airline ihren Tippfehler korrigieren kann, buche ich eine Error Fare für 17 statt 170 Euro für Hin- und Rückflug von Düsseldorf nach Tel Aviv. Nach der Sozialpsychologievorlesung am Folgetag sind neben meinen Weihnachtsferien auch die achtwöchigen Sommerferien verplant. Für insgesamt 180 Euro reise ich nach Mexiko, Kuba, Jamaika und wieder zurück. Ich kann mein Glück kaum fassen.
Gleich nach der letzten Klausur vor Beginn der Sommerferien geht es los. Dafür fahre ich mit einer Mitfahrgelegenheit von Köln nach Paris. Vom Charles de Gaulle Airport geht mein erster Flug zurück nach Frankfurt, wo ich am späten Abend in den Flieger nach Moskau steige und die Nacht auf den schäbigen Bänken des Sheremetyevo A. S. Pushkin International Airport verbringe. Früh am nächsten Morgen steige ich zum sozialistischen Preis in die Maschine nach Havanna und jette am Nachmittag den letzten Teil der Strecke über den Yucatán-Kanal in das Land des Tequilas. Weshalb das Hinzufügen von Charles de Gaulle als Abflughafen den Gesamtpreis der Verbindung von Frankfurt nach Mexiko um Hunderte Euro hat sinken lassen, versteht wahrscheinlich nur der Flugpreis-Algorithmus. Doch mir kann es egal sein, denn erst das Hinzufügen dieses weiteren Fluges hat mir den Karibikurlaub zum Studentenpreis ermöglicht.
An Bord des Fliegers nach Moskau meldet sich zum ersten Mal mein Gewissen. Weshalb 2000 Kilometer nach Osten fliegen, wenn Kuba 8000 Kilometer in der entgegengesetzten Richtung liegt? Zwar freue ich mich über die Möglichkeit, kostengünstig die Welt entdecken zu können, doch etwas scheint hier nicht ganz zu stimmen. Wie kann eine Reise durch acht Zeitzonen deutlich erschwinglicher sein als die dringend benötigte neue Waschmaschine für unsere WG?
Hoch über dem Atlantik melden sich weitere Bedenken hinsichtlich meiner Flugodyssee. Die 32 Reisestunden und fünf Fortbewegungsmittel sind für mich als Weltreisenden, der es gewohnt ist, auf den Fußböden von Flughäfen zu schlafen, keine besonders große Belastung. Für die Umwelt jedoch ist die Belastung beträchtlich. Mit schlechtem Gewissen errechne ich, dass ganze 38 000 Bäume nötig wären, um meine 2,3 verursachten Tonnen CO2 noch heute aus der Luft zu filtern. Reisen mag zwar eine wunderbare Möglichkeit sein, die Schönheit unseres Planeten zu entdecken. Doch trage ich dadurch nicht gleichzeitig zur Zerstörung der Schönheit bei, die ich erst durch das Reisen kennen und schätzen lernte?
Gewiss möchte ich keine der großartigen Freundschaften missen, die ich während des Reisens auf verschiedenen Kontinenten geschlossen habe. Doch sobald ich über meinen CO2-Fußabdruck nachdenke, erscheinen mir meine vergangenen Reisen plötzlich oberflächlich und eigensinnig. Wenn man in einem der reichsten Länder der Welt mit Demokratie, Meinungsfreiheit und ohne Wehrdienstpflicht aufwächst, ist es ein Leichtes zu vergessen, wie außergewöhnlich das Privileg, die Welt zu bereisen, überhaupt ist. Als weißer Mann mit deutschem und spanischem Pass gehöre ich außerdem zu den wenigen Prozenten der Weltbevölkerung, die so gut wie keine Diskriminierung, Sicherheitsbedenken oder Reiseeinschränkungen befürchten müssen.
Zugleich treibt meine rücksichtslose Reiselust den Klimawandel und die Verschlechterung der Lebensbedingungen für alle Lebewesen auf diesem Planeten immer weiter voran. Ich muss mir eingestehen, dass sich diese Fakten auf Papier weniger schön lesen als meine bisherige Selbstwahrnehmung, ein toleranter und offener Weltbürger zu sein. So kann es nicht weitergehen: Dass ich mit Anfang zwanzig mehr Länder der Welt bereisen konnte als alle meine Vorfahren gemeinsam, ist purer Luxus. Es ist ein Privileg, für das ich die damit einhergehende Verantwortung bisher nicht übernommen habe. Wie werde ich meinen Enkelkindern eines Tages erklären, nichts gegen das Aussterben der Meeresschildkröten und die Zerstörung der Lebenshabitate unzähliger Spezies unternommen zu haben?
Mexiko und Kuba
Mexiko wird trotzdem zu einer der schönsten Reisen, die ich je unternommen habe. Ich habe mein Smartphone zu Hause gelassen, um herauszufinden, wie es gewesen sein muss, die Welt vor den Zeiten des Internets und des Massentourismus zu bereisen. Ohne mein soziales Netzwerk in der Hosentasche mit mir umherzutragen, lerne ich die Einheimischen und ihre Gastfreundschaft schneller denn je kennen. Immer wieder werde ich zum Tacoessen oder Mezcaltrinken eingeladen und verbringe einen Abend beim Barbecue mit einer Maya-Familie. Am beeindruckendsten ist jedoch die Biodiversität und Schönheit der Natur hier. Beim Schwimmen mit Walhaien, Sonnenbaden an traumhaften Karibikstränden und Tauchen in glasklaren Cenoten verliebe ich mich in den besonderen Charme dieses Landes.
Da ich ohne Internet vielerorts keine Überlandbusse buchen kann, miete ich mir ein klappriges Fahrrad und zeichne mir schatzkartenähnliche Wegbeschreibungen, um von A nach B zu gelangen. Mit dem Bike lege ich spätestens an jedem zweiten Mangostand neben dem Highway eine Pause ein, um die köstlichen Früchte und die frischen Smoothies zu genießen. An einem dieser Fruchtstände treffe ich einen französischen Abenteurer, der mit seinem vollbepackten Fahrrad von Tijuana durchs ganze Land bis an die Karibikküste Cancúns strampelt. Der ungepflegte Vollbart und das verschmutzte Trikot verleihen seinem Aussehen etwas Wildes, doch er sieht glücklich aus. „Die wahre Schönheit und Gastfreundschaft des Landes bekommst du erst dann zu sehen, wenn du langsam genug unterwegs bist, um sie anzunehmen“, sagt er. Mir war nicht bewusst, dass Menschen solch große Landmassen aus eigener Kraft durchqueren, stelle ich fest. Während meiner Reisen vermisse ich sportliche Betätigung am meisten. Deshalb begeistert mich die emissionsfreie Fortbewegung mit dem Fahrrad auf Anhieb.
Kaum lasse ich mich erschöpft in eine Hängematte meines Hostels fallen, grüßt mich auch schon ein freundlicher Däne. Casper ist groß, blond und interessiert sich ebenfalls für Abenteuer und das Verlassen der eigenen Komfortzone. Besonders das Reisen ohne Smartphone scheint ihn zu faszinieren. „Reisen heutzutage ist zu leicht geworden“, sagt er nachdenklich. „Ohne Smartphone ist die Verbindung zu den Mitmenschen und der lokalen Kultur sicherlich besser als mit unserem digitalen Sicherheitsnetz.“ Ich nicke zustimmend. Casper scheint meine Gedanken gelesen zu haben.
„Ich glaube, ich kenne ein Buch, das dich interessieren dürfte“, fährt er begeistert fort. „Ich habe es erst letzte Woche zu Ende gelesen. Es handelt von zwei Südafrikanern, die an einem Ruderrennen über den Atlantik in Holzbooten teilnehmen. Die beiden sind abwechselnd im Zweistundentakt mehr als sechzig Tage lang von den Kanaren bis in die Karibik gerudert. Ich finde es unglaublich, was wir Menschen mit einer Vision und schierem Durchhaltevermögen alles erreichen können.“
Ich brauche eine Sekunde, um das Gehörte zu begreifen, denn in meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. „Das ist wirklich verrückt“, stimme ich schließlich zu und schüttle den Kopf. Grinsend fragt Casper, wer sich eine solche Tortur freiwillig antun würde. „Es klingt ein wenig wie eine Strafe für Schwerverbrecher im 19. Jahrhundert“, gebe ich zu bedenken, und wir müssen lachen. Doch insgeheim weiß ich schon ganz genau, wer für so etwas infrage kommen würde. Schließlich ist das Überqueren von Ozeanen in Ruderbooten das Aufregendste, von dem ich je gehört habe. Die Frage, die sich mir stellt, ist vielmehr, wie. Casper bemerkt meine funkelnden Augen und verspricht, mir den Buchtitel aufzuschreiben.
Zwei Wochen später mache ich es mir auf dem Malecón bequem, welchen die Einheimischen liebevoll „die größte Couch Kubas“ getauft haben. Abends versammelt sich hier halb Havanna. Alt und Jung sitzen auf der acht Kilometer langen Hafenmauer zusammen, unterhalten sich und sehen den launischen Wellen des Atlantiks dabei zu, wie sie unermüdlich gegen das steinerne Sofa prallen. Die hochschlagende Gischt sorgt immer wieder für unerwartete, aber willkommene Abkühlungen an den tropisch warmen Sommerabenden.
Als ich heute Vormittag durch die Altstadt Havannas schlenderte, sprachen mich Juan und seine Freunde auf der Straße an und luden mich dazu ein, zum Sonnenuntergang mit ihnen über Fußball zu diskutieren. Meine blauen Augen hatten mich als Europäer enttarnt, und als Spanier scheint meine Meinung besonders gefragt zu sein, wenn es darum geht, ob in Madrid oder Barcelona der bessere Fußball gespielt wird. Mir gefällt, dass man sich hier abends einfach mit Freunden zusammensetzt und unterhält, deshalb sagte ich Juan sofort zu.
Trotz bester Gesellschaft schweifen meine Gedanken nach kurzer Zeit ab. Der Traum einer menschlich angetriebenen Reise über Land und Wasser lässt mich nicht mehr los. Vom Malecón aus kann ich einen Fischer beobachten, der im glitzernden Wasser dem Sonnenuntergang entgegentreibt und einen sonderbaren Anblick abgibt. Er sitzt in einer Art aufblasbarem Gummireifen und hält ein Paddel in der Linken und eine Angel in der Rechten. Zwischen seinen Beinen klemmt ein schwarzer Plastikeimer. Fasziniert beobachte ich, wie er die Angelleine auswirft und von den Wellen hin- und hergeschaukelt wird. Was wohl passieren würde, wenn sich der Wind drehte oder ihn die Strömung aufs offene Meer triebe?
„Manche treibt es die sechzig Kilometer bis nach Florida“, sagt Juan, der mich anscheinend beobachtet hat. „Andere kommen nie wieder, wenn sie auf den Ozean getrieben werden.“ Noch lange, nachdem wir uns darauf einigen, dass wir beim Thema Fußball keine Einigung erzielen, schaue ich hinaus auf den dunklen Ozean. Ob der Fischer es zurück ans Ufer geschafft hat, ist unmöglich zu erkennen.
Die Vorstellung, allein und in kompletter Dunkelheit auf hoher See zu sein, ist aufregend und nervenaufreibend zugleich. Im Vergleich dazu scheinen die Sorgen des alltäglichen Lebens an Land regelrecht zu schrumpfen. Ich bin fasziniert. Der Gedanke, dass Menschen solche Distanzen im endlosen Blau aus eigener Kraft zurücklegen können sollen, lässt mir keine Ruhe mehr. Ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat. Wenn das möglich ist, wäre es nicht der perfekte Beweis dafür, dass wir wirklich alles auf nachhaltige Art und Weise schaffen können?
Und dann kam einer, der wusste nicht, dass es nicht geht
Die Idee, meine beiden größten Leidenschaften miteinander zu vereinen, lässt mich auch nach meiner Rückkehr in die Heimat nicht mehr los. Bisher glaubte ich, dass das Bereisen der Welt und intensiver Sport nur schwer Hand in Hand gehen könnten. Schließlich war ich nicht bereit, die spontane Freiheit des Unterwegsseins gegen die regelmäßige Suche nach geeignetem Sportequipment und den passenden Lebensmitteln für einen strikten Ernährungsplan einzutauschen. Doch das Reisen aus eigener Kraft hat nicht nur das Potenzial, Leistungssport und Weltreisen zu kombinieren, es schlägt sogar noch eine dritte Fliege mit derselben Klappe: Es kann einen Beitrag zur Verminderung der globalen CO2-Emissionen leisten.
Meine Recherche ergibt, dass es ein jährliches Ruderrennen über einen Teil des Atlantiks gibt, das von einem Unternehmen mit großen Sponsoren ausgetragen wird. Die zumeist zwei- oder vierköpfigen Teams rudern die 4800 Kilometer lange Passatwindroute von den Kanarischen Inseln bis zum Karibikstaat Antigua. Diese Route wurde schon vor Jahrhunderten von Seefahrern genutzt, um mithilfe der stabilen Passatwinde die Karibik oder den südamerikanischen Kontinent zu erreichen.
Allerdings beträgt allein die Teilnahmegebühr für die Regatta stolze 21 500 Euro, die vor allem durch die Bereitstellung zweier Supportjachten begründet wird. Auch die Zeiten der selbst gebauten Holzboote scheinen bei der Regatta aus Sicherheitsgründen Geschichte zu sein. Während ich den diesjährigen Teams, deren GPS-Koordinaten auf der Veranstalterwebseite in Echtzeit ersichtlich sind, von der Couch aus folge, wird mir klar, dass die kommerzialisierte Expedition nichts für mich ist.
Als 22-jähriger Student scheint mir die Teilnahmegebühr besser in die Anschaffung des bestmöglichen Sicherheitsequipments investiert. Außerdem sieht der Seefahrer-Code vor, dass bei einem Notfall das nächstgelegene Schiff, das zumeist näher als die Supportjacht ist, zur Hilfeleistung und Seenotrettung verpflichtet ist. Auf Medaillen verzichte ich gerne, wenn ich im Gegenzug ein wahres Abenteuer erleben kann. Hinzu kommt: Ich möchte den gesamten Atlantik rudern, vom ersten Tropfen Wasser an der Küste Europas bis zur letzten Welle an der Küste Nordamerikas.
Von nun an verbringe ich den Großteil meiner Freizeit mit dem Studium saisonaler Strömungen und Windmuster, Wetterkunde, Expeditionsausrüstung, Seenavigation, Elektrotechnik und Mechanik. Ich durchstöbere Expeditionsarchive, nehme an Überlebens- und Erste-Hilfe-Kursen für hohe See teil und erwerbe Lizenzen als Skipper und zur Bedienung von VHF-Seefunkgeräten. Ich spreche mit Wetterexpert:innen, Personal Trainer:innen, erfahrenen Abenteurer:innen und Sportpsycholog:innen. Doch als ich die Rennorganisator:innen und die Teams persönlich treffe, muss ich feststellen, dass das Denken jenseits der gewohnten Pfade selbst in einer extremen Nischensportart wie dem Ozeanrudern ungern gesehen wird.
Wetterexpert:innen und Rennleitung sind sich zudem einig: Es gibt einen guten Grund, weshalb niemand die 9000 Kilometer weite Strecke vom Festland Europas zum Festland Nordamerikas rudert. Diese Strecke allein in einem Ruderboot zu bewältigen, ist schlichtweg nicht möglich. „Du wirst dein Geld verschwenden. Wenn du eine Chance haben willst, auf der anderen Seite anzukommen, solltest du auf unsere Profis hören, dich für die Regatta anmelden und die bewährte Route wählen.“ Nun ja, das ist jetzt etwas ungünstig, denn mein Plan steht bereits felsenfest: Ich werde auf eigene Faust von Europa nach Nordamerika rudern – auch wenn das eigentlich gar nicht geht.
Das goldene Ticket
Vom Wochenende vor der Blasenkrebsoperation weiß ich nicht mehr viel, außer dass es sich anfühlt, als würde die ganze Welt zusammenbrechen. Mein Gefühl für Zeit und Raum scheint nicht mehr zu funktionieren. Die Verzweiflung und Traurigkeit haben die Stunden und Tage in ein zeitloses Vakuum verschmelzen lassen. Allerdings taucht immer wieder ein erstaunlicher Gedanke aus meinem Unterbewusstsein auf: Trotz all der Trauer ist da nichts, das ich bereue. Auf eine sonderbare Art und Weise kann ich meine Diagnose akzeptieren. Denn tief im Inneren weiß ich, dass ich mich für ein Leben voller Leidenschaften anstatt eines Lebens voller Sicherheiten entschieden habe.
Schließlich ist es so weit, und zwei Krankenpflegerinnen schieben mich auf einem fahrbaren Krankenhausbett durch das verschachtelte Labyrinth weißer Korridore. In wenigen Minuten werde ich eine Vollnarkose erhalten und den Tumor entnommen bekommen. Auf dem Weg zum Operationssaal kreisen meine Gedanken erneut um die selbst angetriebene Reise ans andere Ende der Welt. „Du bist echt verdammt stur“, teile ich meinem Kopf mit. Seitdem ich denken kann, hat es niemand geschafft, meinem Kopf seine Ideen auszureden, sobald sie es sich dort erst einmal heimisch gemacht haben. Nicht einmal ich selbst. „Falls wir eines Tages die Chance bekommen sollten, so werden wir diese Reise machen. Versprochen“, beruhige ich mein eigenwilliges Gehirn, das sich erst dadurch zufriedenzugeben scheint und etwas ruhiger wird.
Als ich meine Augen wieder öffne, weiß ich für kurze Zeit nicht, in welcher Dimension ich mich befinde. Viele bekannte und unbekannte Gesichter strahlen mich an. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Doch die Chirurgen scheinen sich aus einem weiteren Grund vor Freude kaum einkriegen zu können. Gegen Ende der Woche bestätigen die Ergebnisse des Laborbefunds das von den Ärzten während der Operation vermutete Wunder: Der bösartige und hochaggressive Tumor hat sich unerklärlicherweise nicht in die Blasenwand gefressen, sondern schwamm lose in der Blase umher und konnte vollständig entfernt werden! Weitere Computertomografien bestätigen, dass ich ein wahrhaftiges goldenes Ticket des Lebens erhalten habe: Der Krebs ist nicht auf die benachbarten Organe gestreut. Nach einem zweiten operativen Eingriff sind die bösartigen Zellen vollständig entfernt. Zwar besteht noch immer eine siebzigprozentige Rückfallrate innerhalb der nächsten fünf Jahre, doch angesichts der Umstände hätte ich wohl kaum bessere Nachrichten erhalten können.
In kürzester Zeit dreht sich mein gesamtes Leben nun zum zweiten Mal um 180 Grad. Vor sieben Tagen war ich mit einer Lebenserwartung von weniger als einem Jahr nach Hause gefahren. Heute stehe ich gesund und ohne Strahlentherapie im Haus meiner Eltern, und wir stoßen gemeinsam auf die Zukunft an. Man könnte meinen, alles sei wieder wie vorher, doch in Wahrheit ist alles anders. Die Erfahrung, sich so intensiv mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, ist nicht rückgängig zu machen. Vor Glück könnte ich zwar einerseits tumorgroße Golfbälle von den Hochhäusern unserer Stadt schießen, andererseits hat sich meine Perspektive auf nahezu alles verschoben. Mich erfüllt ein Tatendrang, meine Lebenszeit sinnvoll und bewusst zu nutzen. Unsere Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt, genauso wie unsere Energie. Ich möchte beides mehr denn je dazu verwenden, um die Erde ein kleines bisschen besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ein neuer Fokus blendet alles aus – außer die wichtigsten Dinge des Lebens. Von nun an ist der größte Luxus in meinem Leben die Zeit.
Im Laufe der nächsten Monate tue ich nicht viel mehr, als zu schlafen und all die Sachbücher über zukunftsorientiertes Denken und Umweltschutz zu verschlingen, für die ich nie die Zeit zu haben glaubte. Dabei wird mir mit jeder gelesenen Seite stärker bewusst, wie prekär es um den Klima- und Artenschutz tatsächlich steht. Doch das Besorgniserregendste ist nicht einmal, wie schnell die Erwärmung des globalen Klimas voranschreitet. Was mir am meisten Sorgen bereitet, ist, wie wenige Menschen überhaupt an eine bessere Zukunft glauben. Wenn mich mein Studium der Psychologie eines gelehrt hat, dann, dass diejenigen, die glauben, es zu schaffen, und diejenigen, die glauben, es nicht zu schaffen, meistens beide recht haben.
Die erschreckend langsamen Maßnahmen zur Verminderung der Klimakrise erscheinen mir wie ein Symptom einer gesellschaftlichen Hoffnungskrise. Auf die Frage, ob die Welt insgesamt besser oder schlechter wird, gaben im Jahr 2015 nur vier von hundert Menschen in Deutschland eine positive Antwort. Zudem glaubte nur einer von fünf, dass sich die Lebensbedingungen für Menschen weltweit in den nächsten fünfzehn Jahren verbessern werden. Unser überschaubarer Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit mag diese geringen Zahlen zum Teil erklären und das Einhalten der Klimaziele nicht sehr realistisch erscheinen lassen. Doch vielleicht sollten wir uns neben dem Realismus ab und zu eine Prise Naivität erlauben. Mit einer Mischung aus genug Realismus, um das Problem zu benennen, und genug Naivität, um es lösen zu wollen, können wir unsere Ziele vielleicht noch erreichen.
Positive Entwicklungen scheinen uns zwar nie schnell genug voranzugehen, doch schon minimale Verbesserungen des gesellschaftlichen Narrativs können es in kürzester Zeit schaffen, unsere Supermarktregale mit veganen Produkten zu füllen oder Unternehmen klimaneutrale Betriebsreisen planen zu lassen. Bei der überwältigenden Größe der globalen Klimaproblematik ist es vermutlich wie beim Rudern eines Ozeans. Obwohl es ein Leichtes ist, den Glauben an das Land hinter dem schier unerreichbaren Horizont zu verlieren, müssen wir naiv und stur genug sein, weiter daran zu glauben, dass uns jeder noch so kleine Ruderschlag letztendlich an unser Ziel führen wird.
Paris und Pittsburgh
In der New York Times begegnet mir ein öffentlicher Brief, den die Bürgermeisterin von Paris und der Bürgermeister von Pittsburgh gemeinsam verfasst haben. Er trägt den Titel: „Paris und Pittsburgh: Wir haben unseren eigenen Klimadeal!“ Meine Neugier ist sofort geweckt, denn schon als Jugendlicher habe ich die amerikanische Stadt der Brücken aufgrund meiner Eishockeyidole Sidney Crosby und Mario Lemieux als eine Art dritte Heimat auserkoren. Allerdings ist Pittsburgh alles andere als ein bekanntes Klimaschutzvorbild. Umso erstaunter lese ich den gemeinsamen Appell beider Städte, den sie als Reaktion auf Donald Trumps Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen verfasst haben:
Letzte Woche versuchte Donald Trump, unsere Städte gegeneinander auszuspielen und seinen Austritt aus dem einzigen globalen Klimaabkommen damit zu rechtfertigen, dass er für die Bürger in Pittsburgh und nicht die in Paris gewählt worden sei. Doch wir stehen hier, um zu verkünden, dass Pittsburgh und Paris vereinter denn je sind, um die gemeinsamen Klimaziele zu erreichen. Obwohl uns ein Ozean und eine Sprache trennen, teilen wir den Wunsch, die bestmögliche Zukunft für die Bürger:innen unserer Städte und des gesamten Planeten sicherzustellen. Pittsburgh ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Städte durch Forschung und grüne Technologie transformieren können. Noch vor wenigen Jahrzehnten war Pittsburgh eine Stadt der Stahlarbeitenden, in der 24 Stunden am Tag Laternen brennen mussten, damit die Menschen durch den Smog der Stahlindustrie sehen konnten. Heute ist Pittsburgh eine Vorreiterin in Sachen erneuerbare Energien und strebt an, bis 2035 zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben zu werden.
Alte Stahlarbeiterstädte und ehemalige Vielflieger mögen nicht unbedingt jene Vorzeigevorbilder umweltbewussten Handelns sein, die wir aus den Medien kennen und vielleicht erwarten würden. Doch möglicherweise sind sie gerade deshalb ideale Beispiele dafür, wie wir ungeachtet unserer Vergangenheit positive Veränderungen für die Zukunft herbeiführen können. Pittsburgh zeigt, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss. Jeden Morgen haben wir die Möglichkeit, neue Weichen für eine nachhaltigere Welt zu stellen. Wir sollten nicht glauben, dass es schon zu spät und deshalb egal ist. Sobald sich genügend Menschen für das Einschlagen eines nachhaltigeren Weges entscheiden und sobald nachhaltiges Denken Mainstream wird, kann das latente gesellschaftliche Potenzial zu dramatisch schnellen Veränderungen und Maßnahmen für den Klimaschutz führen.
Die symbolische Brücke, die Anne Hidalgo und William Peduto in ihrem New-York-Times-Artikel spannen möchten, zeigt, dass wir unabhängig von den Entscheidungen unserer Regierungen aus eigener Kraft für unsere gemeinsame Zukunft einstehen können. Doch so sehr mir die Idee auch gefällt, noch besser gefällt mir der Gedanke, beide Städte auch durch eine echte, emissionsfreie Reise auf der Weltkarte miteinander zu verbinden und dabei zu zeigen, dass wir jedes Ziel nachhaltig und aus eigener Kraft erreichen können. Damit ist die Umsetzung der ersten emissionsfreien und selbstangetriebenen Soloexpedition von Europa nach Nordamerika beschlossene Sache: Mit dem Fahrrad will ich von Paris bis an die Atlantikküste Portugals fahren, von dort mit dem Ruderboot den Atlantik bis nach Florida überqueren und im Anschluss die US-amerikanische Ostküste bis nach Pittsburgh hochradeln.
„Das Buch zeigt die Reise eines inspirierenden und mutigen jungen Mannes. Wer also Fernweh hat und ein Abenteuer erleben möchte, braucht gar nicht weit weg zu reisen, sondern kann sich einfach das Buch von Julen Sánchez schnappen.“
„Ein großartiges Buch“
„Die Schilderung der Natur und ihrer Gewalten gelingt Sánchez in seinem Bericht ganz wunderbar. Vor allem die Ozeanüberquerung liefert Momente, die Gänsehaut hinterlassen.“
„Was er in seinem winzigen Ruderboot erlebte, (...) das alles schildert der gebürtige Kölner in seinem wirklich lesenswerten Buch ›Und dann kam einer, der hat’s einfach gemacht‹“
„›Und dann kam einer…‹ liest sich spannend und bietet viel Platz für’s Kopfkino.“
„Das fesselnd geschriebene Buch ist jedoch mehr als ein Abenteuerbericht: Sánchez wollte beweisen, dass man auch nachhaltig reisen kann.“
„Sehr unterhaltsam!“




















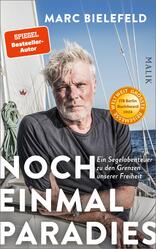












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.