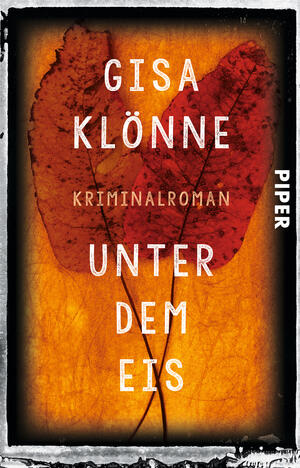
Unter dem Eis (Judith-Krieger-Krimis 2) — Inhalt
Ein Junge und eine Vogelforscherin verschwinden scheinbar spurlos. Zwischen beiden gibt es keinerlei Verbindung. Die Ermittlungen führen Judith Krieger und ihren Kollegen Manni Korzilius mitten hinein in ein Geflecht aus falsch verstandener Liebe, Mobbing, Vertrauen und Verrat. Und berühren sie bald sehr viel mehr, als ihnen lieb ist. Judith reist nach Kanada, ins Revier der Eistaucher, deren geisterhafter Schrei als Stimme der Wildnis gilt. Doch ist das die richtige Spur?
Leseprobe zu „Unter dem Eis (Judith-Krieger-Krimis 2)“
Sonntag, 24. Juli
Im ersten Moment ist da nur ihre Angst. Sie reißt die Augen auf und nimmt das fahle Frühmorgenlicht wahr, ihr vertrautes Zimmer. Eine Weile liegt sie da und hört dem Balzen und Zetern der Amseln vor ihrem Fenster zu, dann denkt sie an Barabbas und ihr müder Körper verkrampft sich in der Konzentration des Lauschens. Närrisches Weib, bangst um deinen Köter wie andere um einen Mann, schilt sie sich. Doch erst als sie sich davon überzeugt hat, dass das kaum wahrnehmbare heisere Raspeln im Flur Barabbas’ Atem ist, findet sie den Mut, sich [...]
Sonntag, 24. Juli
Im ersten Moment ist da nur ihre Angst. Sie reißt die Augen auf und nimmt das fahle Frühmorgenlicht wahr, ihr vertrautes Zimmer. Eine Weile liegt sie da und hört dem Balzen und Zetern der Amseln vor ihrem Fenster zu, dann denkt sie an Barabbas und ihr müder Körper verkrampft sich in der Konzentration des Lauschens. Närrisches Weib, bangst um deinen Köter wie andere um einen Mann, schilt sie sich. Doch erst als sie sich davon überzeugt hat, dass das kaum wahrnehmbare heisere Raspeln im Flur Barabbas’ Atem ist, findet sie den Mut, sich aufzusetzen.
Der Schmerz schießt ihr in Arme und Schultern, noch bevor ihre Füße die verschlissene Wolle des Webläufers berühren. Reiß dich zusammen, lass dich nicht gehen, am Morgen ist es immer am schlimmsten, aber du weißt, dass du trotzdem aufstehen kannst. Sie presst die Lippen zusammen. Abnutzung und jahrzehntelange Fehlhaltungen, zu viel Arbeit und Anspannung, das ist alles, was die Ärzte dazu sagen. Nehmen Sie Schmerztabletten, schonen Sie sich. Ihre wahren Gedanken verstecken sie hinter dem kalten Lächeln der Jugend und scheinheiligen Fragen. Sie wohnen allein? Wie alt sind Sie, Frau Vogt? 82? Ein großer Garten? Und ein Schäferhund? Wird Ihnen das nicht zu viel? Und dann der Braunkohletagebau – das ist doch nicht mehr schön hier in Frimmersdorf. Sie sind alt, was erwarten Sie, scheren Sie sich zum Teufel, das ist es, was die Ärzte eigentlich sagen wollen, doch diesen Gefallen wird sie ihnen nicht tun.
Die Hitze des heranbrechenden Tages hängt wie eine Ahnung über den Beeten. Ich sollte mich jetzt sofort um die Zucchini und die Bohnen kümmern, die Erdbeeren pflücken, bevor die Amseln sie holen, nachher wird es zu warm sein, denkt sie. Der Kessel summt, sie gießt Bohnenkaffee auf, lässt Butter und Honig auf einer Scheibe Toastbrot verlaufen, füllt Barabbas’ Napf mit Wasser und wirft ihm ein paar Hundekuchen zu. Er drängt sich an sie und sie krault seine Ohren, ignoriert den Schmerz, mit dem ihr Körper die leicht gebückte Haltung augenblicklich straft. Barabbas schlabbert drinnen sein Wasser, sie schlürft am Verandatisch vor der Küche ihren Kaffee. Halb fünf. Falls ein Omen für Unglück in der Luft liegt, bemerkt sie es nicht.
So sollte es immer sein, überlegt sie stattdessen. Anfang, nicht Ende. Ein Tag, so sauber und neu, geschaffen wie für uns allein. Ein paar Amseln fliegen auf und in Barabbas’ braunen Augen glimmt Sehnsucht. Wann haben sie den letzten längeren Spaziergang gemacht? Wann hat er über die Felder streifen können? Vorgestern? Vor einer Woche? Sie erinnert sich nicht mehr. Noch ein Fluch des Alters, diese Gedächtnislücken. Man braucht wirklich sehr viel Selbstbewusstsein, um sich nicht unterkriegen zu lassen vom Leben. Je älter man wird, desto mehr. Sie trägt die leere Tasse in die Küche und nimmt den Schäferhund an die Leine, auf einmal selbst ganz beseelt von dem Gedanken an einen ausgedehnten Streifzug. Wird sie die Erdbeeren eben pflücken, wenn sie zurückkommen, und das Gemüse muss bis zum Abend warten.
Sie wählt den Weg durch den Ort, und auch wenn es noch früh ist, löst sie Barabbas’ Leine nicht. Solange sie sich korrekt verhält, kann niemand behaupten, dass sie für ein so großes, starkes Tier nicht mehr die Kraft hat und deshalb eine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellt, dass der Hund eingeschläfert und sie ins Heim gehört. Am Dorfrand, hinter den Sportplätzen, lässt sie Barabbas laufen. Der Kraftwerkskoloss schläft nicht. Dampf zischt in den Morgenhimmel, die Werkssirene heult, die Förderbänder transportieren Braunkohle, rumpeln und quietschen. Sie wählt den Weg durch den Tunnel, überquert den Fluss, an dem später die Angler sitzen werden. Barabbas hat offensichtlich einen guten Tag, stiebt davon wie ein Welpe. Nach einer Weile verlässt er die Straße und schnürt in ein Wäldchen. Sie folgt ihm langsam, darauf bedacht, nicht zu stolpern. Die Sonne steigt jetzt höher, aber noch brennt sie nicht, der Duft wilder Kamille liegt in der Luft.
Das Aufheulen eines Motors fährt ihr geradewegs ins Herz. Verwirrt dreht sie sich einmal um ihre eigene Achse. Was war das? Wieder heult der Motor auf, ein misstönendes Knattern folgt. Halbstarke, denkt sie, kein Respekt vor irgendwas. Aber schlafen junge Leute sonntags um diese Zeit nicht ihren Rausch aus? Für den Bruchteil einer Sekunde glaubt sie, dass der Verursacher des morgendlichen Lärms direkt auf sie zufährt, noch ein Knattern und ein Lichtblitz, dahinten Richtung Straße. Im nächsten Moment kann sie nichts mehr erkennen und das Motorengeräusch entfernt sich.
Wo ist Barabbas? Plötzlich ergreift die Nachtangst wieder Besitz von ihr. Was wäre ich ohne meinen Hund? Was bleibt mir, wenn er stirbt? Sie ruft nach ihm und entdeckt ihn in einer Kuhle, er wälzt sich selig im Dreck, es wird lange dauern, ihm den Staub aus dem Fell zu bürsten. Das ganze Haus stinkt nach Hund, gib’s doch zu, du schaffst es schon seit Monaten nicht mehr, das Vieh zu baden – die Stimme ihrer Tochter. Elisabeth Vogt schüttelt den Kopf, obwohl sie ganz genau weiß, dass Erinnerungen sich dadurch nicht vertreiben lassen.
„Barabbas, hierher, komm zu Frauchen!“ Ihr Ruf ist das heisere Gekrächz eines alten Weibs.
„Barabbas!“
Jetzt endlich bequemt sich der Schäferhund zu gehorchen, mit wedelnder Rute und beinahe schelmischem Blick. Nie kann sie ihm böse sein, nicht einmal als er sich jetzt ihrem Griff entzieht, um in langen Sätzen dorthin zurückzujagen, wo es geknattert und geblitzt hat. Nun ja, letztendlich ist es ihr gleich, welchen Weg sie nehmen, also folgt sie ihm. Der Boden ist sandig. Dreck rieselt in ihre Birkenstocksandalen, immer wieder muss sie die Füße von Gestrüpp befreien. Sie hört das kehlige Knurren ihres Hundes, bevor sie ihn sieht, und ein Hitzeschauer jagt ihr über den Rücken. Der dickgeflochtene lederne Griff der Hundeleine liegt in ihrer Hand wie ein toter Aal.
„Bara…“, ihre Stimme versagt. In all den 16 Jahren ihres Zusammenlebens hat sie sich nicht vor ihrem Hund gefürchtet, er hat ihr nie einen Grund dafür gegeben. Jetzt aber will sie fliehen, will nicht sehen, was aus ihrem freundlichen Gefährten ein geiferndes Höllentier macht, doch eine Macht, die stärker ist als sie, schiebt sie dennoch zwischen die krüppeligen Bäume.
Zuerst sieht sie nur Barabbas’ gekrümmten Rücken. Gesträubtes Fell, angespannte Muskeln, er hat sich in etwas verbissen, reißt daran, und die ganze Zeit grollt in seiner Kehle der Abgrund.
„Barabbas, aus!“ Das Entsetzen gibt ihr die Stimme wieder, sie lässt den Ledergriff der Hundeleine auf seinen Rücken niederfahren. Niemals zuvor hat sie ihm mehr als einen leichten Klaps mit der Zeitung gegeben, aber jetzt drischt sie wie von Sinnen auf ihn ein, mit einer Kraft, die sie längst verloren zu haben glaubte, zerrt den Rüden zugleich am Halsband und würgt ihn, bis sein Knurren endlich zum Winseln wird und er sein blutiges Maul öffnet.
Schlaff und zerstört liegt seine Beute im Schmutz. Ein Rauhaardackel. Bilder flimmern vor Elisabeths Augen. Der Junge aus ihrer Straße mit seinem Struppi, beide mit glänzenden Augen. Ihr Enkel, wie er Barabbas umarmt und seine Mutter anbettelt, ihm doch bitte, bitte, bitte einen Hund zu schenken, wenigstens einen kleinen, es muss ja gar kein Schäferhund sein, ein Dackel reicht völlig, und nie, nie, nie will er danach noch ein anderes Geschenk haben, weder zu Weihnachten noch zu Ostern oder zum Geburtstag, und immer wird er mit seinem Hund Gassi gehen, ich schwöre, Mammi, ich schwöre, bitte, bitte, bitte.
Sie hält Barabbas weiter im Würgegriff des Halsbands und schließt für ein paar gnädige Momente die Augen. Nein, sie will nicht sehen, was da liegt, sie will nicht hier bleiben, will nicht, kann nicht. Barabbas’ Keuchen und das aufdringliche Summen einer grünschillernden Schmeißfliege holen sie zurück in die Wirklichkeit des Wäldchens. Nach Hause, wir müssen nach Hause, hier dürfen wir nicht bleiben, wenn sie uns hier finden und sehen, was Barabbas getan hat, werden sie ihn mir nehmen. Sie klinkt die Leine in sein Halsband und zerrt ihn Schritt für Schritt mit sich. Ihr Rücken schreit vor Schmerz, auf einmal spürt sie das wieder, und auch Barabbas’ Energie scheint verbraucht, er duckt sich zitternd an ihre Seite, ein verwirrter alter Hund, wie hat sie ihn nur so verprügeln können. Nach Hause, denkt sie wieder, wir müssen nach Hause, da sind wir sicher, da wird alles wieder gut.
Die Sonne erklimmt den Himmel jetzt viel zu schnell, Elisabeths Kleid klebt an Schenkeln und Rücken, jeder Atemzug tut weh. Niemand wird erfahren, was du getan hast, ich passe auf dich auf, Barabbas, mein Freund, mein Gefährte, sie werden dich nicht einschläfern, das lasse ich nicht zu, verzeih, was ich dir angetan habe.
Verzeih. Verzeih. Mit aller verbliebenen Kraft zwingt sie sich, nichts anderes zu denken als das.
ooo
Die Villa im Kölner Nobelstadtteil Bayenthal liegt apathisch in der Hitze, deren Ursprung die Medien mit rapide nachlassendem Enthusiasmus als Jahrhundertsommer bezeichnen. Sogar die Alleebäume wirken erschöpft. Judith Krieger, auf eigenen Wunsch beurlaubte Kriminalhauptkommissarin, legt den Kopf in den Nacken und starrt durchs geöffnete Faltdach ihrer Ente in den Himmel. Sie sehnt sich danach, den Motor anzulassen, Gas zu geben und das Gesicht so lange in den Fahrtwind zu halten, bis sie einen See erreicht. Wenn sie die Augen schließt, erscheint ihr das Wasser zum Greifen nah. Kühl und beinahe kitschpostkartenartig blaugrün.
Ein dunkler Mercedes hält hinter ihrer Ente. Der Mann, der herausklettert, ist ihr vertraut und doch auch wieder nicht, genau wie das Haus, vor dem sie parkt. Er kommt auf sie zu, in Schritten, die zu klein sind für seinen Körper. Als seien seine Beine zur Fortbewegung gar nicht nötig, als schiebe er sich vielmehr auf Judith zu, ein übergewichtiger, blauäugiger Krebs in heller Freizeitkleidung, dem man den Seitwärtsgang abtrainiert hat. In Judiths Magengegend flattert etwas. Es war ein Fehler, herzukommen, denkt sie. Dies ist meine letzte Urlaubswoche. Ich hätte mich nicht überreden lassen sollen, auch nicht um der alten Zeiten willen, was vorbei ist, ist vorbei.
„Judith Krieger, höchstpersönlich, Gott sei Dank!“ Ihr ehemaliger Schulkamerad entblößt Zähne, deren Regulierung einem Kiefernorthopäden ein kleines Vermögen eingebracht hätte.
„Berthold Prätorius“, Judith steigt aus und zieht ihre Hand so schnell wie möglich aus seiner feuchtwarmen Begrüßung.
Er strahlt sie an. „Ich wusste, dass du kommst.“
„Da warst du zuversichtlicher als ich.“
Er fährt sich mit der Hand durch die mausbraunen Haarsträhnen, eine nervöse Geste. Früher waren seine Finger wund und tintenfleckig, die Nägel quasi nicht vorhanden. Jetzt verraten nur noch die breiten, fleischigen Fingerspitzen den gefragten EDV-Experten Dr. Berthold Prätorius als einstigen Nagelbeißer und Klassenfreak.
„Bitte, Judith. Ich hab dir doch gesagt, Charlotte ist in Gefahr. Du musst mir helfen.“
Bertholds Anruf war völlig überraschend gekommen. Regelrecht angefleht hatte er Judith, sich mit ihm bei Charlottes Villa zu treffen. Ihre alte Schulkameradin sei seit mehreren Wochen verschwunden, genauer gesagt seit Ende Mai. Kein Urlaub, nein. Charlotte sei immer nur an die Ostsee gefahren, Fischland Darß/Zingst, Pension Storch, Seevögel beobachten, aber da sei sie nicht. Charlotte sei wie vom Erdboden verschluckt, vielleicht sei ihr etwas zugestoßen, aber ihm seien die Hände gebunden, er kenne sich nur mit Computern aus, die Polizei verstehe seine Sorgen nicht und Judith sei doch Kommissarin. Okay, hatte sie schließlich gesagt, ich schau mir das Haus mal an, rein privat. Vielleicht wissen wir dann mehr.
Sie mustert ihn, wie er jetzt in seinen Hosentaschen herumfingert, links, rechts, wieder links, bis er endlich mit einem Seufzer einen Schlüssel hervorkramt und vor Judiths Nase baumeln lässt.
„Willst du oder soll ich?“
„Du bist mit Charlotte befreundet, nicht ich.“
Er nickt und steckt den Schlüssel ins Schloss. Die Kühle im Hausflur ist ein Schock auf der Haut, die Luft abgestanden. Tot, denkt Judith, auch wenn nichts auf den unverkennbaren Geruch der Zersetzung eines menschlichen Körpers hindeutet. Es riecht nach Staub, Mottenkugeln und einem Hauch Desinfektionsmittel. Berthold zieht die Haustür ins Schloss, und das Gefühl, ein Mausoleum zu betreten, wird stärker.
„Gibt’s hier kein Licht?“ Judith tastet an der Wand neben der Haustür nach einem Schalter.
„Die Rollos sind runter, warte.“ Berthold schiebt sich an ihr vorbei und öffnet eine Tür, sie findet den Lichtschalter im selben Moment, in dem er die Rollos im Nebenraum hochzieht. Stofftapeten in bleichem Altrosa werden erkennbar, ein klobiger Garderobenschrank, ein Spiegel und eine altmodische Telefonbank.
Berthold Prätorius setzt sich wieder in Bewegung und Judith folgt ihm in ein Wohnzimmer mit schweren Eichenmöbeln. Auch hier ist es halbdunkel, bis Berthold die Rollos hochzieht und den Blick auf einen parkähnlichen, von hohen Nadelbäumen umrahmten Garten freigibt. Licht flutet ihnen entgegen, Sonnenstrahlen, die im ersten Moment nichts Wärmendes an sich haben, sondern die Augen quälen.
„Der Rasen sieht frisch gemäht aus“, sagt Judith.
„Charlotte hat einen Gärtner.“
„Wie bezahlt sie ihn?“
Berthold zuckt die Schultern. „Per Dauerauftrag? Ich habe keine Ahnung.“
Judith sieht sich um. Über dem nietenbeschlagenen Ledersofa hängt ein schweres Ölbild mit Goldrand. Rotbefrackte Reiter, die ihren hysterisch wirkenden Pferden den Kopf in den Nacken reißen, Jagdhunde mit blutigen Lefzen, ein fliehender Hirsch.
„Dieses Haus wirkt nicht gerade jugendlich.“
„Die Einrichtung stammt noch von Charlottes Vater.“ Berthold spricht, als wolle er die verschwundene Schulkameradin verteidigen, mit der er, im Gegensatz zu Judith, bis heute in Kontakt geblieben ist. Befreundet, wie er sagt.
„Ist ihr Vater tot?“
„Seit einem Dreivierteljahr, ja.“
„Genug Zeit, was zu ändern.“
„Charlottes Zimmer sind oben. Schau dich doch einfach in Ruhe um. Ich muss leider noch mal weg.“ Er sieht sie nicht an.
„Du willst mich hier allein die Leiche suchen lassen?“
Seine rosige Gesichtshaut wird eine Spur blasser, seine fleischige Rechte landet auf seiner Brust. „Hier ist keine Leiche, ich habe schon alles abgesucht, sogar den Keller.“
„Sehr beruhigend.“
„Es geht wie gesagt darum, herauszufinden, wo Charlotte hingefahren sein könnte.“
„Und du hast wirklich keine Idee …“
„Ich bring dich hoch, aber dann muss ich los. Ein Systemfehler in der Firma, das konnte ich nicht vorhersehen, ohne mich sind die aufgeschmissen.“
„Hattest du nicht gesagt, sonntags hättest du auf jeden Fall frei?“
„Tut mir leid. Für Computer ist das ein Tag wie jeder andere.“
Er führt sie eine Treppe hinauf, weiter hinein in den abgedunkelten Kosmos der Charlotte Simonis. Ein brauner Teppich, der mit Messingstangen über die Stufen gespannt ist, schluckt ihre Schritte. Der Geruch nach Desinfektionsmittel und Mottenkugeln wird stärker, der See, von dem Judith eben noch geträumt hat, erscheint mehr und mehr wie eine Fata Morgana.
„Hier.“ Berthold öffnet eine weißlackierte Holztür. Der Raum ist dämmrig, muffig und warm. Judith findet den Lichtschalter und zuckt zurück. Glasige Puppenaugen starren sie an, katapultieren sie in eine Zeit, die sie lieber vergessen wollte. Erinnern sie daran, dass sie etwas wiedergutzumachen hat, obwohl es dafür vermutlich zu spät ist. Im nächsten Moment ergreift Bertholds Sorge um die gemeinsame Schulkameradin Besitz von Judith, schleicht sich in ihren Körper wie ein Gift. Warum hat Charlotte ihre Puppen aufgehoben? Was sagt das aus über ihr Leben? Etwas zieht in Judiths Bauch und die stickige Hitze in dem Mansardenzimmer macht das nicht besser.
ooo
Schmeißfliegen summen. Eine Grille sägt ihre misstönenden Lockrufe nach einem Partner in den Tag. Unbarmherzig beißt die Sonne in Elisabeths Nacken und Unterarme. Sie stützt sich einen Moment lang auf ihren Spaten und holt Luft. Rotschwarze Kreise tanzen vor ihren Augen. Sie muss wahnsinnig sein, in dieser Hitze ein Grab zu schaufeln. Aber natürlich hat sie gar keine Wahl. Sie hat Barabbas zu Hause eingesperrt, hat sein Protestgewinsel ignoriert, als sie sich mit Spaten und Koffer erneut auf den Weg in die Brachen machte. Sie beginnt wieder zu graben, stellt mit Befriedigung fest, dass das Loch bald tief genug sein wird. Es gibt keinen anderen Weg, denkt sie. Ich muss das hier zu Ende bringen. Barabbas’ Sünde vergessen machen.
Der Rauhaardackel liegt neben ihr im Sand. Seine glasigen Augen scheinen sie zu beobachten. Jetzt landet eine Fliege in seinem Augenwinkel. Elisabeth hebt den Spaten und verscheucht sie, aber das Insekt ist hartnäckig. Wieder und wieder kehrt es zurück. Natürlich tut es das, denkt Elisabeth. Es will fressen. Fressen und für seine Brut sorgen, so ist das Leben eben. Die Vorstellung, dass sich alsbald Fliegenmaden an den Dackelaugen gütlich tun werden, lässt ihren Magen revoltieren, obwohl sie auf einem Bauernhof groß geworden ist und weiß Gott nicht zimperlich ist. Sie sticht den Spaten in den Sand und sinkt mit einem Ächzen auf die Knie. Komm, kleiner Hund, bringen wir es hinter uns. Zumindest vor den Fliegen kann ich dich schützen.
Sie öffnet den Deckel des Kinderreisekoffers und nimmt eines der alten Frotteelaken heraus, die ihr als Leichentücher dienen. Sie zieht den Dackel darauf. Er sieht so klein aus, ist aber schwer. Elisabeth schmeckt Magensäure auf der Zunge. Barabbas’ Biss ist in dem weichen, strubbeligen Fell kaum noch zu erkennen. Wieder versucht eine grün schillernde Fliege ihr Glück. Schnell hebt Elisabeth den Dackel in seinen rotgrün karierten Sarg. Immer noch sieht er sie an. Aber das ist nicht der Grund, warum Elisabeth auf einmal so unkontrolliert zu zittern beginnt. Dem Dackel fehlt das rechte Ohr. Jemand muss es abgetrennt haben, vor kurzem erst, mit einem Messer, denn an der geraden Schnittfläche klebt Blut.
ooo
Als sein freies Wochenende frühzeitig beendet wird, sitzt Kriminalkommissar Manfred Korzilius im Maybach-Biergarten und überlegt, ob er die katzenäugige Blonde mit dem rosa Fummel, die sich mit ihrer weitaus weniger attraktiven Freundin am Tresen räkelt, ansprechen soll oder nicht. Wenn er sich ranschmeißt, riskiert er einen Korb. Andererseits sehen die beiden so aus, als wären sie für etwas Abwechslung durchaus dankbar. Und wer nichts wagt … Die Frage ist natürlich immer, ob sich der Einsatz lohnt. Jetzt dreht Miss Katzenauge eine silberne Spange ins Haar und fächert sich mit der Getränkekarte Luft zu. Sehr hübsch. Das Vibrieren von Mannis Handy wird aufdringlicher, fordert, dass er sich jetzt, sofort, darum kümmert. Was soll’s, denkt er, als er sein Nokia aufklappt, eigentlich ist es sowieso zu heiß für Sex.
„Tut mir leid, dass ich stören muss“, bellt die Stimme von Thalbach, seinem neuen Chef.
„Ich hab heute keine Bereitschaft.“
„Das weiß ich, aber ich habe eben mit Millstätt gesprochen, und wir sind beide der Meinung, dass du der richtige Mann für diesen Einsatz bist.“
„Aha“, sagt Manni und ärgert sich, dass ihm nichts Intelligenteres einfällt. Wieso, verdammt noch mal, beruft sich Thalbach auf den Leiter der Mordkommission? Steht Manni nun endlich die Rückversetzung ins KK 11 bevor, um die er sich seit Monaten bemüht? Und warum ruft Millstätt dann nicht selbst an?
„Ein Junge ist verschwunden“, verkündet Thalbach mit sonorer Stimme. „In den Aussagen der Eltern gibt es Ungereimtheiten. Einiges deutet darauf hin, dass ein innerfamiliäres Tötungsdelikt vorliegen könnte, da käme deine Erfahrung vom KK 11 ins Spiel. Die Eltern können einfach nicht genau sagen, seit wann ihr Sohn verschwunden ist. Irgendwann am Wochenende, während eines Zeltlagers, das er mit seinem Vater besucht hat, der übrigens nicht der leibliche Vater ist.“
Ausgerechnet jetzt, da klar ist, dass das mit einer heißen Sommernacht nichts werden wird, sieht Miss Cateye zu ihm hinüber, und zwar durchaus nicht uninteressiert. Manni wirft ihr einen langen Blick zu und versucht, sich auf das Telefongespräch zu konzentrieren. Er trinkt einen Schluck Radler und verzieht das Gesicht. Warm und abgestanden, dabei sitzt er gerade einmal zehn Minuten hier. Er schiebt das Glas zur Seite und winkt der Kellnerin.
„Wie alt ist der Junge?“
„Vierzehn.“
„Vielleicht ist er bei seinen Kumpels. Baden. Oder bei seiner Freundin.“
„Das scheint nicht der Fall zu sein. Fahr bitte zu den Eltern und sprich mit ihnen. Verschaff dir einen Eindruck von der Situation.“
„Für wen arbeite ich?“
„Für mich. Vorläufig jedenfalls. Und hoffen wir für diese Familie, dass es dabei bleibt.“
Und wenn sich rausstellt, dass der Junge tot ist, komme ich dann mit diesem Fall zurück ins KK 11? Die Frage brennt Manni förmlich auf der Zunge, aber er stellt sie nicht. Das letzte halbe Jahr hat ihn Vorsicht gelehrt. Gleich nachdem seine erste gemeinsame Ermittlung mit Judith Krieger auf einer Waldlichtung im Bergischen den Bach runtergegangen war, hat Millstätt ihm eröffnet, dass er in die Vermisstenabteilung versetzt wird. Vorübergehend, nur um einen Personalengpass abzufangen. Eine fromme Lüge, die Manni bis heute nicht glaubt. Judith Krieger hat sich beurlauben lassen, um in sich zu gehen und ihre lädierte Psyche zu hätscheln, und er darf derweil Buße bei den Personenfahndern tun, statt Karriere zu machen, so sieht es aus. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, denn schließlich war es die Krieger, die damals alle Dienstanweisungen ignorierte. Trotzdem darf sie, wenn sie in einer Woche zurückkommt, wieder ins KK 11. Millstätt frisst ihr eben wie eh und je aus der Hand.
„Hast du noch Fragen?“ Thalbachs Stimme holt Manni zurück in die Gegenwart. Manni betrachtet sein Radler, das dasteht, als habe es niemals so etwas wie eine Schaumkrone besessen. Warum nicht ein bisschen pokern, wenn sie ihm schon übel mitspielen? Allzu viel Enthusiasmus schuldet er ihnen momentan nicht, und seine Lust, sich quer durch die Stadt zum Fuhrpark des Präsidiums zu quälen, tendiert gegen null.
„Ich sitze im Biergarten und habe Alkohol getrunken.“
„Viel?“
„Na ja, geht so, Radler.“
„Bestell dir einen Espresso und nimm dir ein Taxi.“
Die Kellnerin wird endlich auf ihn aufmerksam und kommt an Mannis Tisch, er lächelt entschuldigend und entwindet ihr wortlos Block und Stift, um die Adresse zu notieren, die Thalbach diktiert.
ooo
Unten fällt die Haustür ins Schloss. Judith kann den Blick nicht von Charlottes Puppensammlung lösen. Es ist, als würden diese starren Kinderimitationen mit den bunten Kleidern sie hypnotisieren, als stehe sie einer glasäugigen Zeitmaschine gegenüber. Sie weiß, dass sie schon einmal in diesem Zimmer gewesen ist, vor Jahrzehnten. Wie alt war sie damals? Vierzehn oder so. Es war ein nassgrauer Tag im Mai, kurz nach Charlottes Geburtstag. Sie und Charlotte sind beinahe gleich alt, Jahrgang 66. „Herzlichen Glückwunsch“, sagt sie laut, um ihr Unbehagen angesichts dieses Kinderzimmers abzuschütteln, das in seiner Vergangenheit erstarrt zu sein scheint wie in Gelatine.
Bei der Geburtstagsfeier hatte Charlottes Mutter Rhabarberkuchen mit Schlagsahne und Kakao serviert. Es hatte Kerzen und Blumen gegeben, Geschenke natürlich, und trotzdem war keine Stimmung aufgekommen. Die anderen Mädchen stießen sich unter dem Tisch an und kicherten. Sie kannten sich schon seit der fünften Klasse, eine eingeschworene Gemeinschaft, nur Charlotte und Judith waren neu, zugezogen, außen vor. Am nächsten Tag auf dem Schulklo belauschte Judith, wie sich die Mitschülerinnen rauchend in einer der Kabinen drängten und über Charlotte lästerten. Über ihre weiße Spitzenbluse und die Puppen. Darüber, dass es kein Eis gegeben hatte, keine Schokoriegel, keine Cola und keine Musik – überhaupt nichts von alldem, was in war. Und natürlich war es nicht bei diesem Getuschel geblieben. In den Wochen nach Charlottes Geburtstagsfeier hörten die Mitschülerinnen einfach auf, mit ihr zu sprechen. Taten so, als existiere sie nicht. Charlotte hatte Judith zu sich eingeladen, hatte sich im Unterricht neben sie gesetzt, ihr auf dem Pausenhof Geheimnisse anvertraut – was Mädchen eben so tun. Judith fand Charlotte ein wenig wunderlich, aber durchaus nicht blöd oder langweilig. Trotzdem hatte sie aufgehört, sich mit ihr zu treffen. Und dann hatte sie sie verraten. Oder etwa nicht?
Judith steigt die Treppe hinunter zurück ins Parterre, füllt in der Küche ein Glas mit Leitungswasser und setzt sich auf die sonnenwarme Steintreppe, die von der Terrasse in den Garten führt. Die Hitze macht ihren Körper schwer und träge und zieht die Gedanken in die Ferne. Ihr ist immer noch flau im Magen. Sie versucht, die Erinnerungen an Charlotte und ihre Puppen beiseite zu drängen und stattdessen an einen blaugrünen Badesee zu denken, an irgendeine harmlose, unkomplizierte, gegenwärtige Sommerphantasie. Es gelingt ihr nicht.
Sie ist nicht lange mit Charlotte und Berthold zur Schule gegangen, zwei Jahre bloß. Dann hatte ihr rastloser Vater schon wieder einen neuen Job, in Bremen diesmal, und so waren sie ein weiteres Mal umgezogen. Judith erinnert sich nicht gerne an jene Zeit, in der sie den Entscheidungen ihrer Eltern ausgeliefert war. Ihr eigentliches Leben, so kommt es ihr immer vor, begann erst mit dem Schulabschluss. Gleich nach dem Abitur ist sie zurück nach Köln gezogen, nicht aus Nostalgie, sondern weil sie an der juristischen Fakultät einen Studienplatz bekommen hatte. Trotzdem war sie vom ersten Tag an entschlossen, Köln zu ihrer Heimat zu machen. Regelrecht berauscht war sie damals von dem Gedanken, nie mehr umziehen zu müssen, wenn sie es nicht wollte; sich ein Leben aufzubauen, einen Freundeskreis, wie es ihr gefiel. Ein Wiedersehen mit alten Kölner Schulkameraden allerdings gehörte nicht zu ihrem Plan, also hatte sie es vermieden.
Judith dreht sich eine Zigarette. Im Grunde genommen weiß sie nichts von ihrer ehemaligen Mitschülerin, und vermutlich ist es nicht nur falsch, sondern auch anmaßend, zu denken, dass ein paar geteilte Erlebnisse als Teenager und ihre eigene unrühmliche Rolle damals irgendeinen Einfluss auf Charlottes Leben gehabt haben könnten – oder gar auf ihr Verschwinden. Aber verschwunden ist Charlotte, so viel steht fest. Jedenfalls scheint niemand sie in den letzten sieben Wochen gesehen zu haben. Judith zündet ihre Zigarette an und genießt das vertraute Prickeln des Nikotins in ihren Lungen. Was ist mit Charlotte passiert? Wie ist ihr Leben verlaufen? Ist es möglich, dass sie hier im Mausoleum ihres Elternhauses glücklich war? Ist ihr Verschwinden die Spätfolge eines verkorksten Lebens – oder ist sie fortgegangen, um ihr Glück zu finden? Und selbst wenn, was bedeutet das schon? Judith zieht an ihrer Zigarette. Wir jagen dem Glück hinterher, unterwerfen uns unserer Sehnsucht danach wie einem nimmersatten Gott. Wir weigern uns zu akzeptieren, dass das Leben auch Fehlschläge hat. Alltag. Unglücke. Eltern und Partner, die uns verraten oder verlassen. Im Grunde ist diese Hatz nach dem Glück nur eine Spielart von Bequemlichkeit. Weil wir uns weigern zu akzeptieren, dass das Leben nicht nur Sonnenseiten hat und dass uns trotzdem nichts anderes übrig bleibt, als immer weiterzuatmen, ob nun gute Zeiten kommen oder schlechte.
Charlotte wollte meine Freundin sein, denkt Judith. Ich habe sie zurückgewiesen. Das ist damals passiert, weiter nichts, Ende der Geschichte, Punkt. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht, und das löst Judith aus ihrer Erstarrung. Sie drückt ihre Zigarette aus und steht auf. Wenn es in dieser verlassenen Villa einen Hinweis auf Charlottes gegenwärtigen Aufenthaltsort gibt, wird sie ihn finden.
ooo
Im Stadtteil Brück stopft Manni die Taxiquittung in die Hosentasche, schiebt sich ein Fisherman’s Friend zwischen die Zähne und sieht sich um. Die Doppelhäuser sehen aus wie überall, auch die Vorgärten bieten das übliche Programm. Blümchen und eine Holzbank, manchmal ein Miniaturbaum mit grotesk gestutzten Ästen und dann natürlich dieser ganze Plastikkram, der schon von weitem signalisiert, dass die Bewohner dieser Häuser sich redlich bemühen, etwas für das Einkommen der Rentner von morgen zu tun. Manni steigt über ein rotes Bobbycar, Schaufeln, Eimer und einen schlappen Fußball, die auf dem Zierpflasterweg des Hauses ein hässliches Chaos bilden. Noch bevor er klingeln kann, stößt ein Mann die Eingangstür auf, barfuß und blond. An seinen verwaschenen Jeansbeinen kleben zwei Kleinkinder mit schokoladenverschmierten Mündern.
„Kripo?“ Ohne Mannis Dienstausweis zu beachten, packt der Mann das größere Kind an den Schultern. „Geh jetzt bitte mit deiner Schwester ins Wohnzimmer. Papi und Mami wollen allein mit diesem Mann sprechen.“
Ölgötzengleich starren die beiden Rotznasen zu Manni hoch. Der Mann macht eine Bewegung mit den Hüften. „Leander, Marlene – ihr wisst, was wir verabredet haben. Geht jetzt ins Wohnzimmer, sonst war’s das mit dem Kinderkanal für die nächsten Wochen und ich steck euch direkt ins Bett.“
Diese Drohung scheint zu wirken, im Zeitlupentempo löst sich die Brut mit den hoffnungsschwangeren Vornamen von den Beinen des Barfüßigen, der ihnen noch einen letzten Stups in die erwünschte Richtung gibt, bevor er sich an Manni
wendet.
„Frank Stadler, kommen Sie rein.“
Stadlers Frau, Martina, ist in der Küche. Mit angezogenen Beinen und leerem Blick hockt sie auf einer Eckbank hinter einem grob gezimmerten Holztisch. Ihr kastanienrotes Haar fällt in schimmernden Wellen über ihre Schultern, sie trägt ein hellgrünes Trägerkleid und sieht richtig klasse aus, wenn man von ihren verquollenen Augen mal absieht. Ihre schlanken Finger umklammern irgendetwas. Als hinge ihr Leben davon ab, den Griff keinen Millimeter zu lockern.
„Sie müssen Jonny finden“, sagt sie statt einer Begrüßung.
Manni nickt und setzt sich ihr gegenüber. Ja, wir werden deinen Jungen finden, denkt er. Früher oder später. Und vielleicht wünschst du dir dann, dass wir es nicht getan hätten, sehnst dich zurück nach der Ungewissheit, die du jetzt nicht auszuhalten glaubst. Stadler schiebt ein leeres Glas vor ihn hin und füllt es mit Wasser aus einer dieser Plastikflaschen, in denen Geizhälse ihr Sprudelwasser selber herstellen. Manni trinkt einen Schluck. Das Wasser ist warm und schmeckt schal. Er stellt das Glas auf den Tisch.
„Sie vermissen also Ihren ältesten Sohn, Jonathan Stadler. Er ist vierzehn …“
„Röbel“, unterbricht ihn Martina Stadler, „Jonny heißt Röbel mit Nachnamen.“
„Röbel.“ Manni lässt den Stift wieder sinken. „Aber Sie beide heißen Stadler?“
„Jonny ist eigentlich der Sohn von Martinas Schwester“, sagt Frank Stadler. „Wir haben ihn zu uns genommen, weil seine Eltern tödlich verunglückt sind.“
„Lass doch jetzt diese alten Geschichten“, Martina Stadlers Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. „Das tut doch nichts zur Sache. Sie sollen Jonny finden, das ist wichtig.“
„Jonathan Röbel, genannt Jonny“, sagt Manni. Martina ist also die leibliche Tante des Jungen und scheint wirklich unter seinem Verschwinden zu leiden. Aber was ist mit ihrem Mann? Sind Stiefväter potentielle Täter? Ist das der Grund, weswegen sein Chef ein innerfamiliäres Gewaltverbrechen in Betracht zieht? Manni mustert Stadler, der sich mit der Rechten über Stirn und Stoppelhaar fährt. Augenblicklich bilden sich an seinem Haaransatz neue Schweißperlen. Er ist noch jung, etwa so alt wie Manni selbst, um die 30, und die beiden Rotznasen haben sichtbar keinen Respekt vor ihm. Aber was heißt das schon? Vielleicht war Stadler auf den pubertierenden Stiefsohn eifersüchtig, betrachtete ihn als einen Konkurrenten in seinem Heim, den es wegzubeißen galt? Einen Moment lang denkt Manni an seinen eigenen Vater. Ist der jemals jung und lustig gewesen? Hat er sich je für seinen einzigen Sohn interessiert? Manni kann sich nicht daran erinnern. Überhaupt ist es viel zu heiß und stickig, um sich auf mehr als eine Sache zu konzentrieren.
„Seit wann lebt Jonathan bei Ihnen?“
„Seit drei Jahren.“ Frank Stadler räuspert sich. „Ich weiß schon, was Sie als Nächstes fragen wollen. Ja, es war schwierig, natürlich war es das, was glauben Sie denn? Ein trauernder Junge, wir selbst unter Schock, meine Frau und ihre Schwester standen sich sehr nahe, und unsere Marlene war damals erst ein paar Monate alt.“ Wieder wischt er sich mit dem Handrücken über die Stirn. „Es war also schwierig, und zweimal ist Jonny auch abgehauen, im ersten Jahr, wollte sein altes Zuhause noch mal sehen. Aber das ist vorbei, glauben Sie mir. Wir haben das alle zusammen geschafft. Meine Frau hat Recht. Dass er jetzt verschwunden ist, hat nichts mit damals zu tun.“
„Wo ist dieses alte Zuhause denn?“, fragt Manni. Egal was Stadler sagt, natürlich muss man auch den früheren Wohnort des Jungen überprüfen. Rein statistisch gesehen verzeichnet das KK 66 des Kölner Polizeipräsidiums jährlich 2400 Vermisstenanzeigen. Aber die wenigsten Vermissten sind wirklich verschwunden. Jugendliche, gerade wenn sie aus zerrütteten Verhältnissen stammen, kommen und gehen, auch wenn die Eltern natürlich immer schwören, dass alles in Ordnung ist. Aber was wissen die schon von ihren Kindern?
„Jonny lebte früher in der Eifel“, sagt Stadler mit schmalen Lippen. „In Daun, wenn Sie es genau wissen wollen.“
„Ich brauche die Adresse. Und möglichst auch die von früheren Freunden dort.“
„Jonny ist nicht in der Eifel, er wäre dort nicht hingefahren, ohne uns zu informieren“, sagt Stadler mühsam beherrscht. „Sicherheitshalber haben wir trotzdem mit Bekannten in Daun telefoniert. Niemand hat ihn gesehen.“
„Hatten Sie Krach, bevor er verschwand? Hat etwas den Jungen bedrückt?“
„Nein, nichts.“ Beide Stadlers schütteln den Kopf.
„Ist er gesund? Intelligent?“
„Warum fragen sie das? Ja.“
„Sportlich?“
Nicken.
„Zuverlässig?“
„Absolut.“
„Aber früher ist er manchmal weggelaufen, das haben Sie selbst gerade gesagt.“
„Herrgott, weil es damals so war. Damals, verstehen Sie, vor drei Jahren. Als er sich hier noch nicht eingelebt hatte. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie unsere Ehrlichkeit zum Anlass nehmen wollen, nicht nach dem Jungen zu suchen, hätte ich Ihnen das natürlich verschwiegen.“
Nach allem, was Manni in den letzten Monaten über verschwundene Jugendliche gelernt hat, ist es sehr gut möglich, dass Jonny erneut fortgelaufen ist. Aber vielleicht auch nicht. Manni fühlt kalten Schweiß in seinem Nacken. Was, wenn er die Gefährdung des Jungen falsch einschätzt? Was, wenn der Junge entführt wurde, wenn er irgendwo in einem Erdloch hockt, womöglich verletzt und außer sich vor Angst?
„Seine Taschenlampe.“ Martina Stadler schluchzt auf. „Jonnys Taschenlampe lag noch in seinem Bett. Aber das kann doch eigentlich nicht sein, er vergisst sie nie, er kann doch nicht einschlafen ohne seine Taschenlampe.“
Ruhig bleiben, Mann, ruhig bleiben. Manni atmet tief durch. „Kann ich diese Taschenlampe mal sehen?“
Schluchzen.
„Bitte, Martina, zeig sie dem Kommissar.“ Behutsam, als fürchte er, sie zu verletzen, langt Frank Stadler über den Tisch und beginnt, die Finger seiner Frau von dem Gegenstand zu lösen, an den sie sich klammert.
„Ich habe Jonnys Bettdecke aufgeschüttelt, da ist sie runtergefallen.“ Martina Stadlers ganzer Körper bebt jetzt, sie ist kaum zu verstehen. „Ich habe sie sofort aufgehoben und sie funktioniert noch, aber das Glas ist kaputt.“
„Nur ein Sprung. Jonny wird das bestimmt gar nicht bemerken.“ Frank Stadler hat die Taschenlampe jetzt erobert und betrachtet sie, bevor er sie vor Manni auf den Tisch stellt.
„Kaputt“, flüstert Martina. „Kaputt. Er hat doch Angst ohne seine Taschenlampe. Warum hast du ihn denn nicht an seine Taschenlampe erinnert?“
„Mensch, Tina, du weißt doch, wie es ist. Die Kleinen haben gequengelt, wir waren spät dran, und Jonny hat geschworen, dass er alles hat.“
„Wann genau war das?“, fragt Manni.
„Was meinen Sie?“ Stadler sieht ihn an, als hätte er seine Anwesenheit vorübergehend vergessen.
„Als Sie mit Jonny von hier wegfuhren. Wann war das?“
„Am Samstagvormittag, so um elf. Wir haben die beiden Kleinen zu meiner Mutter nach Bensberg gebracht und sind dann direkt ins Zeltlager gefahren.“
Manni blättert in dem Block, den er der Bedienung im Maybach abgeluchst hat. „Und das Zeltlager war am Rande des Königsforsts, auf dem Gelände eines Clubs, der sich Kölsche Sioux nennt.“
Stadler nickt. „Ja, verdammt. Warum sind da eigentlich nicht längst Suchtrupps im Einsatz?“
„Erst einmal müssen wir uns ein Bild von der Lage verschaffen. Wann haben Sie Jonny zum letzten Mal gesehen?“
Martina Stadler beginnt jetzt, noch heftiger zu weinen.
„Hören Sie“, Manni versucht, Frank Stadlers Aufmerksamkeit zu erlangen, „bitte beantworten Sie meine Frage. Und vielleicht wäre es gut, wenn Ihr Hausarzt …“
„Jonnys Taschenlampe ist kaputt. Ich habe sie kaputtgemacht! Mein Gott, ich halte das nicht aus!“ Martinas Stimme kippt.
„Sag das nicht.“ Frank Stadler streichelt die schlanken Finger, die jetzt hölzern und nutzlos wirken, wie die einer Marionette ohne Fäden. „Bitte, Martina, nichts ist kaputt. Und Jonny hat immer noch Dr. D.“
„Wer ist …“ Weiter kommt Manni nicht, denn als sei das letzte D ein Einsatzkommando, stürzen die Rotznasen unter ohrenbetäubendem Geheul in die Küche. „Dee-Dee! Jonny! Dee-Dee! Jonny! Wo ist Dee-Dee?“
Bevor einer der Erwachsenen reagieren kann, krabbeln sie bereits auf die Eckbank und rammen ihrer Mutter die schmierigen Gesichter in Brust und Bauch. Mechanisch beginnt sie, die verstrubbelten Hinterköpfe zu streicheln und beruhigenden Nonsens zu murmeln.
Frank Stadler steht auf und bedeutet Manni mit einer Kopfbewegung, ihm zu folgen. Offenbar hat er es nun aufgegeben, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Ein feines Rinnsal kriecht an seinem Ohr vorbei Richtung Kinn. Aus dem Wohnzimmer trällert eine penetrante Kinderstimme ein Liedchen von einem Krokodil namens Schnappi. Manni hat das unbehagliche Gefühl, dass ihm in diesem Haus die Luft knapp wird.
„Ich weiß nicht, wann Jonny verschwunden ist“, sagt Stadler leise. „Die Kids leben im Lager nach ihren eigenen Regeln.“
Abrupt dreht er sich um. „Kommen Sie, ich zeige Ihnen Jonnys Zimmer.“
Beinahe sieht es so aus, als würde Stadler vor ihm fliehen. Manni ignoriert sein Bedürfnis nach Sauerstoff und heftet sich an seine Fersen.
„Wer ist Dr. D.?“, wiederholt er, als sie das Kellergeschoss erreicht haben.
Frank Stadler öffnet die Tür zu einem Souterrainzimmer und starrt auf ein Hundekörbchen, das neben einem ordentlich mit dunkelblauer Bettwäsche bezogenen Bett steht.
„Dee-Dee, Dr. D., ist Jonnys Hund, ein Rauhaardackel. Die beiden sind unzertrennlich.“
ooo
Es ist, als ob die gedämpfte Stille in Charlottes Villa die Wut, die Judith eben noch empfunden hat, verschlucken würde. Die Wärme, die allmählich durch die geöffneten Fenster ins Haus kriecht, die Möbel, die aussehen, als sei die Zeit vor einigen Jahrzehnten stehen geblieben, und die Erinnerungen an Charlotte verleihen ihr ein Gefühl von Unwirklichkeit. Sie berührt noch nichts, verändert nichts, aber all ihre Sinne sind hellwach. Eine Hausdurchsuchung ist die schrittweise Entschlüsselung eines fremden Mikrokosmos. Jedes Zuhause hütet die Geheimnisse seiner Bewohner, sogar dann, wenn sie sich bemüht haben, alle Spuren, die sie als verräterisch empfinden, zu vernichten. Hat Charlotte Simonis Liebesbriefe und Kontoauszüge verbrannt, Fotoalben oder die Police der Lebensversicherung ihres Vaters, was gewisse Fragen im Hinblick auf seine Todesursache nahe legen würde? Hat sie aufgeräumt, wo zuvor Chaos herrschte? Ich weiß es nicht, denkt Judith, während sie sich von Raum zu Raum bewegt. Dieser erste stille Rundgang ist ihr persönliches Auftaktritual zu einer Durchsuchung. Sie geht nicht systematisch vor, wie es die Kollegen von der Spurensicherung tun würden. Stattdessen übergibt sie sich mit allen Sinnen dem Haus, lässt sich von ihm leiten, seinen Gerüchen und Geräuschen, vor allem aber von alldem, was zu fehlen oder nicht zu passen
scheint.
Das Parterre besteht aus Küche, Wirtschaftsraum, Gäste-WC, Ess- und Wohnzimmer, Eingangshalle und dem Büro von Charlottes Vater. Ohne Zweifel ist dies der freundlichste Raum, obwohl hohe Bücherregale mit Fachliteratur zwei der Wände verdunkeln. Vor dieser Regalfront bilden zwei dunkelgrüne Ledersessel und ein poliertes Mahagonitischchen das perfekte Ambiente für Fachsimpeleien oder eine Partie Schach. An der dritten Wand hängen Fotografien, Gemälde und Radierungen von Tieren, Pflanzen und Landschaften. Die Qualität der Bilder variiert erheblich, einige Fotos sind stark verblichen und zeigen Männer mit Rucksäcken und Kniebundhosen, die mit Eroberermienen in die Kamera blicken. Irgendetwas an der Bilderwand ist irritierend. Judith bleibt stehen und betrachtet die Bilder, analytisch, konzentriert, eines nach dem anderen. Etwas ist falsch an der Bilderwand, sie kann das fühlen, aber sie vermag nicht zu sagen, was.
Im Obergeschoss durchquert sie das weiße Zimmer mit den glasäugigen Kindheitsreminiszenzen. Charlottes zweites Zimmer liegt dahinter, hellblau gestrichen. Ein schmales Bett mit mädchenhaft geblümtem Bezug, ein weißlackierter Schrank, ein Schaukelstuhl und ein Nachttisch sind die einzigen Möbel. Über dem Bett ist mit Nadeln das Kitschposter eines pastellfarbigen Sonnenuntergangs an die Tapete geheftet. Dies ist nicht das Zimmer einer erwachsenen Frau.
Nebenan befinden sich Bad, Gästezimmer und ein großer Raum mit Schrankwand, der wirkt wie das klassische Elternschlafzimmer. Doch statt des Doppelbetts steht ein Krankenhausbett an der Wand, auf dem Boden liegt kein Teppich, sondern Linoleum, und der Geruch nach Desinfektionsmittel ist überwältigend.
Charlotte hatte Biologie studiert, wie ihr Vater, und sogar mit einer Promotion begonnen, hat Berthold erzählt. Verhaltensforschung, irgendwas mit Ratten. Doch dann bekam Charlottes Mutter Brustkrebs und erholte sich nicht wieder. Sieben Jahre hatte Charlotte sie gepflegt, und kaum war die Mutter gestorben, erkrankte der Vater. Judith untersucht das Bett, seine makellosen, weißen Laken. Sie versucht sich Charlottes Leben vorzustellen: eine Existenz zwischen Kinderzimmer und Bettpfanne, die eigene Karriere ist ins Unerreichbare entglitten. Hoffnung bedeutet, dass die Eltern sterben. Es kann nicht sein, denkt sie. Egal was Charlotte gesagt oder getan hat, sie muss gelitten haben, sie muss Aggressionen gehabt haben. Und Träume. Niemand lebt ohne Träume.
Doch wovon auch immer Charlotte geträumt haben mag – nach mehreren Stunden intensiver Suche in den Schränken, Schubladen und Nischen des Obergeschosses hat Judith immer noch keinen Hinweis gefunden. Noch einmal betrachtet sie Charlottes Puppen, Gralshüter mit staubigen Wimpern, aber die Schubladen der Kommode, auf der sie sitzen, sind leer. Judith geht hinunter in die Küche und wäscht sich Hände und Gesicht. Sie trinkt zwei Gläser Leitungswasser, füllt das Glas erneut und nimmt es mit auf die Terrasse. Entfernter Verkehrslärm von der Rheinuferstraße schwebt in der Luft, ein leises, konstantes Sirren. Komm, lass uns was mit den Puppen spielen, hatte die 14-jährige Charlotte gesagt. Hanni und Nanni, Dolly im Internat, ich hab genug Puppen für eine ganze Schulklasse, komm Judith, das macht Spaß. Aber Judith hatte sich nichts aus der unerbittlich fröhlichen und geordneten Welt Enid Blytons gemacht.
Sie geht zurück ins Haus und einen Moment lang erscheint ihr die Schulkameradin zum Greifen nahe: ein hoch gewachsenes Mädchen mit chronisch gekrümmten Schultern, das sich zu oft entschuldigt. Was war Charlottes Traum? Wieder betrachtet Judith die Bilderwand im Arbeitszimmer, kann aber immer noch nicht sagen, was sie daran irritiert.
Im Schreibtisch findet sie Büromaterial sowie Aktenordner mit Kontoauszügen, Versicherungspolicen und wissenschaftlichen Korrespondenzen des Professors. Geldsorgen hatte Charlotte offenbar nicht, auf ihr Konto fließt regelmäßig eine beachtliche Summe aus einem Anlagefonds, die laufenden Kosten – auch der Lohn des Gärtners – werden per Dauerauftrag beglichen, ein Perpetuum mobile, das Charlottes Anwesenheit nicht erfordert. Judith kniet sich auf den Perserteppich und blättert durch die Briefe. Fachsimpeleien, höfliches Geplänkel, nichts Aufregendes, nichts Persönliches. Judith streckt die Hand aus und betastet die Rückwand des Schreibtischfachs hinter den Ordnern. Dort liegt etwas. Sie greift zu und zieht die Gegenstände hervor: zwei gerahmte Fotografien. Eine ist die Nahaufnahme eines fetten Fliegenpilzes, die andere zeigt eine etwa 25-jährige Charlotte mit verwehtem blondem Haar auf einer Bergwiese. An ihrer Seite steht ein älterer Mann in Kniebundhose, der ihr Vater sein muss, denn die Ähnlichkeit seiner Kinn- und Augenpartie mit der von Charlotte ist unübersehbar, auch wenn das Glas gesprungen ist.
Die Fotos in den Händen, richtet Judith sich auf und betrachtet die Bilderwand erneut. Jetzt sieht sie es. In der Mitte hängt ein Vogelbild, wie hineingequetscht in eine zu kleine Lücke. Es ist ein Ölgemälde in einem schlichten blau gebeizten Holzrahmen. Der Vogel scheint am Ufer eines Sees zu brüten, sein schwarzer Schnabel sticht aus seinem schwarzen Kopf, sein Rückengefieder trägt weiße Tupfer, die wie aufgemalte Karos wirken, die Brust ist weiß. Am irritierendsten ist sein Auge. Kreisrund und rubinrot glimmt es Judith an. Als ob das Innere des Vogelkopfs aus Lava bestünde.
Aus einem Impuls heraus hält Judith die beiden Bilderrahmen vor das Gemälde. Sie sind deutlich kleiner. Sie hebt das Gemälde von der Wand. Treffer! In der Lücke, die es an der Wand hinterlässt, zeichnen sich deutlich die Umrisse zweier kleinerer Bilderrahmen ab, die beiden Bilder aus dem Schreibtisch passen exakt hinein. Judith dreht das Vogelbild herum. „Gavia immer – Eistaucher – Stimme der Wildnis – 5/2003“, hat jemand auf die Rückseite der Leinwand geschrieben. Auch der Stempel eines Kunstateliers in der Südstadt ist zu erkennen. Judith wählt die Nummer, erreicht aber nur einen Anrufbeantworter.
Später trifft sie bei den Platanen im Römerpark den Rechtsmediziner Karl-Heinz Müller. Die Sommerluft liegt jetzt wie Samt auf ihrer Haut, der Himmel über ihnen verblasst, der Rotwein, den Karl-Heinz Müller mitgebracht hat, schmeckt nach Beeren und Rauch. Sie bewegen sich langsam, reden nicht viel, ein eingespieltes Team. Sie polieren die Boulekugeln, und das glatte Metall schmiegt sich warm in ihre Hände. Sie werfen die Kugeln mit trägen, fließenden Bewegungen. Sie rauchen und trinken den Wein. Als es dunkel wird, teilen sie sich im Volksgarten eine Pizza. In den Kastanien über ihnen hängen Lautsprecherboxen, aber heute Abend stört Judith das Gedudel nicht, weil sie einen Platz am Wasser ergattert haben, weil die Lichterketten aus den Kastanien zu ihren Füßen schwimmen, weil die Stimmen der anderen Gäste sie einhüllen und die Luft immer noch tropisch ist.
In ihrer Dachwohnung steht noch die Hitze des Tages, das Thermometer im Badezimmer zeigt 38 Grad. Sie macht sich auf der Dachterrasse ein Lager aus Decken und Matten. Das Letzte, was Judith vor dem Einschlafen wahrnimmt, sind die unsteten Flugmanöver der Fledermäuse und das fiebrige Summen der Stadt, die nicht zur Ruhe kommt.
ooo
Das Klingeln reißt Elisabeth Vogt aus einer an Apathie grenzenden Erschöpfung. Sie braucht lange, um sich vom Küchensofa hochzustemmen und ins Wohnzimmer zu schleppen, wo der Telefonapparat immer weiter nach ihr schreit. Kurz vor acht, kurz vor der Tagesschau, Carmen will wissen, ob sie noch lebt. Jeden Abend um kurz vor acht Uhr ruft sie deshalb an. In ihrer Eile, das Telefon zu erreichen, prallt Elisabeth mit der Hüfte an die Anrichte. Tränen schießen ihr in die Augen, das wird einen feinen Bluterguss geben, sie presst die Handfläche auf die schmerzende Stelle. Ihre Hand fühlt sich kühl an durch den Stoff ihres Kleides, dabei hat sie heute wahrlich genug geschwitzt und auch jetzt klebt die Schwüle des Tages in den abgedunkelten Räumen. Sie hebt den Hörer von der Gabel.
„Vogt, ja bitte.“
„Du klingst so komisch, Mutter. Geht’s dir nicht gut?“
„Ich bin nur eingedöst.“ Elisabeth hört selbst, wie heiser und gepresst ihre Stimme klingt. Aber so darf das nicht sein, so führt das nur geradewegs in eine erneute Diskussion darüber, wann sie endlich Vernunft annimmt, Barabbas weggibt und das Haus, in dem sie 43 Jahre lang mit ihrem geliebten Mann gelebt hat, verkauft.
„Irgendetwas stimmt doch nicht. Was ist mit dir, Mutter?“ Mutter ist so ein hartes Wort, wenn ihre Tochter die Konsonanten abfeuert, als wollte sie Elisabeths Herz treffen.
„Alles ist in Ordnung, mir geht es gut“, antwortet Elisabeth mühsam.
„Du hast wieder nicht genug getrunken.“ Jetzt ist die Resignation in Carmens Stimme gekrochen. Elisabeth überlegt, was passieren würde, wenn sie ihrer Tochter eine ehrliche Antwort gäbe. Heute Morgen hat Barabbas einen Rauhaardackel totgebissen, könnte sie sagen. Aber mach dir keine Sorgen, das war ein Ausrutscher, das macht er nie wieder, und niemand hat es gesehen und der Hund war ein Streuner, trug noch nicht einmal ein Halsband. Ich habe Barabbas nach Hause gebracht und dann bin ich zurückgelaufen und habe den Dackel beerdigt, ich konnte ihn doch nicht dem Ungeziefer überlassen oder sogar Schlimmerem. Ich habe ihn in dem karierten Köfferchen begraben, das du als Kind mithattest, wenn wir nach Juist gefahren sind, weißt du noch? Aber mach dir keine Sorgen, ich habe tief gegraben, niemand wird ihn finden. Deshalb bin ich jetzt erschöpft.
„Sag doch was, Mutter.“
Wann hat sie aufgehört, mit ihrer Tochter reden zu wollen? Wann hat sie akzeptiert, dass Blutsverwandtschaft nicht notwendigerweise Verständnis füreinander mit sich bringt? Elisabeth räuspert sich. „Du hast Recht, ich habe heute zu wenig getrunken.“
„Du musst besser auf dich aufpassen, Mutter.“
„Ja.“
„Trink jetzt was. Und schlaf gut.“
„Du auch, Carmen.“
Sie hat tatsächlich Durst sobald sie den Hörer auflegt, fühlt sie, wie trocken ihre Kehle ist. Carmen hat Recht, immer wieder vergisst sie das Trinken. Glücklich solle sie sich schätzen, dass die Tochter sich so rührend um sie sorgt, sagen die Ärzte. Nicht alle Kinder sind so, Frau Vogt, nicht alle Kinder lieben ihre Eltern.
Aber Elisabeth fühlt sich nicht geliebt, sie fühlt sich kontrolliert. Gut, dass sie noch immer fähig ist, ein Geheimnis zu bewahren. Und das war noch nie so wichtig wie jetzt, denn schafft sie das nicht, werden sie Barabbas töten.
ooo
Der Kommissar Manfred Korzilius ist nur die Vorhut gewesen, schon bald danach sind zwei uniformierte Kollegen hinzugekommen, wie eine Hausbesetzung hat sich ihre Geschäftigkeit angefühlt. Sie wollte diese fremden Männer fortjagen, hat sie angeschrien, dass sie Jonny nicht hier finden werden, sondern im Königsforst, wo er verschwunden ist, dass sie sich beeilen müssen, weil es dunkel wird. Aber sie haben nicht auf sie gehört, haben nur immer wiederholt, dass man Schritt für Schritt vorgehen muss. Dass sie sich nicht so viele Sorgen machen soll, wahrscheinlich wird Jonny, wie die meisten vermissten Jugendlichen, morgen wieder auftauchen. Heil und unversehrt. Außerdem sei es warm, selbst wenn Jonny draußen übernachten muss, kann ihm nicht viel passieren. Und dann hat er ja auch noch seinen Hund. Wenn Jonny was passiert wäre, hätte der Dackel sicher den Weg zurück ins Lager gefunden, oder Spaziergänger hätten ihn gemeldet. Aber nichts von alldem ist geschehen, und das kann man durchaus als gutes Zeichen sehen, sagen sie. Als Zeichen dafür, dass Jonny und sein Hund momentan einfach nicht nach Hause kommen wollen.
Hauen Sie ab, lassen Sie uns in Ruhe, wenn sie unseren Jungen nicht suchen wollen, hat sie schließlich geschrien. Aber als die Polizisten sich tatsächlich verabschieden, wird ihr klar, dass das ein Fehler war, denn jetzt bricht die Verzweiflung endgültig ins Haus. Martina Stadler presst die Stirn ans Küchenfenster. Die Silhouette von Manfred Korzilius faltet sich soeben in einen Polizeiwagen, die Fenster der umliegenden Häuser sind längst dunkel, aber was heißt das schon, vermutlich stehen die Nachbarn hinter den Gardinen und beobachten, wie die grünberockten Botschafter der Katastrophe sich verabschieden. Sind betroffen und zugleich unsagbar froh, dass ihr eigenes Leben einmal mehr verschont geblieben ist.
Frank tritt hinter sie und legt ihr die Hände auf die Schultern.
„Komm ins Bett, Tina. Die Polizei hat Recht. Wir können im Moment nichts anderes für Jonny tun, als bei Kräften zu bleiben.“
„Wieso weißt du nicht, wann genau Jonny verschwunden ist?“ Leise, beinahe tonlos stellt sie die Frage, die dieser blonde Kommissar Korzilius mehrfach wiederholt hat, ohne eine befriedigende Antwort darauf zu bekommen.
„Mensch, Tina, Jonny ist vierzehn, ich konnte ihn doch nicht auf Schritt und Tritt beaufsichtigen. Er kennt alle im Camp, er kennt den Wald, er ist mit Dr. D. herumgestromert wie immer, der Späher, du weißt doch, wie der ist, er braucht sein Maß an Freiraum. Und abends hatten die Kids dann eine streng geheime Versammlung, kein Zutritt für Erwachsene, ich dachte einfach, Jonny wäre dabei, alle haben das gedacht, und beim Frühstück dachte ich, dass Jonny eben gern früh aufsteht und mit Dr. D. eine Morgenrunde dreht.“
Vorsichtig drücken seine Daumen in die Verspannungen zwischen ihren Schulterblättern. Er kennt sie so gut, ihr Mann, ihr Freund, ihre Liebe. Selbst in den schlimmsten Anfangsphasen mit Leander und Marlene, wenn sie die Nächte durchschrien, dass die Erschöpfung Martina schließlich in ein namen- und freudloses Nichts verwandelte, das keinen Wunsch mehr hatte, außer dem Verlangen nach Schlaf, haben Franks Zärtlichkeiten ihr Mut und Kraft gegeben.
„Komm ins Bett, du musst dich ausruhen“, wiederholt er leise.
Aber jetzt ist an Schlaf nicht zu denken, und Franks Berührung vermag sie nicht von diesem einen Gedanken abzulenken, der Gift ist, tabu, und trotzdem immer mächtiger wird, seitdem dieser Manfred Korzilius seine Fragen gestellt hat: Ich hätte es gemerkt, wenn Jonny verschwindet.
Martina windet sich aus Franks Händen. Sie muss allein sein, auch wenn alles in ihr nach Trost schreit, sie darf sich nicht, gehen lassen, darf nicht den Verstand verlieren. Sie weiß nicht, wohin, stolpert im Wohnzimmer über irgendein Kinderspielzeug und findet sich schließlich im Garten wieder. Eine Frachtmaschine dröhnt vom Flughafen her über den Garten, viel zu tief, zerschneidet die Nacht, und einen Moment lang verspürt Martina den absurden Wunsch, das Flugzeug möge auf sie herabstürzen, damit sie die Fragen des Kommissars in ihrem Kopf nicht mehr hören muss.
Ein paar Glühwürmchen irrlichtern durch den Garten, freundliche Käfer mit kleinen Laternen in den Händen, so sind sie in Marlenes Lieblingsbilderbuch dargestellt. Jonny hat Lene dieses Buch manchmal vorgelesen, den aufmerksamen Dr. D. zu seinen Füßen, in den Händen seine geliebte Taschenlampe, dieses letzte Andenken an seinen Vater, und wenn sie das Licht löschten, hat er für Lene mit der Taschenlampe Glühwürmchen gespielt. An, aus, an, aus. Jonny hat Lene zugeflüstert, dass die Glühwürmchen sich mit einem geheimen Morsealphabet verständigen, und er würde ihnen jetzt sagen, sie sollen über Nacht gut auf Lene aufpassen und sie behüten.
Wo bist du, Jonny? Wie willst du jetzt deine Lichtzeichen setzen? Und wer behütet dich? Ich kann nicht glauben, dass du weg bist, ich will nicht einmal daran denken, dass du vielleicht tot bist. Martina schaltet Jonnys Taschenlampe ein, dann wieder aus. Ist der Lichtstrahl schwächer geworden? Kann Jonny auf irgendeine Weise wissen, dass sie hier auf dem Rasen kniet und für ihn Signale morst?
„Hier bist du.“ Frank geht neben ihr in die Hocke, will sie umarmen. Sie schüttelt seine Annäherung ab, verwendet alle Kraft darauf, sich weiter auf die Taschenlampe zu konzentrieren, ihre Verbindung zu Jonny. An, aus, an, aus. Wie schnell ein Licht verlöschen kann.
„Tina …“
„Geh weg“, sagt sie. „Lass mich allein.“
















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.