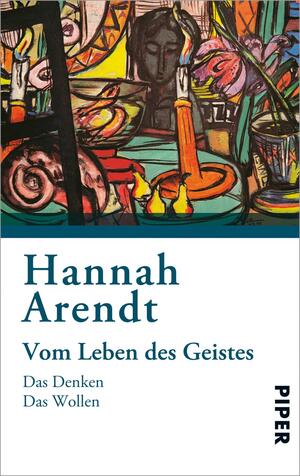
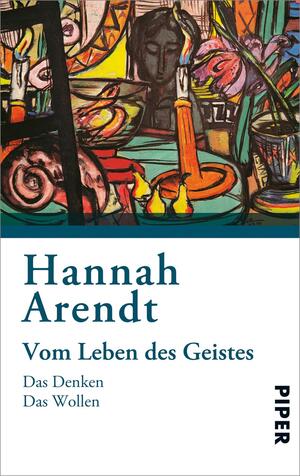
Vom Leben des Geistes Vom Leben des Geistes - eBook-Ausgabe
Das Denken - Das Wollen - Herausgegeben von Mary McCarthy
Vom Leben des Geistes — Inhalt
„Vom Leben des Geistes“, das letzte große Werk Hannah Arendts, hat den Charakter eines Vermächtnisses. Die Beschäftigung mit dem Wesen des Denkens führte die Philosophin zur Betrachtung der beiden anderen spezifisch menschlichen Fähigkeiten: des Wollens und des Urteilens.
Leseprobe zu „Vom Leben des Geistes“
Einleitung
Das Denken führt zu keinem Wissen wie die Wissenschaften
Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit
Das Denken löst keine Welträtsel
Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte zum Handeln
Martin Heidegger, „Was heißt Denken?“
Der Titel „Vom Leben des Geistes“, den ich dieser Vorlesungsreihe gegeben habe, klingt anspruchsvoll; über das Denken zu sprechen, scheint mir so vermessen, daß ich das Gefühl habe, ich sollte eher mit einer Rechtfertigung als mit einer Entschuldigung beginnen. Das Thema selbst bedarf natürlich keiner Rechtfertigung, [...]
Einleitung
Das Denken führt zu keinem Wissen wie die Wissenschaften
Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit
Das Denken löst keine Welträtsel
Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte zum Handeln
Martin Heidegger, „Was heißt Denken?“
Der Titel „Vom Leben des Geistes“, den ich dieser Vorlesungsreihe gegeben habe, klingt anspruchsvoll; über das Denken zu sprechen, scheint mir so vermessen, daß ich das Gefühl habe, ich sollte eher mit einer Rechtfertigung als mit einer Entschuldigung beginnen. Das Thema selbst bedarf natürlich keiner Rechtfertigung, schon gar nicht auf dem gewichtigen Forum der Gifford Lectures. Mich beunruhigt lediglich, daß ich mich an ihm versuche, denn weder kann noch möchte ich als „Philosoph“ gelten oder zu denen gezählt werden, die Kant nicht ohne Ironie die „Denker von Gewerbe“ nannte[1]. Es fragt sich also, ob ich diese Probleme nicht besser den Spezialisten hätte überlassen sollen, und die Antwort wird zeigen müssen, was mich dazu trieb, mich aus den verhältnismäßig sicheren Gefilden der Politikwissenschaft und -theorie an diese recht respekteinflößenden Gegenstände heranzuwagen, statt alles schön auf sich beruhen zu lassen.
Was das Faktische betrifft, so hat meine Beschäftigung mit der Geistestätigkeit zwei recht verschiedene Ursprünge. Der unmittelbare Anstoß ergab sich aus meiner Anwesenheit beim Eichmann-Prozeß in Jerusalem. In meinem Bericht über ihn[2] sprach ich von der „Banalität des Bösen“. Dahinter stand keine These oder Theorie, doch irgendwie ahnte ich, daß diese Formulierung unserer literarischen, theologischen und philosophischen Denktradition über das Böse entgegenlief. Das Böse, so haben wir gelernt, ist etwas Dämonisches; seine Verkörperung ist der Satan, der „vom Himmel fällt als ein Blitz“ (Luk. 10, 18), oder Luzifer, der gefallene Engel („Auch der Teufel ist ein Engel“ – Unamuno), dessen Sünde der Hochmut ist („stolz wie Luzifer“), jene superbia, zu der nur die Besten fähig sind: sie möchten Gott nicht dienen, sondern sein wie er. Böse Menschen, so heißt es, handeln aus Neid, sei es aus Enttäuschung darüber, daß ihnen der Erfolg ohne eigenes Verschulden versagt blieb (Richard III.), oder aus dem Neid eines Kain, der Abel erschlug, denn „der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer; aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an“ (1. Mos. 4,4–5). Oder sie handeln aus Schwäche (Macbeth); oder umgekehrt aus jenem mächtigen Haß heraus, den das Böse für das reine Gute empfindet (Jago: „Ich hasse den Mohren; mein Grund kommt von Herzen“; Claggarts Haß auf Billy Budds „barbarische“ Unschuld, den Melville eine „Verworfenheit von Natur“ nennt), oder aus Begierde, der „Wurzel aller Übel“ (radix omnium malorum cupiditas). Ich aber stand vor etwas völlig anderem und doch unbestreitbar Wirklichem. Ich war frappiert von der offenbaren Seichtheit des Täters, die keine Zurückführung des unbestreitbar Bösen seiner Handlungen auf irgendwelche tieferen Wurzeln oder Beweggründe ermöglichte. Die Taten waren ungeheuerlich, doch der Täter – zumindest jene einst höchst aktive Person, die jetzt vor Gericht stand – war ganz gewöhnlich und durchschnittlich, weder dämonisch noch ungeheuerlich. Nichts an ihm deutete auf feste ideologische Überzeugungen oder besondere böse Beweggründe hin; das einzig Bemerkenswerte an seinem früheren Verhalten wie auch an seinem jetzigen vor Gericht und in den vorangegangenen Polizeiverhören war etwas rein Negatives: nicht Dummheit, sondern Gedankenlosigkeit. Im Rahmen des israelischen Gerichtsverfahrens und der Gefängnisordnung funktionierte er ebensogut wie seinerzeit unter dem Naziregime, doch wenn er vor Situationen stand, für die es keine solchen routinemäßigen Verhaltensvorschriften gab, so war er hilflos, und seine von Klischees durchsetzte Sprache im Zeugenstand führte zu einer Art makabrer Komödie, genau wie es während seiner Amtszeit der Fall gewesen sein mußte. Klischees, gängige Redensarten, konventionelle, standardisierte Ausdrucks- und Verhaltensweisen haben die gesellschaftlich anerkannte Funktion, gegen die Wirklichkeit abzuschirmen, gegen den Anspruch, den alle Ereignisse und Tatsachen kraft ihres Bestehens an unsere denkende Zuwendung stellen. Wollte man diesen Anspruch ständig erfüllen, so wäre man bald erschöpft; Eichmann unterschied sich von uns anderen lediglich darin, daß er überhaupt keinen solchen Anspruch kannte.
Dieses Fehlen des Denkens – eine durchaus normale Erfahrung im Alltagsleben, wo wir kaum die Zeit, geschweige denn die Neigung haben, innezuhalten und nachzudenken – rief mein Interesse wach. Ist böses Handeln (Unterlassungs- wie auch Begehungssünden) möglich, wenn nicht nur „niedrige Motive“ (wie es im Rechtswesen heißt) fehlen, sondern überhaupt jedes Motiv, jede spezielle Aktivität des Interesses oder Wollens? Ist Bosheit, wie immer man sie definieren möge, ist dieser „Wille zum Bösen“ vielleicht keine notwendige Bedingung des bösen Handelns? Hängt vielleicht das Problem von Gut und Böse, unsere Fähigkeit, Recht und Unrecht zu unterscheiden, mit unserem Denkvermögen zusammen? Gewiß nicht in dem Sinne, daß das Denken jemals die gute Tat hervorbringen könnte, als ob „Tugend lehrbar“ und lernbar wäre – nur Gewohnheiten und Sitten lassen sich lehren, und wir wissen nur zu gut, wie erschreckend rasch sie verlernt und vergessen werden, wenn neue Verhältnisse eine Veränderung unserer Sitten und Verhaltensweisen erfordern. (Daß gewöhnlich Fragen von Gut und Böse in Vorlesungen über „Moral“ oder „Ethik“ behandelt werden, das zeigt wohl, wie wenig wir über sie wissen, denn das Wort „Moral“ kommt von „mores“, und „Ethik“ kommt von „ethos“, dem lateinischen bzw. griechischen Wort für Sitte und Gewohnheit, wobei das lateinische Wort an Verhaltensregeln denken läßt, während das griechische von dem Wort für Heimat abgeleitet ist, ähnlich wie das englische „habit“.) Die Gedankenlosigkeit, vor der ich stand, ergab sich weder aus einem Vergessen vorher vorhandener – guter – Sitten und Gewohnheiten noch aus Dummheit im Sinne der Verstehensunfähigkeit, ja nicht einmal im Sinne des „moralischen Defekts“, denn sie machte sich ebenso in Situationen bemerkbar, die nichts mit sogenannten ethischen Entscheidungen oder Gewissensfragen zu tun hatten.
Es drängte sich folgende Frage auf: Könnte vielleicht das Denken als solches – die Gewohnheit, alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit erregt, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse und den speziellen Inhalt – zu den Bedingungen gehören, die die Menschen davon abhalten oder geradezu dagegen prädisponieren, Böses zu tun? (Das Wort „Ge-wissen“ selbst [engl, „con-science“] deutet jedenfalls darauf hin, denn es bedeutet ja „bei sich wissen“, was bei jedem Denkvorgang der Fall ist.) Und wird nicht diese Hypothese durch alles gestützt, was man über das Gewissen weiß, nämlich daß ein „gutes Gewissen“ in der Regel nur wirklich schlechten Menschen zuteil wird, Kriminellen und ähnlichen Elementen, während nur „gute Menschen“ eines schlechten Gewissens fähig sind? Anders ausgedrückt, in Kantischer Sprache: Nachdem mir aufgefallen war, daß ich mich nolens volens „in den Besitz eines Begriffs gesetzt“ hatte (Banalität des Bösen), kam ich nicht um die quaestio iuris herum, „mit welchem Recht man denselben besitze und ihn brauche“[3].
Der Eichmann-Prozeß weckte also zum erstenmal mein Interesse an diesem Gegenstand. Ein zweites: Diese moralischen Fragen, die aus praktischer Erfahrung erwuchsen und der Weisheit aller Zeiten entgegenliefen – nicht nur den verschiedenen herkömmlichen Antworten der „Ethik“, eines Zweiges der Philosophie, auf die Frage des Bösen, sondern auch den viel weiter gespannten Antworten, die die Philosophie auf die viel weniger drängende Frage bereithält, was das Denken sei –, mochten in mir gewisse Zweifel anfachen, die mich nicht mehr losgelassen hatten, seit ich eine Untersuchung beendet hatte, die mein [englischsprachiger] Verleger klüglich „The Human Condition“ betitelte, während ich sie ursprünglich bescheidener als eine Untersuchung über die „vita activa“ verstanden wissen wollte. Es ging mir um das Problem des Handelns, die älteste Frage der Theorie der Politik, und es hatte mich daran schon immer gestört, daß selbst die Bezeichnung, unter die ich meine Überlegungen zu diesem Gegenstand stellte, nämlich „vita activa“, von Leuten geprägt worden war, die ein kontemplatives Leben führten und alles Seiende von diesem Standpunkt aus betrachteten.
So gesehen, ist das tätige Leben „mühselig“, das betrachtende dagegen die reine Ruhe; das tätige Leben spielt sich in der Öffentlichkeit ab, das betrachtende in der „Wüste“; das tätige kümmert sich um „die Nöte des Nächsten“ [wohl richtiger „die nächstliegenden Sorgen“, d. Übers.], das betrachtende um die „Schau Gottes“. („Duae sunt vitae, activa et contemplativa. Activa est in labore, contemplativa in requie. Activa in publico, contemplativa in deserto. Activa in necessitate proximi, contemplativa in visione Dei.“) Ich habe hier einen mittelalterlichen Autor aus dem 12. Jahrhundert zitiert[4], beinahe beliebig herausgegriffen, denn die Vorstellung, die Betrachtung sei der höchste Bewußtseinszustand, ist so alt wie die abendländische Philosophie. Das Denken – nach Platon ein stummes Selbstgespräch – dient nur dazu, die Augen des Geistes zu öffnen, und selbst der Aristotelische nous ist ein Organ, das die Wahrheit sieht und anschaut. Mit anderen Worten, das Denken zielt auf die Betrachtung und erfüllt sich in ihr, und die Betrachtung ist nicht Tätigkeit, sondern Passivität; sie ist der Punkt, an dem die geistige Tätigkeit zur Ruhe kommt. Nach den Traditionen des christlichen Zeitalters, als die Philosophie die Magd der Theologie geworden war, wurde das Denken zur Meditation, und diese wieder erfüllte sich in der Kontemplation, einer Art begnadeten Seelenzustands, in dem sich der Geist nicht mehr um die Erkenntnis der Wahrheit mühte, sondern ihrer als Abglanz eines späteren Zustands zeitweilig in der Intuition teilhaftig wurde. (Es ist charakteristisch, daß Descartes, der noch immer unter dem Einfluß dieser Tradition stand, die Abhandlung, in der er die Existenz Gottes beweisen wollte, „Meditations“ nannte.) In der Neuzeit wurde das Denken hauptsächlich zur Magd der Wissenschaft, der organisierten Erkenntnis; es wurde zwar getreu der zentralen modernen Überzeugung, daß man nur wissen könne, was man selbst macht, äußerst aktiv, doch es war die Mathematik, die nichtempirische Wissenschaft par excellence, in der der Geist nur mit sich selbst zu spielen scheint, die sich als die Königin der Wissenschaften erwies und den Schlüssel zu jenen Gesetzen der Natur und des Weltalls lieferte, die sich hinter den Erscheinungen verbergen. Für Platon stand fest, daß das unsichtbare Auge der Seele das Organ war, das die unsichtbare Wahrheit mit der Gewißheit der Erkenntnis erblicken konnte; bei Descartes bildete sich – in der berühmten Nacht seiner „Erleuchtung“ – die Grundüberzeugung, es gebe „eine tiefe Übereinstimmung zwischen den Gesetzen der Natur [die durch die Erscheinungen und trügerischen Sinneswahrnehmungen verhüllt werden] und den Gesetzen der Mathematik“[5], also zwischen den Gesetzen des diskursiven Denkens auf der höchsten, abstraktesten Ebene und den Gesetzen dessen, was in der Natur hinter dem bloßen Schein liegt. Und er glaubte sogar, mit dieser Denkweise, die Hobbes „Kalkül der Konsequenzen“ nannte, sichere Erkenntnisse über die Existenz Gottes, die Beschaffenheit der Seele und ähnliches liefern zu können.
An der vita activa interessierte mich dies, daß die entgegengesetzte Vorstellung der vollkommenen Ruhe in der vita contemplativa so viel gewichtiger war, daß im Vergleich zu ihr alle sonstigen Unterschiede zwischen den einzelnen Tätigkeiten der vita activa bedeutungslos wurden. Im Vergleich zu dieser Ruhe spielte es keine Rolle mehr, ob man den Boden bearbeitete oder Gebrauchsgüter herstellte oder mit anderen in bestimmten Unternehmungen zusammenarbeitete. Selbst Marx, in dessen Werk und Denken die Frage des Handelns eine so entscheidende Rolle spielte, „gebraucht den Ausdruck ›Praxis‹ einfach im Sinne von ›was der Mensch tut‹ im Unterschied zu ›was der Mensch denkt‹“[6]. Doch es war mir klar, daß man diese Sache auch völlig anders betrachten konnte, und um meine Zweifel kundzugeben, beendete ich diese Untersuchung des tätigen Lebens mit einem merkwürdigen Satz, den Cicero Cato zuschreibt: „Nie ist der Mensch tätiger, als wenn er nichts tut, und nie ist er weniger allein, als wenn er für sich allein ist“ („Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset“.)[7] Angenommen, Cato habe recht, so liegen folgende Fragen auf der Hand: Was „tun“ wir, wenn wir nur denken? Wo sind wir, die wir gewöhnlich stets von unseren Mitmenschen umgeben sind, wenn wir mit niemandem als uns selbst zusammen sind?
Solche Fragen haben offenkundig ihre Schwierigkeiten. Auf den ersten Blick scheinen sie zu dem zu gehören, was man als „Philosophie“ oder „Metaphysik“ zu bezeichnen pflegte, zwei Ausdrücke und zwei Arbeitsgebiete, die, wie wir alle wissen, in Mißkredit gekommen sind. Ginge es bloß um die Angriffe des Positivismus und Neopositivismus der Neuzeit, so brauchte uns das vielleicht nicht zu stören. Carnaps Behauptung, die Metaphysik sei als Dichtung zu betrachten, läuft gewiß den üblichen Auffassungen der Metaphysiker zuwider; doch diese könnten, ebenso wie Carnaps Wertung, auf einer Unterschätzung der Dichtung beruhen. Heidegger, den Carnap zu seinem Angriffsziel machte, erwiderte, Philosophie und Dichtung hingen in der Tat eng zusammen; sie seien nicht ein und dasselbe, hätten aber den gleichen Ursprung – nämlich das Denken. Und Aristoteles, dem bisher noch niemand vorgeworfen hat, er habe „bloße“ Dichtung geschrieben, war der gleichen Auffassung: Dichtung und Philosophie gehörten auf bestimmte Weise zusammen. Wittgensteins berühmter Aphorismus „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“, der den gegenteiligen Standpunkt vertritt, würde, wenn ernst genommen, nicht nur für das gelten, was jenseits der Sinneserfahrung liegt, sondern noch viel mehr für die Gegenstände der Wahrnehmung. Nichts, was wir sehen oder hören oder tasten, läßt sich in Worten ausdrücken, die dem gleichkämen, was sinnlich gegeben ist. Hegel hatte recht, als er sagte: „[Es ist] gar nicht möglich, daß wir ein sinnliches Sein … je sagen können.“[8] War es nicht gerade die Entdeckung eines Auseinanderklaffens der Worte – des Mediums, in dem wir denken – und der Welt der Erscheinungen – des Mediums, in dem wir leben –, die überhaupt erst zur Philosophie und Metaphysik geführt hat? Nur glaubte man anfänglich, das Denken – als logos oder noēsis – könne zur Wahrheit oder zum wahren Sein durchdringen; am Ende dagegen standen das der Wahrnehmung Gegebene und das Gerät zur Erweiterung und Verschärfung unserer Körpersinne im Mittelpunkt. Was wäre natürlicher, als daß in der einen Phase die Erscheinungen und in der anderen das Denken niedrig bewertet wurden?
Unsere Schwierigkeiten mit metaphysischen Fragen werden nicht so sehr von denen geschaffen, für die sie ohnehin „sinnlos“ sind, als vielmehr von den Angegriffenen. Denn genau wie die Krise in der Theologie ihren Höhepunkt erreichte, als die Theologen selbst – im Unterschied zu dem schon immer vorhandenen Haufen der Ungläubigen – über die Behauptung „Gott ist tot“ zu sprechen begannen, so wurde auch die Krise in der Philosophie und Metaphysik offenbar, als die Philosophen selbst das Ende der Philosophie und der Metaphysik zu verkünden begannen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. (Die Anziehungskraft der Husserlschen Phänomenologie entsprang der antihistorischen und antimetaphysischen Tendenz des Mottos „Zu den Sachen selbst“; und Heidegger, der „scheinbar im metaphysischen Geleise blieb“, strebte in Wirklichkeit ebenfalls nach der „Überwindung der Metaphysik“, wie er seit 1930 wiederholt verkündete[9].)
Nicht Nietzsche, sondern Hegel erklärte als erster: „Das Gefühl, worauf die Religion der neuen Zeit beruht, [ist] das Gefühl: Gott selbst ist tot.“[10] Heute vor 60 Jahren hatte die Encyclopaedia Britannica gar keine Bedenken, die „Metaphysik“ als Philosophie „unter ihrem verrufensten Namen“ zu bezeichnen[11], und wenn man diesen Verruf weiter zurückverfolgen möchte, so stößt man auf Kant als einen der hervorragendsten Schmäher, nicht den Kant der „Kritik der reinen Vernunft“, den Moses Mendelssohn den „Alleszermalmer“ nannte, sondern den Kant der vorkritischen Schriften, in denen er ganz offen zugibt, er „habe das Schicksal, in die Metaphysik verliebt zu sein“, aber auch von deren „bodenlosem Abgrund“, „schlüpfrigem Boden“, utopischem „Schlaraffenlande“ spricht, in welchem die „Träumer der Vernunft“ wie in einem „Luftschiff“ sitzen, so daß es keine „Torheit gibt …, die nicht mit einer bodenlosen Weltweisheit könnte in Einstimmung gebracht werden“[12]. Alles, was heute dazu zu sagen ist, wurde unübertrefflich von Richard McKeon formuliert: In der langen und komplizierten Geschichte des Denkens hat diese „ehrwürdige Wissenschaft“ niemals „eine allgemein anerkannte Auffassung von ihrer Funktion … und ebensowenig wesentliche Übereinstimmung bezüglich ihres Gegenstandes“ zustande gebracht[13]. Angesichts dieser Tradition der Herabsetzung überrascht es geradezu, daß sich auch nur das Wort „Metaphysik“ halten konnte. Man möchte beinahe meinen, Kant habe recht gehabt, wenn er als ganz alter Mann, nachdem er der „ehrwürdigen Wissenschaft“ den Todesstoß versetzt hatte, prophezeite, man werde sicher zur Metaphysik „wie zu einer mit uns entzweiten Geliebten zurückkehren“[14].
Ich halte das weder für besonders wahrscheinlich noch gar für wünschenswert. Doch ehe wir über die möglichen Vorzüge unserer gegenwärtigen Situation zu spekulieren beginnen, dürfte es ratsam sein, zu überlegen, was eigentlich gemeint ist, wenn man feststellt, daß Theologie, Philosophie, Metaphysik ans Ende gekommen seien – gewiß nicht dies, daß Gott gestorben sei, denn darüber kann man ebensowenig wissen wie über die Existenz Gottes (und das ist so wenig, daß schon das Wort „Existenz“ fehl am Platze ist), sondern vielmehr, daß die Art, wie man sich Gott seit Jahrtausenden vorgestellt hat, nicht mehr überzeugt; wenn etwas tot ist, dann kann es nur die herkömmliche Vorstellung von Gott sein. Und Ähnliches gilt für das Ende der Philosophie und Metaphysik: nicht, daß die Fragen, die so alt sind wie die Menschen selbst, „sinnlos“ geworden wären, sondern daß die Art, wie sie gefaßt und beantwortet wurden, nicht mehr einleuchtet.
Ans Ende gekommen ist die grundlegende Unterscheidung zwischen Sinnlichem und Übersinnlichem in Verbindung mit der mindestens seit Parmenides vorhandenen Vorstellung, alles nicht sinnlich Gegebene – Gott oder das Sein oder die ersten Grundsätze und Ursachen (archai) oder die Ideen – sei wirklicher, wahrheitshaltiger, sinnvoller als das Erscheinende, es gehe nicht bloß über die Sinneswahrnehmung hinaus, sondern stehe über der Sinnenwelt. „Tot“ ist nicht nur die nähere Bestimmung solcher „ewiger Wahrheiten“, sondern die Unterscheidung überhaupt. Inzwischen warnen die wenigen Verteidiger der Metaphysik mit immer schrillerer Stimme vor der in dieser Entwicklung liegenden Gefahr des Nihilismus; und sie haben ein Argument auf ihrer Seite, das sie freilich selbst nur selten anführen: Es stimmt wirklich, daß mit der Streichung des Übersinnlichen auch sein Gegenstück, die Erscheinungswelt, wie sie jahrhundertelang verstanden wurde, getilgt wird. Das Sinnliche, wie es heute noch von den Positivisten verstanden wird, kann den Tod des Übersinnlichen nicht überleben. Keiner wußte das besser als Nietzsche, der in seiner dichterischen und bildhaften Beschreibung der Tötung Gottes[15] so viel Verwirrung in diesen Dingen gestiftet hat. An einer wichtigen Stelle der „Götzendämmerung“ erklärt er, was das Wort „Gott“ in jener Geschichte bedeuten sollte. Es war lediglich ein Symbol für das übersinnliche Reich, wie die Metaphysik es verstand; nun spricht er statt von „Gott“ von der „wahren Welt“ und sagt: „Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die scheinbare vielleicht? – Aber nein! mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft!“[16]
Diese Erkenntnis Nietzsches, nämlich daß „die Absetzung des Übersinnlichen auch das bloß Sinnliche und damit den Unterschied beider beseitigt“ (Heidegger)[17], liegt nun so auf der Hand, daß sie historisch überhaupt nicht datiert werden kann; aus jeder Vorstellung von zwei Welten folgt, daß diese unlöslich miteinander verbunden sind. Daher sind die ganzen ausgefeilten modernen Argumente gegen den Positivismus schon bei Demokrit in seinem unübertrefflich einfachen kleinen Zwiegespräch zwischen dem Geist, dem Organ für das Übersinnliche, und den Sinnen vorweggenommen. Sinneswahrnehmungen sind Täuschungen, sagt der Geist; sie wechseln mit den Zuständen unsereres Körpers; Süßes, Bitteres, Farbe und all das existiert nur nomō, durch Übereinkunft zwischen den Menschen, und nicht physei, gemäß der wahren Natur hinter den Erscheinungen. Darauf antworten die Sinne: „Armer Verstand, von uns nahmst du die Beweisstücke [pisteis, alles Verläßliche] und willst uns damit niederwerfen? [Unser] Fall [wird] dir der Niederwurf.“[18] Mit anderen Worten, sobald einmal das empfindliche Gleichgewicht zwischen den beiden Welten verlorengeht, ob nun die „wahre Welt“ die „scheinbare“ abschafft oder umgekehrt, so bricht das gesamte gewohnte Bezugs- und Orientierungssystems unseres Denkens zusammen. So gesehen, will nichts mehr recht als sinnvoll erscheinen.
Diese modernen „Tode“ – Gottes, der Metaphysik, der Philosophie und damit auch des Positivismus – haben erhebliches historisches Gewicht erlangt, denn seit Beginn unseres Jahrhunderts sind es nicht mehr bloß Gegenstände der Beschäftigung für eine geistige Elite, sondern ungeprüfte Voraussetzungen für fast jedermann. Mit dieser politischen Seite der Sache beschäftigen wir uns hier nicht. Es ist in unserem Zusammenhang vielleicht sogar besser, diese Frage, die eigentlich eine der politischen Autorität ist, auszuklammern und uns statt dessen an folgende einfache Tatsache zu halten: So stark auch unsere Denkweisen in dieser Krise betroffen sein mögen, unsere Denkfähigkeit steht nicht zur Diskussion; wir sind das, was die Menschen immer gewesen sind – denkende Wesen. Damit meine ich lediglich, daß die Menschen eine Neigung, vielleicht ein unabweisliches Bedürfnis haben, über die Grenzen der Erkenntnis hinauszudenken und mit ihrer Denkfähigkeit mehr anzufangen, als sie bloß zum Erkennen und Handeln einzusetzen. Spricht man in diesem Zusammenhang von Nihilismus, so heißt das vielleicht nur, daß man sich von Begriffen und Denkströmungen distanzieren möchte, die schon eine ganze Weile tot sind, wenn das auch erst neuerdings öffentlich anerkannt worden ist. Könnten wir doch, so möchte man seine Gedanken spinnen, in dieser Lage das tun, was die Neuzeit in ihren Anfängen tat, nämlich jeden einzelnen Gegenstand so behandeln, „als hätte noch niemand die Frage behandelt“ (wie Descartes in seinen einleitenden Bemerkungen zu „Les passions de l’âme“ empfiehlt)! Doch das ist unmöglich geworden, teils wegen unseres ungeheuer erweiterten historischen Bewußtseins, hauptsächlich aber deshalb, weil für uns das einzige Zeugnis davon, was Denken als Tätigkeit denen bedeutete, die es als Lebensform gewählt hatten, in dem besteht, was man heute „metaphysische Trugschlüsse“ nennen würde. Keines der Systeme, keine der Doktrinen, die uns von den großen Denkern überliefert sind, ist vielleicht für den heutigen Leser überzeugend oder auch nur verständlich; doch keine von ihnen, das werde ich hier zu zeigen versuchen, ist etwas Willkürliches, und keine läßt sich als bloßer Unsinn abtun. Im Gegenteil, die metaphysischen Trugschlüsse enthalten für uns die einzigen Hinweise darauf, was Denken denen bedeutet, die es betreiben – das ist heute von großer Bedeutung, doch merkwürdigerweise gibt es darüber nur wenige unmittelbare Äußerungen.
Unsere Situation nach dem Abtreten der Metaphysik und Philosophie könnte also einen doppelten Vorteil bieten. Wir könnten, unbelastet und ungeleitet von jeder Tradition, die Vergangenheit mit neuen Augen sehen und damit an einen ungeheuren Schatz unbearbeiteter Erfahrungen herankommen, ohne an irgendwelche Behandlungsvorschriften gebunden zu sein. „Notre heritage n’est precede d’aucun testament“ („Unserem Erbe ist kein Testament vorgeschaltet“)[19]. Der Vorteil wäre noch größer, ginge er nicht, fast unvermeidlich, mit einer wachsenden Unfähigkeit einher, sich im Reich des Unsichtbaren zu bewegen, auf welcher Ebene es auch sei; oder, anders gesagt, ginge er nicht mit dem Verruf einher, dem alles nicht Sichtbare, Greifbare anheimgefallen ist, so daß wir Gefahr laufen, mit unseren Traditionen auch die Vergangenheit selbst zu verlieren.
Denn es hat zwar nie große Übereinstimmung über den Gegenstand der Metaphysik gegeben, doch zumindest eines unterlag keinem Zweifel: daß diese Disziplinen – ob man sie nun Metaphysik oder Philosophie nannte – mit Gegenständen zu tun hatten, die nicht in der Sinneswahrnehmung gegeben waren, und daß ihr Verständnis über den gemeinen Verstand hinausging, der aus der Sinneserfahrung entspringt und mit empirischen Prüfverfahren bestätigt werden kann. Von Parmenides bis zum Ende der Philosophie waren alle Denker darin einig, daß zur Beschäftigung mit solchen Fragen der Geist von den Sinnen losgelöst werden mußte, und zwar von der durch sie gegebenen Welt wie auch von den durch die Sinnesgegenstände hervorgerufenen Empfindungen oder Leidenschaften. Der Philosoph als Philosoph und nicht als „Mensch wie jeder andere“ (der er natürlich auch ist) zieht sich von der Welt der Erscheinungen zurück, und die Gefilde, die er dann betritt, wurden seit dem Beginn der Philosophie stets als die Welt der wenigen beschrieben. Diese uralte Unterscheidung zwischen den vielen und den „Denkern von Gewerbe“, die sich auf das angeblich Höchste spezialisieren, dessen der Mensch fähig ist – dem Philosophen bei Platon „ist es beschieden, ein Gottgeliebter zu werden und der Unsterblichkeit teilhaftig, wenn anders sie überhaupt einem Menschen zuteil wird“[20] –, leuchtet nicht mehr ein, und das ist der zweite Vorteil unserer heutigen Situation. Wenn etwas Richtiges an dem oben von mir geäußerten Gedanken sein sollte, daß die Fähigkeit, Recht und Unrecht zu unterscheiden, etwas mit dem Denkvermögen zu tun habe, dann müßten wir ihre Anwendung von jedem normalen Menschen „verlangen“ können, gleichgültig, wie gebildet oder unwissend, intelligent oder dumm er zufällig ist. Kant – der in dieser Hinsicht unter den Philosophen beinahe allein dasteht – nahm an der verbreiteten Meinung, die Philosophie sei nur für die wenigen da, starken Anstoß, und zwar gerade wegen ihrer moralischen Konsequenzen, und er bemerkte einmal: „Das schlechte Herz ist eine Ursache der Dummheit.“[21] Das stimmt nicht: Gedankenlosigkeit ist nicht Dummheit; sie findet sich auch bei hochintelligenten Menschen, und ihre Ursache ist nicht ein schlechtes Herz; wahrscheinlich kann umgekehrt Schlechtigkeit durch Gedankenlosigkeit entstehen. Auf jeden Fall kann man die Frage nicht mehr den „Spezialisten“ überlassen, als wäre das Denken, wie die höhere Mathematik, das Monopol einer Spezialdisziplin.
Entscheidend für unser Vorhaben ist die Kantische Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand (intellectus), die er nach seiner Entdeckung des „Skandals der Vernunft“ einführte, der Tatsache nämlich, daß unser Geist keine gewisse und bestätigbare Erkenntnis über Gegenstände und Fragen gewinnen kann, über die nachzudenken er sich doch nicht entschlagen kann, und für Kant beschränkten sich derartige Fragen – diejenigen nämlich, mit denen sich das reine Denken beschäftigt – auf das, was man heute oft die „letzten Fragen“ bezüglich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit nennt. Doch ganz abgesehen von dem existentiellen Interesse, das diese Fragen einst bei den Menschen erweckten, und obwohl Kant immer noch glaubte, es habe „wohl niemals eine rechtschaffene Seele gelebt, welche den Gedanken hätte ertragen können, daß mit dem Tode alles zu Ende sei“[22], war er sich auch völlig darüber im klaren, daß „das dringende Bedürfnis“ der Vernunft nicht identisch mit und „noch etwas mehr als bloße Wißbegierde“ ist[23]. Damit fällt die Unterscheidung zwischen den Vermögen der Vernunft und des Verstandes mit der zwischen zwei völlig verschiedenen geistigen Tätigkeiten zusammen, dem Denken und dem Erkennen, wie auch mit der zwischen zwei völlig verschiedenen Zielen, dem Sinn im ersten Fall und der Erkenntnis im zweiten. Kant hatte zwar auf diese Unterscheidung Wert gelegt, doch er unterlag noch so stark dem ungeheuren Gewicht der metaphysischen Tradition, daß er an deren herkömmlichem Gegenstand festhielt, nämlich jenen Fragen, deren Unbeantwortbarkeit beweisbar war; er rechtfertigte zwar das Bedürfnis der Vernunft, über die Grenzen des Erkennbaren hinauszudenken, doch es entging ihm, daß der Mensch das Bedürfnis hat, über so gut wie alles nachzudenken, was ihm widerfährt, über Bekanntes wie über grundsätzlich Unerkennbares. Es war ihm auch nicht völlig klar, in welchem Maße er die Vernunft – das Denkvermögen – befreit hatte, indem er sie im Rahmen der letzten Fragen rechtfertigte. Er äußerte defensiv: „Ich mußte … das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“[24], doch er hatte nicht Platz für den Glauben geschaffen, sondern für das Denken, und er hatte nicht „das Wissen aufgehoben“, sondern Erkenntnis und Denken voneinander geschieden. In den Notizen zu seinen Vorlesungen über Metaphysik schrieb er: „Der Zweck der Metaphysik: … unseren Vernunftgebrauch über die Grenzen der Sinneswelt, obzwar nur negativ, auszudehnen, d. i. die Hindernis, die die Vernunft selbst… macht, wegzuschaffen“ (Hervorhebung H. A.)[25].
Das große Hindernis, das sich die Vernunft selbst in den Weg legt, entspringt auf der Seite des Verstandes und der völlig berechtigten Kriterien, die dieser für seine Zwecke, nämlich die Befriedigung unseres Erkenntnisdrangs, aufgestellt hat. Daß weder Kant noch seine Nachfolger dem Denken als Tätigkeit oder gar den Erfahrungen des denkenden Ichs nennenswerte Aufmerksamkeit schenkten, liegt daran, daß sie trotz aller Unterscheidungen solche Ergebnisse verlangten und Gewißheits- und Beweiskriterien anwandten, wie sie für die Erkenntnis gelten. Doch wenn es stimmt, daß Denken und Vernunft das Recht haben, über die Grenzen der Erkenntnis und des Verstandes hinauszugehen – für Kant hatten sie es deshalb, weil ihre Gegenstände zwar unerkennbar, aber für den Menschen von größtem existentiellem Interesse seien –, dann muß man davon ausgehen, daß sich das Denken und die Vernunft mit etwas anderem beschäftigt als der Verstand. Wir wollen unser Ergebnis jetzt schon auf eine Formel bringen: Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahrheit und Sinn sind nicht dasselbe. Der Grundirrtum, dem alle speziellen metaphysischen Trugschlüsse nachgeordnet sind, besteht darin, den Sinn nach der Art der Wahrheit aufzufassen. Das neueste und in mancher Hinsicht überraschendste Beispiel dafür findet sich in Heideggers „Sein und Zeit“, einem Werk, das damit beginnt, „die Frage nach dem Sinn von Sein erneut zu stellen“[26]. In einer späteren Deutung dieser seiner Eingangsfrage sagt Heidegger selbst ausdrücklich: „›Sinn von Sein‹ und ›Wahrheit des Seins‹ sagen dasselbe.“[27]
Die Versuchung zu dieser Gleichsetzung – die auf eine Ablehnung der Kantischen Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand, zwischen dem „dringenden Bedürfnis“ zum Denken und der „Wißbegierde“ hinausläuft –, ist sehr groß und keineswegs nur auf das Gewicht der Tradition zurückzuführen. Kants Erkenntnisse wirkten ungeheuer befreiend auf die deutsche Philosophie und lösten den Aufstieg des deutschen Idealismus aus. Zweifellos hatten sie dem spekulativen Denken Raum geschaffen; doch auch dieses wurde wieder zur Domäne einer neuen Art von Spezialisten, für die „die Sache selbst“ in der Philosophie „das wirkliche Erkennen dessen [ist], was in Wahrheit ist“[28]. Durch Kant von dem Dogmatismus alter Schule und seinen sterilen Übungen befreit, errichteten sie nicht nur neue Systeme, sondern eine neue „Wissenschaft“ – der ursprüngliche Titel eines der größten dieser Werke, Hegels „Phänomenologie des Geistes“, lautete „Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins“[29] –, wobei sie geflissentlich die Kantische Unterscheidung zwischen dem Gegenstand der Vernunft – dem Unerkennbaren – und dem Geschäft des Verstandes – der Erkenntnis – verwischten. Sie jagten dem Cartesischen Gewißheitsideal nach, als hätte Kant nie gelebt, und sie glaubten allen Ernstes, die Ergebnisse ihrer Spekulationen seien im gleichen Sinne gültig wie die Ergebnisse von Erkenntnisvorgängen.
[1] Kritik der reinen Vernunft, B 871.
[2] Eichmann in Jerusalem, Piper, München, 1964.
[3] Reflexionen zur Metaphysik, in Kants handschriftlicher Nachlaß, Bd. 5, Nr. 5636: Kants gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Bd. 18.
[4] Hugo von Sankt Viktor.
[5] André Bridoux, Descartes: Œuvres et lettres, Pléiade, Paris, 1937, introduction, S. VIII. Vgl. Galilei: „Das Universum ist in mathematischer Sprache geschrieben.“ Ebenda, S. XIII.
[6] Nicholas Lobkowicz, Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx, Notre Dame, 1967, S. 419.
[7] De re publica, I, 17.
[8] Phänomenologie des Geistes, A I: „Die sinnliche Gewißheit …“, Werke, Jubiläumsausgabe (H. Glockner), Bd. 2, S. 84.
[9] Siehe die Anmerkung zu „Vom Wesen der Wahrheit“, eine Vorlesung aus dem Jahre 1930, abgedruckt in Wegmarken, Frankfurt, 1967, S. 97.
[10] „Glauben und Wissen“ (1802), letzter Absatz; Werke, Jubiläumsausgabe (H. Glockner), Bd. 1, S. 433.
[11] 11. Aufl.
[12] Werke, Darmstadt, 1963, Bd. 1, S. 982, 621, 630, 968, 952, 974, 959; Akademie-Ausgabe, Bd. 2, S. 367, ?, ?, 356, 342, 360, 348.
[13] Einleitung zu The Basic Works of Aristotle, New York, 1941, S. XVIII.
[14] Kritik der reinen Vernunft, B 878. Dieser merkwürdige Satz steht im letzten Abschnitt der „Kritik der reinen Vernunft“, wo Kant die Metaphysik als eine Wissenschaft begründet zu haben behauptet, deren Idee „ebenso alt [ist] als spekulative Menschenvernunft; und welche Vernunft spekuliert nicht, es mag nun auf scholastische oder populäre Art geschehen?“ (B 870). Diese „Wissenschaft“ ist „zuletzt in allgemeine Verachtung gefallen“, „da man ihr anfänglich mehr zumutete, als billigerweise verlangt werden kann“ (B 877). Vgl. auch Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, Abschn. 59 u. 60.
[15] Die fröhliche Wissenschaft, Buch 3, Nr. 125: „Der tolle Mensch“.
[16] Götzendämmerung, „Wie die ›wahre Welt‹ endlich zur Fabel wurde“, Abs. 6. „…“ i. Orig.
[17] „Nietzsches Wort ›Gott ist tot‹“, in Holzwege, Frankfurt, 1963, S. 193.
[18] B 125, B 9.
[19] René Char, Feuillets d’Hypnos, Paris, 1946, Nr. 62.
[20] Gastmahl, 212a.
[21] Kants handschriftlicher Nachlaß, Bd. 6, Nr. 6900: Kants gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Bd. 19.
[22] Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik, letzter Absatz.
[23] Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, nach § 60; Akademie-Ausgabe, Bd. 3, S. 367.
[24] Kritik der reinen Vernunft, B XXX.
[25] Kants handschriftlicher Nachlaß, Bd. 5, Nr. 4849: Kants gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Bd. 18.
[26] Sein und Zeit, 11. unveränd. Aufl., Tübingen, 1967, S. 1. Vgl. S. 151 (in §32) und S. 324 (in §65).
[27] Einleitung zu „Was ist Metaphysik?“, in Wegmarken, Frankfurt, 1976, S. 377 (1. Aufl. 1967: S. 206).
[28] Hegel, Phänomenologie des Geistes, Werke, Jubiläumsausgabe (H. Glockner), Bd. 2, S. 67.
[29] Ebenda, S. 80.


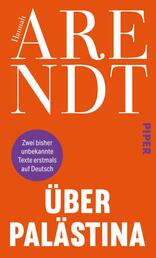








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.