

Vom Wachsen und Werden Vom Wachsen und Werden - eBook-Ausgabe
Wie wir beim Gärtnern zu uns finden
— „Das weiseste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe.“ Stephen FryVom Wachsen und Werden — Inhalt
Im Garten finden viele Menschen Entspannung, schöpfen neue Kraft und kommen zur Ruhe. Der Prozess des Pflanzens und Pflegens, Säens und Erntens beeinflusst unser Wohlbefinden, unsere Fähigkeit zur Selbstreflexion und unsere Kreativität. Gartenarbeit ist aber auch ein bewährtes Heilmittel zur Behandlung vieler psychischer Probleme – von Sucht- und Angststörungen bis hin zu Depressionen und Traumata. In diesem Buch zeigt die Psychiaterin und begeisterte Gärtnerin Sue Stuart-Smith, wie sich die Natur positiv auf unsere innere Welt auswirkt, uns Inspiration bietet und den Geist bereichert.
Leseprobe zu „Vom Wachsen und Werden“
1 Die Anfänge
Heraus, das Licht der Dinge macht nicht blind:
Lass die Natur dein Lehrer sein!
William Wordsworth (1770–1850)
Lange bevor ich den Wunsch verspürte, Psychotherapeutin zu werden, lange bevor ich auch nur ahnte, dass das Gärtnern einmal eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen könnte, erinnerte ich mich gelegentlich daran, dass in meiner Familie darüber gesprochen wurde, wie mein Großvater nach dem Ersten Weltkrieg wieder ins Leben zurückfand.
Mein Großvater hieß Alfred Edward May, wurde aber von allen Ted genannt. Er war fast noch ein Kind, [...]
1 Die Anfänge
Heraus, das Licht der Dinge macht nicht blind:
Lass die Natur dein Lehrer sein!
William Wordsworth (1770–1850)
Lange bevor ich den Wunsch verspürte, Psychotherapeutin zu werden, lange bevor ich auch nur ahnte, dass das Gärtnern einmal eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen könnte, erinnerte ich mich gelegentlich daran, dass in meiner Familie darüber gesprochen wurde, wie mein Großvater nach dem Ersten Weltkrieg wieder ins Leben zurückfand.
Mein Großvater hieß Alfred Edward May, wurde aber von allen Ted genannt. Er war fast noch ein Kind, als er in die Royal Navy eintrat. Dort ließ er sich zum Marconi-Funker ausbilden und wurde Matrose auf einem U-Boot. In der Schlacht von Gallipoli im Frühjahr 1915 lief sein U-Boot in den Dardanellen auf Grund. Fast die gesamte Mannschaft überlebte, geriet aber in türkische Kriegsgefangenschaft. Die ersten Monate seiner Gefangenschaft hielt Ted in einem winzigen Tagebuch fest. Dann folgte eine Phase der Internierung in mehreren barbarischen Arbeitslagern, die nicht dokumentiert ist. Zuletzt arbeitete er in einer Zementfabrik am Marmarameer, aus der er im Jahr 1918 über das Meer entkommen konnte.
Ted wurde geborgen und auf einem britischen Lazarettschiff versorgt. Kaum war er wieder halbwegs bei Kräften, wagte er die lange Heimreise über den Landweg. Er wollte so schnell wie möglich seine Verlobte Fanny wiedersehen. Er hatte sie als stattlicher junger Mann verlassen, nun stand er in einem abgewetzten, alten Regenmantel und mit einem türkischen Fez auf dem Kopf vor ihrer Tür. Sie erkannte ihn kaum wieder, denn er wog gerade mal 38 Kilo und hatte seine Haare verloren. Er erzählte Fanny, dass die 4000 Meilen lange Reise „ein Horror“ gewesen sei. Seine Unterernährung war derart fortgeschritten, dass man ihm nach einer medizinischen Untersuchung im Krankenhaus der Navy nur noch wenige Monate gab.
Fanny pflegte Ted aufopferungsvoll, flößte ihm stündlich wenige Löffel voll Suppe und anderen Speisen ein, bis er langsam wieder in der Lage war, Nahrung zu verdauen. Nach und nach kam Ted wieder zu Kräften, und kurz darauf heirateten sie. In diesem ersten Jahr strich Ted oft stundenlang mit einer weichen Bürste über seinen kahlen Schädel, um seine Haare zum Wachsen zu animieren. Und tatsächlich wuchsen sie wieder, waren aber weiß geworden.
Mit Liebe, Geduld und Entschlossenheit trotzte Ted seiner düsteren Prognose, doch seine Erlebnisse der Kriegsgefangenschaft verließen ihn nicht und quälten ihn nachts. Vor allem Spinnen und Läuse machten ihm Angst, denn sie hatten die Gefangenen heimgesucht, wenn sie schlafen wollten. Noch jahrelang konnte er nicht allein im Dunkeln sein.
Die nächste Phase seiner Genesung begann im Jahr 1920, als er sich zu einem einjährigen Gartenbaulehrgang anmeldete; es war eine der vielen Maßnahmen, die in der Nachkriegszeit zur Wiedereingliederung von kriegsversehrten Veteranen durchgeführt wurden. Nach der Ausbildung reiste Ted nach Kanada, ohne Fanny. Er suchte nach neuen Arbeitsmöglichkeiten, auch in der Hoffnung, durch Landarbeit seine körperlichen und seelischen Kräfte wiederzugewinnen. Die kanadische Regierung hatte damals ein Programm aufgelegt, um ehemalige Weltkriegssoldaten ins Land zu holen. Tausende folgten ihrem Ruf und machten sich auf die lange Reise über den Atlantik.
Ted arbeitete zuerst in Winnipeg bei der Weizenernte und fand dann auf einer Rinderfarm in Alberta eine feste Anstellung als Gärtner. Zwei Jahre blieb er in Kanada, und einen guten Teil der Zeit war auch Fanny bei ihm, aber aus welchen Gründen auch immer kam ihr Traum eines neuen Lebens nicht zustande. Gleichwohl kehrte Ted gekräftigt und gesund nach England zurück.
Nach einigen Jahren erwarben die beiden einen kleinen Bauernhof in Hampshire, wo Ted Schweine, Bienen und Hühner hielt und Blumen, Obst und Gemüse anbaute. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Funker in der Admiralty Wireless Station in London. Meine Mutter erinnert sich noch an seinen mit Fleisch aus eigener Schlachtung und selbst gezogenem Gemüse vollgepackten schweinsledernen Koffer, mit dem er nach London reiste. Und dann kam er mit dem Koffer voll mit Zucker-, Butter- and Teevorräten wieder zurück. Nicht ohne Stolz erzählt sie, dass die Familie während des Kriegs niemals Margarine essen musste und dass Ted sogar seinen eigenen Tabak anbaute.
Ich erinnere mich an seinen Humor und an sein warmherziges Wesen. In meinen Kinderaugen war er ein Mann, der robust und mit sich selbst im Reinen zu sein schien. Ich musste keine Angst vor ihm haben, und er trug seine Kriegstraumata nicht nach außen. Er verbrachte Stunden mit der Arbeit im Garten und in den Gewächshäusern, immer die Pfeife dabei und den Tabaksbeutel in Reichweite. Teds langes und gesundes Leben – er wurde beinahe achtzig Jahre alt – und die Tatsache, dass er sich mit den in der Kriegsgefangenschaft erlittenen Misshandlungen abzufinden vermochte, ist Teil unseres Familienmythos über die regenerierende Wirkung von Gartenarbeit und Ackerbau geworden.
Ted starb ganz unerwartet an einem Aneurysma, als er gerade mit seinem geliebten Shetland Schäferhund spazieren ging. Ich war damals zwölf Jahre alt. Die Überschrift seines Nachrufs in der Lokalzeitung lautete: „Ehemals jüngster U-Boot-Matrose gestorben.“ Dort stand, dass Ted im Ersten Weltkrieg zweimal für tot erklärt worden war und dass er und die anderen Häftlinge, mit denen er aus der Zementfabrik geflohen war, sich 23 Tage lang nur von Wasser ernährt hatten. Der Schlusssatz des Nachrufs bezog sich auf seine Liebe zum Gärtnern: „Er widmete seine Freizeit der Pflege seines großen Gartens und erlangte mit einigen seltenen Orchideenarten lokale Berühmtheit.“
Vielleicht hat sich meine Mutter unbewusst daran ein Beispiel genommen, als mein Vater noch vor seinem fünfzigsten Geburtstag starb und sie als relativ junge Witwe zurückließ. Im zweiten Frühling nach seinem Tod zogen wir in ein anderes Haus, und sie machte sich daran, einen verwahrlosten Bauerngarten herzurichten. Selbst ich in meiner jugendlichen Selbstbezogenheit bemerkte, dass sie sich beim Graben und Jäten mit ihrem Verlust abfand.
In dieser Phase meines Lebens konnte ich mir nicht vorstellen, dass mich Gartenarbeit jemals intensiv beschäftigen würde. Mich interessierte die Welt der Literatur, und ich wollte mir das Leben des Geistes erschließen. Gartenarbeit war für mich eine Art ins Freie verlagerte Hausarbeit, und Unkraut zupfen kam mir genauso wenig in den Sinn wie Kuchen backen oder Vorhänge waschen.
Während meines Studiums war mein Vater immer wieder im Krankenhaus; er starb, als gerade mein letztes Studienjahr begonnen hatte. Die Nachricht erreichte mich in den frühen Morgenstunden per Telefon. Kaum war die Sonne aufgegangen, ging ich durch die stillen Straßen von Cambridge, durchquerte den Park und kam hinab zum Fluss. Es war ein heller, sonniger Oktobertag; die Welt war grün und still. Die Bäume, das Gras und das Wasser hatten etwas Tröstliches. Erst in dieser friedvollen Umgebung war ich fähig, mich der schrecklichen Wahrheit zu stellen, dass mein Vater diesen schönen Tag nicht mehr erleben konnte.
Vielleicht erinnerten mich das Grün und das Wasser an glücklichere Tage und an die ersten Landschaften, die als Kind Eindruck auf mich gemacht hatten. Mein Vater hatte ein Boot auf der Themse, und als mein Bruder und ich noch klein waren, verbrachten wir viele Ferien und Wochenenden auf dem Wasser. Einmal machten wir eine Expedition bis zur Quelle des Flusses, oder so nah wir ihr eben kamen. Ich erinnere mich noch an die Stille des Morgennebels, an meine Freiheitsgefühle, als wir auf den Sommerwiesen spielten. Angeln gehörte damals zu unseren Lieblingsbeschäftigungen.
Während meiner letzten Semester in Cambridge erschloss sich mir ein neuer, sehr emotionaler Zugang zur Lyrik. Meine Welt hatte sich unwiederbringlich geändert, und ich klammerte mich an Verse, die von der tröstenden Natur und vom Kreislauf des Lebens handelten. Dylan Thomas und T. S. Eliot waren mir eine Stütze, aber hauptsächlich wandte ich mich Wordsworth zu, jenem Dichter, der selbst erfahren hatte:
Zu betrachten die Natur
nicht mehr gedankenlos wie in der Jugend,
vernehmend oftmals nun den ruhigen,
getragenen Gesang der Menschheit …
Trauer macht einsam, selbst wenn sie gemeinsam erfahren wird. Ein Verlust, der eine Familie erschüttert, weckt das Bedürfnis, sich gegenseitig zu stützen; doch gleichzeitig verstummen die Menschen und erleiden einen seelischen Zusammenbruch. Sie entwickeln den Impuls, sich gegenseitig vor zu heftigen Gefühlen zu bewahren, und es erscheint ihnen einfacher, ihren Gefühlen im Stillen freien Lauf zu lassen. Bäume, Wasser, Steine und Himmel mögen menschlichen Gefühlen gegenüber gleichgültig sein, aber sie weisen uns auch nicht zurück. Die Natur ist von unseren Gefühlen unbeeindruckt, und da sie sich von uns nicht anstecken lässt, erfahren wir in ihr einen die Einsamkeit des Verlusts lindernden Trost.
In den ersten Jahren nach dem Tod meines Vaters fühlte ich mich zur Natur hingezogen – nicht zu Gärten, sondern zum Meer. Seine Asche war den Wassern des Solent übergeben worden, einer von Booten und Schiffen viel befahrenen Meerenge unweit seines an der Südküste gelegenen Elternhauses. Am meisten Trost fand ich jedoch an den langen, einsamen Stränden im Norden von Norfolk, wo kaum ein Boot in Sicht war. Der Horizont erschien mir so unendlich weit, als befände ich mich am äußersten Rand der bekannten Welt – und ihm so nahe, wie es irgend ging.
Für eine Prüfung an der Universität hatte ich mich mit Freuds psychoanalytischer Theorie beschäftigt. Mein Interesse für die Funktionsweise der menschlichen Psyche war geweckt. Meine angestrebte Promotion in Literatur gab ich auf und entschied mich für ein Studium der Medizin. Dann heiratete ich im dritten Studienjahr Tom, für den das Gärtnern Teil des Lebens war. Er liebte es so sehr, dass ich mich entschied, es ebenfalls zu lieben, wenngleich ich, ehrlich gesagt, immer noch eine Gartenskeptikerin war. Gärtnern war für mich lediglich eine zu erledigende Aufgabe, wenngleich es draußen im Freien – jedenfalls wenn die Sonne schien – schöner war als im Haus.
Nach einigen Jahren zogen wir mit Rose, unserem Baby, auf einen umgebauten Bauernhof unweit von Toms Familie in Serge Hill in Hertfordshire. Im Laufe der folgenden Jahre kamen noch unsere Söhne Ben und Harry hinzu. In dieser Zeit machten Tom und ich uns mit Feuereifer daran, einen von Grund auf neuen Garten anzulegen. The Barn (die Scheune), wie wir unser neues Zuhause nannten, war von Feldern und Wiesen umgeben und, da das Gelände sich an einem Nordhang erstreckte, Wind und Wetter ausgesetzt. Als Erstes bauten wir also einen Windschutz. Wir gruben an mehreren Stellen den steinigen Boden um, pflanzten Bäume und Hecken, hegten Flächen mit Flechtzaun ein und arbeiteten an der Verbesserung des Bodens. Dies alles wäre ohne die enorme Unterstützung und Ermutigung von Toms Eltern und einer Reihe von hilfsbereiten Freunden nicht möglich gewesen. Manchmal feierten wir Steinlesefeste; dann halfen Rose, ihre Großeltern, Tanten und Onkel und füllten Eimer um Eimer mit großen und kleinen Steinen, die weggeschafft werden mussten.
Ich war körperlich wie seelisch entwurzelt und musste erst wieder ein neues Heimatgefühl entwickeln, dennoch war mir damals noch nicht ganz bewusst, dass die Gartenarbeit mir möglicherweise dabei half, Wurzeln zu schlagen. Viel gegenwärtiger war mir die wachsende Bedeutung des Gartens im Leben unserer Kinder. Sie bauten Unterschlüpfe in den Büschen und verbrachten Stunden in selbst erschaffenen Fantasiewelten. Der Garten war ein Reich der Fantasie und zugleich ein realer Ort.
Toms kreative Energie und seine Vision trieben unsere Gartengestaltung voran. Erst als Harry, unser Jüngster, im Krabbelalter war, begann ich selbst etwas anzupflanzen. Ich interessierte mich für Kräuter und vertiefte mich in die einschlägige Literatur. Dieses neue Studiengebiet führte zu einigen Versuchen in der Küche und zu einem „eigenen“ kleinen Kräutergarten. Es gab auch ein paar gärtnerische Missgeschicke wie das Ausreißen eines kriechenden Borretschs und eines hartnäckigen Seifenkrauts, aber es war eine Bereicherung, unser Essen mit allen möglichen selbst gezogenen Kräutern zu würzen. Danach war es nur noch ein kleiner Schritt zum Gemüseanbau. Damals reizte es mich am meisten, selbst Lebensmittel anzubauen.
Ich war Mitte dreißig und arbeitete als Assistenzärztin für Psychiatrie im National Health Service. Die Gartenarbeit belohnte meine Mühen mit sichtbaren Erträgen und stellte ein Gegengewicht zu meinem Berufsleben dar, in dem ich mit den weniger greifbaren Eigenschaften der Psyche zu tun hatte. Die Arbeit auf der Station und in der Ambulanz fand vorwiegend in Innenräumen statt, wogegen die Gartenarbeit mich nach draußen brachte.
Ich entdeckte die Freude, mit frei schwebender Aufmerksamkeit durch den Garten zu schlendern und zu registrieren, wie sich die Pflanzen veränderten, wuchsen, kränkelten, Früchte hervorbrachten. Meine Einstellung zu profanen Tätigkeiten wie Unkrautjäten, Hacken und Gießen änderte sich. Ich stellte fest, dass es weniger wichtig war, alles zu erledigen, als sich ganz in die Arbeit zu vertiefen. Gießen beruhigt – solange man nicht in Eile ist –, und eigenartigerweise fühlt man sich nach getaner Arbeit ebenso erfrischt wie die eben gewässerten Pflanzen.
Bis heute begeistert mich beim Gärtnern am meisten, Pflanzen aus Samen zu ziehen. Samen verraten nicht, was einmal aus ihnen werden wird. Ihre Größe ist unabhängig von dem ihnen innewohnenden Leben. Bohnen keimen effektvoll und sind dabei nicht besonders schön, aber man spürt von Anfang an die sich in ihnen entfaltende impulsive Energie. Die Samen vom Ziertabak sind fein wie Staubkörnchen, man sieht sie eigentlich nicht beim Säen. Kaum vorstellbar, dass aus ihnen etwas entstehen könnte – Wolken von duftenden Blüten –, und doch ist es so. Ich spüre, wie das neue Leben eine Bindung schafft, wenn ich mich dabei ertappe, wie ich fast zwanghaft zurückkomme, um nach meinen Samen und Setzlingen zu sehen, wie ich zum Gewächshaus hinausgehe, mit angehaltenem Atem hineintrete, um ja nichts zu unterbrechen und die Stille des gerade entstehenden Lebens nicht zu stören.
Die Jahreszeiten lassen beim Gärtnern grundsätzlich nicht mit sich debattieren – vielleicht verzeihen sie einem einen kleinen Aufschub. Ich säe diese Samen oder pflanze jene Sämlinge erst am nächsten Wochenende aus. Doch an einem gewissen Punkt merkt man, dass eine Verzögerung zur verpassten Chance wird, zu einer ungenutzten Gelegenheit. Hat man jedoch seine Setzlinge in die Erde ausgebracht, wird man von der Energie des Erdenkalenders fortgetragen wie von einem Fluss.
Besonders liebe ich die Gartenarbeit im Frühsommer, wenn die Wachstumsenergie am stärksten ist und es viel zu pflanzen gibt. Habe ich einmal begonnen, will ich nicht mehr aufhören. Ich arbeite bis zum Einbruch der Dunkelheit, wenn ich fast nichts mehr sehe. Dann zieht mich der warme Schein der Lampen wieder ins Haus hinein. Und wenn ich mich am nächsten Morgen aus dem Haus schleiche, sehe ich es: An welchen Beeten ich auch gearbeitet habe, alle haben sich über Nacht gesetzt und eingelebt.
Natürlich muss man beim Gärtnern immer auch Niederlagen einstecken – insbesondere wenn man voller Erwartung den Garten betritt und mit den traurigen Überresten von allerliebsten jungen Salatpflänzchen oder Reihen von unbarmherzig kahl gefressenem Grünkohl konfrontiert wird. Zugegeben, das unbekümmerte Essgebaren der Schnecken und Kaninchen kann hilflose Wutanfälle auslösen, und die Beharrlichkeit und Ausdauer von Unkraut kann sehr, sehr zermürbend sein.
Die aus der Pflege von Pflanzen resultierende Befriedigung hat nicht nur mit dem Erschaffen von Neuem zu tun. Der Gartenarbeit ist auch ein destruktives Element eigen, aber das Gute daran ist, dass es nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig ist, denn wenn es nicht geschieht, wird man überwuchert. Viele Tätigkeiten bei der Gartenpflege sind also auch von Aggressionen durchdrungen – sei es beim Schneiden mit der Heckenschere, beim Rigolen des Gemüsebeets, beim Schneckenmorden, beim Vernichten von Blattläusen, beim Ausreißen von Gänsegras oder beim Ausgraben von Brennnesseln. Man kann sich rückhaltlos und ohne Probleme in diese Arbeiten stürzen, denn sie sind Formen der Destruktivität, die dem Wachstum dienen. Dauert solch eine Phase sehr lang, ist man möglicherweise vollkommen verausgabt, fühlt sich innerlich aber seltsam erneuert – gereinigt und gleichzeitig gestärkt, als hätte man bei diesem Vorgang an sich selbst gearbeitet. Eine Art Garten-Katharsis.
Jedes Jahr, wenn der Winter vorbei ist und die Welt im kalten Märzwind fröstelt, zieht mich das Gewächshaus mit seiner verlockenden Wärme an. Was macht das Betreten eines Gewächshauses so besonders? Liegt es an der Sauerstoffsättigung der Luft, an der Art des Lichts und der Wärme? Oder ist es einfach die Nähe der Pflanzen, ihr Grün und ihr Duft? Als wären alle Sinne in diesem intimen, geschützten Raum geschärft.
An einem verhangenen Tag im vorigen Jahr war ich mit Arbeiten im Gewächshaus beschäftigt – Gießen, Säen, Kompost umsetzen und überhaupt alles herrichten. Dann riss der Himmel auf, die Sonne strömte hinein und versetzte mich in eine Welt aus schillerndem Grün und vom Licht durchschienenen Blättern. Die Tropfen auf den frisch gegossenen Pflanzen fingen aufreizend funkelnd das Licht auf, und einen Augenblick lang wurde ich von einer Empfindung irdischer Güte überwältigt – einem Gefühl, das ich mir bewahrt habe, wie ein Geschenk zur rechten Zeit.
An diesem Tag säte ich im Gewächshaus Sonnenblumen aus. Als ich die Keimlinge ungefähr einen Monat später ins Freie pflanzte, dachte ich, dass es einige nicht schaffen würden. Die größeren sahen vielversprechend aus, andere jedoch wirkten im Freien schmächtig und ungeschützt. Zufrieden beobachtete ich, wie sie größer und allmählich auch kräftiger wurden, auch wenn ich das Gefühl hatte, sie immer noch besonders im Auge behalten zu müssen. Dann nahm ihr Wachstum Fahrt auf, und ich widmete mich anderen, empfindlicheren Setzlingen.
Für mich ist Gärtnern ein sich wiederholendes gegenseitiges Geben. Ich mache etwas, dann verrichtet die Natur ihren Teil, dann reagiere ich darauf und so weiter – fast wie in einem Gespräch. Es ist kein Flüstern, Schreien oder Sprechen, aber das Hin und Her ist ein verlangsamter, ununterbrochener Dialog. Ich gebe zu, dass ich manchmal die Langsame bin und mich etwas zurückhalte. Zum Glück gibt es Pflanzen, die trotz Vernachlässigung überleben. Und wenn man Zeit mit anderen Dingen verbracht hat, ist die Faszination bei der Rückkehr umso größer, als würde man entdecken, was der andere in seiner Abwesenheit ausgeheckt hat.
Eines Tages bemerkte ich, dass die ganze Reihe von Sonnenblumen kräftig gewachsen war und ihre knospenden Blüten hochmütig und selbstbewusst emporreckte – und ich fragte mich: Wann und wie seid ihr so groß geworden? Es verging nicht viel Zeit, und der erste vielversprechende Keimling – immer noch die kräftigste Pflanze von allen – blickte mit seinem strahlend gelben Blütenteller von weit oben auf mich herab. Ich kam mir in seiner Gegenwart sehr klein vor, fühlte mich aber eigenartig bestätigt, hatte ich doch sein Leben auf den Weg gebracht.
Wie sehr hatten die Sonnenblumen sich nach gut einem Monat verändert! Die Bienen hatten sie ausgesaugt; ihre Blütenblätter waren verblasst, und die größte Blume konnte kaum ihren herabhängenden Kopf stützen. Gerade noch so stolz, und jetzt so melancholisch! Ich hätte sie am liebsten alle abgeschnitten, aber ich wusste, dass sie, würde ich ihre desolate Traurigkeit noch eine Weile ertragen, sie in der Sonne bleichen und trocknen und mit dem heranziehenden Herbst eine andere Gestalt annehmen würden.
Die Pflege eines Gartens ist wie ein immerwährendes Kennenlernen. Es setzt voraus, ein Verständnis dafür zu entwickeln und zu verfeinern, was funktioniert und was nicht. Man muss eine Beziehung zu dem Ort in seiner Gesamtheit aufbauen – zu seinem Klima, seinem Boden und den Pflanzen, die in ihm wachsen. Das sind die Realitäten, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und auf dem Weg dorthin müssen fast immer bestimmte Träume aufgegeben werden.











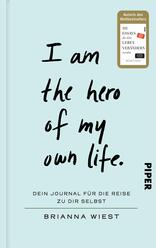
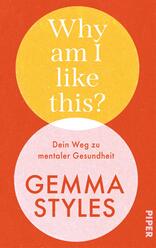






In Georgien bricht eine tödliche Grippeerkrankung aus, die sich als Pandemie schnell bis nach Nordamerika und die ganze Welt ausbreitet. Innerhalb kürzester Zeit sterben die Menschen, die mit den Erkrankten in Kontakt kommen. Den Ausbruch der Katastrophe erlebt der Leser mit Jeevan, einem ehemaligen Paparazzi und Journalist, der gerade noch als Zuschauer im Theaterstück "König Lear" sitzt und miterlebt, wie König Lear, gespielt von Arthur Leander, während der Aufführung an einem Herzinfarkt stirbt. Noch am selben Abend wird ihm von einem befreundeten Arzt empfohlen wegen des Ausbruchs der georgischen Grippe, die Stadt zu verlassen, weshalb er damit beginnt, Lebensmittel zu bevorraten und bei seinem gehbehinderten Bruder einzuziehen. In den Nachrichten erfahren sie, wie sich die Pandemie ausbreitet und letztlich muss sich Jeevan allein auf den Weg in Richtung Süden machen, als die Vorräte zu neige gehen. 19 Jahre später ist die "Symphonie" unterwegs und zieht als Theater-/ Musikergruppe durch verlassene Städte an der Küste der USA. Dort haben sich vereinzelt autarke Gruppen von Menschen zusammengeschlossen, die das Zusammenleben neu organisieren mussten. Ohne die Annehmlichkeiten, an die man sich in der Gegenwart gewöhnt hatte, leben die Menschen jetzt ohne Benzin, Strom etc. wie in vergangenen Jahrhunderten - mit dem Unterschied, dass sie ein anderes, komfortableres, sicheres Leben kennengelernt hatten. Der Roman wechselt zwischen Vergangenheit (vor der Katastrophe) und der gegenwärtigen Situation (knapp 20 Jahre nach der Katastrophe) ab. Beide Erzählstränge sind durch den Comic "Station Eleven", eine Grafic Novel, die die Künstlerin Miranda, die die Ex-Ehefrau von Arthur ist, gezeichnet hat und die Lebensgeschichte des Schauspielers miteinander verknüpft. In den verlassenen Häusern, in denen das Symphonie-Mitglied Kristen einbricht, macht sie sich auf die Suche nach Veröffentlichungen des Comics und nach Presseartikeln über Arthur Leander, mit dem sie als Kinderschauspielerin auf der Bühne stand. Auf dem Flughafen Severn City in Michigan sind kurz nach dem Ausbruch der Katastrophe, als die Grundversorgung zusammengebrochen ist, die Passagiere mehrere Flugzeuge, darunter auch eine der Ex-Ehefrauen von Arthur und sein Sohn Tyler, gestrandet. Sie harren mehrere Tage am Flughafen aus, bis es an Tag 29 ein Pilot wagt, nach Los Angeles abzufliegen. Die restlichen Menschen verbleiben am Flughafen, ernähren sich vom Wild, das sie in den Wäldern jagen und beginnen sich wieder ein zivilisiertes Leben aufzubauen. Es entsteht sogar ein eigenes kleines Museum, wo sie Dinge sammeln, die sie an ihr altes Leben erinnern, aber nun nutzlos geworden sind. Severn City wird die größte Menschenansammlung in Nordamerika werden. Ich hatte mich auf den interessanten Plot dieses Katastrophenromans gefreut, fand die Umsetzung der Erzählung aber unnötig kompliziert und verwirrend und vor allem den Alltag nach der Katastrophe nicht ganz schlüssig nachvollziehbar. Durch die georgische Grippe wurde ein Großteil der Menschheit ausgelöscht. Die Überlebenden werden in Form der "Symphonie" beschrieben, eine Gruppe von (Laien-)schauspielern und Musikern, die durch die USA ziehen und den verbliebenen Bewohnern der Städte ein Stück Vergangenheit durch die Aufführung von Shakespeare-Stücken zurückbringen. Ich habe nicht ganz nachvollziehen können, warum die Menschen es nicht schaffen bzw. gar nicht erst versuchen, wieder eine Infrastruktur aufzubauen und sich damit abfinden, dass sie sich per Pferd fortbewegen und ohne Stromversorgung auskommen. Auch war mir schleierhaft, warum sie sich in Kleingruppen in Tankstellen und Restaurants zusammentun und nicht in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Ich musste mich wirklich lange in "Das Licht der letzten Tage" einlesen und ab Seite 200 ziehen sich die Fäden dann auch zusammen, der Roman wird runder und spannender zu lesen. Erst dann kann man auch die große Anzahl von Protagonisten unterscheiden und wie sie miteinander zusammenhängen und mit ihren Schicksalen mitfühlen. Die offenen Fragen und eine Handlung, die nach der Katastrophe immer wieder durch Rückblicken in Arthurs Leben unterbrochen wird und darüber hinaus sich etwas ereignislos in die Länge zieht, störten mich lange in meinem Lesefluss, wobei der Roman in der zweiten Hälfte deutlich an Spannung und Emotionen gewinnen konnte. Der postapokalyptische Plot und die unterschiedlichen Charaktere zusammen mit der melancholische Stimmung hätten durchaus mehr Potenzial gehabt, das die Autorin nicht ganz ausgeschöpft hat.
„So stand ich da, blickte auf mein zerstörtes Zuhause und versuchte zu vergessen, wie süß das Leben auf der Erde gewesen war.“ Dr. Eleven Die meisten Bewohner der Erde dahingerafft von einem Virus, gegen den die vermeintliche wissenschaftliche Allmacht der Menschheit nichts auszurichten vermochte. Apokalypse, Endzeit? So weit kein uns unbekanntes Szenario, vielmehr ein Thema, das Filmemacher und Schriftsteller seit jeher beschäftigt und in Anbetracht der aktuellen Ereignisse erschreckend vorstellbar scheint. Doch entgegen der üblichen übertriebenen Dramatik und Düsternis schildert Marie St. John Mandel das Ende der Welt auf eine unerwartet einfühlsame, ja beinahe schöne Weise. Umstände werden nebensächlich, vielmehr geht es um ausgelöschte Lebensentwürfe, Verlust, Rivalität aber auch Zusammenhalt und den Entschluss zum Neuanfang, Die Menschen sind beherrscht von einer tiefen Sehnsucht nach der Welt, im Licht der letzten Tage erkennen sie, was sie einst erreicht haben und wie wenig sie es zu schätzen wussten. Gleichzeitig sind sie nicht bereit diese Erinnerungen der Vergangenheit zu übergeben. Und über allem steht die Gewissheit: was einmal möglich war, wird wieder möglich sein.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.