
Vorleben — Inhalt
Von der verführerischen Macht des Zweifelns
Für Sophia, journalistischer Nachwuchsstar auf dem absteigenden Ast, eröffnet sich die große Chance: Sie soll für das Staatliche Symphonieorchester München das Programmheft konzipieren und die Musiker bei ihren Proben und Konzertreisen begleiten. Als aus der Affäre mit dem gefeierten Cellisten Daniel eine Liebesbeziehung wird und sie in seine Wohnung im Glockenbachviertel zieht, braucht sie ein neues Projekt. Sie beginnt, einen Roman zu schreiben, und stößt auf beunruhigende Informationen aus Daniels Vergangenheit. Wenn sie ihrem Verdacht folgt, gefährdet sie ihre Beziehung. Wie wahrhaftig muss Liebe sein?
„Georg M. Oswald ist eine Ausnahmeerscheinung in der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft.“ DIE ZEIT
Leseprobe zu „Vorleben“
1.
Warum schöpft man Verdacht gegen jemanden, den man liebt? Und ab wann? Und wenn man es tut, warum folgt man diesem Verdacht? Fragen wie diese stellten sich Sophia Winter seit einigen Tagen. Seit der Mann, den sie in Gedanken ihren Mann nannte, verreist war. Sie nannte ihn so, obwohl sie nicht verheiratet waren und obwohl sie nicht wusste, ob sie es jemals sein würden. Es war nicht ausgeschlossen, dass es einmal so käme, aber sie hatten noch nicht darüber gesprochen.
„Das liegt doch in der Luft“, hatte ihre Freundin Lea neulich am Telefon gesagt. Sophia [...]
1.
Warum schöpft man Verdacht gegen jemanden, den man liebt? Und ab wann? Und wenn man es tut, warum folgt man diesem Verdacht? Fragen wie diese stellten sich Sophia Winter seit einigen Tagen. Seit der Mann, den sie in Gedanken ihren Mann nannte, verreist war. Sie nannte ihn so, obwohl sie nicht verheiratet waren und obwohl sie nicht wusste, ob sie es jemals sein würden. Es war nicht ausgeschlossen, dass es einmal so käme, aber sie hatten noch nicht darüber gesprochen.
„Das liegt doch in der Luft“, hatte ihre Freundin Lea neulich am Telefon gesagt. Sophia hatte es abgestritten und sich über die blöde Redewendung geärgert – was lag schon in der Luft? Stickoxide vielleicht, Feinstaub, aber keine Hochzeiten –, doch insgeheim fragte sie sich auch, ob dies nicht der nächste Schritt wäre. Der nächste logische Schritt. So als hätte das, was zwischen Daniel und ihr geschah, je irgendetwas mit Logik zu tun gehabt.
Seit einem halben Jahr kannten sie sich, vor einem halben Jahr hatten sie sich ineinander verliebt, vor einem halben Jahr war sie bei ihm eingezogen. Hals über Kopf, auch so eine Redewendung, die immer wieder gebraucht wurde. Nicht von ihnen, von anderen.
Für sie fühlte es sich nicht so an, das stellten sie gelegentlich lachend fest, wie besonders wagemutige Komplizen, die sich von den Bedenken anderer anfeuern, aber nicht einschüchtern lassen. Alles war schnell gegangen, und wenn etwas, egal was, schnell geht, gibt es immer jemanden, der sagt, das sei zu schnell. Aber wer bestimmt, wie lange es mindestens dauern muss, um sich ineinander zu verlieben und zusammenzuziehen?
Jedes Paar erzählt die Geschichte, wie es sich kennengelernt hat, immer wieder gerne. Staaten haben Gründungsmythen, Paare auch. Wenn sich die Erzählenden ins Gehege kommen, ist das meist kein gutes Zeichen. Sophia und Daniel waren sich über ihre Geschichte einig, sogar über den ersten Satz, den Sophia gerne zu allen möglichen Gelegenheiten zitierte, im Bett, beim Essen, wenn sie mit Freunden zusammensaßen.
„Sie wissen also überhaupt nicht, wer ich bin?“, lautete er. Daniel hatte ihn gesagt, als Sophia sich zu ihm an den Tisch in der Musikerkantine des Herkulessaals setzte. Es war ein Vorstellungsgespräch gewesen. Es gefiel ihr, diesen Satz und ihre Antwort darauf wieder und wieder zu zitieren, wobei sie übertrieben die Stimmen nachahmte.
„Sie wissen also überhaupt nicht, wer ich bin?“, dunkel und bedeutungsschwer, und darauf kieksend sie:
„Ich habe nicht die geringste Ahnung.“
In Wirklichkeit war die Szene nicht so albern gewesen. Er hatte seinen Satz gesagt und dabei gelächelt, als bereite ihm die Vorstellung besonderes Vergnügen. Sie reagierte mit, wie sie hoffte, genug Ironie, um ihm zu signalisieren, dass sie die Regeln des Spiels, das sie gerade begonnen hatten, durchschaute und deshalb nicht zu ernst nahm. Das Spiel hieß: berühmter Cellist trifft Journalistin zum Interview.
Wenn sie jetzt daran dachte, war ihr weniger fröhlich zumute. Vielleicht stimmte es, dass sie überhaupt nicht wusste, wer er war, und zwar in einem Sinn, der weder ihm noch ihr gefallen konnte. Sie war sich dessen nicht sicher. Immer, wenn sie allein in der Wohnung war, verfiel sie ins Grübeln und fing an, alles infrage zu stellen. Die Dinge, die sie umgaben, wurden ihr fremd. Nur mit Daniel zusammen fühlte sie sich eingeladen, alles, was ihm gehörte, auch als ihres zu betrachten.
„Du bist hier zu Hause“, hatte er, vor allem in den ersten Wochen, wieder und wieder zu ihr gesagt, bis sie anfing, es zu glauben. Doch sobald sie alleine war, verflog dieser Glaube, und sie blickte anders auf die Sache. Dann dachte sie: Ich befinde mich in der Wohnung eines fremden Mannes.
Eines Mannes, den sie liebte, und – sie hatte jeden Grund, ihm das zu glauben – der sie liebte, und dennoch, eines Mannes, der die ersten knapp fünfzig Jahre seines Lebens ohne sie verbracht hatte. Da waren seine Möbel, seine Platten, seine Bücher, seine Wäsche, seine Erinnerungsstücke, seine Bilder, und, ja, sein Arbeitszimmer, das eine besondere Anziehung auf sie ausübte.
Wenn er zu Hause probte, was selten vorkam, tat er es dort. Ansonsten war sie diejenige, die zu Hause arbeitete. So zuvorkommend und einladend er war, dieses Zimmer hatte er ihr dafür nicht angeboten. Ohne es je ausdrücklich von ihm gehört zu haben, verstand sie, dass dies allein seines war. Er schloss es nicht ab, und sie durfte jederzeit hinein, aber ihr war klar, was sich darin befand, war nur für ihn bestimmt.
Doch wenn sie alleine war, zog es sie dorthin. Nicht, um zu tun, was sie angeblich tagsüber tat, nämlich zu schreiben, sondern um sich umzusehen. Sie tat es nicht, wenn er nur tagsüber weg war und abends nach Hause kam. Wenn er aber mehrere Tage unterwegs war, so wie jetzt, konnte sie nicht widerstehen.
Vor ein paar Wochen war zum ersten Mal eine Missstimmung zwischen ihnen aufgekommen, die nicht so schnell verflog, wie sie gekommen war. Beim Abendessen hatte er von einer neuen Bratschistin erzählt, die gerade ins Orchester aufgenommen worden war. Er lobte ihr freies und kraftvolles Spiel, erzählte, wie sie vor der Auswahlkommission, der er angehörte, brilliert hatte. Sie musste mehrere Soli vorspielen, Bach, Strawinsky, Hindemith.
„Wir waren alle ziemlich beeindruckt. Es kann nicht an ihrem Aussehen gelegen haben, denn sie saß beim Spielen hinter einem Vorhang, wir haben sie erst hinterher zu Gesicht bekommen.“
Daniel hatte ihr dieses Ritual schon öfter beschrieben. Die Aufnahme in das Staatliche Symphonieorchester war für fast alle Musiker das Ziel ihrer beruflichen Träume. Wer es bis zu so einem Vorspieltermin schaffte, hatte bereits den größten Teil bewältigt und doch noch die schwierigste Hürde vor sich. Die Auswahlkommission versammelte sich hinter einem Vorhang und lauschte von dort dem Spiel. Posen, Aussehen, Auftreten, das alles sollte ihr Urteil nicht beeinflussen.
Daniel erzählte, auch ihre achtjährige Tochter sei im Raum gewesen und habe, ganz in sich versunken, auf der Seite der Auswahlkommission gesessen.
Daniels Tochter war elf, und Sophia und er waren mit ihr auch schon einmal im Konzert gewesen. Die Geschichte war nicht eben gut ausgegangen, doch Sophia hatte verstanden, dass Daniel seine Tochter gerne öfter und auf andere Weise gesehen hätte, als es möglich war. Deshalb schien es Sophia etwas zu bedeuten, dass Daniel die Tochter der Bratschistin erwähnte.
Er sagte, sie sei „auch alleinerziehend“, und gegen dieses „auch“ regte sich Protest bei Sophia, denn er war nicht alleinerziehend. Seine Tochter lebte bei ihrer Mutter. Das Wort behauptete eine Ähnlichkeit, vielleicht sogar Verbundenheit mit der Musikerin, die in Wahrheit gar nicht bestand. Er erwähnte, sie sei ungefähr Mitte dreißig, also ein bisschen jünger als Sophia, und während er ihre Vorzüge als Bratschistin rühmte, kam es Sophia so vor, als meinte er damit eigentlich die Frau. Warum behelligte er sie damit? Wollte er sie darauf vorbereiten, bald abgelöst zu werden?
„Du bist also ganz begeistert von ihr“, sagte sie. „Warum sagst du es nicht einfach. Warum all die Ausführungen über ihr grandioses Spiel, wenn du eigentlich sagen willst, dass du scharf auf sie bist?“
Diese Bemerkung traf ihn offensichtlich völlig unerwartet. Die Stimmung sank auf den Nullpunkt. Daniel stocherte in seinem Essen herum, scheinbar um eine Antwort verlegen, bis er doch etwas sagte.
„Wirst du jetzt eifersüchtig?“
Nur diesen einen Satz, der keineswegs triumphierend klang, eher ratlos, nach einer Erklärung suchend. Sophia antwortete mit einem Schulterzucken, stand auf und fing an, den Tisch abzuräumen.
Er schien der Meinung, es handle sich um eine Bagatelle, ein Missverständnis, nicht der Rede wert. Sie wollte es, zumindest vorerst, dabei belassen, doch seine Frage hatte ihr einen Stich versetzt. Alles daran war toxisch, besonders das „Jetzt“ und das Futur. Sicher ohne es zu wollen hatte Daniel mit dieser Frage eingeräumt, was er sonst immer leugnete. Dass es eine Schieflage zwischen ihnen gab, ein Gefälle. Nicht von Beginn an sichtbar vielleicht, aber eben doch vorhanden.
Und natürlich hatte Daniel recht. Sie war eifersüchtig. Nicht auf die Bratschistin, die ihr herzlich egal war, zumindest, solange sie noch keinen Grund hatte, anzunehmen, dass Daniel hinter ihr her war. Sie war eifersüchtig auf viel mehr.
Nach diesem Vorfall, den man kaum so nennen konnte, war der Entschluss in ihr gereift, einmal Daniels Arbeitszimmer aufzusuchen und mehr zu tun, als sich nur umzusehen. Er war auch nur vage, sie nahm sich keinen konkreten Zeitpunkt dafür vor. Sie dachte, irgendwann einmal, wenn du nicht da bist.
Sie vergaß das Vorhaben, als sie sich wieder beruhigt hatte.
Daniel kam ein paar Tage später von sich aus noch einmal auf die Bratschistin zu sprechen und entschuldigte sich. Er setzte Sophia auseinander, dass sich seine Begeisterung wirklich allein auf deren berufliche Qualitäten bezog. Er machte es so charmant und selbstironisch, dass es ihr leichtfiel, ihm zu glauben.
Am Morgen seiner Abreise, bei ihrem letzten gemeinsamen Frühstück auf der Dachterrasse, dachte sie nicht mehr daran. Daniel würde länger als eine Woche unterwegs sein, das Orchester gab Konzerte in London, Brüssel und Amsterdam. Er holte Croissants aus der französischen Bäckerei, die kürzlich in einem der Nachbarhäuser eröffnet hatte.
„Die kriegst du in Paris nicht besser“, sagte er.
Sie stimmte zu, obwohl ihr der Überblick über die Qualität der Croissants in Paris fehlte, den er zu haben schien. Gemeinsam bereiteten sie Omelette mit fein gehackter Petersilie zu, die Sophia am Vortag besorgt hatte. Es gab frisch gepressten Orangensaft, und sie hatten genug Zeit, nach dem Frühstück noch einmal miteinander ins Bett zu gehen.
Sie verabschiedeten sich mit innigen Küssen und Umarmungen, Ratschlägen, wie sie die Zeit ohne einander überstehen konnten.
„Sei nicht zu aufgeregt“, sagte sie, als wäre das nötig.
„Und du, mach dir eine richtig gute Zeit“, sagte er.
Sie verstand, was er damit meinte: Arbeite weiter, lass dich nicht von den Selbstzweifeln einholen.
Bald darauf saß sie an Daniels zierlichem Sekretär aus Walnussholz im Wohnzimmer. So begann sie ihre Arbeitstage. Bevor sie bei Daniel eingezogen war, hatte sie noch nie einen derartigen Schreibtisch besessen. Genau das Möbel, an dem ein Cellist von Weltrang seine handschriftliche Korrespondenz erledigen mochte. Ihr letzter eigener Schreibtisch war ein umfunktionierter Tapeziertisch gewesen. Sie hatte ihn nicht unangemessen gefunden.
Sie fuhr ihren Laptop hoch, ordnete Dateien, öffnete eine, holte sich, zur Ermutigung und Stärkung, noch einmal frischen Kaffee, setzte sich wieder, las einige Zeilen, überlegte, wo sie weitermachen konnte, und spürte in diesen Momenten schon, wie sich weit hinten in ihrem Bewusstsein diese Welle auftürmte, die sie bald überrollen würde. Eine Welle aus Fragen, Einwänden, Bewertungen, die im Nu ihren Kopf vollständig überschwemmen würde, und dann wäre es unmöglich, auch nur ein Wort zu schreiben. Noch während sie dies dachte, war es so weit, und alles, was ihr blieb, war ein hilfloses Lachen über sich selbst. Vielleicht lachte eine Ertrinkende so, wenn sie begriff, dass jede Rettung ausgeschlossen war, all ihren Bemühungen zum Trotz.
Was sie jeden Morgen hier veranstaltete, war vollkommen absurd, dachte sie, ein Fall von schwerer Hochstapelei. Hier saß sie, eine gescheiterte, arbeitslose Journalistin, in der Luxuswohnung eines berühmten Cellisten, an dessen „Sekretär“, der mehr Geld kostete, als sie mit dem, was sie zu machen versuchte, jemals verdienen würde. Aber dieser Mann, ihr Geliebter, der noch keine Zeile davon lesen durfte, behauptete, sie schreibe an einem „Roman“. Er nutzte jede Gelegenheit, das Wort auszusprechen. „Wie geht es deinem Roman?“, „Sophia schreibt an einem Roman“.
Sie bat ihn, es nicht zu tun, nicht darüber zu reden, aber er bestand darauf. „Wieso nicht?“, sagte er. „Der erste Schritt, es zu schaffen, besteht darin, es sich zuzutrauen.“
Sie musste lachen. Aus dem Mund eines hochbegabten Musikers gewannen auch Selbsthilfetipps erstaunliche Autorität.
Dennoch, der Moment, in dem alle Vorbereitungshandlungen und -rituale beendet waren und sie zu schreiben beginnen sollte, kam einem beinahe täglich wiederkehrenden Albtraum gleich.
In den ersten Monaten ihrer gemeinsamen Zeit war das anders gewesen. Sie hatte den Auftrag bekommen, für das Jahresprogrammheft des Symphonieorchesters zu schreiben. Ein guter Job, für ihre Verhältnisse erstklassig dotiert. Auf die Frage, was sie danach machen sollte, hatten Daniel und sie eine gemeinsame Antwort gesucht und gefunden.
„Bleib bei mir. Finde heraus, was du tun willst. Schreibe. Du wirst sehen, früher oder später wirst du wissen, was du als Nächstes tun möchtest. Vergeude deine Zeit nicht mit irgendwelchen Brotjobs.“
Wie hätte sie sich ernsthaft dagegen sträuben sollen? Sie wollte ja bei ihm bleiben, mit ihm zusammenleben. Ihre gemeinsame Zeit war aufregend und schön. Doch je länger sie darüber brütete, was ihr „Projekt“ oder ihr „Roman“ sein könnte, desto heilloser erschienen ihr diese Bemühungen. Vielleicht war die Wahrheit ganz einfach die, dass es ein solches Projekt gar nicht gab, dass sie nicht imstande war, irgendetwas Künstlerisches zu schreiben, das den Erwartungen standhielt. Da half es auch nichts, dass Daniel immer aufs Neue beteuerte, es gäbe keine Erwartungen, sie müsse sich frei fühlen, einfach zu tun, was sie wollte. Am Ende, das stand doch schon fest, musste etwas ganz Großartiges herauskommen, das seiner Kunst irgendwie ebenbürtig war. Wann immer sie Versuche unternahm, sich aus dieser merkwürdig irrealen Verpflichtung herauszumanövrieren, redete er ihr gut zu. Mach dir keinen Druck, lass dir Zeit, bleib zuversichtlich. Wie sollten die paar armseligen Seiten, die sie in ihren Laptop gehackt hatte, dem standhalten?
Während Sophia mit diesen Grübeleien beschäftigt war, regte sich in ihr, zuerst vage und kaum merklich, dann immer bestimmter, der Wunsch, sich in Daniels Arbeitszimmer umzusehen. Sie versuchte, sich dagegen zu wehren: Welche Antwort wollte sie dort finden?
„Neugier konnte ein mächtiges Ablenkungsmanöver sein.“ Sie wusste nicht mehr, wo sie diesen Satz gelesen hatte, aber er schien ihr eine unheilvolle Möglichkeit zu beschreiben, die sie selbst betraf. Was, wenn ihre Neugier vor allem damit zusammenhing, was Daniel war und was sie selbst, zumindest ihrer Einschätzung nach, nicht war? Daniels Überzeugtheit von ihrem Talent war nicht ganz frei von Anmaßung. Was machte ihn zum Experten darin, zu beurteilen, wie talentiert sie war? Sie selbst kannte sich viel länger als er. Wie konnte er so sicher sein, er kenne sie besser als sie sich selbst?
Die Hoffnung, darin mehr über ihn und sein Talent, seine Fähigkeiten, sein Künstlertum erfahren zu können, war ein Grund, warum sein Arbeitszimmer solche Anziehungskraft auf sie besaß. In Museen gab es manchmal original eingerichtete Arbeitszimmer bedeutender Persönlichkeiten zu besichtigen. Der Besucher durfte dann, hinter einer roten Kordel stehend, das Tischchen oder den wuchtigen Schreibtisch bewundern, an dem unsterbliche Werke komponiert oder gedichtet, politische Ideen ersonnen, wissenschaftliche Entdeckungen gemacht wurden.
Die rote Kordel deutete dezent und doch mit Bestimmtheit darauf hin, dass der Betrachter von diesen Sphären ausgeschlossen bleiben musste, mochte er ihnen auch räumlich noch so nahe kommen. Denn dass es ganz gewöhnliche Verhältnisse, vielleicht sogar bescheidene Umstände waren, unter denen Bedeutendes entstanden war, nahm ihm nicht etwa das Geheimnis, sondern vergrößerte es noch.
Daniels Arbeitszimmer war genau durch eine solche unsichtbare Kordel vom Rest der Wohnung getrennt. Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem ihre Sprachlosigkeit sie aufstehen ließ, um hinüberzugehen.
Das Arbeitszimmer war der hinterste Raum der Wohnung. Sophia betrat es bereits mit dem Gefühl der Schuld. Es war ein schönes Zimmer. Und es war keineswegs gewöhnlich oder bescheiden eingerichtet. Auch nicht protzig, aber mit größter Sorgfalt.
In der Mitte stand der Stuhl, auf dem er übte. An den Wänden neben der Tür und über dem Türstock befanden sich Bücherregale aus schwerem, dunklem Holz. Ein aufgeräumter, wuchtiger Schreibtisch am Fenster. Das Gegenstück zu dem filigranen Sekretär, an dem sie sitzen durfte.
Ein dunkelbraunes Ledersofa auf der gegenüberliegenden Seite, nahe der Balkontür. Daniel besaß eine umfangreiche Musikbibliothek, aber auch viel Literatur. Das meiste davon gelesen, er war ein umfassend gebildeter, interessierter Mensch.
Mehr als einmal, wenn sie einen Tag im Bett verbracht hatten, hatte sie aus den Herumliegenden etwas ausgesucht, was sie sich gegenseitig vorlesen konnten.
„Sieh mal an, Amiel!“, rief sie aus, als sie auf eine Auswahl aus dessen Tagebüchern stieß. „Den kennen nicht viele.“
Daniel nahm die Anerkennung geschmeichelt entgegen. Sophia las ihm, im Schneidersitz auf dem Bett sitzend, vor:
„Wenn der Mann sich stets mehr oder weniger über die Frau täuscht, so deshalb, weil er vergisst, dass sie und er nicht ganz die gleiche Sprache sprechen …“
Sie lachten darüber, kein bisschen beunruhigt.
Das war sie auch jetzt nicht. Eher neugierig. Sie wollte wissen, wie die andere Seite aussah, diejenige, die er ihr nicht zuwandte, diejenige, die er vor ihr zu verbergen suchte.
Was machte sie so sicher, dass es diese Seite gab? Nichts! Sie nahm einfach an, jeder habe so eine Seite. Das schien ihr keine sonderlich hässliche Unterstellung.
Sie näherte sich den Bildern an der gegenüberliegenden Wand, Ölbilder, Stiche, und spielte sich selbst vor, sie interessierten sie, aber sie waren ihr vollkommen egal.
Also, was tat sie hier? Sich umsehen, dachte sie, um das andere Wort zu vermeiden, das ihr ebenfalls in den Sinn kam: herumschnüffeln.
Sophia bewegte sich auf Zehenspitzen und atmete flach, so als dürfe sie keinesfalls Spuren hinterlassen. Vor allem aber wollte sie es nicht. Wenn sie nur die kleinste Kleinigkeit veränderte oder irgendeine noch so geringfügige Spur hinterließ, konnte sie nicht mehr sicher sein, dass Daniel es später nicht bemerken würde. Vielleicht, oder sogar ziemlich sicher, würde er sie nicht zur Rede stellen. Aber seine verheerende Analyse von vor ein paar Wochen – „Wirst du jetzt eifersüchtig?“ – bekäme Nahrung.
Daniel schrieb Tagebuch. Er machte kein Geheimnis daraus. In ihrer Anfangszeit, als sie gemeinsam auf Reisen waren, schrieben sie oft gleichzeitig auf dem Hotelzimmer. Sie an ihrem Laptop, er in eines dieser eleganten schwarzen Notizbücher im mittleren Format. Das aktuelle hatte er auf seinen Reisen dabei, aber die vorhergehenden standen in seinem Bücherregal.
Sie hatte noch nie eines herausgenommen, geschweige denn in einem gelesen. Aber sie sah nach ihnen, so als wollte sie sich vergewissern, ob sie noch da waren. Warum tat sie das? Vermutlich doch nur, weil einmal der Tag kommen würde, an dem sie eines herausnähme, um es aufzuschlagen und hineinzusehen. Sie machte sich Vorwürfe deswegen. Warum gingen ihre Gedanken überhaupt in diese Richtung? War das der Charakter ihrer Beziehung? Er in der Welt draußen, ein berühmter Mann, sie in ihrem Beruf gescheitert, mit einer Scheinbeschäftigung in einem Asyl von seinen Gnaden? Es hatte so anders begonnen.
Doch nun war sie hier, hatte den ganzen Tag für sich und arbeitete angeblich oder tatsächlich an ihrem Projekt, das ihr vollkommen schleierhaft war. Daniel hingegen eilte von Konzert zu Konzert, von Plattenaufnahme zu Plattenaufnahme. Eine dichte Abfolge einzigartiger Momente höchster Kunst.
Sie hatte allen Anlass, sich zu fragen, was er noch so trieb, nicht nur, wenn er mit dem Orchester auf Reisen war. Warum sollte er ihr treu sein? Er war umgeben von schönen, erfolgreichen, hochbegabten Musikerinnen, begeistertem Publikum. Schnell hatte er sich auf sie eingelassen, warum sollte er sich nicht ebenso schnell wieder für eine andere Frau interessieren, die jetzt in seiner Nähe war?
Es war ein ungünstiges Gemisch aus Neid und Eifersucht, das sie antrieb. So als fände sie hier die Antworten. Wie war er zu einem großen Künstler geworden? Worin bestand der Trick? Konnte sie sich etwas von ihm abschauen, um ihr eigenes Vorhaben voranzubringen? Und was war mit den anderen Frauen in seinem Leben? Er behauptete, es gäbe keine, außer seiner Exfrau. Das konnte nur gelogen sein.
In einem der unteren Fächer des Bücherregals, etwa auf Höhe des Schreibtischs, stand eine Reihe von Fotoalben.
Sie konnte natürlich keine Aussage über alle Männer treffen, aber der Teil der männlichen Weltbevölkerung, den sie in ihrem achtunddreißigjährigen Leben kennengelernt hatte, legte keine Fotoalben an. Mütter taten das, Ehefrauen, bis sie irgendwann genug davon hatten, weil weder ihre Kinder noch ihre Männer sie freiwillig ansahen.
In dem Fach darüber befanden sich die Tagebücher. In ihnen würde sie nicht lesen. Sie befürchtete nicht, er würde es merken. Aber ihr selbst wäre es wie eine Bankrotterklärung für ihre Beziehung vorgekommen. Die Fotoalben stellten in gewisser Weise einen Kompromiss dar. Vermutlich hätte er sie ihr ohne Umstände gezeigt, sie vielleicht aufgefordert, selbst welche aus dem Regal zu nehmen und durchzusehen. Die Alben waren eigentlich Aktenordner mit beschrifteten Rücken, Jahreszahlen standen darauf, manchmal kombiniert mit Ortsnamen. Es waren keine fortlaufenden Jahreszahlen, es schien sich nur um eine Auswahl aus einem größeren Bestand zu handeln. Vielleicht diejenigen, die ihm besonders viel bedeuteten, und die er deshalb gerne zur Hand hatte. Ein Album war wohl älteren Datums, kein Aktenordner, sondern ein billiger weißer, an den Rändern vergilbter Kunstlederband. Es war dasjenige, nach dem Sophia griff, vielleicht einfach nur, weil es anders aussah als die übrigen. Sie hatte nicht vor, alle durchzusehen. Eigentlich suchte sie nur nach einem Hinweis, der ihr erlauben würde, dieses Gefühl zwischen Neid und Eifersucht zu nähren, das ihr zu schaffen machte.
Das weiße Album schien den Fotos nach aus den späten Achtzigern oder den frühen Neunzigern zu stammen. Sie waren nicht beschriftet.
Der Anblick von Daniel als ganz jungem Mann rührte Sophia. Er wirkte so fohlenhaft, schlaksig, ungelenk. Nichts von der souveränen, feingliedrigen Sicherheit, die ihn heute so besonders und imposant erscheinen ließ. Es waren nicht viele Aufnahmen darin. Einige, die allem Anschein nach von einer Konzertaufführung stammten. Lauter sehr junge Leute. Vielleicht ein Abschlusskonzert an der Musikhochschule. Der Rest bestand aus leeren Seiten. Ganz hinten aber waren einige Fotos lose eingelegt, die Sophias speziellen Wunsch, etwas Kompromittierendes zu finden, zumindest teilweise befriedigten. Es handelte sich um eine Serie von Polaroids, vielleicht sechs oder sieben. Auf typische Weise verblasst und unnatürlich in den Farben. Doppel- und Einzelporträts von ihm als jungem Mann, noch keine zwanzig, und einer Frau, vielleicht ein bisschen älter als er, aber nicht viel. Sie hatte die Haare blau-schwarz gefärbt und wild abstehend, eine Punkfrisur. Beide hatten sie tiefe Augenringe, Zigaretten in den Händen, und sie alberten herum, während sie jemand fotografierte. Jemand, den sie nicht fotografiert hatten, jedenfalls war er auf keinem der Bilder zu sehen. Ein ganz unterschiedliches Paar.
Sie ein Nachtschattengewächs, er ein unbeholfener, netter Junge. Aber sie schienen Spaß miteinander gehabt zu haben. Sophia schämte sich, nachdem sie die Fotos betrachtet hatte. Sie hatte gefunden, wonach sie gesucht hatte. Ging es ihr jetzt besser? Auf eine gewisse Weise schon, denn ihre Eifersucht hatte ein wenig Nahrung bekommen. Und doch kam sie sich lächerlich vor. Sie klappte das Album zu, stellte es zurück ins Regal und trat den Rückzug an.
Hatte sie die Fotos genau so wieder in das Album gesteckt, wie sie darin gelegen hatten? Sie waren lose und scheinbar achtlos hineingelegt worden, aber vielleicht würde Daniel trotzdem bemerken, dass jemand – sie – das Album aus dem Regal genommen hatte?
Sie rief sich zur Ordnung und zwang sich zurück an den Sekretär, um zu schreiben.
Sie hätte diese Episode zweifellos vergessen, verdrängt, genauso wie die belanglose Eifersucht auf diese mutmaßliche Liebe aus längst vergangenen Zeiten, wäre ihr nicht ein Gedanke in den Sinn gekommen, der sie eher befremdete und den sie sofort wieder verwarf: Hatte sie diese Frau nicht schon einmal gesehen?
2.
„Sie wissen also überhaupt nicht, wer ich bin?“, fragte er und lächelte, als bereite ihm diese Vorstellung besonderes Vergnügen.
„Ich habe nicht die leiseste Idee“, antwortete Sophia.
Das war nicht ganz die Wahrheit, und dennoch: Es grenzte an Hochstapelei, dass sie diesen Auftrag angenommen hatte. Er ahnte es, und sie wusste es. Sie konnte kaum Noten lesen, es wäre ihr sehr schwergefallen, die Namen von mehr als zehn Komponisten aufzuzählen, und sie erinnerte sich kaum an das letzte klassische Konzert, das sie besucht hatte. Es musste über ein Jahr her sein, und sie wusste nicht mehr, was gespielt worden war. All das zugeben zu müssen, wäre schrecklich gewesen.
„Und du glaubst wirklich, das ist kein Problem?“, hatte sie Lea gefragt, die ihr den Job vermittelt hatte.
„Nein, das ist vielmehr der Witz an der Sache!“, hatte die geantwortet.
Lea war eine ziemlich bekannte Fotografin, sie hatten schon öfter zusammen gearbeitet. Nun begleitete sie eine Spielzeit lang das Staatliche Symphonieorchester bei seinen Proben, bei Auftritten zu Hause im Herkulessaal der Residenz in München und auf Tourneen, die um die Welt führten: in die USA, nach Asien, Russland und beinahe jede Woche in eine andere europäische Großstadt. Sophia war voller Bewunderung, als Lea ihr auf dem Laptop die Bilder zeigte, die sie bisher gemacht hatte. Lea war gut im Geschäft, Aufträge dieser Größenordnung waren für sie keine Seltenheit.
„Das ist alles für das Jahresprogrammheft der kommenden Saison. Ein aufwendiges Ding, beinahe ein Buch. Dazu sind natürlich auch noch Texte nötig. Ich verstehe mich gut mit dem Orchestermanager und habe zu ihm gesagt: ›Ich kenne eine Journalistin, die schreibt Ihnen dafür ein paar richtig schöne Texte: lebendige, interessante Geschichten über Ihr Orchester, hundertmal spannender als irgendwelche musikwissenschaftlichen Abhandlungen.‹ Das fand er gut.“
„Und er weiß, dass ich keine Ahnung habe?“
„Ich habe ihm gesagt: ›Mal ehrlich: Die meisten normalen Leute, die ins Konzert gehen, haben keine Ahnung. Und genau für die soll sie schreiben.‹ Das hat ihm eingeleuchtet. Und außerdem habe ich ihm natürlich vorgeschwärmt, wie genial du bist.“
Sophia war glücklich darüber und konzentrierte sich darauf, professionell zu erscheinen. Sie telefonierte mit dem Manager, der ihr ein stattliches Honorar in Aussicht stellte und sie nach München einlud, um ein Gespräch zu führen.
„Ist das ein Vorstellungsgespräch?“
„Wenn Sie so wollen, ja. Sie werden dem Orchester sehr nahekommen. Wir wollen, dass Sie für die Dauer Ihrer Arbeit ein Teil davon werden. Sie haben überall Zugang, genießen volles Vertrauen. Vor allem das der Musiker. Sie sollen so nah wie möglich an sie herankommen. Ohne sie natürlich zu stören. Die Musiker müssen sich mit dieser Entscheidung wohlfühlen.“
„Und mit wem werde ich sprechen?“
„Mit einem Mitglied des Musikerrates, das gerade Zeit hat. Wer es genau sein wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir sind mitten in den Proben.“
Für Sophia war der Auftrag eine große Sache. Nicht nur lukrativ, sondern auch interessant. Sie wollte sich von ihrer besten Seite zeigen. Die anderthalb Wochen bis zu ihrer Reise nach München nutzte sie für einen Youtube- und Wikipedia-Crashkurs in Klassik, studierte eingehend das umfangreiche Material, das ihr der Orchestermanager zugesandt hatte, sowie die Homepage des Orchesters und stellte fest, dass es unmöglich war, in so kurzer Zeit auch nur halbwegs glaubhaft wenigstens als interessierter Laie zu erscheinen. Mit Schummelei, das war ihr klar, würde sie hier nicht weit kommen. Es blieb ihr nur die Flucht nach vorn. Vielleicht konnte sie damit landen, vielleicht würde man sie aber auch mit freundlicher Herablassung abblitzen lassen. Beide Möglichkeiten spielte sie auf dem Weg nach München unzählige Male durch. Immerhin hatte sie sich sämtliche Porträts der Musiker genau angesehen, mit Fotos und Biografien. Es waren mehr als hundert, und nicht alle hatten sie so beeindruckt wie das des Mannes, der ihr nun gegenübersaß, aber das wollte sie vorerst für sich behalten. Sein feines, scharf konturiertes Gesicht verriet, dass er es gewohnt war, sich ausdauernd zu konzentrieren und Müdigkeit zu unterdrücken. Er lächelte amüsiert.
„Und wie wollen Sie dann über uns schreiben?“, fragte er.
„Indem ich meine Unwissenheit zur Arbeitsgrundlage mache.“
Er lachte.
„Aber was soll dabei herauskommen?“
„Ich stelle mir meinen Auftrag vor wie den einer Ethnologin, die einen exotischen Stamm besucht. Einen Nomadenstamm, der den größten Teil des Jahres in der Welt herumzieht. Der ein starkes Kollektivbewusstsein besitzt, was man daran erkennen kann, dass er sich selbst als ›Klangkörper‹ bezeichnet. Dabei sind seine Angehörigen ausgeprägte Individualisten. Nur, wer sein Instrument auf einzigartige Weise zu spielen versteht, kann aufgenommen werden. Mich interessieren zum Beispiel folgende Fragen: Welchen Regeln folgt diese Initiation? Wie sieht das Leben der Stammesmitglieder aus, wenn sie einmal aufgenommen wurden? Worin bestehen ihre Siege, ihre Niederlagen? Was wollen sie erreichen?“
Er zog kurz die Augenbrauen hoch.
„Klingt besser, als ich dachte. Und die Musik? Soll sie gar keine Rolle spielen?“
„Wie ich darüber schreiben werde, weiß ich aber noch nicht. Das hängt von Ihnen ab, von den Musikern. Je mehr sie sich öffnen, desto tiefer kann ich in ihre Musik eindringen.“
„Das ist ein bisschen vage.“
„Es ist ganz konkret. Sehen Sie sich zum Beispiel den Raum an, in dem wir hier sitzen. Sie verschwenden vermutlich keinen Gedanken daran, wie er aussieht. Ich finde ihn kurios. Hätte man gedacht, dass eines der berühmtesten Orchester der Welt seine Pausen in einer Kantine verbringt, die einem Internat aus den Fünfzigerjahren ähnelt? Und doch, für jeden jungen Musiker, der hier aufgenommen werden will, sind das heilige Hallen.“
Ganz unabhängig davon, was sie sagte, spürte sie, dass sie ihm gefiel. Sie bemerkte es an der merkwürdigen Vertrautheit, mit der er sie von dem Augenblick an, als sie hereingekommen war, ansah. So, als würde er sie schon gut kennen. Es schmeichelte ihr und ermutigte sie, weiterzureden.
„Seien wir ehrlich“, sagte sie, „den meisten Menschen heute ist klassische Musik ziemlich fremd, wenn sie nicht gerade selbst Musiker sind. Klassische Musik gilt als elitär und schwierig. Wäre es nicht eine gute Idee, den Leuten die Furcht zu nehmen, sie seien zu dumm oder ungebildet, um Ihre Kunst zu verstehen, und sie dafür zu gewinnen?“
Nun lag alles in seinen Händen. Er konnte sie als Ignorantin hinauskomplimentieren, und ihr Job wäre erledigt. Mit etwas Glück würde man ihr das Rückflugticket erstatten.
„Mag sein“, sagte er, „aber das kann nur funktionieren, wenn Sie sich ganz und gar darauf einlassen.“
„Ich bin schon dabei. Ich ahnte ja nicht, dass ich heute mit Ihnen sprechen würde. Der Musikerrat des Orchesters besteht immerhin aus fünf Mitgliedern. Trotzdem wusste ich schon, als ich hier hereinkam, dass Sie Daniel Keller heißen und einer der gefragtesten Violoncellisten des Landes sind. Ich weiß, wann Sie mit dem Cello begonnen haben, wo Sie studiert haben, welchen Ensembles und Orchestern Sie angehörten, dass Sie an der hiesigen Musikhochschule unterrichten, und dass Sie ein Tononi-Cello von 1730 spielen.“
Er lachte.
„Ich sehe, man darf Ihnen nicht trauen, wenn Sie behaupten, Sie hätten keine Ahnung. Haben Sie das auswendig gelernt?“
„Nicht absichtlich. Dinge, die mich interessieren, merke ich mir.“
Sie hatte nicht erwartet, eine so passende Gelegenheit zu bekommen, um zu brillieren. Von den vier anderen Mitgliedern des Musikerrates hätte sie die Namen nicht gewusst. Seinen hatte sie behalten, weil sie sein Foto interessant gefunden hatte. Das Gesicht so hager und ausdrucksstark. Er musste es gewohnt sein, Eindruck zu hinterlassen. Dennoch war ihm anzusehen, wie geschmeichelt er sich fühlte.
„Es laufen gerade die Proben. Wollen wir mal reingehen? Dann sehen Sie ein erstes Mal, wie wir arbeiten“, schlug er vor.
„Das bedeutet: Ich habe den Auftrag?“
„Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.“
Bei dem Versuch, ihre gemeinsame Geschichte aufzuschreiben, hatte Sophia so begonnen. Sie hatte diese Seiten an einem einzigen Abend, jedoch schon vor Monaten geschrieben, voller Anfangseifer. Seither begannen ihre Tage wieder und wieder damit, sie zu lesen. Immer wirkten sie anders auf sie. Einmal fiel ihr zum Beispiel auf, dass sie schon damals das Wort „Hochstaplerin“ für sich gebraucht hatte. Ein andermal kamen sie ihr zu glatt vor, mal war sie unzufrieden damit, wie sie selbst darin erschien: zuerst ahnungslos wie eine Anfängerin, dann plötzlich allzu clever. War das wirklich der Verlauf ihrer ersten Begegnung gewesen? Schon der erste Satz: War es das, was er zu ihr gesagt hatte? Oder eher das, was sie ihm nun in den Mund legte? Und sie? War sie wirklich so gut vorbereitet gewesen? Oder war da nicht sofort jenes Interesse aneinander oder vielleicht sogar schon eine augenblickliche Verliebtheit, die ihre offensichtliche Ahnungslosigkeit im Verlauf der Unterhaltung zu einem immer geringeren Problem werden ließ?
So klar, so geradlinig wie dieser Anfang, war der Anfang in Wirklichkeit nicht gewesen. „Der Anfang“, welcher Anfang? Je länger sie darüber nachdachte oder leise vor sich hin sprach, was sie, wenn sie mit sich alleine war, öfter tat, desto rätselhafter wurden ihr alle diese vermeintlichen oder tatsächlichen Zusammenhänge. Wenn irgendetwas helfen konnte, dann, sich an die Fakten zu halten.
Die Fakten: Sie hatte Daniel vor ziemlich genau sechs Monaten kennengelernt. Das Datum ihres ersten Treffens stand in ihrem Kalender. Ihr kleiner, bordeauxroter Filofax lag vor ihr auf der Arbeitsfläche, zugeklappt. Sie musste nicht nachsehen, das Datum kannte sie auswendig. „Dinge, die mich interessieren, merke ich mir“, murmelte sie vor sich hin. Das war Sarkasmus. Daniel sagte, den müsse sie sich dringend abgewöhnen. Vor allem sich selbst gegenüber. Man könne nichts lernen, wenn man sich verbiete, Erfahrungen zu machen, und Erfahrungen zu machen, heiße in erster Linie, zu scheitern. Ein einschüchterndes Statement von einem „der gefragtesten Violoncellisten des Landes“, wie sie angeblich bei ihrer ersten Begegnung gesagt hatte. Vielleicht hatte sie das nicht ausdrücklich gesagt, aber es war ihr klar gewesen, und sie hatte ihm das auch zu verstehen gegeben. Daniel war von unermüdlichem Fleiß. Er übte, probte, spielte jeden Tag stundenlang. Anfangs dachte sie, „wie ein Besessener“, aber das traf es nicht. Daniel war nicht besessen von seinem Instrument, er war von ihm begeistert.
„Wir sprechen davon, ein Instrument zu beherrschen. Aber das ist falsch, es geht nicht darum, es zu beherrschen. Es geht darum, es zu spielen“, hatte er einmal zu ihr gesagt.
Und sie? Anfangs schien die Sache in der Balance. Er spielte Cello, sie schrieb. So hatte es begonnen, so sollte es weiter sein. Deshalb setzte sie sich nun jeden Morgen, nachdem er die Wohnung verlassen hatte oder verreist war, an den Schreibtisch.
War es richtig, über sich selbst in der dritten Person zu schreiben? Warum tat sie das? Warum sagte sie nicht einfach „Ich“? Weil ihr das Gesagte nur so die angemessene Distanz zu sich selbst zu bekommen schien. Wenn sie irgendetwas über ihre Lage herausfinden wollte, musste sie so viel Abstand wie möglich zu sich selbst gewinnen.
Wie war sie an diesen Punkt gekommen? Warum schien es ihr, als wolle sich das erstaunliche, gerade gefundene Glück wieder gegen sie wenden? Alles in ihr sträubte sich, darüber nachzudenken. Vor allem wollte sie nicht ihre Gefühle für Daniel in Zweifel ziehen. Sie liebte ihn. Wenn etwas nicht stimmte, dann musste es an ihr liegen, und sie musste es in Ordnung bringen. Schreiben konnte vielleicht helfen. Schreiben in der dritten Person über sich selbst. Distanz und Klarheit. Sie musste Schritt für Schritt vorgehen. Wenn auf diese Weise kein Roman daraus wurde, war das nicht so wichtig. Vielleicht kam etwas viel Wichtigeres dabei heraus. Sie musste rekapitulieren.
Wann genau verliebte man sich in jemanden? Sophia interessierte sich tatsächlich für den Zeitpunkt. Denn wenn sie an den Anfang dachte, kam es ihr mehr und mehr vor, als sei sie schon in Daniel verliebt gewesen, bevor sie ihn zum ersten Mal getroffen hatte. Wie konnte man schon in jemanden verliebt sein, den man noch gar nicht kannte? Das war eine dieser Fragen, denen sie nachgehen musste. Vielleicht hatte das viel weniger mit der Person zu tun, in die man sich verliebte, und viel mehr mit einem selbst.
Der Anblick der Polaroids hatte Sophia eigenartig berührt. Das Gefühl, die Frau darauf schon einmal gesehen zu haben. Es war vielleicht nicht vollkommen unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Auf den Fotos dürfte sie ungefähr Mitte zwanzig gewesen sein. Heute wäre sie also Mitte fünfzig und sähe wohl kaum noch aus wie damals. Die Erinnerung zu ihrem Gefühl fehlte.
Sophia wandte sich wieder ihrer Erzählung zu:
Daniel und sie hatten sich in der Musikerkantine ein paar Minuten unterhalten. Obwohl sie erst ganz kurz zusammen waren, stand schon fest, sie würden Zeit miteinander verbringen. Er war bereit, Zeit mit ihr zu verbringen, denn so waren die Spielregeln von Beginn an: er der bewunderte Künstler, sie die Berichterstatterin, auch wenn er diesen Unterschied gerne herunterspielte, indem er sich betont unkompliziert gab. Ebendies wiederum ließ sie denken, ich scheine ihm gut zu gefallen.
Er ermunterte sie mit einem Kopfnicken, aufzustehen und ihm zu folgen. Sie verließen die Kantine und stiegen über ein schmales, hölzernes Treppengeländer zu einer schweren Metalltür, auf der in großen roten Lettern NICHT BETRETEN! stand. Dahinter war, leise, das Orchester zu hören.
„Die 9. Sinfonie von Schostakowitsch“, sagte Daniel, dann zog er die Tür auf und lud Sophia mit einer Handbewegung ein, voranzugehen. Die Musik umfing sie, als sie über eine Feuertreppe den Balkon des Herkulessaals erreichten. Steil unter ihnen befand sich die Bühne. Sie klappten dicht nebeneinander zwei der schmalen Sitze aus und setzten sich. Die Ellbogen auf das Geländer des Balkons gestützt, sahen sie hinab. Daniel, den sie zu diesem Zeitpunkt noch „Herr Keller“ nannte, deutete auf den Mann am Dirigentenpult und flüsterte:
„Maeterlinck.“
Sophia nickte ehrfurchtsvoll. Zum Teil, weil sie so empfand, aber auch, weil sie zum Ausdruck bringen wollte, dass ihr die Exklusivität des Einblicks in die Arbeit des Orchesters, der ihr so ohne alle Umstände gewährt wurde, bewusst war. Die Musiker trugen größtenteils Jeans, T- oder Sweat-Shirts, Maeterlinck einen zerbeulten minzfarbenen Cardigan. Die Kleidung stand in einem überraschenden Gegensatz zur Festlichkeit der Musik und zur Autorität des Dirigenten. Maeterlinck hob die Hand, und das Orchester hielt sofort inne. Er sagte: „Nur ein paar Kleinigkeiten.“
Er war mit den Cellisten nicht zufrieden und erläuterte ihnen, worum es ihm ging. Er ließ einige Takte wiederholen. Das Ergebnis gefiel ihm noch immer nicht. Er unternahm einen neuen Anlauf, es zu erklären. „Dies hier ist so, wie der Mensch ist“, sagte er und ließ kleine pantomimische Darstellungen von Hoffnung, Nachdenklichkeit, Aufgeregtheit, Ängstlichkeit folgen. Sophia war entzückt.
„Als kleiner Junge saß er auf Schostakowitschs Schoß“, flüsterte ihr Daniel zu.
Sie lächelte, als handle es sich um einen Scherz, aber Daniel Keller lächelte zurück und nickte, um ihr zu signalisieren, dass das tatsächlich stimmte.
Die Stelle wurde wiederholt und wiederholt, Maeterlinck bestand darauf, zu hören, was er hören wollte. Er entschuldigte sich beim Rest des Orchesters: „Verzeihung, dass ich Sie so quäle, aber die brauchen das.“
Nach einigen Anläufen gelang es den Cellisten, den Ausdruck, den sie eben noch im Gesicht des Dirigenten fanden, in ihre Musik zu legen. Maeterlinck schien immer noch nicht ganz zufrieden, doch seine Miene wechselte gewissermaßen das Thema, und er ließ das Orchester weiterspielen.
Wochen später hatte Sophia genau diese Szenen vor Augen, als sie schrieb:
„Einem Laien wie mir erscheint der Dirigent als die mysteriöseste Figur in einem Orchester. Nichts, was er schafft, wäre je mit Händen zu greifen. Sein Werk hat er nicht komponiert, und es wird von anderen gespielt, und doch ist es unzweifelhaft vorhanden. Aber es bleibt unsichtbar, immateriell, niemand kann es wägen oder messen. Kann man es hören? Das Orchester kann man hören, den Taktstock nicht. Dennoch gilt der Dirigent vielen als die entscheidende Person auf der Bühne. Dahinter nur die Sehnsucht nach ein bisschen Starkult zu vermuten, wäre vermutlich zu kurz gegriffen. Was tut er denn also? Stellt er auf irgendeine Weise die Musik dar? Wohl kaum, er interpretiert keine Rolle, und einen Schauspieler würde man ihn nur im schlechtesten Fall nennen. Ein echtes Rätsel also.“
Sie fand, sie hatte sich bei dem Versuch, etwas halbwegs Intelligentes über den Dirigentenberuf zu schreiben, tapfer geschlagen.
„So, danke“, sagte Maeterlinck, als sie am Ende des Satzes angelangt waren, und das war offenbar das Zeichen für alle, sich von ihren Plätzen zu erheben und ihre Instrumente abzulegen.
„Pause“, sagte Daniel. „Sie kommen jetzt hoch in die Kantine. Auch der Maestro. Wenn Sie Lust haben, stelle ich Sie vor?“
Lust war vielleicht nicht das richtige Wort. Natürlich wollte, musste sie das Orchester kennenlernen, nur fühlte sie sich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass ihre Arbeit schon gleich losging, an Ort und Stelle.
„Denken Sie, das ist ein guter Zeitpunkt?“
„Wann sonst? Gibt es einen besseren? Sie werden nicht abgefragt, keine Angst. Und falls doch, springe ich Ihnen bei. Es geht nur darum, dass die Leute Ihr Gesicht einmal sehen, damit sie wissen, dass Sie uns nun begleiten.“
Sophias Schulterzucken und Nicken hieß, „Wenn Sie meinen“, und hinterließ, wie sie sofort befürchtete, nicht gerade den engagiertesten Eindruck. Sie ermahnte sich stumm, es jetzt nicht durch Zaghaftigkeit zu vermasseln. Daniel Keller ging mit einer aufmunternden Geste voran.
Die Kantine war nun lebhaft gefüllt, vor der kleinen Essensausgabe in der Wand hatte sich eine Schlange gebildet. Keller hielt einzelne Musiker auf und stellte ihnen Sophia vor, als „die Journalistin, die uns in nächster Zeit für das Programmheft begleitet“. Anders, als sie erwartet hatte, löcherten sie sie nicht sofort mit Fragen, um sie als Musikdilettantin zu überführen, sondern grüßten freundlich und eher beiläufig interessiert. Einige wechselten ein paar unverbindliche Worte mit ihr, wünschten ihr viel Vergnügen und Erfolg und wandten sich wieder ihren Gesprächspartnern und ihrem Kaffee zu.
Dann kam Maeterlinck herein. Er erschien ihr jetzt kleiner als vom Balkon aus. Begleitet von einer jungen Frau und einem jungen Mann, die beide offenbar ganz mit seiner Betreuung beschäftigt waren, durchmaß er den Raum, es wäre unmöglich gewesen, ihn anzusprechen, sein Blick war, über alles und alle hinweg, nach vorne gerichtet. Der Cardigan und seine verbeulte Hose unterstrichen in gewisser Weise noch seine Majestät. Daniel, der möglicherweise vorgehabt hatte, ihm Sophia vorzustellen, unterließ es. Als Maeterlinck an ihnen vorbei war, sagte Daniel:
„Er hat eine eigene Garderobe nebenan, in der er die Pausen verbringt. Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie mal eine Audienz bei ihm. Es ist gar nicht so leicht, ihm eine Frage zu stellen, die er für interessant hält.“
Sophia glaubte das sofort. Sie wünschte sich nun eigentlich nur noch, gehen zu können, am Nachmittag in der Stadt und im Hotel diesen ersten Tag zu verarbeiten, die Tatsache, dass sie den Auftrag bekommen hatte, wusste, wovon sie die nächsten Monate leben konnte, darüber nachzudenken, wie sie über das Orchester und seine Musik schreiben könnte, ohne sich damit zum Narren zu machen. Daniel schien zu spüren, dass sie wegwollte.
„Was haben Sie jetzt vor? Sind Sie verabredet?“, fragte er sie.
Genau in diesem Moment hatte sie zum ersten Mal das Gefühl, es könne sich ein Flirt zwischen ihnen ergeben.
Mit diesem letzten Satz hatte Sophia sich selbst, ohne es zu ahnen, eine Falle gestellt, in die sie auch gleich getappt war. Als sie ihn hinschrieb, fand sie, er gäbe einen hübschen Schlusseffekt für den Absatz. Zuvor hatte sie gesagt, sie interessiere der Zeitpunkt, an dem sie sich ineinander verliebt hatten, nun benannte sie ihn.
Tagelang brütete sie darüber, wie sie von dieser Stelle aus fortfahren konnte. Eigentlich war es doch ganz einfach. Sie müsste nun erzählen, wie sie spazieren gingen, zuerst im Hofgarten, dann im Englischen Garten. Sie müsste erzählen, worüber sie gesprochen hatten. Doch das erschien ihr als mühsame Fleißaufgabe, die überhaupt nicht erklärte, wie sie zueinanderkamen. Schließlich begriff sie, warum das so war.
Der Satz, „Genau in diesem Moment hatte sie zum ersten Mal das Gefühl, es könne sich ein Flirt zwischen ihnen ergeben“, ließ sie selbst vollkommen außer Betracht, obwohl er das Gegenteil behauptete. Sophia verblüffte diese Erkenntnis so sehr, dass sie sich fragte, ob es wirklich eine war. Was sollte das überhaupt heißen, „außer Betracht“? Sie brauchte eine ganze Weile, bis sie es, zunächst nur in Frageform, klarer fassen konnte.
Die Frage, um die es ihr an dieser Stelle ging, war nicht durch die Schilderung mehr oder weniger romantischer Ereignisse zu beantworten. Die Frage war: Wer hatte sich wen ausgesucht? Sie ihn? Er sie? Hierauf Antworten zu finden war viel wichtiger, als die Erlebnisse des Tages zu schildern. Es sei denn, die Erlebnisse des Tages konnten Aufschluss darüber geben.
Wenn Sophia an ihre erste Begegnung zurückdachte, kam es ihr so vor, als sei ihr schon davor klar gewesen, dass sie beide ein Paar würden. Das konnte doch eigentlich nur eine bestimmte Art von Wahrnehmungsverschiebung sein, dachte sie. Wie hätte sie wissen können, dass sie sich in Daniel verliebte?
Sie war schon verliebt, als sie sein Bild auf der Homepage des Symphonieorchesters gesehen hatte. Es war nicht so, dass sie schmachtend über diesem Bild zusammengebrochen wäre. Wenn sie sich recht erinnerte, hatte sie leise vor sich hingesagt, „Oh, hübsch“. Das war alles. Oder eben nicht alles. Denn das Bild arbeitete weiter in ihr.
Beim Schreiben verfiel sie auf die Idee, es so auszudrücken:
Es gab da eine Stimme, die sagte, „den schnappe ich mir“. „Stimme“ traf es gar nicht richtig. Es war ein Impuls, eine Regung, die das bedeutete, mehr nicht. Nie im Leben wäre Sophia auf die Idee gekommen, das als realen Plan auszusprechen, einfach, weil es kein realer Plan war.
Aber das erschien ihr beim Wiederlesen viel zu grob, zu ausdrücklich, zu ausgesprochen. Doch, das Wort „Fang“ kam in ihrem Wortschatz durchaus vor, aber normalerweise nicht, wenn sie über sich sprach. Stand Berechnung hinter ihrem Interesse für Daniel? Nein, auch wenn Daniel zweifellos das darstellte, was man einen Fang nannte.
Vielleicht sollte sie sich nicht mit der Frage abmühen, warum sie sich ineinander verliebt hatten. Irgendeine unergründliche Verbindung von Fantasie und Biochemie. Das große Geheimnis, das man gerne dahinter vermutete, existierte möglicherweise einfach nicht. War die Wahrheit dahinter viel banaler? Sophia hatte nichts gegen banale Erklärungen. Oft trafen sie ins Schwarze. Es war einen Versuch wert. Wie wäre es mit: Journalistin auf dem absteigenden Ast, in einer allgemeinen Lebenskrise befindlich, um das schöne Wort einer Therapeutin aufzugreifen, die sie einmal und nie wieder besucht hatte, verliebt sich in einen Mann, der alles hat, was sie vermeintlich oder tatsächlich entbehrt: Geld, Talent, eine luxuriöse Wohnung, Erfolg, Ruhm, eine Mitte, eine Aufgabe, etwas, das ihn begeistert. Nur konnte sie das bei ihrer ersten Begegnung alles noch nicht gewusst haben. Sie hätte es ahnen können, bestenfalls. Aber es hatte bei dem, was zwischen ihnen geschah, überhaupt keine Rolle gespielt.
Daniel schlug einen gemeinsamen Spaziergang vor, und sie stimmte zu. Er müsse zuvor nur noch kurz etwas erledigen, wenn es ihr nichts ausmache, könne sie schon vorgehen, er komme gleich nach. Auch damit war sie einverstanden.
Sie wartete unten vor dem Hintereingang der Residenz auf ihn. Es war Mitte April, aber das Wetter war, zu früh im Jahr, schon sommerlich. Die Cafés im Hofgarten waren voller Menschen.
Als Daniel wenig später aus der Tür kam, schlug ihr Herz so aufgeregt, dass sie sich nur wundern konnte. War das echt? Sie musste über sich selbst lachen, und sie lachte den näher kommenden Daniel Keller an, der sie bloß ansehen musste, um zu wissen, was mit ihr los war. Sie boten sich das Du an und begannen einen langen Spaziergang. Durch den Hofgarten hinüber zum Englischen Garten, und dort dann weiter bis zum Chinesischen Turm. Sophia hatte zwar diese Namen schon gehört, aber kannte sich in der Stadt nicht aus. Sie fragte Daniel, ob er immer in München gelebt habe. Er bejahte lachend, wie jemand, der eine hoffentlich verzeihliche Schwäche gesteht. Sie gingen weiter Richtung Norden, bis zum Aumeister, machten dort eine Pause und gingen wieder zurück. Sie waren stundenlang unterwegs, und allein die Dauer dieses ersten gemeinsamen Spaziergangs war schon Zeichen genug, dass etwas Außergewöhnliches zwischen ihnen geschah. Sophia erinnerte sich kaum noch an den Wortlaut ihrer Gespräche, aber an die Art des Einverständnisses, das sich zwischen ihnen herstellte. Als sie sich voneinander verabschiedeten, verabredeten sie sich für den Abend wieder, und es erschien ihr da schon ausgemacht, sie würden noch an diesem Tag ein Paar werden.
Er hatte das Schumann’s vorgeschlagen, für ein Abendessen. Er holte sie vom Hotel ab, und als sie das Lokal betraten, empfing sie der Chef des Hauses mit lässiger Vertraulichkeit, die Daniel galt, und in die er Sophia miteinbezog, sodass sie sich fühlen durfte, als sei auch sie hier schon seit langer Zeit ein willkommener Stammgast. Bald kamen weitere Gäste an ihren Tisch, bekannte Journalisten, von denen zwei behaupteten, Sophias Namen schon einmal gehört zu haben. Ein Tatort-Schauspieler, ein Rechtsanwalt, ein Theaterschriftsteller mit zwei Residenz-Schauspielerinnen und ein sinister wirkender Literaturagent.
Daniel stellte ihm Sophia als „Sophia Winter, Autorin“, vor, was den Literaturagenten sofort in Fahrt brachte.
„Was schreiben Sie?“, fragte er sie mit beinahe dramatischem Ernst.
Sie erzählte ihm von ihrem Auftrag, sie sprachen über Musik und Literatur, und schon nach kurzer Zeit schien er von der Idee besessen, Sophia könne einen Roman schreiben.
Während ihrer Unterhaltung beobachtete sie Daniel, der an allem, was sich an ihrem Tisch ereignete, spöttischen Gefallen zu finden schien. Ihr kam es vor, als hätten sich die Anwesenden entschlossen, ihr in einem Schnellkurs vorzuführen, warum diese Stadt einen so eigenartigen Ruf hatte, so liebenswert und lächerlich, so pompös und imposant, so provinziell und hochberühmt.
Der Abend ging lange, und draußen am Taxistand, nach einer überschäumenden und vielfältigen Abschiedszeremonie aller Beteiligten, kam es zwischen Sophia und Daniel beinahe zu einem ersten Kuss. Sie wechselten einen Blick des Einverständnisses, dass sie sich ihn für später aufheben würden, wenn sie allein wären.
Sophia wohnte im Hotel Olympic, in der Hans-Sachs-Straße, in der, wenige Häuser entfernt, auch Daniel zu Hause war. Vor dem Hotel gab es einen unschlüssigen Moment, und er schlug vor, noch ins Pimpernel zu gehen. „Früher war das ein reiner Transenladen, und als Hetero musste man sich wirklich was trauen, wenn man hineinging. Heute ist das eher ein Selbstzitat aus früheren Zeiten“, erklärte er ihr. Sie nahmen einen letzten Drink zusammen, und dann fragte er sie, ob sie noch zu ihm mitkommen wolle. Wieder auf der Straße küssten sie sich zum ersten Mal lange und leidenschaftlich. Danach beeilten sie sich, zu ihm nach Hause zu kommen.
„Hier sind wir“, sagte er, als er die schwere, dunkle Holztür zu einem Jugendstilaltbau aufsperrte, prachtvoll renoviert, wie alle Häuser in dieser Straße. Sie war nicht sonderlich überrascht, dass er an einem Ort wie diesem lebte, dennoch war sie beeindruckt. Ein schmiedeeiserner Käfigaufzug brachte sie in den fünften Stock, und von dort ging es ein weiteres Stockwerk zu Fuß in seine Wohnung, die, um es in ein Wort zu fassen, spektakulär war. Aber sie hielten sich nicht mit einer Führung auf. Das Schlafzimmer befand sich hinter einem Vorhang auf einer Empore rechts neben der Tür.
Wie war der Sex? Sie fand ihn zärtlich, aufmerksam, rücksichtsvoll, leidenschaftlich, auch wild. Alles also, was man von einem begnadeten Cellisten erwarten durfte. Keine bösen Überraschungen, keine peinlichen Entdeckungen, keine finsteren Abgründe. Sie liebten sich lange, und er schlief irgendwann, vor ihr, ein. Sie dachte lächelnd an Lea, fragte sich, ob es irgendetwas zu bereuen gab, aber das gab es nicht. Sie hatte sich auf ein romantisches Abenteuer eingelassen, zu dem sie sich beglückwünschte.
Sie erwachte von einem Kuss, den er ihr auf die Stirn gab. Das Licht des frühen Vormittags fiel durch die Fenster, er war schon angezogen und sagte, er müsse zu den Proben.
„Auf dem Esstisch steht ein Frühstück. Mach es dir gemütlich. Ich hoffe, du bist noch da, wenn ich wiederkomme?“, sagte er.
Sie nickte, und er machte sich auf den Weg.
Sie blieb und bestaunte Daniels Wohnung. Ein ausgebautes Speichergeschoss, große, ineinander übergehende Zimmer, hohe Fenster, hohe Räume, hell, eine Dachterrasse, ganz am anderen Ende eine Tür, hinter der sie einen weiteren Raum vermutete, das Arbeitszimmer, von dem sie noch nichts wusste. Vorne, neben dem Eingang, eine elegante Küche und, mitten im Raum, ein kleiner runder Tisch, auf dem ihr Frühstück stand. Sie ging ins Bad, und es erleichterte sie, keinerlei Utensilien zu finden, die auf eine Frau hinwiesen.
Sie musste ihn das fragen. Eigentlich konnte sie sich nicht vorstellen, dass jemand wie Daniel keine Freundin hatte. Er hatte sie nicht danach gefragt, ob sie in einer Beziehung lebte. Lediglich seine Exfrau und seine Tochter hatte er einmal erwähnt.
Sophia holte ihr Handy aus ihrer Jackentasche, stieg wieder ins Bett und rief Lea an, die nach dem zweiten Klingeln dranging. Sie war wohl schon am Arbeiten.
„Rate mal, wo ich bin?“, fragte Sophia.
„Ich habe schon Ausschau nach dir gehalten. Irgendwo hier im Konzertsaal?“
„Nein, in Daniel Kellers Bett.“
Das Schweigen Leas am anderen Ende war monumental.
„Bist du sicher, das war eine gute Idee?“, fragte Lea nach einer Weile. Es klang schlimmer verärgert, als Sophia erwartet hatte.
„Warum hätte ich es sonst getan?“
„Willst du wissen, was ich davon halte?“
„Ich vermute, du wirst es mir gleich sagen.“
„Ja, werde ich. Unprofessionell. Total unprofessionell. Was, denkst du, wird das beim Orchester auslösen. Und erst bei diesem Musikdirektor. Es war ein gutes Stück Arbeit, ihn davon zu überzeugen, dass du die Richtige für diesen Auftrag bist.“
„Ist das deine Version von ›was sollen denn die Leute denken‹?“
Sophia hatte mit freundschaftlichem Tadel gerechnet, aber nicht mit echter Verärgerung. Das Gespräch ging eher frostig zu Ende. Sophia war das in diesem Moment egal. Leas Reaktion mochte verständlich sein, aber nur, weil sie keine Ahnung hatte, was geschehen war. Noch war alles unsicher, aber es gab keine Ernüchterung, nichts fühlte sich verkehrt an. Sie war verliebt in jemand vollkommen Fremden. Und er?
Als Daniel von den Proben zurückkam, gingen sie sofort wieder miteinander ins Bett, und dann begann der Ausnahmezustand. Daniel hatte die nächsten paar Tage frei. Sie verließen das Haus nur zum Essen oder für den ein oder anderen langen Spaziergang, dann kehrten sie gleich wieder zurück. Sie erzählten sich gegenseitig ihr Leben, Daniel beschrieb Sophia, wie er als kleiner Junge von seinen Eltern zum Cellospiel gebracht wurde. Sophia berichtete über ihre Schreibanfänge in der Schülerzeitung. Sie erzählten über ihre Beziehungen zu ihren Eltern, zu Exfreundinnen und -freunden, Daniel war schon einmal verheiratet, Sophia nicht, Daniel fiel es immer noch schwer, über die Trennung und die Scheidung zu reden, Sophia ermunterte ihn. Dass die Ehe mit Nicole gescheitert war, hatte er inzwischen verkraftet. Sie waren seit dreieinhalb Jahren getrennt, die Scheidung war im vergangenen Jahr über die Bühne gegangen, aber da war Marie, die elfjährige Tochter, die auch Nicole und ihn immer noch aneinanderband. Je weniger Nicole und er miteinander zu tun haben wollten, je größer ihre Abneigung gegeneinander wurde, desto schwieriger gestaltete sich Daniels Umgang mit Marie.
„Du hast hier gar kein Kinderzimmer eingerichtet“, stellte Sophia fest.
„Nein. Ich bin zu viel auf Reisen, um das so regelmäßig hinzubekommen, wie sich die Behörden und Nicole das vorstellen.“
„Wollen wir was mit Marie machen?“
„Du meinst, wir zu dritt?“
„Warum nicht?“
„Ich glaube, Nicole wäre davon überhaupt nicht begeistert.“
„Warum denn nicht? Ich bin einfach eine Kollegin. Und wir machen uns zu dritt einen schönen Tag.“
„Frau Kollegin“, sagte Daniel und küsste sie.
Am Nachmittag des ersten Tages, den sie gemeinsam verbrachten, holte Sophia ihre Sachen aus dem Hotelzimmer, das sie nur für eine Nacht gebucht hatte.
Niemand fasste nach einer gemeinsam verbrachten Nacht den Entschluss zusammenzuziehen. Das entwickelte sich so nach und nach. Daniel forschte nicht allzu sehr nach, ob sie in Berlin etwas zu tun habe, als könne er so sicherstellen, dass sie bei ihm blieb. In Berlin wartete tatsächlich nichts auf sie, außer einer genervten Mitbewohnerin, von der sie ein paar Tage später eine SMS bekam:
„Kommst du noch mal wieder? Miete ist fällig.“
Sophia erzählte Daniel, dass sie ihrer Mitbewohnerin die Miete aus irgendwelchen Gründen bar bezahlen musste. Außerdem war ihr Verhältnis zueinander nicht das Beste, beide wären über Sophias Auszug froh gewesen. Es war ihr peinlich. Daniel interessierte sich nicht für die Details.
„Gib ihr die Chance. Lagere deine Sachen ein und zieh bei mir ein. Du hast sowieso hier zu tun“, sagte er.
Sie hätte es nicht zu hoffen gewagt, aber das war genau das, was sie hören wollte. Dass sie hier gebraucht wurde, dass eine wichtige journalistische Arbeit auf sie wartete, die es rechtfertigte, die Stadt zu wechseln. Durch diesen Satz befand sie sich endgültig nicht mehr in einer kopflos begonnenen Affäre. Was sie tat, hatte plötzlich Hand und Fuß.
„Wer bin ich?“ ist eine der grundlegenden Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Gewöhnlich beantworten wir sie, indem wir Geschichten erzählen. Uns und den anderen. Doch diese Geschichten, wir wissen es genau, entsprechen nicht immer ganz der Wahrheit. Ich wollte ein Buch schreiben, in dem es um diese Fragen geht: „Wer bin ich?“ Und um die sich daran anschließende: „Wer bist du?“
Stellen Sie sich vor, der Geliebte, mit dem Sie, eine Frau Ende Dreißig, erst seit einem halben Jahr in dessen Wohnung zusammen leben, verreist für eine Woche beruflich. Sie bleiben zuhause, und stoßen auf ein Jahrzehnte altes Foto, das ihn als jungen Mann zeigt. Neben ihm eine andere Frau. Kein Problem, denken Sie? Sie mögen Recht haben. Nur, was tun Sie, wenn Sie das Gesicht dieser Frau wiedererkennen. Sie haben es schon einmal gesehen, da sind Sie sich sicher, und zwar in einem ziemlich schrecklichen Zusammenhang. Und nun fragen Sie sich doch mit einer gewissen Unruhe, was es damit auf sich hat.
Für mich verkörpern die beiden Hauptfiguren des Romans die eingangs gestellten Fragen. Sophia steht für „Wer bin ich?“ und Daniel für „Wer bist du?“
Sophia ist eine Journalistin, die nach verheißungsvollem Beginn etwas vom Weg abgekommen ist. Es handelt sich dabei gar nicht so sehr um eine berufliche Krise, auch, wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht. Sie spürt, dass sie aus einer Rolle gewachsen ist, die sie einmal besser ausgefüllt hat, und sie weiß nicht, ob es eine neue Rolle für sie gibt, oder ob es überhaupt erstrebenswert ist, eine „Rolle“ durch eine andere zu ersetzen. Das Schreiben, soviel ahnt sie, könnte ihr helfen, der Wahrheit näher zu kommen. Doch hat sie überhaupt genügend Talent dazu?
Sie begegnet Daniel, als sie den Auftrag bekommt, über ein Symphonieorchester in München zu schreiben, dem er angehört.
Daniel erscheint ihr als perfektes Gegenbild zu sich selbst: Gefeierter Cellist in einem weltbekannten Orchester. Sein Talent ist über jeden Zweifel erhaben, seine Karriere hat ihn scheinbar zwangsläufig dorthin geführt, wo er jetzt ist.
Sehr schnell wird aus der Begegnung der beiden eine Liebesgeschichte. Sophia kann es gar nicht schnell genug gehen, sich aus ihrem bisherigen Leben zu verabschieden. Sie zieht zu Daniel, der sie ermutigt, das zu tun, was sie ohnehin schon tut: zu schreiben. Nun aber einen Roman.
Aber ist es wirklich die Beziehung zweier Künstler, die die beiden führen?
Sophia ist voller Zweifel. Vielleicht habe ich sie deshalb zur Schriftstellerin gemacht. Die Zweifel, die das Schreiben mit sich bringt, sind mir bestens vertraut. Sie zu lösen, ist eigentlich im Kern, das, worum es beim Schreiben geht.Bei Daniel hingegen ist es umgekehrt. Seine ganze Kunst handelt davon Zweifel, Unsicherheiten ganz und gar zu beherrschen.
Ich hatte einmal einen ähnlichen Job wie Sophia im Roman und durfte einem Symphonieorchester hinter den Kulissen bei der Arbeit zusehen und mit ihm reisen. Diese Erfahrung hat meinen Zugang zur „klassischen“ oder besser E-Musik sehr verändert. Wenn ich orchestrale Musik höre, achte ich nun mehr auf das, was die einzelnen Musiker dazu beitragen, auf den menschlichen Anteil daran. Zu dieser Zeit entstand auch die erste Idee für die Figur, die später zu Daniel wurde. Während der Arbeit am Roman habe ich gerne die Suiten für Violoncello von Bach gehört, gespielt von Pablo Casals. Es sind alte Schallplattenaufnahmen, ich habe sie mir im „Optimal“ gekauft, dem Platten- und Buchladen in der Kolosseumstraße, in dem auch Sophia eine folgenschwere Entdeckung macht.
Aber zurück zum Orchester, ich war zutiefst beeindruckt von der Perfektion mit der dort gearbeitet wird. Das beginnt mit der unglaublichen Logistik und Organisation, und gipfelt im Zusammenspiel dieses „Klangkörpers“ (so der etwas eigenartige Fachbegriff) mit dem Dirigenten. Nur die talentiertesten, besten Musiker werden aufgenommen, aber Talent ist bei weitem nicht alles, was es dazu braucht. Wer je gesehen hat, mit welchem Fleiß, welcher Akribie jeder einzelne von ihnen, und schließlich das ganze Orchester, probt, und immer wieder probt, weiß, was ich meine. Sophia erscheint es, als wäre es dieser Apparat, der die Zweifel bändigt. Wenn das Orchester auftritt, ist immer schon gesetzt, dass nun große Kunst geboten wird. Ihr eigenes Talent erscheint ihr fragwürdig. Alles, was ihr bleibt, ist, es Satz für Satz zu beweisen.
Sophia begibt sich auf die Suche nach der Geschichte hinter dem Foto. Sie führt zurück ins Münchener Nachtleben der Achtzigerjahre im Glockenbachviertel. Einen Ausschnitt von dem, was ich dabei vor Augen hatte, kann man in dem Video „Living On My Own“ von Freddie Mercury sehen, das damals dort gedreht wurde. Aber auch heute vergessene Bands wie zum Beispiel Psychic TV haben ihren Auftritt. Sophia blickt bei ihren Recherchen allerdings in Abgründe, in die sie lieber nie geschaut hätte.
Wie sie das tut, und was sie dabei entdeckt, will ich hier nicht verraten, nur soviel: Indem sie darüber schreibt wird sie zur Autorin der wahren Geschichte Daniels. Findend und erfindend bringt sie eine Wahrheit ans Licht, an die sie niemals gerührt hätte, hätte sie die Wahl gehabt.


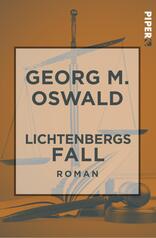











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.