Produktbilder zum Buch
Während wir feiern
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Es ist ein treffender Einblick in ein bestimmtes Milieu der Wirtschaftsmetropole Zürich, mit vielen topografisch präzisen Details.“
Tages-Anzeiger (CH)Beschreibung
Wie in jedem Jahr feiert die deutsche Sängerin Alexa am Abend des Schweizer Nationalfeiertags ihren Geburtstag mit einer Dachparty – leider noch ohne den Einbürgerungsentscheid. Währenddessen braucht Kamal eine sichere Bleibe. Wenn er nicht unverzüglich das Land verlässt, droht ihm die Abschiebung nach Tunesien. Weil dort aber Homosexuelle verfolgt werden, fragt er seinen Deutschlehrer Zoltan, ob er ein paar Tage bei ihm untertauchen kann. Doch Alexas bester Freund sagt Nein aus Gründen, die er nicht mal vor sich selbst zugibt. Im Laufe des Tages eskalieren die Ereignisse, und nicht nur das…
Wie in jedem Jahr feiert die deutsche Sängerin Alexa am Abend des Schweizer Nationalfeiertags ihren Geburtstag mit einer Dachparty – leider noch ohne den Einbürgerungsentscheid. Währenddessen braucht Kamal eine sichere Bleibe. Wenn er nicht unverzüglich das Land verlässt, droht ihm die Abschiebung nach Tunesien. Weil dort aber Homosexuelle verfolgt werden, fragt er seinen Deutschlehrer Zoltan, ob er ein paar Tage bei ihm untertauchen kann. Doch Alexas bester Freund sagt Nein aus Gründen, die er nicht mal vor sich selbst zugibt. Im Laufe des Tages eskalieren die Ereignisse, und nicht nur das Fest, auf dem alles zusammenläuft, steht infrage.
Inspiriert von Virginia Woolfs Klassiker „Mrs Dalloway“ zeichnet Ulrike Ulrich ein Panoramabild unseres Lebens in Europa – vielstimmig, mit eigenem Ton und literarischer Brillanz.
„Wer erfahren will, wie sich das Leben im 21. Jahrhundert in einem der Herzen des Kapitalismus anfühlt, von welchen Widersprüchen die Menschen zerrissen werden und wie die große Politik auf die private Liebe wirkt, der sollte diesen rasanten, bitteren und immer wieder komischen Roman lesen.“ Lukas Bärfuss

Medien zu „Während wir feiern“
Über Ulrike Ulrich
Aus „Während wir feiern“
Sie muss diese Blumen loswerden. Deren giftig-süßer Geruch es jetzt tatsächlich bis ins Schlafzimmer geschafft hat. Kann sein, dass sie sogar davon aufgewacht ist. Wie hat sie bloß denken können (wenn auch nur für einen Moment), dass Adrian der Absender ist. Adrian, der Schnittblumen weder mag noch schenkt, Lilien schon gar nicht. Der längst im Spital ist (die Decke neben ihr hat er aufgeschlagen), rettet wahrscheinlich schon Leben, während sie noch im Bett liegt. Und heute – mit einem Ruck setzt sie sich auf, ist ja immer gleich wach, wenn sie wach ist –, heute [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
"Es ist ein starkes Buch!“
SRF „Literaturclub“ (CH)"Vier Mal eine Leseempfehlung"
SRF „Literaturclub“ (CH)„Den Spannungsbogen hat Ulrich großartig konstruiert. Präzise durchorchestriert verflechten sich die Schicksale der Personen und spitzen sich gegen Ende zu.“
NZZ Bücher am Sonntag (CH)„Ein bezwingendes Buch über das Leben in der Mitte Europas und der Mitte der Gesellschaft - und wie es ist, wenn man dort nicht zugehört.“
Leipziger Volkszeitung„Eine kluge Gesellschaftsanalyse“
Kölner Stadt-Anzeiger„Dieses Buch ist ein Spektakel!“
Brigitte Woman„Das Buch ist eine Odyssee des Ankommens. Es braucht keine abenteuerlichen Reisen, nicht die Weite der Welt, sondern nur die Enge der Schweiz, um zu erzählen, was es erzählen will.“
(CH) Neue Zürcher Zeitung - Online„›Während wir feiern‹ ist voller guter Dialoge und dichter Gedanken, die sich in den sehr unterschiedlichen Tonlagen der Figuren mal schnippisch und oft liebevoll anhören, meist schlagfertig, voller Wortwitz, oft cool [...] ein Buch der vielen guten Einfälle, der Zufälle auch.“
(CH) Luzerner Zeitung„›Während wir feiern‹ ist auf der Ebene der Figurenpsychologie ein feinnerviges und subtil orchestriertes Buch, das präzise das Überlappen von Außenwelt und subjektivem Empfinden festhält.“
vicecersaliteratur.ch (CH)„Ein Roman, der weckende Wirkung hat und tief in die Menschen, ja in die heutige Gesellschaft insgesamt hineinschaut, sie analysiert - all diese Tiefe, in die Ulrike Ulrich hier eintaucht, findet statt vor dem ganz alltäglichen Hintergrund der Organisation eines oberflächlichen Ereignisses. G-e-n-i-a-l !“
philosophenstreik.com„Die Gegenüberstellung der Wahrnehmung einer Situation aus der Sicht von mindestens zwei Personen ist prototypisch für den Roman und gleichzeitig nie stereotyp gestaltet, was dazu führt, dass man nach anfänglich angenehm dahinplätschernder Lektüre in einen Sog hineingezogen wird.“
feinerbuchstoff.com„Rasant, humorvoll, wortgewandt und mit einem frauenspezifischen Blick erzählt, versteht es Ulrike Ulrich, die heute wichtigen Themen Migration und Menschrechte in Europa auf unseren Alltag herunterzubrechen, und dabei hält sie uns auch als Nichtschweizerinnen einen Spiegel vor.“
der-kultur-blog.de„Ein intelligentes, sozialkritisches Lesevergnügen“
borromaeusverein.de„Ein kluges und wichtiges Buch.“
Radio Transglobal„Ulrich schafft es, die Gleichzeitigkeit des Banalen und Existenziellen abzubilden sowie die Hilflosigkeit der Figuren angesichts der Tatsache: Während wir feiern, bangen andere darum, dass wir sie abschieben.“
Die Zwanzger (A)„Es ist ein treffender Einblick in ein bestimmtes Milieu der Wirtschaftsmetropole Zürich, mit vielen topografisch präzisen Details.“
Tages-Anzeiger (CH)Worum geht es in Deinem Roman?
Es geht um Projektionen, um Vorurteile, Bilder, die jede und jeder sich macht, von anderen und von sich selbst. Wie oft wir uns irren. Um die Konsequenzen von Handeln und Nichthandeln. Und darum, wen wir ein- und wen wir ausschließen, wenn wir Wir sagen. In welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und um Liebe. Um Liebe geht es auch.
Warum hast Du Zürich als Ort des Geschehens gewählt?
Zürich ist – wie so viele große Städte – voller Gegensätze und Widersprüche, Zürich steht also auch stellvertretend für die europäischen Metropolen. Eine progressive Stadt, in der die Gesetze einer oft eher konservativ abstimmenden Schweiz gelten. Eine Stadt mit Anspruch auf Weltoffenheit mitten im sich abschottenden Europa. Eine Stadt mit vielen ganz unterschiedlich privilegierten Zugewanderten. Ich fühle mich als Zürcherin mit einem immer wieder staunenden, auch kritischen Außenblick.
Welche Leser*innen wünscht Du Dir für Deinen Roman?
Leser*innen an sich sind ja schon mal wunderbar. Wenn ich es spezifizieren soll, dann vielleicht: Leser*innen mit Offenheit, die bei der Lektüre ihre eigene Position hinterfragen, die sich für Zwischen- und Grautöne interessieren. Für Menschen und ihre Geschichten. Leser*innen, die sich einlassen und auseinandersetzen. So wünsch ich mir auch mich selbst, wenn ich lese. Und schreibe.




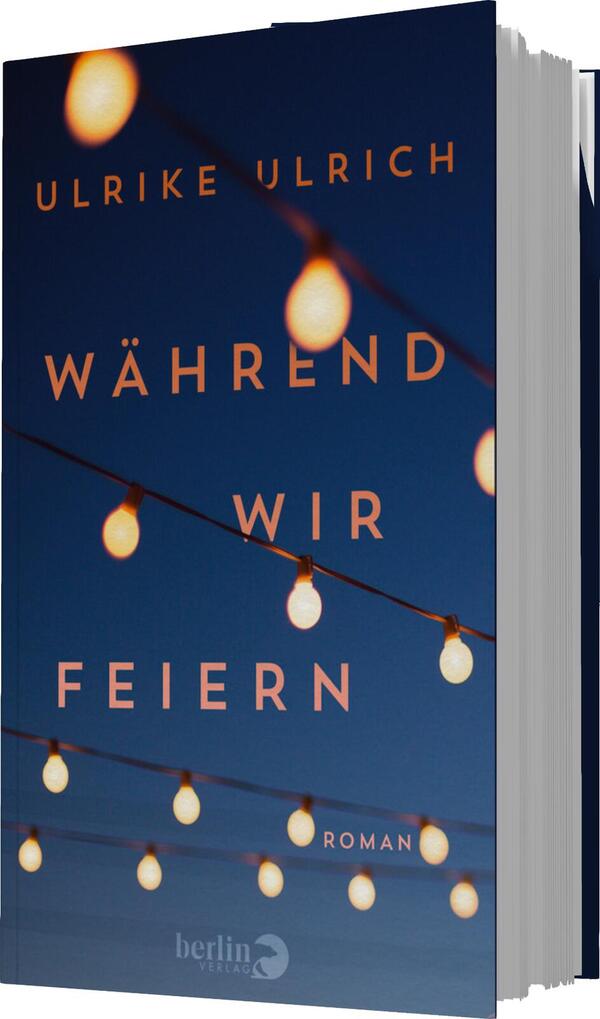
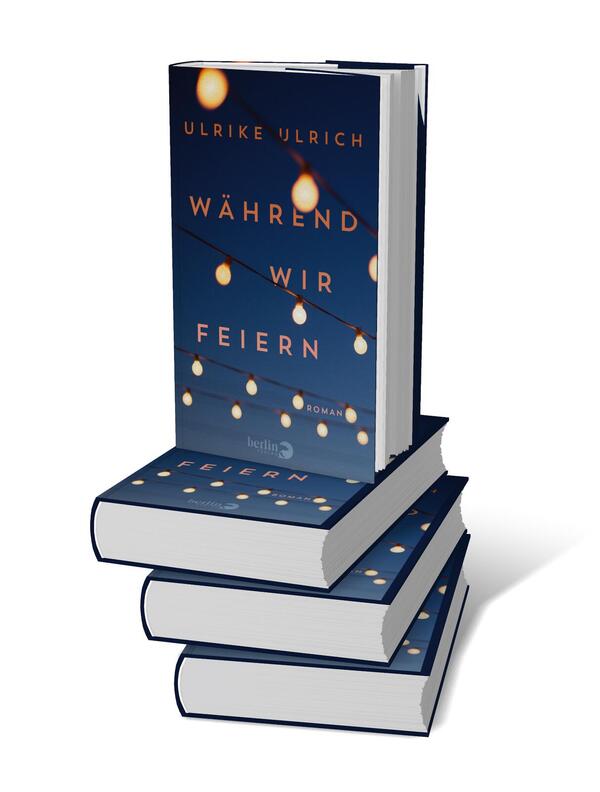







Die erste Bewertung schreiben