
Was am Ende möglich ist
Wie ein gutes Sterben gelingen kann
— Ein Palliativmediziner erzähltEin Palliativmediziner erzählt
"Der Pallitivmediziner Matthias Gockel hat ein Buch über Sterben geschrieben. Wer es liest, geht sicher nicht leichter aus dem Leben aber hat nach der Lektüre verstanden, dass er Verantwortung übernehmen kann für seine letzten Lebenswochen, sofern er sich traut, dem unabwindlichen Schicksal, das wir alle haben, ins Auge zu schauen." - swr 2
Was am Ende möglich ist — Inhalt
„Halte es für möglich, dass dein Arzt beim Thema Tod noch mehr Angst hat als du.“
Wir müssen über den Tod reden. Es nicht zu tun, bedeutet, die Entscheidung darüber, wie wir sterben wollen, anderen zu überlassen. Der Palliativmediziner Matthias Gockel erlebt täglich, wie sehr Verdrängen und Verschweigen einen bewussten Umgang mit dem Sterben blockieren - nicht nur bei Patienten und Angehörigen, sondern auch bei ihren Ärzten. Er fordert deshalb eine neue Art der Gesprächskultur. Indem er aus seinem Berufsalltag erzählt, macht er nicht nur Mut, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Er gibt zudem wichtige Orientierungshilfen, wie sich in einem zunehmend auf Kostenersparnis ausgerichteten Medizinsystem Entscheidungen treffen lassen, die für ein Sterben in Selbstbestimmung und Würde unabdingbar sind.
Leseprobe zu „Was am Ende möglich ist“
Vorwort
„Warum ist der Tod eines Menschen stets eine Art Skandal? Warum sind wir jedes Mal erstaunt, wenn ein Lebender dahingeht, als fände solch ein Ereignis zum ersten Mal statt?“ Die Antwort auf die Fragen, die der französische Philosoph Vladimir Jankélévitch einmal gestellt hat, fällt leicht: Weil wir Angst vor dem Tod haben.
An den Tod gewöhnt man sich nicht. Der Tod ist immer jung. Man wird die Angst vor ihm nicht los. Auch ich spüre sie, obwohl ich mich als Palliativmediziner jeden Tag mit Sterben und Tod beschäftige.
Oft scheint es, als wären [...]
Vorwort
„Warum ist der Tod eines Menschen stets eine Art Skandal? Warum sind wir jedes Mal erstaunt, wenn ein Lebender dahingeht, als fände solch ein Ereignis zum ersten Mal statt?“ Die Antwort auf die Fragen, die der französische Philosoph Vladimir Jankélévitch einmal gestellt hat, fällt leicht: Weil wir Angst vor dem Tod haben.
An den Tod gewöhnt man sich nicht. Der Tod ist immer jung. Man wird die Angst vor ihm nicht los. Auch ich spüre sie, obwohl ich mich als Palliativmediziner jeden Tag mit Sterben und Tod beschäftige.
Oft scheint es, als wären gerade Ärzte besonders von dieser Angst betroffen. Doch sie einzugestehen, gilt im Gesundheitssystem als Zeichen von Schwäche. Ärzte sind darauf trainiert, cool und kompetent zu wirken, distanziert und professionell aufzutreten. Dabei macht auch sie der Tod unsicher. Weil sie so gut darin sind, Leben zu retten, halten sie es manchmal kaum aus, wenn ihnen das nicht gelingt.
Die Palliativmedizin kann als Ergänzung oder auch als Alternative betrachtet werden zum Heilenwollen um jeden Preis und zum reinen Verlängern der Lebenszeit. Ihr Ansatz ist es, bei lebensbedrohlichen Erkrankungen die Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen zu verbessern. Dazu gehört nicht nur das Lindern von Schmerzen oder anderer körperlicher Symptome. Genauso wichtig ist das frühzeitige Erkennen und Behandeln von psychischen, sozialen oder spirituellen Problemen.
Im besten Fall geht Palliativmedizin aber über bloße Fachkompetenz hinaus. Es gibt Probleme, die sich nicht rein technisch lösen lassen. Manche Schmerzen sind durch kein Medikament zu stillen. Für sie braucht es Aufmerksamkeit und Zuwendung und eine Haltung, die dem anderen die Gewissheit gibt, wahrgenommen zu werden – im Leben wie im Sterben.
Nicht zuletzt von dieser Haltung soll das vorliegende Buch handeln. Sie soll sich, so meine Hoffnung, beim Gang durch die Kapitel mitteilen. Ich habe versucht, dem Buch einen persönlichen, nie abstrakten Tonfall zu geben. Mir geht es darum, das Vermitteln von konkreten Fakten und Informationen mit dem Erzählen zu verbinden; einem Erzählen aus der Innensicht von zwanzig Jahren Berufserfahrung.
Orientiert habe ich mich dabei an Fragen, die mir bei meiner Arbeit immer wieder begegnen: Was sollten Patienten mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung unbedingt beachten? Welche Möglichkeiten palliativer Versorgung gibt es in Deutschland? Was können Angehörige tun? Wie sieht eigentlich der Alltag auf einer Palliativstation aus? Warum fällt es vielen Ärzten so schwer, Schmerzen adäquat zu behandeln? Kann sich der Traum von einem „guten Sterben“ erfüllen?
Ich erzähle von Menschen, die ich in ihrer letzten Lebensphase kennengelernt und bis zum Tod begleitet habe. So ist es auch ein Buch voller Geschichten geworden, traurigen wie absurden, wütenden wie komischen.
Im Lauf der Zeit habe ich gelernt, dass gelingende Kommunikation viel dazu beitragen kann, der Angst vor dem Sterben und dem Tod etwas von ihrer Wucht zu nehmen – durch das Vermitteln von Sicherheit und das Schaffen von Nähe. So einiges kann schiefgehen im Gespräch zwischen Ärzten und Patienten, Ärzten und Angehörigen, Angehörigen und Patienten. Anhand zahlreicher Beispiele möchte ich Wege aus der Sprachlosigkeit aufzeigen, die viele in der Gegenwart Sterbender befällt.
Dieses Buch kann als ein Appell verstanden werden, mit größerer Entschlossenheit über die letzten Dinge zu reden. Das gilt auch für das mit großen Ängsten besetzte Thema Sterbehilfe. Ich möchte es in den abschließenden Kapiteln ebenso diskutieren wie das in meinen Augen verbesserungswürdige Konzept der Patientenverfügungen. Darüber hinaus finden sich im Anhang noch einige praktische Tipps. Sie sollen lebensbedrohlich erkrankte Patienten zu einer offeneren Kommunikation mit den behandelnden Ärzten ermutigen.
Der Tod wird immer ein Skandal bleiben. Aber wir können lernen, ihm etwas weniger unvorbereitet zu begegnen. Dazu möchte ich mit diesem Buch einen Beitrag leisten.
Matthias Gockel, im Juli 2019
Einführung
Trau dich, über den Tod nachzudenken
Zwischen Diesseits und Jenseits
Es war ein stressiges Jahr gewesen, und ich hatte mich auf den Urlaub gefreut. Einige freie Tage über Silvester; etwas Zeit, mit Freunden über die vergangenen Monate zu reden – die ersten, in denen ich als junger Palliativmediziner an einer Münchner Klinik gearbeitet hatte. „Gut“, antwortete ich auf die Frage eines Freundes, wie es mir gehe, „richtig gut, ich bin ganz entspannt.“ Wir saßen vor dem Kamin, es war Abend, und ich glaubte, was ich sagte. Doch etwas an meiner Antwort schien den Freund zu irritieren. Er sah mich aufmerksam an und fragte noch einmal: „Nein, ich meinte: Wie geht es dir wirklich?“
Hätte er nicht nachgehakt, wäre wohl nichts passiert, und ich wäre davongekommen. So aber brachte seine Hartnäckigkeit alles zum Einstürzen. Plötzlich rückte das in München auf der Palliativstation Zurückgelassene wieder ganz nah: Gespräche, Krankheitsverläufe, Schicksale. Und nicht zuletzt der Tod. Wie in einer Diashow zogen die Gesichter all der Patienten vor meinem inneren Auge vorbei, die ich im zurückliegenden Jahr betreut hatte und die bei uns gestorben waren. Ein langer, flackernder Zug letzter Bilder, manche schon etwas unscharf, manche noch so deutlich, als hätte ich mich gerade erst von dem Betreffenden verabschiedet. Ich begann zu weinen und konnte für eine halbe Stunde nicht mehr damit aufhören.
Das ist viele Jahre her. Heute habe ich gelernt, mit dem Thema Krankheit und Sterben, das in meinem Beruf nun einmal allgegenwärtig ist, umzugehen. Ich habe Wege gefunden, das Unumgängliche zu akzeptieren und es als Teil meines Lebens zu betrachten. Ich fliehe nicht mehr vor der Macht, die vom Tod und allem, was mit ihm zusammenhängt, ausgeht und die für viele so beängstigend ist, dass sie ihr Heil im Verdrängen suchen. Für gewöhnlich klappt das ja auch gut. Im Alltag werden wir kaum je gezwungen, an den Tod zu denken. Fast scheint es zu seiner Natur zu gehören, dass er immer nur die anderen trifft. Und die anderen sind weit weg, vor allem aber sind sie: nicht wir. Nur manchmal, wenn unsere Abwehrmechanismen versagen, merken wir, welche Dämonen im Dunkel unserer Ängste lauern, immer bereit, uns anzufallen. Dann wird uns klar, dass wir sehr weit davon entfernt sind, den Tod als das wahrzunehmen, was er ist. Er ist das am wenigsten überraschende Ereignis der Welt.
Dass das auch und vielleicht sogar ganz besonders für Menschen gilt, die im Beruf häufig mit Sterben und Tod konfrontiert werden, habe ich immer wieder bei Workshops mit angehenden Ärzten erlebt. Zum ersten Mal geschah das vor einigen Jahren auf Einladung der Münchner Studierendeninitiative „MuM – Medizin und Menschlichkeit“. Engagierte junge Leute, die mehr wollten als das, was ihnen der Uni-Betrieb zu bieten hatte, und deshalb für eine Woche ein Seminarhaus irgendwo in Oberbayern angemietet hatten. Für Blicke über das Curriculum hinaus waren verschiedene Dozenten eingeladen worden, etwa ein Psychologe, aber auch ein Komplementärmediziner, der über alternative Heilmethoden referieren sollte. Mich hatte man für den Bereich „Medizin und Sterblichkeit“ angefragt.
Schon kurz nach meiner Zusage war mir klar gewesen, dass ich keinen trockenen Vortrag halten wollte. Die Teilnehmer sollten sich auf einer eher emotionalen Ebene mit dem Thema Sterblichkeit auseinandersetzen. Dazu schwebten mir einige Reflexionsübungen vor, die ich selbst im Rahmen meiner Palliativausbildung kennengelernt hatte. Sie waren mir im Gedächtnis geblieben, weil sie mich damals alles andere als gleichgültig gelassen hatten. Nun wollte ich herausfinden, ob es mir gelingen konnte, ähnliche Emotionen auch bei anderen hervorzurufen.
Für die erste Übung trennte ich den Seminarraum mithilfe eines Seils in zwei Hälften. Eine Hälfte blieb leer, in der anderen versammelten sich die zwanzig Teilnehmer, die ich in kleine Gruppen aufteilte, nachdem jeder Einzelne durch Durchzählen seine eigene Nummer erhalten hatte. Dann erläuterte ich die Aufgabe. Jeder sollte den anderen in der Gruppe erzählen, warum er heute hier war. Das Mitgeteilte sollte möglichst individuell ausfallen und durfte gern auch sehr persönlich sein. Wichtig war, ins Reden zu kommen und zu versuchen, sich den anderen ein wenig näherzubringen.
Natürlich gab es einen Haken an der Sache, schließlich sollte es keine reine Gesprächsrunde werden. Ich kündigte an, in gewissen Zeitabständen einen Gong zu betätigen und eine Zahl aufzurufen. Der Teilnehmer, zu dem die Zahl gehörte, musste dann auf der Stelle aufstehen und sich in die andere Hälfte des Raums begeben, und zwar ganz egal, ob er gerade nur zuhörte oder mit Erzählen dran war. Dort sollte er stehen bleiben und den anderen zuschauen, konnte aber selbst nicht mehr ins Geschehen eingreifen und durfte sich auch nicht mit seinen nach und nach hinzukommenden Nebenleuten unterhalten. Wann der Gong jeweils ertönte und welche Zahl aufgerufen wurde, lag allein in meinem Ermessen. Eine Art „Reise nach Jerusalem“ also. Aber eine, die unter der Überschrift „Sterblichkeit“ stand und daher bei allen, ohne dass ich das explizit aussprechen musste, die entsprechenden Assoziationen auslöste. Das zeigte sich spätestens bei den Rückmeldungen nach Ende der Übung.
Eine Studentin sagte: „Ich wollte meine Geschichte erzählen, unbedingt. Aber ich kam und kam nicht dran. Und dann redete der Typ unmittelbar vor mir auch noch mit einer Engelsgeduld über das langweiligste Zeug, das man sich nur vorstellen kann. Warum konnte der sich nicht kurz fassen oder schneller reden? Oder sich wenigstens auf wirklich Wichtiges konzentrieren? Aber plötzlich machte es klick, und mir wurde bewusst, dass es gleich für mich vorbei sein konnte; dass also diese Erzählungen möglicherweise das Letzte waren, was ich hörte, bevor ich starb. Und von dem Moment an war alles anders. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem bei einem so langweiligen Vortrag mit einer so großen Aufmerksamkeit zugehört. Und ich war glücklich dabei.“
Ein anderer sagte: „Auch mir war es unheimlich wichtig, erzählen zu können, und ich kam ja auch an die Reihe. Nur eben als Allerletzter, als sich alle anderen schon drüben, in der anderen Hälfte des Raums, befanden. Niemand war mehr da, der meine Geschichte hören konnte. Da habe ich gelernt, dass man beim Wünschen besser vorsichtig ist. Denn in Wahrheit war es mir gar nicht so sehr darum gegangen, zu Wort zu kommen, sondern darum, von jemandem gehört zu werden.“
Am härtesten traf es den Studenten, der als Erster auf die andere Seite gerufen wurde. Er musste erleben, dass sein Verstummen und damit sein „Tod“ für die anderen nur ein banaler Zwischenfall war. Die entstandene Lücke wurde schnell geschlossen, und das Leben ging weiter, als wäre überhaupt nichts geschehen. Aber auch für ihn gab es Trost, denn ganz undurchlässig war die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits dann doch nicht: „Ich fand das so ungerecht, ganz allein im Nichts zu stehen, bis ich sah, wie ein guter Freund zu mir herüberschaute und mit den Lippen lautlos den Satz formte: ›Hinter dir, der Nachtisch!‹ Tatsächlich, da stand der Kuchen! Und auf einmal war das mit dem Sterben gar nicht mehr so schlimm.“
So enthielt diese Übung sogar noch eine von mir gar nicht eingeplante Lektion in Sachen Hoffnung aufs Paradies …
Das Leben ist manchmal ein Arschloch
Die zweite Übung zielte noch stärker auf die jeweilige Persönlichkeit des Einzelnen, auf seine Hoffnungen und Werte. Aus diesem Grund kann man sie recht gut auch ganz für sich allein, in der eigenen Vorstellung durchspielen. Ich verteilte an jeden der Teilnehmer fünf Karteikarten und einen Stift, dann nannte ich das Motto der Übung: „Was ist mir wirklich wichtig im Leben?“
Jeder hatte eine Viertelstunde Zeit, um diese Frage für sich zu beantworten, und zwar anhand von bestimmten Kategorien: Welche Person ist mir am wichtigsten? Auf welche meiner Fähigkeiten bin ich am meisten stolz? Gibt es etwas an meinem Äußeren, auf das ich großen Wert lege? Welchen Traum möchte ich noch verwirklichen? Und schließlich: Welcher materielle Gegenstand besitzt den höchsten Wert für mich? Fünf Kategorien, fünf Karteikarten, fünf Antworten. Je kürzer sie ausfielen, desto besser. Nur ein Stichwort war verlangt, keine Begründung. Also etwa: „Paul“; „anderen Sicherheit geben“ oder auch: „Klavier spielen können“; „meine Hände“; „eine Weltreise unternehmen“; „die Armbanduhr, die ich von meinem Vater geerbt habe“. Zwar würde die Übung in der Gruppe abgehalten werden. Was jeder auf seine Karten geschrieben hatte, würde aber, das versicherte ich den Teilnehmern vor Beginn, weder den anderen gezeigt noch laut vorgelesen werden.
Dann ging es los. Ich stellte mich in die Mitte des Raums und sagte: „Leben, das bedeutet sehr oft auch Verlust. Dinge gehen verloren, Träume zerplatzen, es gibt schwere, uns für immer verändernde Krankheiten, und Menschen, die wir lieben, sterben. Es kann nicht schaden, sich das gelegentlich klarzumachen.“
Ich griff nach einer großen Schale, die ich mitgebracht hatte, und begann meinen Gang von Teilnehmer zu Teilnehmer. Jeder sollte sich von einer der fünf Karten, die er in der Hand hielt, trennen und sie in die Schale legen. Den meisten, das zeigt die Erfahrung, fällt diese erste Wahl noch leicht. Sie entscheiden sich für den Gegenstand. Weg mit der geliebten Lederjacke, der in einer glücklichen Stunde erworbenen Kafka-Erstausgabe oder dem so lange gehüteten Bündel Briefe, zusammengehalten von einer roten Schleife. Das Hergeben mag zwar durchaus schmerzen, berührt aber noch nicht den Kern der Persönlichkeit. Interessanterweise fand sich am Ende dieser Eröffnungsrunde in der Schale auch einmal eine Karte, auf der „Meine Mutter“ stand. Ein Psychoanalytiker hätte daraus sicher eine spannende Sitzung gestaltet. Und ich lernte: Nicht immer muss die wichtigste Person in unserem Leben auch die sein, mit der wir die besten Gefühle verbinden.
„Verlusterfahrungen prägen unser ganzes Leben“, sagte ich, „sie hören nie auf.“ Also nächste Runde. Jetzt wurden die Karten schon deutlich zögerlicher in die Schale gelegt. Einige der Teilnehmer schienen bis zur letzten Sekunde zu überlegen, für welche sie sich entscheiden sollten. Leicht fiel es keinem. Ausgeträumt der Traum vom eigenen Geschäft, mit Freunden aufs Land zu ziehen oder den Doktortitel doch noch zu schaffen. Nächste Runde. Vorbei die Illusion, noch jung genug zu sein für ein Gesicht ohne Falten, den aufrechten Gang, die intakte Gesundheit. Eine Teilnehmerin sagte mir hinterher, dass sie zum ersten Mal die Klagen ihrer Großmutter verstanden habe. Es tut weh, Stück für Stück von sich hergeben zu müssen, ohne etwas dafür zurückzuerhalten. Sukzessive wird alles weniger, woran man so lange festgehalten, worüber man sich und sein Dasein in der Welt definiert hat.
Mittlerweile war es vollkommen still geworden im Raum. Nur noch zwei Karten hatte jeder in der Hand. Ich konnte an den Gesichtern ablesen, wie sich manch Teilnehmer innerlich gegen das Kommende wappnete – weil sie die Pointe der Übung nicht kannten und noch davon ausgingen, eine Wahl zu haben, wussten sie nicht, wie sinnlos das war. Ich sagte: „Das Leben ist nicht nur Veränderung und Verlust. Das Leben ist manchmal auch ein ungerechtes Arschloch, das macht, was es will. Halten Sie jetzt bitte die letzten beiden Karten hoch, und dann werde ich herumgehen und für Sie entscheiden, welche davon in die Schale gelegt wird.“
Ich habe diese Übung inzwischen recht häufig durchgeführt, und an dieser Stelle ist es bisweilen vorgekommen, dass ich sie abbrechen musste, weil sich im Verlauf der Runden die Emotionen immer mehr gesteigert haben und schließlich in unverhohlene und gegen mich gerichtete Aggression umgeschlagen sind. Das war jedoch nicht weiter tragisch. Denn im Grunde zeigte es ja nur, dass die Übung ihren Sinn erfüllte. Ich wusste schließlich, dass die Aggression in Wahrheit nicht mir galt, sondern der Unberechenbarkeit des Lebens und dem damit verbundenen Kontrollverlust. Man hat die wirklich wichtigen Dinge manchmal eben nicht in der Hand, und das wurde den Teilnehmern nun buchstäblich vor Augen geführt.
Beinahe immer bleibt die Karte mit der wichtigsten Person bis ganz zum Schluss im Rennen. Und auf der zweiten übrig gebliebenen steht meistens entweder die geschätzte Fähigkeit oder der noch zu verwirklichende Traum. Gehe ich herum, um meine Wahl zu treffen, achte ich sehr genau darauf, wie jemand die beiden letzten Karten hält. Es ist beinahe wie früher beim Spiel mit dem „Schwarzen Peter“: Welche Karte wird weiter nach hinten geschoben? Welche wird mir regelrecht angeboten? Einmal, als ich die Übung im Rahmen eines Festivals mit Menschen abseits des Medizinsystems veranstaltet habe, geriet ich an eine ältere Dame, die mir ihre beiden Karten nur äußerst widerwillig entgegenzustrecken schien. Beim Näherkommen sah ich auch den Grund. Auf die eine Karte hatte sie geschrieben „Meine beste Freundin“ und auf die andere „Eine Skandinavien-Reise mit meiner besten Freundin“. Ich nahm ihr die erste Karte weg, wodurch gleich auch die zweite allen Wert verlor. Der Blick, den ich dabei auffing, hatte Tötungspotenzial.
Ohne Zweifel: Die Übung hat es in sich. Das wurde mir schon beim allerersten Workshop bewusst. Nach jeder Runde mit den Münchner Studierenden hatte ich die Schale entleert und die entsprechenden Karten zu Stapeln sortiert. Ich wollte abends nachsehen, welche Karte die Teilnehmer in welcher Runde abgegeben hatten. Insgesamt einhundert Karten, verteilt auf fünf Stapel. Als ich aber nach einer Zigarettenpause wieder zu meinem Tisch zurückkam, fiel mir auf, dass manche Stapel deutlich kleiner geworden waren. Besonders der mit den Karten, die ganz zuletzt in die Schale gewandert waren, hatte abgenommen. Offensichtlich hatten sich manche Teilnehmer während der Pause ihre Karten, auf denen sie die wichtigste Person notiert hatten, heimlich wieder zurückgeholt. Ich musste lächeln. Wer eine simple Karteikarte mit einem Namen drauf keinem Fremden überlassen wollte, musste sie mit genau der von mir erhofften Bedeutung aufgeladen haben. Und dabei hatte ich mich zu Hause noch gefragt, ob die Übung vielleicht nur für kollektives Gähnen sorgen würde. Jetzt war ich froh, dass ich meine ursprüngliche, zugegeben etwas theatralische Idee, die Karten vor aller Augen in einer Feuerschale zu verbrennen, nicht in die Tat umgesetzt hatte. Vermutlich wäre ich dann nicht mehr mit heiler Haut aus der Nummer herausgekommen.
Diese Übung funktioniert, weil sie unsere Schutzmechanismen unterläuft. Wer es gewohnt ist, Themen wie Vergänglichkeit und Sterben in den hintersten Winkel seines Bewusstseins zu verbannen, wird auf dem falschen Fuß erwischt. Die Rationalisierung, warum diese Übung eigentlich gar nichts mit einem selbst zu tun hat, müsste einsetzen, bevor die ersten Emotionen intensiver werden oder gar, wie ich es häufig erlebt habe, die ersten Tränen fließen. Passiert das nämlich, ist es zu spät für Coolness. Man kann nicht sagen: „Das betrifft mich alles nicht“, und gleichzeitig um ein Taschentuch bitten. Mir war es während meiner Ausbildung nicht anders ergangen – warum löst denn bitte schön so ein banaler Zettel, den ich hier abgebe, so starke Gefühle aus? Damals hätte ich es kaum für möglich gehalten, dass andere auch so emotional reagieren könnten wie ich. Heute weiß ich, dass fast alle es tun. Nur scheinen wir uns leider für die meiste Zeit an die stillschweigende Übereinkunft zu halten, dass man über „solche Dinge“ besser nicht nachdenkt, geschweige denn spricht. Doch man kann diese Übereinkunft ja auch ignorieren. Etwa in einem Buch wie diesem. Wir müssen über den Tod sprechen.
Und das haben viele Teilnehmer auch gemacht, weil sie gemerkt haben: Verdammt, alles ist tatsächlich vergänglich, auch die wichtigste Person in meinem Leben könnte morgen weg sein. Die Übungen hatten dem Thema die beruhigende Abstraktion genommen und es vielleicht zum ersten Mal wirklich greifbar für sie gemacht. So greifbar, dass manche sich, wie sie mir einige Wochen später per Mail mitteilten, nach Ende des Workshops ins Auto gesetzt hatten und zu ihren Eltern gefahren waren. Ein Teilnehmer schrieb mir:
„Ich weiß schon seit Jahren, dass ich mit meiner Mutter noch mal über alles reden muss, nicht zuletzt, um ihr endlich einmal ›Danke‹ zu sagen. Immer habe ich gedacht: Wenn sich mal die Zeit dafür ergibt oder die Stimmung passend ist, dann mache ich das. Aber die passende Stimmung, der richtige Moment, die kommen nie von selbst. Vielleicht haben wir ja doch nicht mehr die zwanzig, dreißig Jahre zusammen, von denen ich immer ausgegangen bin. Die Zeit wartet auf niemanden.“
Und der Tod erst recht nicht.
Du wirst gesehen in deinem Leid
Je öfter ich später ähnliche Workshops mit Medizinstudenten abhielt, desto deutlicher trat zutage, dass fast jeder der Teilnehmer schon in jungen Jahren mit dem Tod eines nahen Menschen in Berührung gekommen war. Zufall? Wohl kaum. Normalerweise gibt es heutzutage für die meisten Menschen bis ins hohe Erwachsenenalter hinein, bis zum Ableben der Eltern, kaum einen Anlass, sich mit dem Tod wirklich auseinandersetzen zu müssen. Anders bei den angehenden Ärzten, zumindest bei denen, die ich erlebt habe. Vielleicht kann ja diese Vorerfahrung einer der Gründe sein, warum sich jemand dafür entscheidet, Medizin zu studieren – um fortan dem Schicksal nicht mehr ganz so ohnmächtig gegenüberstehen zu müssen, sondern helfend und im besten Fall sogar heilend eingreifen zu können. Gleichzeitig sorgt die biografische Prägung aber auch dafür, dass später jede neue, dann berufliche Konfrontation mit dem Tod alte Wunden aufreißt. Was man sich aber lieber nicht anmerken lässt. Denn es würde einem ja womöglich von den Kollegen und erst recht von den Vorgesetzten als Schwäche ausgelegt werden.
Genau deshalb stellte ich ans Ende solcher Workshops gerne eine Übung, die den Schutzpanzer, den sich die Teilnehmer schon zugelegt hatten, aufbrechen sollte. Ich sagte: „Immer zwei von euch stellen sich nun in einem Abstand von ein paar Metern gegenüber. Dann geht ihr aufeinander zu. Achtet darauf, wie ihr euch dabei fühlt und wie sehr ihr euch an den anderen im Raum orientiert. Was geht in euch vor, wenn euch jemand ganz, ganz langsam immer näher kommt? In einem Abstand, der für euch beide okay ist, bleibt ihr schließlich stehen. Und dann stellt erst der eine, dann der andere eine einzige Frage und blickt dabei seinem Gegenüber direkt in die Augen. Die Frage lautet: ›Ich fühle mich überfordert, ich fühle mich hilflos, ich schaffe das nicht alleine, kannst du mir bitte helfen?‹“
Eigentlich sollte das Eingestehen von Unwissenheit, Verletzlichkeit und Überforderung in keinem Beruf ein unrealistisches Szenario sein. Wo man es wie in der Medizin mit den existenziellen Problemen des Menschseins zu tun bekommt, erst recht nicht. Eigentlich. Die hochemotionalen Reaktionen auf diese Übung zeigten mir jedoch, dass so etwas im Ärztealltag praktisch nicht vorkommt. Nicht selten weinte anschließend der ganze Raum. Die Teilnehmer wirkten wie befreit, denn sie hatten es endlich gewagt, sich Kollegen in einem Moment der Hilflosigkeit zu zeigen. Jetzt erst konnten sie einander jene Geschichten aus der Klinik erzählen, die sie belastet hatten, weil sie von Angst handelten, von Traurigkeit und vom Gefühl, versagt zu haben. Von dem Patienten, dessen Sterben dem des eigenen Vaters so ähnlich gewesen war. Von der noch so jungen Patientin, die auf einem guten Weg schien und es dann doch nicht geschafft hatte.
Jeder hatte sich, das wurde nun sichtbar, die ganze Zeit über Vorwürfe gemacht, zu weich für diesen Beruf zu sein; hatte geglaubt, die professionelle Abgebrühtheit der anderen niemals erreichen zu können. Dabei war es seinem Gegenüber ganz genauso ergangen. Doch keiner hatte sich aus der Deckung gewagt, weil in der Medizin die zutiefst menschliche Reaktion, sich Hilfe zu holen, nach wie vor als Mangel gilt. Also hatten sie einander immer weiter den harten Einzelkämpfer vorgespielt.
Wenn ich mir anschaue, wer mit mir vor vielen Jahren Medizin studiert, aber irgendwann damit aufgehört hat, weil er oder sie sich mit dem ganzen System nicht mehr identifizieren konnte und der Preis für das eigene Seelenheil zu hoch war; und wenn ich mir gleichzeitig anschaue, wer dagegen mit ungebrochener, nie hinterfragter Begeisterung durch das Studium gegangen ist, dann weiß ich, dass diesen Beruf nicht immer nur diejenigen ausüben, die für ihn am besten geeignet sind.
Nicht ohne Grund halten viele den Anatomiekurs, der im dritten Semester auf dem Programm steht, auch für eine Art abhärtenden Initiationsritus. Ein „Fisherman’s Friend“-Moment: Ist man für den Umgang mit der Leiche zu sensibel, hat man in diesem Beruf nichts verloren. Schafft man es, kann man sich als Teil einer auserwählten Gruppe fühlen.
Immer geht es darum, zu funktionieren. Wird man zum Mediziner ausgebildet, macht man diese Erfahrung erst an der Uni und dann in den Krankenhäusern, wo es ganz eigene, ungemein starre Hierarchiestrukturen gibt. Wer in der klinischen Versorgung bleibt, darf mit diesen Strukturen kein größeres Problem haben. Oder zieht vielleicht sogar eine ganz eigene Befriedigung aus der Ausübung von Macht und lässt das die ihm unterstellten Kollegen auch spüren, ob als Facharzt, Stationsärztin, Oberarzt oder Chefärztin. Es braucht schon viel Mut, sich in solchen Strukturen eine Blöße zu geben und sich anmerken zu lassen, wie sehr einen das Sterben eines Patienten berührt und wie hilflos man sich fühlt, weil man nichts dagegen tun kann.
Daher möchte ich jedem Leser gleich zu Beginn einen Satz mit auf den Weg geben: Halte es für möglich, dass dein Arzt beim Thema Sterben und Tod noch mehr Angst hat als du; dass er heilfroh ist, wenn du ihn damit nicht behelligst.
Oder wie mir ein Patient, zu dem ich gerufen wurde, einmal anvertraute: „Ganz ehrlich: Dass ich in absehbarer Zeit sterben werde, das weiß ich. Für den Fall, dass es bald schon holprig werden sollte, habe ich meinen Sohn gebeten, sich sicherheitshalber schon mal nach einem Hospizplatz für mich umzusehen. Denn immer, wenn ich auf der Station versucht habe, mit den netten Assistenzärzten darüber zu sprechen, haben die so bedröppelt dreingeschaut, dass ich es schnell wieder gelassen habe. Die reden da wohl nicht so gern drüber, und ich will sie ja auch nicht quälen.“
Zu der Angst kommt auf Ärzteseite der Anspruch hinzu, vor Krankheiten nicht zu kapitulieren, sondern sie zu heilen. Nur klappt das eben nicht immer. Und was dann? Ich selbst habe im Rahmen meiner Facharztausbildung ein Dreivierteljahr auf der Intensivstation gearbeitet und dabei gemerkt, wie leicht man sich vom Tod eines Patienten persönlich beleidigt fühlen kann: Wir kümmern uns hier um dich, alles scheint so gut zu laufen, und du, was machst du? Du stirbst einfach, und unsere ganze schöne Mühe war vergeblich …
Für mich als Palliativmediziner ist der Tod weder Gegner noch Freund. Ich betrachte den Tod eines Patienten nicht als Ergebnis persönlichen Scheiterns und auch nicht als das Schlimmste, was geschehen kann – sondern als etwas Natürliches, als eine Tatsache, an der es nichts zu rütteln gibt.
Viel wichtiger ist ohnehin, welche Bedeutung der Tod für den Patienten hat, den ich gerade behandle. Ist er der schon lange herbeigesehnte Erlöser? Wird er in einer Mischung aus Fatalismus, Galgenhumor und Traurigkeit mehr oder weniger akzeptiert? Oder löst sein Herankommen eine Angst aus, die so groß ist, dass sie alles Ertragbare übersteigt? Wenn es mir gelingt, das herauszufinden, kann ich nicht nur sehr viel besser über das weitere Vorgehen entscheiden. Dann kann ich es auch schaffen, den nahenden Tod dieses einen bestimmten Patienten in die An- und Besprechbarkeit zu holen.
Nach ihrer Definition ist es Aufgabe der Palliativmedizin, die Lebensqualität sowohl von Patienten mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung als auch von deren Familien zu verbessern. Das heißt, es geht letztlich nicht mehr ums Heilen, sondern ums Lindern von Schmerz und ums Behandeln von auftretenden Problemen, seien sie körperlicher, psychosozialer oder spiritueller Art. Dazu gehört auch, das vielleicht medizinisch noch Machbare, aber mit großer Wahrscheinlichkeit zusätzliches Leid Verursachende genau abzuwägen. Abzuwägen gegen die Möglichkeit eines würdevollen und beinahe immer ohne Schmerzen verlaufenden Sterbens.
Alles orientiert sich an der Frage: Was hilft diesem Menschen hier und jetzt am besten? Palliativmedizin ist neben dem Fachlichen vor allem auch eine bestimmte Haltung, ist Aufmerksamkeit und Da-Sein. Ich kann den Schmerz des anderen erkennen, und ich kann dafür sorgen, dass er sich nicht vollkommen verlassen fühlt, wenn er ihn trägt.
Vielleicht besteht eine wichtige Aufgabe des Palliativmediziners darin, dem Patienten stets zu verstehen zu geben: Du wirst gesehen in deinem Leid. Du bist nicht allein. Ich nehme dich wahr.
Wie zerbrechlich wir sind
Sicher wäre es eine Illusion zu glauben, man könne jedem Menschen, ob er nun im Gesundheitswesen arbeitet oder nicht, zu einem erwachsenen, also reflektierten und im Idealfall fast schon entspannten Verhältnis zum Tod verhelfen. Das würde der menschlichen Natur auch widersprechen. Für viele wird der Tod immer das ultimative Schreckbild sein, das lauernde Schwarz am Ende der Tage, vor dem man, so lange es geht, die Augen verschließen muss, um überhaupt normal weitermachen zu können.
Der Tod bleibt ein Tabu, im Alltagsleben wie in der Gesellschaft. Es gehört zum Wesen von Tabus, hochwirksam, doch nicht rational begründet zu sein. Das unterscheidet sie von Verboten aller Art. Sie bestehen einfach, und es scheint, als seien sie immer schon da gewesen. Das Tabu des Todes gewinnt in unserer Zeit sogar noch an Macht hinzu. Gäbe es die Krimis nicht mit ihrer täglichen Leichenschau, würden uns die Nachrichten nicht jederzeit mit Berichten über Katastrophen, Unfälle und Verbrechen versorgen, dann blieben uns nur noch die Traueranzeigen in der Zeitung, die wir aber schnell überblättern, oder die Friedhöfe, über die wir aber kaum je spazieren, um uns daran zu erinnern, dass der Tod tatsächlich existiert.
Leider tun uns die Dinge, die uns verstören oder ängstigen, nicht den Gefallen, einfach zu verschwinden, wenn wir sie ignorieren. Im Gegenteil. Nicht selten entwickeln sie ein Eigenleben und beginnen, uns heimzusuchen. Nicht nur nachts verursachen sie hässliche Klopfgeräusche in den Kellerräumen unseres Bewusstseins. Sie wirken sich auch generell darauf aus, wie wir die Welt wahrnehmen, was wir denken und fühlen und wie wir uns verhalten.
Vor einigen Jahren entwarf der amerikanische Psychologe Jeff Greenberg zusammen mit ein paar Kollegen die sogenannte „Terror-Management-Theorie“. Sie besagt, dass wir vor allem zwei Strategien einsetzen, um mit dem Wissen um unsere Sterblichkeit umgehen zu können. Zum einen bemühen wir uns, unsere Weltanschauung als etwas Gewichtiges und Beständiges zu betrachten. So fällt es uns leichter zu glauben, dass dem menschlichen Leben ein tieferer Sinn innewohnt, der die Flüchtigkeit unseres Daseins übersteigt. Und zum anderen versuchen wir bei allem, was wir tun, unser Selbstwertgefühl zu stärken. Denn nur wenn wir davon ausgehen, dass wir wertvolle Wesen und unsere Handlungen von Bedeutung sind, können wir für Momente unsere Vergänglichkeit vergessen und uns der Illusion hingeben, dass etwas von uns für immer bleibt.
Problematisch wird es, wenn wir Menschen begegnen, die unsere Weltanschauung nicht teilen, oder unsere Selbstachtung gefährdet ist. Alles, was unsere Werte infrage stellt, wirft uns wieder auf unsere Verletzlichkeit und Sterblichkeit zurück, denn dann haben wir nichts mehr, was uns vor dem Blick in den Abgrund schützt. Also muss diese Bedrohung abgewehrt werden. Wir erheben uns über abweichende Weltbilder, lehnen sie ab, verurteilen sie oder, wenn das alles nichts hilft, integrieren sie in unser eigenes Wertesystem. Greenberg und seine Kollegen konnten anhand zahlreicher Studien zeigen: Wann immer wir an unsere ansonsten verdrängte Sterblichkeit erinnert werden, hat das anschließend konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Wir wählen konservativer, urteilen rigider und wagen weniger.
Demnach kostet unsere Kultur der Verdrängung einen Preis. Unsere eigenen psychischen Schutzmechanismen nicht zu hinterfragen und dem Tod nicht ins Gesicht zu schauen, raubt uns ein gutes Stück Lebensmut, Spontaneität und Freude am (kalkulierten) Risiko. Man lässt zu, dass die Angst immer mehr Raum einnimmt und schließlich lähmend wird. Wie schnell alles vorüber sein kann! Einmal nicht aufgepasst beim Überqueren der Straße, ein ungünstiges Röntgenbild, und von einem Moment auf den anderen ist Schluss. Wie zerbrechlich wir sind. Doch deshalb die Verdrängung noch zu intensivieren, kann nicht die Lösung sein. Stattdessen sollte uns gerade das Wissen, dass wir endlich sind, den Mut geben, das Leben zu genießen.
Selbstverständlich muss man sich nicht mindestens einmal in der Woche intensiv mit seiner Sterblichkeit auseinandersetzen, um ein glücklicher Mensch zu werden. Es geht eher um einen anderen Umgang mit dem Thema. Und die beste Voraussetzung dafür ist: Wissen. „All knowledge is worth having“, schrieb die Autorin Jacqueline Carey einmal, und sie hat recht damit. Mehr darüber zu wissen, was einen hinter den Kulissen der eigenen Aufmerksamkeit negativ beeinflusst, kann ungemein befreiend wirken. Der Blick weitet sich, man gewinnt eine neue Flexibilität im Handeln und kann sein Leben selbstbestimmter führen.
Was macht mir am Tod am meisten Angst? Was sollte auf keinen Fall passieren? Was könnte mir ein wenig von meiner Furcht nehmen? Welche Möglichkeiten gibt es, auch das Sterben, so gut es eben geht, nach meinen Vorstellungen zu gestalten? Was ist mir am wichtigsten, wenn ich ans Sterben denke? Je genauer ich mir solche Fragen stelle, desto weniger bedrohlich werden mir die Antworten erscheinen, die ich auf sie finde.
Hab den Mut, Entscheidungen zu treffen
Oft wollen die Menschen von mir wissen, wie man den täglichen Umgang mit Sterben und Tod nur aushalten könne. Ob es mir gelinge, auch mal abzuschalten und den Tod in der Klinik zu lassen. Doch das muss ich gar nicht, denn der Tod hat seinen Platz ja nicht nur auf einer Palliativstation, in einem Hospiz oder in einem Pflegeheim. Der Tod ist immer da, und daher halte ich es eher für seltsam, sich nie über ihn Gedanken zu machen. Wohlgemerkt: ohne vorauseilende Panik und ohne allzu große Angst, sondern als Tatsache, mit der wir uns, ob wir wollen oder nicht, ebenso abfinden müssen wie mit anderen Gegebenheiten des Lebens.
Manche Dämonen, die uns plagen, gedeihen nur im Dunkeln oder im Halbschatten gut. Holt man sie aber ans Licht, werfen sie plötzlich viel kürzere Schatten, werden kleiner und kleiner und verlieren viel von ihrer destruktiven Kraft. Daher lautet mein Ratschlag:
Trau dich, über den Tod nachzudenken, trau dich, über ihn zu reden, auch wenn es dir Angst macht. Selbstverständlich kann dich niemand dazu zwingen, das Unausweichliche in Augenschein zu nehmen. Aber das ändert nichts daran, dass es dich an irgendeiner Stelle, manchmal früher, manchmal später, erwischen wird. Dich vorher schon mit ihm zu beschäftigen, verhindert möglicherweise einige hässliche Wendungen, die das Lebensende für dich bereithalten kann. In unserer Gesellschaft ist Sterben häufig auch das Resultat einer Folge von Entscheidungen. Was wird unternommen, was wird unterlassen? Es ist zwar vollkommen legitim, wenn du das nicht selbst entscheiden möchtest, weil du dich damit überfordert fühlst. Doch dann sei dir bitte im Klaren darüber, dass jemand anders über dich bestimmen wird. Im Zweifelsfall der Vertreter eines Medizinsystems, das häufig Entscheidungen vorsieht, die nicht unbedingt dem entsprechen, was man sich unter einem guten Sterben vorstellt. Daher hab den Mut, herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist, und hab dann auch den Mut, Entscheidungen zu treffen.
Weil es unser Leben ist, müssen wir über den Tod sprechen.
"Der Pallitivmediziner Matthias Gockel hat ein Buch über Sterben geschrieben. Wer es liest, geht sicher nicht leichter aus dem Leben aber hat nach der Lektüre verstanden, dass er Verantwortung übernehmen kann für seine letzten Lebenswochen, sofern er sich traut, dem unabwindlichen Schicksal, das wir alle haben, ins Auge zu schauen."
"Der Autor gibt [...] sehr wertvolle, aus einer reichen Praxis geschöpfte Hinweise"
„In lockerem, prägnanten Stil beschreibt Dr. Gockel, unterstützt von seinem Koautor Oliver Kobold, den Alltag eines Palliativmediziners und stellt medizinische, menschliche und auch finanzielle Schwierigkeiten in der Begleitung von Sterbenden dar. Ohne mit dem Zeigefinger zu belehren, gibt er Betroffenen und Behandelnden Hilfestellung, um die Situation zu erleichtern und vor allem auch das weit verbreitete Schweigen zu dem Thema zu überwinden.“
„Ein von großer Erfahrung und Kompetenz getragenes Buch!“
„In seinem Buch ermuntert er dazu, über den Tod nachzudenken und darüber zu reden. Er tut dies lebendig, berichtet von seiner Berufswahl, seinem Wunsch nach Intensität und beschreibt, was am Ende des Lebens abläuft.“









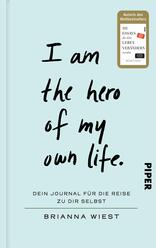
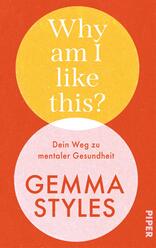










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.