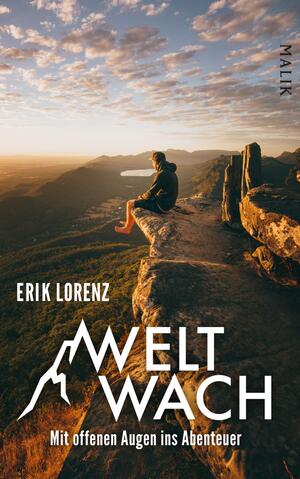
Weltwach - eBook-Ausgabe
Mit offenen Augen ins Abenteuer
— Der beliebte Podcaster über die Schönheit und unsere Verantwortung beim ReisenWeltwach — Inhalt
Abenteuer. Reisen. Leben.
Der bekannte Reise-Podcaster erzählt erstmals von seinen eigenen Abenteuern
Mit inspirierenden Lebenslektionen
Eine spektakuläre Trekkingtour durch Schwedens Wildnis. Ein Motorradtrip durch den Himalaja. Die Begegnung mit fremden Lebenswelten am anderen Ende der Welt. Die Auseinandersetzung mit sich selbst, das Überwinden innerer Grenzen und das Lösen eigener Vorurteile. Erik Lorenz erzählt von Momenten großer Abenteuer und innerer Ruhe. Er erkundet, was Reisen uns geben können und was sich auf ihnen zu suchen lohnt. Er zeigt, dass Abenteuer auch im Zeitalter von Google Maps und pauschal buchbaren Gruppenreisen zum Everestgipfel noch wertvoll für uns sind. Und er beschreibt, wie und wo wir sie finden.
„›Weltwach‹ stillt das Fernweh.“ Bayern 3
„Hier wird Abenteuerlust geweckt! Unbedingt reinhören!“ freundin über den Weltwach-Podcast
Leseprobe zu „Weltwach“
Der skeptische General – Aufbruch in den Himalaja
General Kumar schaute uns erstaunt an. „Ihr wollt von hier bis nach Leh fahren?“
„Ja. Und noch weiter.“
Er schüttelte den Kopf. Der weißhaarige Mann, seit einigen Jahren pensioniert, hatte 1962 im Indisch-Chinesischen Grenzkrieg an vorderster Front gekämpft und Truppen befehligt, hatte im eisigen Schnee Zehen verloren, Helikopter und Flugzeuge geflogen, dem Grauen ins Auge geblickt und gewaltige Verantwortung getragen. Er erschien uns als ein Mann, der wusste, was er geleistet hatte, und in sich ruhte.
Aber [...]
Der skeptische General – Aufbruch in den Himalaja
General Kumar schaute uns erstaunt an. „Ihr wollt von hier bis nach Leh fahren?“
„Ja. Und noch weiter.“
Er schüttelte den Kopf. Der weißhaarige Mann, seit einigen Jahren pensioniert, hatte 1962 im Indisch-Chinesischen Grenzkrieg an vorderster Front gekämpft und Truppen befehligt, hatte im eisigen Schnee Zehen verloren, Helikopter und Flugzeuge geflogen, dem Grauen ins Auge geblickt und gewaltige Verantwortung getragen. Er erschien uns als ein Mann, der wusste, was er geleistet hatte, und in sich ruhte.
Aber jetzt wirkte er fassungslos.
„Das ist die gefährlichste Straße der Welt. Ist euch das klar?“
Marcus, Bastian und ich wechselten verunsicherte Blicke. Ich wartete nur darauf, dass es draußen schlagartig dunkel wurde und Blitze übers Firmament zuckten.
„Die gefährlichste …?“, murmelte ich unentschlossen. „Nun …“
„Das sind Hunderte Kilometer steilster Gebirgspässe: Abgründe, Straßen aus Schlamm und Geröll, Hangrutsche, reißende Flüsse, menschenleere Wildnis.“
„Wir werden vorsichtig sein.“
„Das solltet ihr! Erst vor zwei Monaten ist der Sohn unseres Nachbarn dort hochgefahren. Aber er ist auf einer Kiesstraße ausgerutscht.“ General Kumar schlug mit der linken Handfläche auf den rechten Handballen, um den Aufschlag zu veranschaulichen. „Er verstarb. Sein Schädel war gebrochen.“
Er schüttelte den Kopf, während er sich kurz in Erinnerungen an den Verstorbenen verlor. Ich schluckte schwer. Und musste an ein anderes Gespräch an einem anderen Ort denken. Es hatte mir ähnliches Unwohlsein bereitet wie General Kumars Sorge um uns. Denn der General war nicht der erste Zweifler.
Von einem Freund hatte es schon vor unserem Aufbruch nach Indien skeptische Fragen gehagelt: „Durch den Himalaja mit dem Motorrad? Ich wusste gar nicht, dass du so gut Motorrad fahren kannst!“
Ich zuckte bescheiden mit den Schultern.
„Wo hast du denn das Fahren durchs Gelände gelernt?“
„Och …“
„Nein, im Ernst! Was braucht man dafür mehr: Talent oder Erfahrung?“
Da der Freund nicht lockerließ, änderte ich meine Taktik. Statt Bescheidenheit täuschte ich nun Desinteresse vor und tat so, als wollte ich seiner Fragerei keine übermäßige Aufmerksamkeit schenken. Talent oder Erfahrung – welch beschränkter Kleingeist kommt denn auf so eine Frage? Wie hat Napoleon sein Geschick in Politik und Kriegsführung erlangt? Wie Sokrates seine Fähigkeiten in Philosophie? Ganz einfach, es steckte ihnen im Blut. Und genauso war es bei mir mit dem Motorradfahren. Diesen Eindruck versuchte ich jedenfalls gegenüber meinem Freund zu erwecken.
Die Wirklichkeit sah geringfügig anders aus. Das wurde mir kurz nach unserer Ankunft in Indien schmerzlich klar, als wir die Maschinen für unsere Expedition auf einem Hinterhof in Neu-Delhi von einem freundlichen Mann entgegennahmen. Nachdem wir Zelte, Verpflegung und sonstige Ausrüstung verpackt und an den Motorrädern befestigt hatten, saßen wir auf und klappten die Ständer hoch. Da wir nicht sehr zuversichtlich waren, dass es uns gelingen würde, die Maschinen souverän zu starten und anzufahren, schoben wir sie ächzend – in ausgeschaltetem Zustand – vorwärts. Wir konnten spüren, wie sich die verwunderten Blicke des Verleihers in unsere Rücken bohrten. Unsere Füße erreichten kaum den Boden, sodass wir uns voll und ganz darauf konzentrieren mussten, nicht umzukippen. Wenigstens noch nicht jetzt – nicht hier.
Wir drehten uns ein letztes Mal nach dem Verleiher um und winkten fröhlich. Er hob seine Hand zu einem zögerlichen Abschiedsgruß. Als wir im Schneckentempo um die nächste Ecke steuerten, verschwand er aus unserem Sichtfeld. Wir schnauften erschöpft. Und erleichtert. Immerhin waren wir nicht aufgeflogen.
Doch nun war die Stunde der Wahrheit gekommen. Wir starteten die Motoren, fuhren vorsichtig an, verließen die gassenartige Nebenstraße … und fanden uns wenig später mitten im Verkehrschaos von Neu-Delhi wieder. In einem endlosen Strudel aus sechsspurigen Straßen voller Lastwagen, Tuk-Tuks, Fahrrädern und Kühen, die sich weder für die Spuren noch für die Fahrtrichtung interessierten. Wildes Hupen statt Blinken, plötzliches Von-links-außen-nach-rechts-innen-Schneiden, hier eine Vollbremsung, dort eine Beinahekarambolage. Mittendrin, im Herzen des Stroms, im Zentrum einer riesigen, staubigen Kreuzung: wir – drei deutsche Greenhorns auf großer Tour, die einmal mehr ihre Maschinen abgewürgt hatten.
Selten habe ich mich so verloren und dem Schicksal ausgeliefert gefühlt wie auf diesen Kreuzungen Neu-Delhis. Alles floss an uns vorbei, unvorhersehbar, ohne Richtung, ohne Struktur und natürlich auch ohne Rücksicht.
Ich begann mich zu fragen, wie ich diese Reise jemals überstehen sollte. Denn die Wahrheit war: Ich konnte gar nicht Motorrad fahren. Hatte es noch nie gekonnt. Meine beiden Reisegefährten ebenso wenig. Wir waren zwar in Südostasien mit halb automatischen Motorrollern durch die Gegend gedüst, aber nicht mit Motorrädern. Keiner von uns besaß einen Motorradführerschein – oder auch nur irgendeine Art von Erfahrung oder Ahnung. Nicht gerade beste Voraussetzungen für einen wochenlangen Trip über lebensgefährliche Straßen, quer durch das gewaltigste Gebirge überhaupt.
Zweifel waren also durchaus angebracht. Und von denen hatte General Kumar reichlich. Er war der Vater eines engen Freundes von Marcus und hatte uns zusammen mit seiner Frau am Ende unserer ersten Tagesetappe aufgenommen. Er lebte in Chandigarh, rund zweihundertsechzig Kilometer nördlich von Neu-Delhi, aus dessen Verkehrschaos wir uns nur mühsam herausgekämpft hatten. Eine unserer Leitlinien für diesen Trip war, nie bei Dunkelheit zu fahren, aber weil unsere mangelnden Fahrkünste in Kombination mit verstopften, von Schlaglöchern, Tieren und Geisterfahrern übersäten Highways kein rasches Fortkommen zuließen, hatten wir die Regel schon am ersten Abend brechen müssen.
Am darauffolgenden Morgen hatten wir dem General und seiner Frau beim Frühstück von unseren Plänen berichtet: Wir wollten von hier aus weiter nach Shimla fahren, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Himachal Pradesh, von dort auf dem NH22 – einem Gebirgshighway, der als eine der „tödlichsten Straßen der Welt“ gilt – gen Kinnaur, durch die zerklüftete Mondlandschaft des Spiti Valley, eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Indiens, über etliche weitere Zwischenstationen und Umwege bis nach Leh im Herzen Ladakhs und von dort weiter in Richtung Tibet.
All das lag an diesem Morgen noch vor uns, und während General Kumar auf uns einredete, schien die Herausforderung minütlich zu wachsen. Der General ließ einen Reigen aus Warnungen auf uns niederprasseln: „Überholt nie links! Fahrt bei Regen außerordentlich vorsichtig! Zeltet nicht unterhalb von Hängen, besonders nicht bei Regen, denn es gibt ständig Hangrutsche! Prüft, bevor ihr durch Flüsse fahrt, ihre Tiefe! Und wenn ihr es tut, fahrt mit konstantem Tempo im ersten oder zweiten Gang hindurch! Haltet unter keinen Umständen an! Sonst läuft Wasser durch den Auspuff in den Motor, und dann war’s das!“
Während er versuchte, seine eigenen Zweifel zu besänftigen, indem er uns in den wenigen Minuten, die ihm noch blieben, bestmöglich auf all die tödlichen Gefahren vorbereitete, wuchsen die meinen ins Unermessliche. Worauf hatten wir uns da nur eingelassen? Nein, nicht eingelassen, das klingt, als wären wir Opfer äußerer Umstände gewesen. Eher: Was hatten wir uns da bloß eingebildet?
Nachdem wir dem General und seiner Frau versprochen hatten, all seine Hinweise zu beherzigen, brachen wir auf. Die beiden winkten uns mit bangen Gesichtern hinterher, nicht unähnlich dem Motorradverleiher am Tag zuvor. Ich glaube nicht, dass sie damit rechneten, uns jemals wiederzusehen.
Die ersten Tage waren elektrisierend und zermürbend zugleich. Die Straßen wurden langsam steiler, als wir die Ausläufer der Berge erreichten, aber sie blieben voll – voller waghalsiger Fahrer, die sich mehr auf ihr Schicksal als auf objektive Wahrscheinlichkeiten zu verlassen schienen. Selbst in engsten Kurven, die um Felsvorsprünge herumführten, mussten wir stets damit rechnen, von einem auf uns zurasenden Lastwagen oder Motorradfahrer überrascht zu werden.
Schon am zweiten Tag verzeichneten wir einen ersten Sturz: Marcus musste unmittelbar vor einem Schlagloch eine Vollbremsung machen und rutschte weg. Die Fahrzeuge hinter ihm reagierten gerade noch rechtzeitig. Das Ergebnis: zerrissene Kleidung, ein blutiger Arm, ein kaputter Scheinwerfer und viel verbogenes Metall. Zum Glück nichts Schlimmeres. Trotzdem kehrten die Fragen immer wieder zu mir zurück: Was taten wir hier? Warum um Himmels willen strebten wir mit alten indischen Royal-Enfield-Maschinen auf das Dach der Welt zu? Und warum wollte überhaupt irgendjemand irgendetwas Derartiges tun?
Wieso brechen Menschen auf, um sich sehenden Auges in Situationen zu begeben, die andere nur als „haarsträubend“ bezeichnen würden? Warum besteigen einige von ihnen unter größter Mühsal einen Berg, auf dessen Gipfel nicht viel mehr als eine gute Aussicht und eine kalte Nasenspitze warten, während andere sich mit dem Ausblick von der heimischen Fensterbank aus begnügen? Was treibt jene an, die auf ihren Abenteuern bis ans Äußerste gehen, aber auch jene, die jenseits von Gefahr und Übermut die Welt erkunden?
Fragen wie diese habe ich mir schon oft gestellt, nicht nur hier auf dem Motorrad. Und ich habe sie nicht nur an mich gerichtet, sondern auch an zahlreiche andere Reisende, Weltenbummler, Abenteurer. Ich möchte ihre Motivationen und Denkweisen verstehen, in ihre Erlebnisse und Erkenntnisse eintauchen und herausfinden, mit welchen Einstellungen und Hoffnungen sie sich in die Welt hinausbegeben. Deshalb habe ich vor einiger Zeit das Projekt www.weltwach.de ins Leben gerufen, eine Onlineplattform rund um die Themen Abenteuer und Reisen. Herzstück ist der gleichnamige Podcast, in dem ich mit meinen Gästen über ihre Expeditionen, ihre Weltsicht und die Faszination außergewöhnlicher Orte spreche. Viele von ihnen kommen auch in diesem Buch zu Wort und lassen uns an ihren Erfahrungen und ihrem Verständnis vom Reisen teilhaben. Denn darum geht es mir: zu erkunden, wie Reisen uns hilft, die Welt in ihrer Vielfalt besser zu verstehen, und wie wir jenseits des heimischen Komforts mehr über uns selbst herausfinden können.
Einige Einsichten verdichte ich nachfolgend zu sogenannten Lebenslektionen, die selbstverständlich nicht auf alles eine Antwort geben können. Ich durfte noch nicht vom Baum der Erkenntnis kosten, nein, ich versuche lediglich, einige der Lektionen festzuhalten, die ich auf meinen Reisen erfahren habe oder die mir meine Gesprächspartner mit auf den Weg gegeben haben. Das heißt nicht, dass ich ihnen selbst stets gerecht werde. Aber das ist auch nicht mein Anspruch. Sie dienen mir vielmehr als Richtschnur, als gedankliche Stupser, die ich mir gelegentlich vergegenwärtige, wenn ich versucht bin, es mir zu leicht zu machen.
Für mein eigenes Abenteuer fehlte mir an jenem Tag auf dem Motorrad ein tieferes Verständnis: Mir fiel kein vernünftiger Grund ein. Ich wusste nur, dass ich es tun wollte, dass ich – warum auch immer – dafür brannte, diesen irren Traum zu verwirklichen, mit dem Motorrad durch den Himalaja zu fahren.
Bald wandelte sich das Bild: Der Verkehr auf den Gebirgsstraßen nahm ab, bis er ganz versiegte, und wir gelangten in Landschaften, die jedes Motorradfahrerherz höherschlagen lassen: die märchenhaft verwitterten Felsen bei Sarchu; das weite, zuweilen grüne Nubra-Tal mit seinen Obstgärten und Sanddünen, eingefasst von zerklüfteten, teils gletscherbedeckten Bergen, deren Hänge je nach Licht und Wolken in allen Farben schimmerten; der bitterkalte Salzsee Pangong Tso im Hochland von Tibet, blau leuchtend inmitten sandfarbener Felskolosse. Die einzigen Menschen, die wir jetzt noch zu Gesicht bekamen, waren die Bewohner abgelegener Dörfer, die nach wie vor tief in alten buddhistischen Traditionen verwurzelt sind, Trucker mit ledrigen Gesichtern, die hier in den Monaten, in denen die Straßen frei von Schnee sind, unentwegt ihre Fracht über die Berge bringen, und alle paar Tage eine Gruppe von Motorradfahrern. Wobei insbesondere Letztere regelmäßig dafür sorgten, dass wir uns hier fehl am Platz fühlten. Denn diese Gruppen bestanden meist aus rund einem Dutzend Fahrern, deren Anblick uns an RoboCop erinnerte: von Kopf bis Fuß in dunkle Schutzkleidung und Schoner gehüllt, mit Ersatzreifen, Benzinreservekanistern und Jacken mit Aufklebern, die in großen Buchstaben eine „Himalaya Expedition“ verkündeten.
Sie waren also auf „Expedition“. Und wir? Wir fuhren ohne Schoner, dafür in gewöhnlichen Trekkinghosen und Regenjacken, ohne Reservekanister oder -reifen oder sonst eine Art von Plan B. Leichtsinnig? Aus heutiger Sicht würde ich sagen: schon möglich. Andererseits hatte uns unsere Naivität überhaupt bis hierher gebracht. Hätten wir vorher zu viel gegrübelt, hätten wir uns wohl niemals in den Verkehr Neu-Delhis hineingetraut. Statt zaghaft abzuwägen, waren wir einfach losgefahren, hatten den Umstand, dass sich niemand an die Regeln hielt, innerhalb kürzester Zeit akzeptiert und uns vom Strom mitreißen lassen.
Der General sollte recht behalten: Gute Asphaltstraßen gab es hier oben nur selten. Meist fuhren wir über staubige Schotterpisten, oft über grobes Felsgeröll, manchmal durch feinen Sand oder rutschigen Schlamm. Dabei war die Fahrbahn häufig nur drei oder vier Meter breit und wurde auf der einen Seite von einer rohen Felswand und auf der anderen von einem senkrechten, Hunderte Meter tiefen Abgrund flankiert. Manchmal schraubten sich Straßen und von Bächen überspülte Schotterpisten über Stunden hinweg in engen Serpentinen in die Höhe, Hunderte Meter, Tausende Meter, bis die Luft so dünn war, dass die Maschinen kaum noch genug Zug hatten, um die Steigung zu schaffen. Dazu die Kopfschmerzen, Anzeichen einer leichten Höhenkrankheit, die klare Luft, der weite Blick – es fühlte sich an, als würden wir wahrlich auf das Dach der Welt hinauffahren. Die Vorstellung, wie hoch wir waren, ließ mich zusätzlich schwindeln. Wir passierten den Chang La, den Kardung La und den Taglang La, die mit jeweils über 5300 Metern zu den höchsten befahrbaren Gebirgspässen der Erde gehören. Wir übernachteten in abgelegenen, tausend Jahre alten Klosteranlagen mitten im Nirgendwo und erlebten dort die eindrucksvollen Vajrayana-Zeremonien der Mönche und tranken mit ihnen Buttertee. Entgingen nur wenige Kilometer einem gewaltigen Felsrutsch, der die Straße über Tage versperrte, bis das Geröll vom Militär weggeräumt wurde. Zelteten an kristallklaren Gebirgsseen, umgeben von schroffen Sechs- und Siebentausendern. Fuhren durch Flüsse, passierten militärische Stützpunkte, beobachteten Artillerieübungen dicht an den konfliktreichen Grenzen zu Pakistan und China, die hoch über uns ganze Bergflanken zum Explodieren brachten. Und stets flatterten an unseren Lenkern zwischen den Spiegeln Bänder mit tibetischen Gebetsfahnen, die uns Glück bringen sollten.
Jeder Berg, jede Hochebene, jedes Tal war auf seine Art atemberaubend. Es war die mit Abstand spektakulärste Landschaft, die ich je gesehen hatte, und ich kann mir keine Motorradstrecke vorstellen, die beeindruckender und zugleich herausfordernder wäre. Es fühlte sich berauschend an: das Aufheulen des Motors, das schwerelose Dahingleiten auf der endlosen Asphaltbahn, die Geschwindigkeit, der um die Nase wehende Fahrtwind, die Leichtigkeit. Und die rückenstauchende Schwere, der erbitterte Kampf, wenn die Räder nicht über den Asphalt schwebten, sondern sich durchs Gelände kämpften. Dann fühlten wir zwar nicht wie beim Gehen jeden Kiesel und jede Wurzel, aber wir spürten doch mehr als im Auto den Wind, den Regen und vor allem die Landschaft, die Oberfläche der Erde und ihre Wandlungsfähigkeit. Die Bodenwellen sandten Stöße über Gummi und Metall bis in die Arme und Schultern, der Geruch von Wäldern, Weiden und den höchsten Wüsten der Welt strömte ungefiltert in unsere Nasen und veränderte sich dabei genauso schnell wie die Landstriche, durch die wir fuhren. Dazu die Möglichkeit, Strecke zu machen und danach abzusteigen, mit einem zufriedenen Seufzen den Helm abzunehmen und in einen ganz neuen Ort einzutauchen, die Offenheit und die Herzlichkeit der Einheimischen zu genießen. Und dann einmal mehr den Blick hinaufwandern zu lassen zu den schneebedeckten Gipfeln hoch über uns und in die Ferne, wo die nächste Passstraße sich in die Unendlichkeit zu schrauben schien.
An all das denke ich, wenn mir im Alltag der eine oder andere Holperstein in den Weg geworfen wird, wenn im Büro die Hölle losbricht oder eine kostspielige Autoreparatur ansteht. Eine Sekunde des Besinnens nur, dann bin ich wieder dort, in Indien, dann tauche ich erneut ein. Und spüre, wie meine innere Unruhe sich in Windeseile auflöst und ich ausgefüllt werde von einem Gefühl großen Reichtums. Denn die Bilder, die vor meinem inneren Auge entstehen, sind echt: Ich habe sie aufgenommen, ich habe all das erlebt. Und dabei erfahren, was es heißt, sich lebendig zu fühlen.
Es ist ein Gefühl, das mit jeder Reise, mit jedem Abenteuer wächst. Und mir die Frage nach dem Warum im Nachhinein immer wieder aufs Neue beantwortet.
Lebenslektion
Entdeckergeist wecken
Buzz Aldrin hatte sprichwörtlich „alles“ gesehen. Er war ein Mann von Welt – mehr noch als der gewandteste Kosmopolit. Denn er hatte sie, die Welt, nicht nur auf unzähligen Reisen betrachtet, sondern in ihrer Gänze – auf einem der aufregendsten Trips der Menschheitsgeschichte.
Im Jahr 1969 betrat er im Rahmen der Apollo-11-Mission zwanzig Minuten nach Neil Armstrong als zweiter Mensch den Mond, um Fotos aufzunehmen, Gesteinsproben zu sammeln, Forschungsgeräte aufzubauen, vor allem aber, um es getan zu haben. Um zu zeigen, dass der Mensch den Mond erreichen kann. Um den menschlichen Entdeckerdrang auch hier draußen, im Weltall, zu stillen. Mit dieser Großtat hatte er seinen lebenslangen Bedarf an Abenteuern doch sicher gedeckt – möchte man meinen.
Nicht ganz. Vor ein paar Jahren sprang mir sein Name plötzlich von den Newsseiten im Internet ins Auge: in Berichten über seine jüngste Unternehmung in einer der unwirtlichsten Gegenden der Erde. Er hatte den Südpol besucht, dabei einen Schwächeanfall erlitten und musste wegen Atemnot von einem medizinischen Evakuierungsflug gerettet werden. Zu diesem Zeitpunkt war er sechsundachtzig Jahre alt. Damit ist er der älteste Mensch, der je den Südpol erreicht hat, wie er später erfuhr. Lässt sich die Reise zum Mond in gewisser Weise noch als entdeckerische Notwendigkeit im Dienste eines höheren Zwecks betrachten, so kann man die Südpolreise wohl nur noch mit chronischem Fernweh erklären.
Warum gab es für ihn offenbar kein „genug“? Warum wollte er mehr sehen, mehr erleben, egal, wie groß die Mühe auch war? Warum reichte ihm selbst die Erde in ihrer ganzen Pracht nicht? Und warum brechen wir überhaupt immer wieder auf? Auf meinem Motorrad auf den Pisten des Himalajas konnte ich mir solche Fragen oberflächlich beantworten. Mit dem Wind im wehenden Haar und unendlicher Weite vor den Augen fällt es nicht schwer, sich dem Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit hinzugeben und sich selbst zu bestätigen, dass dies das einzig wahre Leben sei.
Etwas später allerdings verlor die Sache an Klarheit, als ich – meine Nasenlöcher verklumpt vom Staub zurückliegender Hochebenen – mit aufgerissenem Mund nach Luft schnappte, während die Maschine unter mir wie ein wild gewordener Rodeogaul von Felsbrocken zu Felsbrocken sprang. Die Steine waren unsichtbar, verbargen sich im weiß schäumenden Wasser des Flusses, den ich gerade durchqueren wollte. So klammerte ich mich nach Kräften an den Lenker, gab weiter Gas und hoffte, dass ich irgendwie durchkommen würde. Angesichts meiner überschaubaren Fahrkünste hatte ich mich schon vor dem Trip darauf eingestellt, ins sprichwörtliche „kalte Wasser“ geworfen zu werden. Aber dabei blieb es nicht. Denn selbstverständlich kam ich nicht heil durch den Fluss. Als mein Vorderrad auf einen besonders großen Stein traf, war Schluss. Es gelang mir zwar, den Flug über den Lenker zu vermeiden, aber als ich schließlich zum Stehen kam, kippte ich mit schmerzlicher Langsamkeit – und einem bedauerlichen Mangel an Eleganz – zur Seite. Mein Fuß trat auf der Suche nach Halt ins Leere. Natürlich, ausgerechnet jetzt, da ich einen gebraucht hätte, war da kein Stein. Der Fuß verschwand in den Fluten, und der Rest meines Körpers folgte ihm nach, inklusive Maschine und Gepäck.
Einige Stunden später bettete ich mich in meinem Zelt zur Nachtruhe und spürte, wie sich die Nässe in Kälte verwandelte, wie meine Zeltaußenwand langsam gefror, während ich im klammen Schlafsack versuchte, die betäubenden Kopfschmerzen zu ignorieren. Voller Sehnsucht erinnerte ich mich an eine kleine Begebenheit in der Heimat, in der ich mich genau an einen Ort wie diesen, hier im Himalaja, gewünscht hatte. Ich dachte daran, wie ich mir, tief in einen Stuhl gesunken, ein paar Schweißtropfen aus dem Gesicht gewischt und bedauert hatte, dass sie mir nicht von der Sonne über der iranischen, glutofenähnlichen Lehmziegelstadt Yazd oder der Hitze des jordanischen Wadi Rum aus den Poren getrieben worden waren, sondern dass mich lediglich ein banales Komplott aus einer Studiohalle ohne Klimaanlage, erbarmungslosen Scheinwerfern und dem deutschen Hochsommer am Ende eines langen Drehtags leiden ließ. Ich war müde. Und sehnte mich vage nach der Ferne. Nach dem Rauschen der Wellen, die an einen einsamen Strand schwappen und die zahllosen kleinen Steinchen sanft klickern lassen. Nach dem verlorenen Schrei eines Vogels hoch oben, weit über den Baumkronen, die so dicht sind, dass kein Blick sie zu durchdringen vermag. Nach der Sicht aus dem Zelt auf einen unberührten Fluss, gespeist aus dem leuchtend weißen Gletscher, der sich hinter der Wiese am anderen Ufer erhebt. Und nach köstlichem Essen und herzlichen Menschen und …
Tief versunken in die schönsten Reiseklischees, entfuhr mir ein erschöpfter Seufzer. Der Aufnahmeleiter Gustav war dagegen noch genauso munter wie zwölf Stunden zuvor, als er mit schwungvollen Schritten ins Studio gekommen war. Ich kannte ihn seit Jahren als Workaholic, der jeden Tag von früh bis spät schuftete, auch an den meisten Wochenenden, und jede Minute davon genoss. Dabei war er ständig in allen Ecken Deutschlands unterwegs – aber nur dort, denn von einer Handvoll kurzer, unvermeidbarer Ausflüge in unsere Nachbarländer abgesehen hatte er unsere Heimat noch nie verlassen. Er war Freiberufler, was für ihn den gewaltigen „Vorteil“ mit sich brachte, dass er keinen Urlaub nehmen musste.
Noch halb in meine Gedankenfetzen vertieft, fragte ich ihn: „Wo würdest du eigentlich deinen Urlaub verbringen, wenn du mal einen machen würdest?“
„Nirgends. Weil ich keinen mache“, gab er zurück.
„Und wenn man dich zwingen würde?“
„Würde ich mich weigern! Lieber gehe ich für zwei Wochen ins Gefängnis! Da weiß ich immerhin, was mich jeden Tag erwartet.“
Ich lachte und wischte den Kommentar mit einer erschöpften Handbewegung beiseite. Ich hoffte noch immer, zumindest einen Hauch von Fernweh bei ihm feststellen zu können. „Ehrlich, welches Ziel würde dich am ehesten interessieren?“
„Keines! Warum sollte ich reisen wollen?“
Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ich spürte, wie meine Gedanken langsam arbeiteten. Dann erst begriff ich: Er meinte es ernst! Ich betrachtete ihn interessiert. Konnte es wirklich sein, dass er nie seine Nase in die Welt mit ihrer flimmernd ungewissen Vielfalt hinaushalten, nie den Duft der Freiheit und der unendlichen Faszination schnuppern wollte? „Das Beste, was einem beim Reisen passieren kann, ist, dass man sich selbst verändert“, sagte mir der Schriftsteller Ilija Trojanow in einem Gespräch für meinen „Weltwach“-Podcast, aber das schien Gustav wenig zu reizen. Ich glaubte ihm. Dafür kannte ich ihn gut genug. Er wäre tatsächlich lieber ins Gefängnis gesteckt worden, als auf eine Reise geschickt zu werden. Aus seiner Sicht ergab das durchaus Sinn: Nicht nur graute ihm vor den kleinen und großen Herausforderungen des Reisens, nein, er konnte auch aufrichtig nicht verstehen, was verlockend daran sein sollte, sich mit ständiger Ungewissheit und gelegentlicher Ungemütlichkeit herumschlagen zu müssen.
Nie zuvor war mir derart deutlich vor Augen geführt worden, wie unterschiedlich stark ausgeprägt unsere Neugierde auf die Welt sein kann. Gustav war sicherlich ein Extremfall. Obwohl ich ein wenig fassungslos war, wollte ich nicht versuchen, ihn zu missionieren. Sicherheitshalber schwieg ich ganz. Genauso wie jetzt im Zelt oben im Himalaja. Was hätte ich auch sagen sollen? Meine beiden Reisegefährten waren nebenan in ihren eigenen kleinen Zelten längst eingeschlafen. Ich dagegen schaute stumm und zitternd auf die langsam gefrierende Zeltwand, die im Licht meiner Stirnlampe zu funkeln begann, und ärgerte mich über meinen Sturz in den Fluss. Momente wie dieser unfreiwillige Abgang waren auf der Tour keine einsamen Ausreißer, sondern kehrten mit einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit wieder. Und mich beschlich langsam der Eindruck, dass das Freiheits- und Fernwehgerede zu kurz griff als Erklärungsversuch dafür, weshalb zur Hölle ich freiwillig hier war. Ich bin weder ein Adrenalinjunkie noch übermäßig leichtsinnig. Auch wenn unsere Motorradtour einen anderen Eindruck erwecken mag, ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass es keine Suche nach oberflächlichem Nervenkitzel war, die mich zu dieser Tour und anderen antrieb. Das Gleiche galt für meine beiden Freunde.
Die Gründe mussten woanders liegen.
Bereits unsere Vorfahren wurden in Zeiten von Unsicherheit und Unwissenheit häufig von Abenteuern überrascht oder wagten sie gar sehenden Auges, um ihre Ziele zu verfolgen. Es lag, so möchte man meinen, einfach in der Natur des Menschen, dass wir uns nicht damit zufriedengaben, ganze Erdteile nicht zu kennen und viele natürliche Phänomene nicht wissenschaftlich erklären zu können. Hätte es Christoph Kolumbus nicht gegeben, wäre wohl ein anderer als vermeintlicher Entdecker der Neuen Welt berühmt geworden. Dabei waren viele der großen Entdecker und Forscher wie Charles Darwin und Alexander von Humboldt weniger von Abenteuerlust getrieben als von der Leidenschaft für das Aufspüren von geografischem wie fachlichem Neuland. Sie waren in allererster Linie Wissenschaftler, die auszogen, um menschliches Wissen zu mehren. Und brachten die dafür notwendige Bereitschaft für abenteuerliche Reisen mit.
Aber auch später, als die meisten großen geografischen Geheimnisse gelüftet waren, brachen Menschen immer wieder auf und stellten sich Herausforderungen: Grenzgänger, die innere und äußere Barrieren durchstoßen wollten, getrieben vom Willen, die höchsten Gipfel, die lebensfeindlichsten Wüsten, die entlegenen Pole zu erreichen. Teils zur Selbstbestätigung, teils, um stellvertretend für ihre Nation die Landesflagge an Orte zu tragen, wo niemand zuvor seinen Fuß hingesetzt hatte, und teils als Ausdruck einer persönlichen Sinnsuche.
Welcher Art auch immer die Abenteuerreise, welchen Ursprungs auch immer die Motivation, sie alle verbindet, dass sie nicht nur bereit, sondern begierig darauf waren, die Komfortzone zu verlassen und sich gewaltiger Mühsal auszusetzen. Es muss also Faktoren jenseits von naturwissenschaftlicher Neugierde oder geografischem Entdeckungs- und Eroberungseifer geben, die darüber entscheiden, warum sich einige Menschen ins Ungewisse stürzen.
Einen Großteil unserer sechs Millionen Jahre zurückreichenden Geschichte haben wir jagend und sammelnd verbracht, auf der stetigen Suche nach einem besseren Platz zum Leben, nach einem größeren Territorium zum Jagen, einer nomadischen Lebensweise folgend, die wir immer noch in uns tragen. Manche mehr, manche weniger. Tendenziell waren wir aber unsere gesamte Geschichte hindurch immer wieder unterwegs zum nächsten Horizont, selbst wenn wir über genügend Ressourcen verfügten, um uns niederlassen zu können. Kein Säugetier zog – ohne dass es überlebensnotwendig gewesen wäre – so viel umher, wie wir es getan haben. Das gilt für unsere wandernden Vorfahren. Das gilt für Entdecker, die auf unbekannte Meere hinaussegelten, ohne zu wissen, was sie auf der anderen Seite erwartete. Und das gilt für jene unter uns, die heute Berge besteigen, Flüsse befahren, Kontinente durchqueren. Mit rastloser Energie hat über Jahrtausende hinweg immer ein Teil von uns erkundet, erobert und kartografiert.
Im Verhältnis zu einer Zeitspanne von sechs Millionen Jahren sind die zehntausend Jahre zurückliegende Abkehr vom Nomadentum und unsere heutige Vorstellung von Zivilisation nicht mehr als ein sprichwörtlicher Wimpernschlag. Es überrascht deshalb wenig, dass die Wissenschaft vor einigen Jahren belegt hat, dass unser Antrieb herauszufinden, was hinter der nächsten Wüste, hinter dem nächsten Ozean, ja, jenseits unseres Planeten liegt, auch genetisch bedingt ist. Forscher haben die Wege der menschlichen Migration anhand von DNA-Analysen nachgezeichnet und sich dabei mit dem Gen DRD4 beschäftigt, das im Gehirn bei der Dopaminregulierung mitwirkt und damit unsere Lernfähigkeit und unser hirneigenes Belohnungssystem beeinflusst. Bei zwanzig Prozent aller Menschen tritt eine harmlose Mutation dieses Gens auf: DRD4–7R. Wissenschaftler stellten einen Zusammenhang fest zwischen dieser Genvariante und Eigenschaften wie Neugierde und Rastlosigkeit. So neigen Menschen mit der Mutation mehreren Studien zufolge eher dazu, Risiken einzugehen, sich für neue Orte, Ideen, Nahrungsmittel oder auch Beziehungen zu interessieren. Sie sind aufgeschlossener und lieben Veränderung, Bewegung und Abenteuer.
In nomadisch lebenden Kulturen wie jenen der amerikanischen Ureinwohner war das Gen weiter verbreitet als bei sesshaften Völkern wie den Jakuten. Eine interessante Untersuchung wurde auch mit den Ariaal durchgeführt, einem ursprünglich nomadischen Volk in Nordkenia. Ein Teil von ihnen, der weiterhin nomadisch lebt und über das Gen verfügt, ist meist besser ernährt als jene nomadisch lebenden Stammesmitglieder ohne das Gen. Diejenigen allerdings, die sesshaft sind und über das Gen verfügen, sind tendenziell schlechter ernährt als jene Sesshaften ohne das Gen. Das heißt, Träger des Gens verkümmern in einer stabilen Umwelt, in der sich das Leben in festen Bahnen bewegt, während sie unter ungewissen, sich wandelnden Bedingungen aufblühen.
Ist DRD4–7R also das Forscher- beziehungsweise Abenteuergen, das darüber entscheidet, ob wir am Ofen sitzend unsere Heimeligkeit genießen oder als Superpfadfinder in die Welt aufbrechen? Liegt das Abenteuer folglich tatsächlich in der Natur des Menschen – beziehungsweise einiger Menschen? Seine wirkliche Bedeutung ist in der Wissenschaft umstritten, aber das Gen mag zumindest ein Faktor gewesen sein, der Reinhold Messner auf Berge und Rüdiger Nehberg in den Dschungel trieb und manch andere von uns auf Klettersteige oder Segelboote – oder auf die Schotterpisten und in die eiskalten Flussgewässer des Himalajas.
Aber es wäre zu einfach, den Entdeckerdrang des Menschen auf ein einzelnes Gen zu reduzieren. Zusammen mit anderen Genen könnte es zwar das Fundament für unsere Rastlosigkeit legen, mindestens ebenso wichtig ist aber noch eine andere Fähigkeit: unsere Vorstellungskraft und Fantasie. Während Tiere auf ihren Land-, Luft- und Wasserwanderungen von Futter- und Fortpflanzungstrieben geleitet werden oder gleich ganz standorttreu sind, fragen wir Menschen uns immer wieder, welche Erfahrungen wohl hinter dem nächsten Horizont warten mögen. Unser Körper ist darauf ausgerichtet, weite Strecken zu überwinden, und unser Gehirn vermag, abstrakt zu denken und sich immer neue Aufgaben für unsere Beine zu überlegen. Diese Stimmen des Unterbewusstseins können leise flüstern oder penetrant auf uns einreden, bis wir ihren Ideen und bohrenden Fragen nachgeben und uns auf Antwortsuche begeben. Ja, was wäre, wenn …?
Die Ursache für die Fähigkeit zur Imagination sehen Forscher in unserer Kindheit: Weil wir ungefähr anderthalb Jahre früher abgestillt werden als etwa Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen, wächst unser Gehirn deutlich langsamer als bei unseren nächsten Verwandten. Deshalb dauert unsere Kindheit länger und beginnt die Pubertät später (bei Gorillas und Schimpansen nach drei bis fünf Jahren, bei uns nach etwa zehn Jahren). So haben wir mehr Zeit, uns im Schutz unserer Eltern auszuprobieren und nicht nur unser Geschick, sondern eben auch unser Vorstellungsvermögen zu entwickeln. Im Gegensatz zu Tieren, deren Spiele vorwiegend auf das Herausbilden von Basisfähigkeiten wie der Jagd, der Flucht und dem Kampf abzielen, stellen wir frühzeitig hypothetische Überlegungen an: Was wäre, wenn ich das Loch im Ostseestrand so tief buddeln würde, dass ich mich vollständig hineinlegen könnte? Was wäre, wenn ich beim Fangenspielen die Rolle meines liebsten Comichelden einnehmen würde? Kann ich die Luft lange genug anhalten, um bis zum Ende des Schwimmbeckens zu tauchen? Von solchen Fragen scheint es nur noch ein kleiner Schritt zu sein bis zu den visionären Überlegungen großer Entdecker und Abenteurer: Ist es möglich, ohne künstlichen Sauerstoff auf den höchsten Gipfel der Welt zu gelangen? Wird es mir gelingen, als erster Mensch die Wüste Gobi zu durchlaufen? Kann ich es schaffen, tausend Kilometer ohne Geld und Proviant durch Deutschland zu wandern und mich nur von dem zu ernähren, was ich unterwegs finde?
Als Kinder sind wir offen für zahlreiche Antworten auf unsere Fragen. Wir probieren aus, erkunden, erforschen – und finden Lösungen. Doch neigt sich unsere Kindheit dem Ende entgegen, verlieren viele von uns Stück für Stück die Fähigkeit – und den Willen –, neue Wege zu beschreiten, sich auf Unbekanntes einzulassen, überrascht zu werden. Wir suchen – das bemerke ich jedenfalls immer wieder an mir selbst – Sicherheit im Bekannten, in den Erfahrungen, die wir selbst bereits gesammelt haben, und in denen unserer Mitmenschen. Unterwegs in fremden Städten oder Ländern können das zum Beispiel Bewertungsportale oder Reiseführer sein. Wir bewegen uns im Denken und Handeln auf vordefinierten Spuren.
Das gilt sowohl fürs Reisen als auch für viele andere Tätigkeiten und Lebensbereiche. In meiner früheren Arbeit im strategischen Management habe ich zahlreiche Einblicke in die Arbeitsweisen und Entscheidungsprozesse von Konzernen erhalten und dabei ein ums andere Mal erlebt, wie sich die überwältigende Tendenz von Entscheidungsträgern, bewährten Mustern zu folgen, negativ auf die Innovationskraft ihres Unternehmens ausgewirkt hat. Das Gleiche trifft für unsere Lebensentscheidungen zu. Von der Freizeitgestaltung bis zur Berufswahl neigen wir dazu, konform mit dem zu agieren, was üblich ist, also den „gesellschaftlichen Erwartungen“ zu entsprechen. Das schafft Orientierung und Sicherheit. Es kann uns aber auch davon abhalten, unsere Begabungen voll zu entfalten und unsere Wünsche zu verfolgen.
Um daraus auszubrechen, braucht es Mut, innere Kraft, Inspiration und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Es braucht den Willen, sich zumindest hier und da ein Stück weit vom anerkannten Status quo zu lösen. Es braucht eine Besinnung auf unseren frühkindlichen Entdeckergeist. Aber wie können wir den wiedererwecken? Die gute Nachricht: Wir müssen an keiner Wunderlampe rubbeln, sondern können ihn trainieren. Es liegt allein bei uns. Die schlechte: Das kostet Überwindung und die Bereitschaft zum Risiko. Nicht weil wir blind alles auf eine Karte setzen, sondern weil wir genau die Stützpfeiler entfernen müssen, an die wir uns so gern lehnen. Das bedeutet zum Beispiel, vorher mal nicht zu recherchieren und unterwegs nicht den Reiseführer zu konsultieren, sondern stattdessen einfach loszugehen und zu schauen, was passiert – ob bei der Restaurantsuche in Venedig oder dem Erkunden eines indischen Molochs. Auch auf die Gefahr hin, die eine oder andere bittere Pille zu schlucken. Mut zum Unmut.
Wir könnten sogar noch einen Schritt weitergehen und uns an einem Ort, den wir nicht kennen, absichtlich verirren. Wir könnten Google Maps auf dem Smartphone ausschalten, in einen öffentlichen Bus steigen, dessen Route wir nicht wissen, und ihn an einer Station verlassen, deren Namen wir noch nie gehört haben. Wir könnten weitergehen, spontan um eine Ecke biegen und den vierten oder neunten Menschen ansprechen, der uns begegnet, mit ihm über seine Nachbarschaft ins Gespräch kommen und uns davon verblüffen lassen, in welcher himmelstrebenden Welt aus Glas und Beton oder in welch bunt schillerndem Markttreiben wir gelandet sind. Wenn wir wagen, uns zu verirren, setzen wir uns dem Gefühl aus, verwundbar und hilflos zu sein, und zwingen uns damit, uns selbst zu vertrauen. Wir werden uns unserer Umgebung bewusst, achten auf Details und Hinweise, die wir sonst verpasst hätten. So gehen wir auf eine kleine Entdeckungsreise mit uns selbst, ohne zu wissen, was uns erwartet. Wir öffnen uns neuen Erfahrungen und Gedanken, lassen uns durchdringen von neuen Umgebungen und dem Lachen fremder Menschen, von ihrem Anblick und ihren Geschichten.
Ilija Trojanow empfiehlt, bei der Suche nach dem eigenen Reiseabenteuer die Form der Wahrnehmung zu ändern, also das Gegenteil vom alltäglich Üblichen zu tun. Für jene, die stets mit dem Auto fahren, sei eine Reise mit dem Fahrrad oder zu Fuß extrem befruchtend. Wer ständig mit Smartphone und Computer arbeite, verschaffe sich womöglich eine schöne Erfahrung, indem er die Geräte zurücklässt und sich in eine „digitalfreie Zone“ begibt. Ob ein anderes Körpergefühl oder eine andere Wahrnehmung des Fremden – man solle immer das suchen oder sich auferlegen, was man sonst nicht kennt, denn: „Reisen ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn man seinen Horizont nicht erweitert. Dabei ist Horizont nicht nur geografisch gemeint, sondern tatsächlich auch technisch, philosophisch und körperlich.“
Das Entscheidende ist also, unsere eingefahrenen Spuren gelegentlich zu verlassen. Ich denke an einen kleinen Bach zurück, in dessen Lauf ich als Kind gemeinsam mit meinem Vater gern Zweige warf. Wir schauten ihnen zu, wie sie vom Wasser davongetragen wurden: auf drei oder vier kleine Felsstufen zu, in die das Wasser kleine Rillen gegraben hatte. In den Rillen gewann das Wasser an Geschwindigkeit, der Zweig, der eben noch sanft dahingeglitten war, machte einen Satz und rauschte durch die erste Furche und dann durch die nächste, und dann war er fort. Ein schöner Anblick – und stets der gleiche. Denn der Lauf des Wassers war vorherbestimmt und damit auch die Reise des Zweiges.
Wie Wasser, das über einen Felsen fließt, bilden auch wir für uns kleine Rinnen. Allmählich schneiden sich diese Rinnen tiefer und tiefer in den Felsen hinein, bis sie zu Schluchten werden, deren Verläufe sich kaum noch ändern lassen. Je mehr Zeit wir an einem Ort damit verbringen, wieder und wieder die gleichen Dinge zu tun, desto mehr Leben verpassen wir. Und desto schwerer wird es uns fallen, unsere Denk- und Handlungsmuster zu durchbrechen. Wem es aber gelingt, seinen Entdeckergeist zu bewahren oder wiederzufinden, der wird das Neue begrüßen, statt es als Bedrohung wahrzunehmen. Und sich so die Aussicht auf ein Leben verschaffen, das mal stürmisch sprudelnd und mal beschwingt dahinfließend, selten aber fad ist – ob draußen in der Welt oder daheim.
Anfänge mit Hindernissen
Endlich: Ankunft im Paradies. Von einer Holzterrasse aus, die über dem Hang schwebt, betrete ich den gemütlichen Bungalow. Nachdem ich die gläserne Flügeltür geschlossen habe, lasse ich den Rucksack von meinen Schultern gleiten und die plötzliche Ruhe in stillen Wellen über mich ziehen. Zwei internationale Flüge liegen hinter mir, dazu eine siebenstündige Busfahrt, eine unruhige Fährfahrt, eine ausgedehnte Tuk-Tuk-Fahrt. Und schließlich ein fünfminütiger Fußweg durch den Dschungel. Alles, um hierherzugelangen: zu einem dieser Handvoll Bungalows, die das Resort auf der thailändischen Insel Koh Chang bilden, für das ich mich entschieden habe. Sie sind lose über den Hang verteilt und fügen sich mit ihren spitz zulaufenden Bastdächern perfekt in die wogende, knarrende Waldwelt ein, die sie umhüllt.
Auf dem großzügigen Doppelbett liegen Blüten und ge-
schickt zu Schwänen gefaltete Handtücher. Kunstvolle Ornamente zieren die handgefertigten Holzschränke und -regale, die in den zurückhaltenden Farben von dunkler Baumrinde und des hellen Sandstrands gehalten sind. Ein perfekter Rückzugsort für Frischverliebte – und für einen Autor, der in Ruhe die Ideen für ein neues Buchprojekt fließen lassen will.
Ich nicke zufrieden. Ja, hier werde ich …
Ein Geräusch auf der Terrasse unterbricht meinen Gedanken. Ich blicke durch die Flügeltür nach draußen. Und sehe einen Affen mitten auf der Terrasse sitzen. Er muss vom Dach gesprungen und frisch gelandet sein. Dankbar freue mich über die wundervolle Begrüßung.
Doch die Idylle währt nur ein paar Augenblicke.
Mit einem raschen Satz springt der Affe auf einmal vorwärts und rammt seinen Kopf gegen die Glasscheibe. Er beginnt sich an ihr zu schaffen zu machen. Verblüfft weiche ich einen Schritt zurück. Mein Besucher fletscht die Zähne und schlägt mit den kleinen Pfoten gegen das Glas, gegen den Holzrahmen. Ich schaue einen Moment zu und hadere, ob ich hierbleiben soll, um mir das seltsame Schauspiel anzusehen, oder mich lieber vorübergehend ins Badezimmer zurückziehe, damit das Tier das Interesse an mir verliert und verschwindet. Aber vermutlich wird es sowieso eher von irgendeinem Essensduft angezogen, der mir entgeht, ihm jedoch verheißungsvoll um die Nase wabert.
Plötzlich hält der Affe inne – und tut dann etwas, womit ich nicht gerechnet habe: Er springt hoch, packt den Türknauf, hält sich daran fest und beginnt an ihm zu rütteln. Nun bin ich es, der einen Satz nach vorn macht. Ich stürze auf die Tür zu und drehe innen am Knauf rasch den kleinen Knopf, der die Tür verschließt. Der Affe rüttelt weiter, bleckt die Zähne und faucht mich an. Zunehmend perplex, betrachte ich ihn, während ich sicherheitshalber den bebenden Knauf weiter festhalte. Die Augen des Tiers funkeln wild, aber was mich noch mehr fesselt, ist das zerfetzte und vernarbte Fleisch um sein Maul herum. Auf der linken Seite fehlt ein großes Stück der Oberlippe, was den Eindruck, dass der Affe dem Wahnsinn anheimgefallen ist, noch verstärkt.
Ich nehme den Nervenkitzel auf mich und bewege meinen Kopf noch näher an die Scheibe heran. Nur wenige Zentimeter und eine dünne, unsichtbare Schicht trennen mich von dem verunstalteten Wesen, das sich weiter in Rage an der Tür abarbeitet. Plötzlich lässt es von dem Knauf ab und beginnt an dem kleinen Metallstift herumzufingern, der die Mitte der Flügeltür im Boden arretiert. Ich erkenne sofort: Sollte es dem Tier gelingen, den Stift hochzuziehen, wird das Schloss am Knauf unwirksam werden und sich die Tür aufschwenken lassen. Von innen kann ich den Stift nicht packen, aber auch von außen scheint der Affe Schwierigkeiten zu haben, ihn zu fassen zu kriegen.
Die Idylle, die mich kurzzeitig umgab, ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Stattdessen finde ich mich mitten in einem Horrorfilm wieder. Das Monster mit der zerfetzten Visage ist so wild entschlossen, zu mir hineinzugelangen, dass es mir die Hände feucht werden lässt. Bilder eines durch meinen Bungalow rasenden, beißenden, kratzenden, krankheitsübertragenden Fellknäuels blitzen durch meinen Kopf. Ich halte die Luft an. Und weiß, dass ich mich für den gesamten restlichen Aufenthalt nicht mehr sicher fühlen werde. Nicht hier drinnen. Nicht draußen auf der Terrasse, auf der ich doch Tag um Tag sitzen und schreiben wollte. Und auch nicht, wenn ich gezwungenermaßen über die Holzstege und Waldpfade schlendere, die sich zwischen den Bäumen hindurchschlängeln und von den Bungalows zur Rezeption mit dem kleinen Restaurant führen. Zweifellos wird mich auf dem Fußweg jedes Rascheln im Blätterdach zusammenzucken lassen – und es raschelt viel, das habe ich schon auf dem Herweg festgestellt, denn eine ganze Affenhorde lebt und liebt und lacht hier lautstark im Geäst.
So viel ist klar: Nicht jede Reise empfängt uns mit offenen Armen, nicht jeder Trip hüllt uns wie eine wohlig weiche Decke ein und heißt uns lächelnd willkommen. Am Flughafen spüren wir noch das angenehme Kribbeln, das mit den meisten Aufbrüchen einhergeht, ausgelöst von Vorfreude und Vorahnung, von Erwartungen und Hoffnungen. Welche Erlebnisse, welche Begegnungen mögen warten – und welche Erkenntnisse? Was werden wir über die Welt erfahren, was wird bleiben?
Doch was uns häufig erst einmal erwartet, sind kleine Rückschläge. Jedenfalls habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass aus den verschiedensten Gründen insbesondere am Anfang so manches schiefgehen kann. Dann sticht und reibt die Reise, hält mal unerwarteten tierischen Besuch und mal andere Widrigkeiten bereit: vermeidliche und unvermeidliche Hindernisse, die einen wie feine, durchsichtige Tentakel davon abhalten, sich wie geplant vom ersten Moment an widerstandslos auf die neue Umgebung einzulassen. Sind sie überwunden, ist die Freude umso größer. Ohnehin handelt es sich rückblickend zumeist um harmlose, eher unterhaltsame Episoden. Auch ich bin unverbesserlich, nehme mir jedes Mal vor, mich in das nächste große Abenteuer wie ein Sprinter beim Startschuss hineinzustürzen. Nur um dann ins Taumeln zu geraten, jedenfalls für ein paar Schritte, bevor der Reiseflow schließlich einsetzt.
Manchmal haben die Startschwierigkeiten vielmehr emotionale als physische Gründe. Reisebuchautor Thomas Bauer erzählte mir von seinen Erlebnissen auf dem Shikoku-Weg, einem der ältesten Pilgerwege Japans. Gleich zu Beginn der Wanderung kaufte er sich in einem Geschäft die angemessene Ausstattung, mit der auch die Einheimischen auf dem Weg unterwegs sind: einen mit Plastik überzogenen Strohhut, ein kimonoähnliches Baumwollhemd, einen verzierten Wanderstab, ein Stempelbuch und zweihundert osame-fuda, Wunschzettel, die in den Tempeln deponiert werden können. All das hatte der Tradition gemäß die Farbe Weiß, „die Farbe des Todes, verstanden als Auflösung der Begierden, als Überwindung der Anhaftungen und Übertritt zum Nirwana“, wie Thomas in seinem Buch Fremdes Japan erläutert. Statt sich dank dieser Montur allerdings wie ein richtiger Pilger inklusive der dazugehörigen spirituellen Intensität zu fühlen, kam Thomas sich zunächst verkleidet vor. Während er unsicher einen Schritt vor den anderen setzte, erwartete er, dass ihn jeden Augenblick jemand anhalten und fragen würde, was er sich bei dieser Maskerade dachte. Thomas fühlte sich wie ein Schauspieler, der sich erst in seine neue Rolle einfinden musste, bevor der Weg ihm seine Geheimnisse und Weisheiten offenbaren würde. Nachdem er eine Weile unterwegs gewesen war, folgte der äußeren schließlich auch die innere Wandlung zum Pilger, und die Pilgerreise konnte endlich beginnen.
Nicht nur in Japan fühlte Thomas sich auf die Probe gestellt: „Bei den meisten meiner Abenteuerreisen hatte es am Anfang geknirscht.“ Jedes Mal war der Denk- und Wahrnehmungsprozess, den er zwischen dem Reisebeginn und dem Ankommen im Unterwegssein durchmachte, der gleiche: „eine Purifikation, eine umfassende Wandlung, eine Hinwendung ohne Wenn und Aber“. Im Gespräch für meinen Podcast fügte er hinzu, dass zu dieser Hinwendung auch gehöre, dem Drang zu widerstehen, darüber nachzugrübeln, wie es wohl gerade zu Hause oder im Büro aussehen möge. Man müsse sich körperlich, vor allem aber im Kopf auf das Unterwegssein einstellen. Am Ende seien gerade die Reisen mit Startschwierigkeiten besonders schön geworden, hätten mit jedem Kilometer mehr von ihren Reizen offenbart.
Von solch einer Offenbarung fühlte ich mich meilenweit entfernt, als ich mit Falk und Bastian am einzigen Gepäckband von Gällivares Provinzflughafen im Norden Schwedens stand und trotz der Gesellschaft meiner beiden Freunde zunehmende Einsamkeit empfand. Weil die anderen Fluggäste einer nach dem anderen ihr Gepäck vom Band wuchteten und uns zurückließen. Es war das gleiche Gefühl, wie ich es vor vielen Jahren beim Sportunterricht in der Grundschule hatte, wenn zwei meiner Mitschüler vor dem Rest der Klasse standen und abwechselnd die geschicktesten Kicker in ihre Mannschaft wählten. Um mich herum wurde es einsam, während sich einer nach dem anderen zu seinem Team begab. Und mich zurückließ. Jede Entscheidung ein kleiner Stich, jedes Mal, wenn einer meiner Freunde ging, ein kleiner Verrat.
In jener Nacht in Nordschweden waren es nicht die Klassenkameraden, die mich verrieten, sondern die mit uns am Gepäckband stehenden Passagiere. Ihre Reihen hatten sich längst gelichtet. Bis schließlich nur noch Bastian, Falk und ich übrig blieben. Die Aussätzigen. Die Zurückgelassenen. Die allem Anschein nach einzigen Menschen in einem winzigen, von dichten Fichtenwäldern umgebenen Flughafengebäude, das nach unserem bisherigen Eindruck irgendwo am Ende vom Ende der Welt lag.
Es war nach Mitternacht. Wir waren müde. Und demoralisiert. Die von Vorfreude und Abenteuerlust genährte Aufregung, mit der wir einen halben Tag zuvor in Düsseldorf in die erste von mehreren Maschinen gestiegen waren, hatte sich mittlerweile wie die Luft aus einem beschädigten Reifen verflüchtigt. Mit desillusionierten Blicken starrten wir auf das Gepäckband, das noch für ein paar letzte Augenblicke leer vor sich hin ratterte und schließlich mit einem müden Seufzer stehen blieb.
Aus und vorbei.
Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Wie bei einer unschönen Diagnose. Unsere hieß: Gepäckverlust. Ein Schock, schwer zu verdauen, vor dem sich wohl jeder fürchtet, der auf ein Gepäckband starrt. Und zugleich – zugegeben – ein Klassiker, mit dem gelegentlich zu rechnen ist. Aber wir hatten viel vor. Und detaillierte, über Monate ausgearbeitete Pläne für jede Etappe, um unser Pensum zu schaffen. Mit jedem Tag, den wir nun verloren, würden wir einen von nur drei Puffertagen einbüßen. Was uns später teuer zu stehen kommen konnte.
Nach einiger Suche trieben wir doch noch eine Flughafenmitarbeiterin auf. Die uns zwar nichts zum Verbleib unseres Gepäcks sagen konnte, aber immerhin so viel Mitleid empfand, dass sie uns drei Zahnbürsten spendierte. Und uns ein Taxi rief, das uns in ein Hotel brachte, in dem wir am nächsten Morgen den Koch überredeten, uns zum anderthalb Stunden entfernten Flughafen von Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens, zu fahren. Dorthin ging ein Flug, der womöglich unser Gepäck an Bord hatte, das, so wussten wir mittlerweile, bei der Zwischenlandung in Amsterdam hängen geblieben war. Und tatsächlich, welch wohliger Anblick: Dort standen unsere drei Rucksackkolosse!
Anderthalb Stunden später waren wir wieder zurück am Hotel, das geradewegs auf den Ausgangspunkt der nächsten Reiseetappe blickte: den Busbahnhof. Wo just im Moment unserer Rückkehr mit einer halben Stunde Verspätung einer von zwei täglich verkehrenden Bussen einfuhr, die uns zu unserem Ziel bringen sollten (den ersten hatten wir längst verpasst). Einer von uns sprintete zum Fahrer und flehte ihn an, er möge fünf Minuten warten. Wir anderen schleppten die Rucksäcke ins Hotelfoyer und begannen, vorgepackte Beutel auszusortieren: Kleidung für den Rückflug, dazu eine Socke hier, eine überflüssige Ersatzbatterie da, auch die Papiere mit den Daten und Umsteigezeiten für die Rückflüge blieben hier – denn auf einer Tour, wie wir sie planten, zählte jedes Gramm. Wir gaben alles im Hotel ab und spurteten zum Bus. Geschafft. Und trotz Gepäckdesaster nur einen halben Tag verloren.
Der Überlandbus brachte uns vorbei am Muddus-Nationalpark und durch den Stora-Sjöfallet-Nationalpark bis zur Fjällstation Ritsem an den Ufern des Akkajaure. Schon seit Stunden waren wir durch keine nennenswerte Siedlung mehr gekommen. Wir stiegen auf eine kleine Fähre um und waren damit im Begriff, die Zivilisation endgültig hinter uns zu lassen. Kaum ein Dutzend Menschen befand sich an Bord, Bastian, Falk und mich eingeschlossen.
Das Boot glitt ratternd über die glatte Wasseroberfläche des Sees, in der sich der tiefblaue Himmel spiegelte. Vor uns, am anderen Ufer, erhob sich das Akka-Massiv in den blauen Dunst, am Fuß von Wald ummantelt, die Gipfel schneebedeckt. Dort begann der Sarek-Nationalpark, das Ziel unserer Reise. Weil eine Tour durch seine Weidendschungel und reißenden Furten als eines der großen Naturabenteuer Europas gilt, wird der Sarek gern etwas reißerisch als „Europas letzte Wildnis“ beschrieben. Das ist zwar streng genommen nicht ganz korrekt, bringt aber zum Ausdruck, was uns erwartete: vollkommene Abgeschiedenheit. Eine endlose Landschaft aus kargen, gletscherbedeckten Bergen, eiskalten Gebirgsflüssen und von struppigem Heidekraut überwucherten Ebenen. Auf zweitausend Quadratkilometern.
Wir wollten diese unberührte, ursprüngliche Landschaft auf einer selbst zusammengestellten Route durchmessen. Wir wollten Gletscherwasser trinken und Elchen begegnen und abends am Lagerfeuer sitzen, umgeben von unendlicher Weite und fernen Horizonten. Nichts dabei außer unseren monströsen Dreißigkilorucksäcken samt Zelt und Verpflegung für die nächsten drei Wochen. Unterwegs würde es keine Imbissbuden geben, genauso wenig wie markierte Wege, Handyempfang oder sonst irgendwelche Möglichkeiten, auszusteigen oder auf Hilfe von der Außenwelt zu hoffen. Wir würden ohne doppelten Boden unterwegs sein. Da blieb nicht viel Raum für Fehler. Schon ein verstauchter Knöchel konnte zum Problem werden, eine gröbere Nachlässigkeit würde die Natur unnachgiebig bestrafen.
Es sollte für uns alle das bisher größte Abenteuer werden. Dementsprechend gründlich hatten wir uns vorbereitet. Wir hatten jede einzelne Mahlzeit jedes einzelnen Tages so zusammengestellt, dass das Verhältnis von Gewicht zu Kalorien möglichst günstig war. Haferflocken mit Milchpulver und einer Prise Kakao, alles aufs Gramm genau abgewogen, für jeden Tag in separaten Beuteln verpackt. Schwarzes Dosenbrot. Astronautennahrung. Proteinriegel. Trockenfrüchte. Nüsse. Und wir waren die Route wieder und wieder durchgegangen, hatten anhand von Karten und Beschreibungen in tagelanger Arbeit ein zwanzigseitiges Textdokument mit Wegmarken zusammengestellt und ausgedruckt, das hoffentlich verhindern würde, dass wir uns verirrten.
Trotzdem waren unsere Mitmenschen vor unserem Aufbruch weit weniger zuversichtlich gewesen als wir selbst. Wir konnten nicht leugnen, dass sie mit ihrer Mischung aus bohrenden Fragen und gleichermaßen bewundernden wie skeptischen Blicken Zweifel gesät hatten, nicht unähnlich dem Gespräch, das ich mit einem Freund vor dem Aufbruch in den Himalaja geführt hatte. Als ich unsere Sarek-Reiseidee drei Wochen davor erstmals einem Kollegen schilderte, betrachtete er mich von oben bis unten, als wollte er herausfinden, wie groß meine Überlebenschancen waren. Er machte nicht den Eindruck, als würde ihm das, was er sah, imponieren. Eher, als wollte er sich einprägen, wie ich aussah. Nahm er insgeheim schon Abschied?
„Drei Wochen?“, fragte er. „Keine Wege? Nur Wildnis? Keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen? Dann müsst ihr ja Experten im Umgang mit GPS-Geräten sein!“
Ich nickte zögerlich. „Selbstverständlich.“ Was nicht weiter von der Wahrheit hätte entfernt sein können. Niemand von uns hatte je ein GPS-Gerät bedient, und wir planten auch nicht, eines mitzunehmen.
„Und das Navigieren mit Karte und Kompass wurde euch wohl in die Wiege gelegt.“
„In die Wiege vielleicht nicht, aber …“ – gewinnendes Lächeln, zuversichtliches Zwinkern – „das kriegen wir schon hin.“
„Und …“
Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter, um ihn zum Schweigen zu bringen, und sagte mit aller Selbstsicherheit, die ich aufbringen konnte: „Mach dir mal keine Sorgen.“
Nach dem Feierabend spurtete ich nach Hause und initiierte eine Skypekonferenz mit meinen beiden Reisepartnern.
„Wie ist das eigentlich mit der Navigation?“, platzte es aus mir heraus. „Könnt ihr mit Karte und Kompass umgehen?“
„Noch nicht“, sagte Falk, „aber das kann ja nicht so schwer sein.“
„Nicht so schwer? Unser Leben könnte davon abhängen!“ Meine Stimme klang ein wenig schrill. „Bastian, was ist mit dir?“
„Ich habe das bei der Bundeswehr gelernt.“
Gott sei Dank! Ich lehnte mich erleichtert zurück, aber Bastian war noch nicht fertig: „Ich würde mir vier von zehn Punkten geben.“
„Vier von zehn? Was soll das heißen?“
Nun saßen wir also auf der Fähre, mit zu Schlitzen verengten Augen in die vor uns liegende Wildnis starrend, umgeben von der Aura wahrer Abenteurer, bereit zu beweisen, was wirklich in uns steckte. Eine gute Gelegenheit, um sich ein letztes Mal die erste Etappe einzuprägen. Ich kramte aus meinem Rucksack einen Beutel hervor, in dem ich all die Dinge aufbewahrte, an die ich mit wenigen Handgriffen gelangen wollte. Ich zog das Bündel Zettel mit der Routenbeschreibung hervor, entfaltete die zwanzig Seiten – und stellte fest, dass es nur noch zehn waren. Sie begannen bei Tagesetappe neun. Ich wühlte erneut in dem Beutel. Nichts.
Eine böse Ahnung beschlich mich. Ich ließ meine Augen unauffällig zu Bastian und Falk wandern – hatten sie schon etwas bemerkt? Nein, sie schauten immer noch in die Natur. Ich wühlte weiter. Aber die Papiere waren fort. Ich musste sie in der Eile im Hotel versehentlich mit ausgepackt haben.
„Wenn du schon dabei bist, magst du mir deine Karte geben?“
Beim Klang von Bastians Stimme zuckte ich zusammen. Ich nickte. Und suchte nach der Karte, dem wichtigsten Utensil des gesamten Trips. Maßstab 1:100 000, wasserfestes Papier, mit Folienstiften aufgetragene Anmerkungen, Markierungen, kleine Post-its. Ein Meisterwerk der Routenplanung.
Ich schürzte ungläubig die Lippen. Auch die Karte war fort. Zum Glück hatten wir sicherheitshalber zwei gekauft. Falk musste die zweite haben. Allerdings wagte ich nicht, ihn danach zu fragen und damit meinen Lapsus zuzugeben, noch nicht.
„Und gib mir gern auch gleich den Kompass“, sagte Bastian.
Ich blickte aus dem Beutel auf: „Den Kompass?“
„Ja. Ich will schon mal …“
„Du hast doch gesagt, dass du einen Kompass kaufen willst.“
„Ach ja?“
„Ja! Du hast mich von Globetrotter aus angerufen und bestätigt, dass du dich um den Kompass kümmern wirst.“
„Aber du hast doch in unserer Skypekonferenz gesagt, du hättest einen Kompass.“
„Richtig. Und ich habe auch gesagt, er sei ein Überbleibsel meiner Grundschulzeit und ich wolle ihm ungern mein Leben anvertrauen!“
„Und deshalb hast du ihn nicht mitgenommen?“
„Ja! Deshalb, und weil du zugesagt hast, einen Qualitätskompass zu kaufen!“
„Ich habe aber keinen gekauft.“
Ich atmete tief durch. Auch wenn dieses Gespräch nicht gerade den Eindruck erweckt, hatten wir uns ausführlich auf diesen Trip vorbereitet, alle Details immer wieder besprochen, von der Ausrüstung über die Verpflegung und Streckenführung bis hin zu der Frage, wer ein Feuerzeug, wer eine Nagelschere und wer eine Notklorolle mitbringen würde. Um absolut sicherzustellen, dass wir genau das mithatten, was wir unbedingt brauchten – nicht mehr und nicht weniger. Nun waren wir endlich hier und drohten an den grundlegendsten Dingen zu scheitern. Ohne Routenbeschreibung und Kompass würde es unmöglich sein …
„Zum Glück habe ich aus langer, schmerzvoller Erfahrung gelernt, mich auf keinen von euch zu verlassen“, schaltete sich Falk ein. Mit einem gänzlich berechtigten Siegerlächeln hob er einen wunderschönen – den wunderschönsten! – Kompass in die Luft, zusammen mit seiner eigenen Karte.
Unsere Rettung. Der Trip konnte weitergehen.
Trotzdem hatte ich nach diesem Gespräch das betrübliche Gefühl, dass unsere Überlebenschancen entschieden gesunken waren. Nun ja. Wir würden es schon schaffen. Ich ließ meinen Beutel unauffällig in meinen Rucksack zurückgleiten und heftete meinen Blick wieder auf die Berge vor uns, die schon viel näher gekommen waren.
Die verlorene Karte und Streckenbeschreibung ließ ich unerwähnt.








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.