
Wir Angepassten - eBook-Ausgabe
Überleben in der DDR
„Groß ist das Buch trotzdem. Weil es ohne Schaum vorm Mund gerade jüngeren Menschen einen guten Einblick in das gibt, was die DDR gewesen ist: autoritär fürsorglich, bei Bedarf gemein und im Ernstfall ein Unrechtsstaat.“ - Berliner Zeitung
Wir Angepassten — Inhalt
Zwischen Anpassung und Widerspruch.
„Wie habe ich in der DDR gelebt? Einfach ist es nicht, sich dieser Frage zu nähern. Sie birgt die Gefahr, unbequem zu werden für jeden, der ihr ernsthaft nachgeht. War ich angepasst? Habe ich widersprochen? Hätte ich anders handeln können? Mir geht es dabei um Aufklärung, nicht um Abrechnung. Ich will vor allem Mut machen zu erzählen. Weniger werten und voreilige Schlüsse ziehen als vielmehr ein offenes Gespräch führen. Denn es gibt keinen allgemein gültigen Maßstab über das ›richtige‹ Verhalten in einer Diktatur.“ So beschreibt Roland Jahn das Anliegen seines Buches. In elf Kapiteln reflektiert er aus eigener Erinnerung das Leben in der DDR zwischen den Polen Anpassung und Widerspruch. wehtut, wir sollten Antworten suchen.
Leseprobe zu „Wir Angepassten“
Vorwort
Erzählen als Chance
Ich glaube, dass das Erzählen über die DDR eine Chance sein kann. Es steckt noch viel Ungesagtes in dieser Vergangenheit. Offen zu erzählen kann befreiend sein. Dieses Buch will deshalb zum Erzählen einladen. Über die Bedingungen, unter denen Menschen in der DDR gelebt haben.
Wir Angepassten enthält Erinnerungen an mein Leben in der DDR, an Geschichten von Freunden und Weggefährten. Es sind Geschichten, die Menschen damals und nach dem Ende der DDR über ihr Leben dort erzählten. Es sind Episoden und Fragmente, beileibe keine [...]
Vorwort
Erzählen als Chance
Ich glaube, dass das Erzählen über die DDR eine Chance sein kann. Es steckt noch viel Ungesagtes in dieser Vergangenheit. Offen zu erzählen kann befreiend sein. Dieses Buch will deshalb zum Erzählen einladen. Über die Bedingungen, unter denen Menschen in der DDR gelebt haben.
Wir Angepassten enthält Erinnerungen an mein Leben in der DDR, an Geschichten von Freunden und Weggefährten. Es sind Geschichten, die Menschen damals und nach dem Ende der DDR über ihr Leben dort erzählten. Es sind Episoden und Fragmente, beileibe keine systematische oder umfassende Analyse. Die Lücken mögen Anregung für das Erinnern und Erzählen anderer sein.
Die Kapitel widmen sich lose verschiedenen Formen von Anpassung und Widerspruch. Dabei überschneiden sich die Überlegungen zu den verschiedenen Formen. Es sind Beschreibungen anhand konkreter Erlebnisse, die Menschen dazu bewogen haben, sich zu gewöhnen, zu schweigen, mitzulaufen oder auch die Angst zu überwinden.
Allen diesen Erinnerungen ist gemeinsam, dass sie zeigen, dass das Leben unter den Bedingungen der Diktatur Menschen oft vor unmögliche Entscheidungen stellt. Das eigene Menschsein wird auf eine bisweilen absurde Art getestet. Ich glaube, dass im Erzählen all dieser Geschichten ein wichtiger Schritt für unser Zusammenleben heute getan werden kann.
Wichtig ist mir, dass die Bedingungen für das Erzählen stimmen. Dass wir alle offen mit den Erinnerungen in vielen Perspektiven umgehen. Niemand war nur gut oder nur schlecht. Nur widersprechend oder nur angepasst. Viele Menschen haben versucht, aufrecht unter den Bedingungen des „real existierenden Sozialismus“ zu leben. Nicht immer ist es gelungen.
Wir haben noch viel zu wenig erzählt darüber, wie wir in der DDR gelebt haben. Viel zu wenig berichtet von all den vielen alltäglichen Details. Vielleicht schaffen wir es, uns zu öffnen für die Geschichten, die in uns schlummern.
Roland Jahn
Berlin, im August 2014
Nachdenken
Zwischen Anpassung und Widerspruch
Wir Angepassten. Um den Titel dieses Buches haben wir eine Weile gerungen. Er sollte niemanden vor den Kopf stoßen und doch provozieren. Aber es ist klar: Das Wort Anpassung ist sperrig. Es ruft Abwehr hervor. Als ich mit meinem Freund Peter Rösch für dieses Buch über unser Leben in der DDR gesprochen habe, darüber, dass wir uns doch auch in bestimmte Abläufe eingetaktet, uns also angepasst haben, da hat er mir spontan widersprochen. „Ich habe mich nicht angepasst.“ Niemand will ein Anpasser sein. Und doch haben wir es alle getan. Und tun es noch. Damals und heute.
Sich den Umständen anzupassen, das gilt in Natur und Technik als klug. Es kann eine Überlebensstrategie sein. Anpassung als Prinzip, das hat der Menschheit das Überleben gesichert. Und doch empfinden wir es meist nicht als positiv, wenn sich jemand anpasst. Die „Unangepassten“, sie finden heute – gerade im Rückblick auf die DDR – schneller Zuspruch.
Als ich neulich zum Thema „Warum ich nicht zum Mitläufer wurde“ sprechen sollte, habe ich gezögert. Es wäre die Erzählweise geworden, die man gern hört, die Mut machen soll. Es wäre eine klare Rollenzuweisung gewesen: Ein politisch Verfolgter erzählt von seinem Widerspruch gegen das System und den Folgen. Aber interessanter erschien es mir, auch die Momente zu reflektieren, in denen ich mich angepasst habe. Ich habe den Vortrag einfach umbenannt in „Zwischen Anpassung und Widerspruch“. Das Leben in der DDR, in einem Land mit Mauer und Stacheldraht, unter einer Ein-Parteien-Herrschaft und ohne den umfassenden Zugang zu Menschenrechten, es war komplizierter, als die gängigen Kategorien es den Menschen zugestehen. Die Schubladen Täter/Opfer/Mitläufer beschreiben nicht wirklich, wie Menschen in der DDR gelebt haben. Und so habe ich in meiner Rede darüber gesprochen, wie ich mich angepasst habe an die Vorgaben des Staates und dann zwischen Anpassung und Widerspruch meinen Weg gesucht habe.
„Anpassung“ ist die Haltung, die für mich den Alltag unter den Bedingungen einer Diktatur stark geprägt hat. Genau darüber haben wir noch viel zu wenig gesprochen und es noch viel zu wenig analysiert. Es ist ein vielschichtiges Verhalten, stetig gefangen in einer Dynamik zwischen der Abwägung der Kosten oder dem Nutzen des Anpassens und der Kosten oder dem Nutzen des Widersprechens.
Diese Prozesse habe ich auch in meinem eigenen Leben in der DDR gespürt, immer wieder. Auch ich habe mich eine Zeit lang in den vorgezeichneten Bahnen des SED-Staates bewegt und stetig die Kosten und Nutzen meines Verhaltens abwägen müssen. Wenn man also über den Alltag in der DDR reflektiert, so sollte man den Aspekt der Anpassung und der Mechanismen, die an uns als Menschen gewirkt haben, viel stärker beleuchten. Niemand war nur Rebell oder nur Angepasster. Wir brauchen einen Prozess des offenen Nachdenkens über das Leben in diesem Staat DDR, in dem wir unseren Alltag gelebt haben.
Wir sind in der DDR aufgewachsen, zur Schule gegangen, haben Berufe gelernt, Familien gegründet, Geburtstage und Weihnachten gefeiert. Wir haben gelebt. Gute Erinnerungen geschaffen und schlechte. Woran erinnert man sich? In der Regel doch wohl zuerst an das eigene Leben, an das Private. Vielleicht auch daran, wie dieses Leben mit den großen politischen und kulturellen Ereignissen kollidierte und von ihnen eingerahmt wurde. Aber der Staat DDR, der von einer Partei, der SED, bestimmt wurde, hat den Menschen, die in ihm lebten, viel zugemutet. Er hat sich immer wieder in das Private der Menschen eingemischt, um jeden Widerspruch, der den Anspruch der Partei auf Allmacht gefährden konnte, im Keim zu ersticken Die SED war letztendlich an ihrem dauerhaften Machterhalt interessiert und hat dazu ein Staatsgebilde gebaut, das systematisch die Menschenrechte einschränkte oder auch verwehrte. Dazu musste sie sich jederzeit darum bemühen, das Denken der Menschen in ihrem Sinne zu kontrollieren. Und das hat zu massiver Repression und Verfolgung geführt.
Täter und Opfer. Das sind die Begriffe, um die sich die öffentliche Diskussion zur DDR hauptsächlich rankt. Die Opfer, die Menschen, die ihre Menschenrechte wahrgenommen und für ihre Selbstbestimmung gekämpft haben und die deswegen aus der Bahn geworfen, ins Gefängnis gesperrt wurden, sogar mit dem Leben bezahlten – sie haben unsere Aufmerksamkeit, unseren Respekt und unser Mitgefühl verdient. Sie haben Unrecht erlebt, sie sind an Leib und Seele beschädigt worden, ihr Leben ist durch die Unterdrückung der Menschenrechte in der DDR oft aus den Fugen geraten. Und deshalb gehört zur Aufarbeitung dieses Unrechts dazu, dass man Täter und Verantwortung benennt. Das SED-Regime hat funktioniert, weil viele Menschen verantwortlich für das Unrecht gehandelt haben. Diese Pole der DDR-Gesellschaft, sie verkörpern die Extreme, und das macht sie besonders interessant und einsichtsvoll. Sie spiegeln aber nicht das gesamte Bild wider: Die Mehrheit der Menschen, die in der DDR gelebt haben, kann sich weder mit der Definition eines Täters noch mit der eines Opfers identifizieren. Die großen Debatten über Stasiverstrickung und Diktaturanalyse fegen direkt über ihre Erinnerung hinweg. Das Wort Diktatur kommt vielen nicht unbedingt in den Sinn, wenn sie an ihr Leben in der DDR denken. Auch in der Diktatur schien die Sonne.
Das Leben in der DDR, es war ein Leben zwischen Anpassung und Widerspruch. „Die meisten lebendigen Menschen in der DDR haben nämlich immer beides zugleich: sich angepasst und widerstanden“, schreibt Wolf Biermann und verweigert sich der Entscheidung nach Anpassen oder Widerstehen in der DDR. „Ein ›UND‹ wäre treffender.“ Der Historiker Stefan Wolle, der in der DDR groß geworden ist, fasst die Zeit zwischen seinem 17. und 40. Lebensjahr „als einen einzigen Eiertanz“ zusammen. Eiertanz. Das Wort passt für so vieles, was ich mit der DDR verbinde. Sich durchlavieren. Das eine sagen, das andere meinen. Strategien und Taktiken entwickeln, die das Geforderte bedienen, ohne sich selbst zu verraten. Das System hat eben auch funktioniert, obwohl so viele dagegen waren.
Wie habe ich in der DDR gelebt? Einfach ist es nicht, sich dieser Frage zu nähern. Sie birgt die Gefahr, unbequem zu werden für jeden, der ihr ernsthaft nachgeht. War ich angepasst? Habe ich widersprochen? Hätte ich anders handeln können? Mir geht es dabei um Aufklärung, nicht um Abrechnung. Ich will vor allem Mut machen zu erzählen. Weniger werten und voreilige Schlüsse ziehen, als vielmehr ein offenes Gespräch führen. Denn es gibt keinen allgemeingültigen Maßstab über das „richtige“ Verhalten in einer Diktatur.
Anpassen oder widersprechen, das war in der DDR in hohem Maße individuell. Der alleinstehenden Mutter mit zwei kleinen Kindern kann man z. B. keinen Vorwurf daraus machen, dass sie nicht zur Demonstration für Meinungsfreiheit ging. Die Risiken waren unkalkulierbar. Es war verständlich, das Wohl der Kinder im Auge zu behalten und sich anzupassen.
Doch es gibt auch Situationen, die weniger klar und nicht so schnell einzuschätzen sind. War es verwerflich, an den staatlichen Feiertagen die DDR-Fahne vors Haus zu hängen, weil man Ärger vermeiden wollte? Oder war es einfach taktisch klug? Und wie sind wir später dann mit unseren Entscheidungen umgegangen? Waren wir enttäuscht über uns selbst, verängstigt – oder war es uns am Ende egal, weil wir uns längst gefügt hatten in das Schicksal, in einem Land mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl leben zu müssen?
Bis heute haben wir keine ausreichende Erklärung dafür, dass die DDR so lange existieren konnte. Warum dauerte es 40 Jahre, bis sich die Menschen endlich trauten zu sagen, dass die Machthaber „des Kaisers neue Kleider“ trugen? Bis sie den Mut hatten, auf die Straße zu gehen, ihre Rechte wahrzunehmen – und sie schließlich die Mauer zum Einsturz brachten? Wenn wir wirklich verstehen wollen, warum diese Diktatur 40 Jahre funktioniert hat, dann brauchen wir auch Aufklärung über das, was die Mehrheit der Bewohner der DDR erlebte und wie sie mit den Zwängen des Systems umgegangen sind: Zur Wahl gehen oder den Studienplatz riskieren? Den Kontakt zur Tante im Westen abbrechen oder den beruflichen Aufstieg gefährden? Den Unmut über die fehlende Meinungsfreiheit schlucken oder ins Visier der Stasi geraten?
In einer Diktatur sind die Konsequenzen des Handelns ungleich weitreichender als in einer Demokratie. In unterschiedlichsten Lebenslagen, in unterschiedlichen Jahrzehnten hatte jede Art von Verhalten in der DDR unkalkulierbare Folgen. Man konnte sich nie darauf verlassen, was wirklich passierte, wenn man sich dem verlangten Verhalten verweigerte.
Tatsächlich ist in vielen Fällen wenig oder gar nichts passiert. Nicht selten aber ist ein Mensch komplett aus der Bahn geworfen worden durch den Eingriff des Staates in ein Leben. Diese Eingriffe, die auch für andere sichtbar waren, hatten einen weiteren Effekt. Sie führten dazu, dass man sich selbst zurückhielt. Dass man zu wissen glaubte, wo eine Grenze erreicht war, und die Konsequenz daraus zog. Zum Schutz der eigenen Familie, der Freunde, für das eigene Wohlbefinden und auch zum Überleben.
Warum aber haben manche widersprochen, und warum haben so viele mehr mitgemacht? Hatte nicht jeder auch einen kleinen Anteil daran, dass es so lange gedauert hat? Wenn schon viel eher viel mehr Menschen ausgestiegen wären, sich den Zumutungen des Staates verweigert hätten – den gefälschten Wahlen, den Ergebenheitsadressen, den Mai-Paraden –, wäre die DDR dann nicht schon viel eher am Ende gewesen? Oder ist das alles nur schönes Wunschdenken?
Menschen haben auch ein Recht auf Anpassung. Anpassung, das klingt nicht wirklich heldenhaft. Aber war es nicht der Weg, den die meisten für sich wählten? Man muss doch nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen. War das nicht vernünftig, zum Wohle der Familie und des eigenen Lebensglücks? Wer darf das verurteilen? Anpassung ist seit Menschengedenken überlebenswichtig. Die Art und Weise, wie wir uns anpassen, und das Maß der Anpassung in der jeweiligen Situation aber sind variabel. Jeder, der sich anpasst, hat auch einen Spielraum. Und es gibt viele Formen der Anpassung, von Schweigen bis Anbiederung. Aber Anpassung hatte eben auch einen Preis. Sie hat denjenigen, die von Staats wegen Unrecht begangen haben, zur Legitimation gedient.
Anfang der 80er-Jahre kursierte in Jena im Zusammenhang mit politischen Inhaftierungen eine Postkarte mit folgender Maxime: „Wo das Unrecht alltäglich ist, wird Widerstand zur Pflicht.“ Man kann den rigorosen Moralismus bewundern, der in dieser Maxime steckt. Aber diese Aufforderung wird den Menschen nicht gerecht, die unter den Bedingungen einer Diktatur leben mussten, weil eine derartige Maxime Übermenschliches verlangt. Wer kann das verlangen, dass sich jeder gegen die Umstände auflehnen muss, wenn Unrecht von Staats wegen geschieht? Man also aufgefordert wird, es Inhaftierten gleichzutun? Es kann keine Pflicht sein, ins Gefängnis zu gehen. Es kann auch keine Pflicht sein, die Erfahrungen der vorhergehenden Generationen zu ignorieren. Deren Versuche, sich gegen das Unrecht zu wehren, wurden sogar mit Panzern niedergemäht. Der 17. Juni 1953, die gewaltsame Niederschlagung des Arbeiteraufstands, wurde zum Trauma, das noch Jahrzehnte fortwirkte. Ebenso wie der 13. August 1961, der Mauerbau, und der 21. August 1968, die Niederschlagung des Prager Frühlings.
Wir sollten uns viel mehr darüber erzählen, wie und warum wir uns den staatlichen Vorgaben so lange angepasst haben. Wir sollten unsere individuellen Erfahrungen austauschen. Ohne Vorwürfe. Ohne Vorverurteilung. So können wir besser erkennen, welche Konsequenzen unser Verhalten hatte. In jedem einzelnen Fall, positiv wie negativ. Sich auf diese Erzählung einzulassen geht vielleicht nicht ohne Schmerz. Es kann wehtun, sich einzugestehen, dass die Entscheidung, sich anzupassen, Folgen hatte, Folgen für einen selbst und für andere. Dass man als ein Rädchen im Getriebe sich drehte und so mit dazu beigetragen hat, dass das System insgesamt funktionierte. Aber es kann auch Erleichterung verschaffen, eine neue Klarheit, für das Hier und Jetzt.
Entscheiden
Weichen stellen für das Leben
Der Name auf dem Zettel sagte mir nichts, ich hatte erst einmal keine Ahnung. „Wer ist denn das?“, fragte ich die Sekretärin. „Er meint, er kennt sie von früher. Von der Uni in Jena.“ Ich musste in meiner Erinnerung kramen. Könnte es wirklich einer meiner ehemaligen Mitstudenten sein? Fred Maiwald.[Name geändert.] Die vage Vermutung verdichtete sich, als ich ihn anrief. 36 Jahre war es her, dass wir voneinander gehört hatten. Verrückt, dass der Klang einer Stimme die Erinnerung beschleunigt. 36 Jahre ist es her, dass wir zusammen in einem Seminar saßen. Unser letztes gemeinsames Uni-Erlebnis war denkwürdig. Es ging um eine Entscheidung, über die alle Studenten gemeinsam abzustimmen hatten. Seither waren wir alle unserer Wege gegangen. Aber Fred wollte nach all den vielen Jahren mit mir reden. Er hatte einen Artikel in der Zeitung gelesen, in dem ich erwähnt worden war. „Da kam alles wieder hoch. Ich muss dir einfach persönlich erklären, was damals war.“ Wir verabredeten uns in einem Café in Berlin. Ich war erfreut, überrascht und neugierig. Auf ihn, auf die Erinnerung. Und sehr gerührt, dass er sich gemeldet hatte. Es war ein eindringliches Gespräch, seine Erinnerung glasklar. „Roland, du musst wissen, ich habe nichts von all dem, was damals passiert ist, jemals vergessen können. Es hat sich mir eingebrannt. Jeder Moment, jeder Satz, jedes Gesicht.“
Der 5. Januar 1977 war ein kalter Wintertag. Meine Studentenbude am Markt war nur ein paar Minuten von der Uni entfernt. Die meisten Seminare fanden in den altehrwürdigen Gebäuden der Friedrich-Schiller-Universität statt. Manche der Mauern standen seit der Gründung der Uni 1558 hier, fast 500 Jahre Geschichte. Es war mir ein beruhigendes Gefühl, dass schon so vieles an diesem Ort geschehen war. Es war eine stete Erinnerung an die Veränderung der Dinge.
In den frühen 70er-Jahren expandierte die Uni. So thronte seit 1972 der Uni-Turm, ein riesiger kreisrunder Stahlbeton-Glaskasten, 29 Stockwerke hoch, im Stadtzentrum. Er war vom Ministerrat der DDR beschlossen worden, um auch meiner Heimatstadt ein „sozialistisches“ Aussehen zu verpassen. Als ich 16 wurde, hatten sie begonnen, die wenigen vom Zweiten Weltkrieg weitgehend verschonten Wohn- und Geschäftshäuser rund um den Eichplatz abzureißen. Im Oktober 1972, kurz vor dem Beginn meines Grundwehrdienstes als 19-Jähriger, war das runde Universitäts-Hochhaus eingeweiht worden.
Ich hatte mich im September 1975, als ich mein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fakultät für „Sozialistische Betriebswirtschaft“ begann, immer noch nicht an seinen Anblick gewöhnt. So ein Glas-und-Stahl-Koloss an der Stelle, wo zuvor jahrhundertealte Häuser eine ganz andere Stadtgeschichte erzählt hatten. Aber die Aussicht aus dem 25. Stock, in dem die Sektion Wirtschaftswissenschaften der Uni angesiedelt war, genoss ich dennoch. Der Blick über die Stadt auf die Jenaer Berge, den Fuchsturm, den Jenzig, auf die Kernberge, die das Refugium meiner Freunde waren. Ein Wald ohne Grenzen, so empfanden wir es, in dem wir wanderten, picknickten, diskutierten, weit weg von dem, was in der DDR von jungen Menschen offiziell verlangt wurde. Wenn ich auf die Berge blickte, musste ich grinsen. Viele gute Erinnerungen, die mir gehörten und nicht den Offiziellen, die mir beim Studium unentwegt das politisch Korrekte abverlangten.
Aber jetzt war Winter, die Berge nur Kulisse. Und ich war auf dem Weg zu einer besonderen Uni-Veranstaltung – einer Diskussion und Abstimmung unserer Seminargruppe, einer von sechs Seminargruppen unseres Jahrgangs der Sektion. Knapp zwei Monate zuvor hatte die DDR dem Liedermacher Wolf Biermann die Staatsbürgerschaft aberkannt. Er durfte von seiner Konzerttournee in der Bundesrepublik nicht wieder zurück in die DDR kommen. Die „grobe Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten“, nach Paragraf 13 des Staatsbürgerschaftsgesetzes vom 20. Februar 1967, gab dieser Entscheidung ein rechtliches Kostüm.
Als zukünftige „Leitungskader der sozialistischen Wirtschaft“ hatten wir uns laut Studienplan natürlich mit den Grundlagen des Marxismus-Leninismus zu beschäftigen. „Wissenschaftlicher Kommunismus“ hieß das Pflichtfach. Im November 1976 hatte der Seminarleiter Helmut Horst kurz nach dem Konzert und der Ausbürgerung von Biermann eine Aussprache dazu angestoßen. Für den Genossen, Mitte 30, groß und schlank und schütteres Haar, war der Fall Biermann eine gute Gelegenheit, die Festigkeit unseres sozialistischen Standpunkts zu testen. Und so verkündete er weitgehend monoton das, was die Partei dazu zu sagen hatte.
„Mit seinem feindseligen Auftritt gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft der DDR entzogen … Schon jahrelang hat er unter dem Beifall unserer Feinde sein Gift gegen die DDR verspritzt … In besonders gemeiner Weise hat er den Sozialismus in unserem Lande verunglimpft. Wir in der DDR hätten, so drückte er sich aus, einen Sozialismus serviert gekriegt, der ›halb Menschenbild, halb Tier‹ war.“
Biermann sei ein „antikommunistischer Hetzer“, damit schloss Horst sein Verlesen der offiziellen Darstellung. Ich konnte es mir nicht verkneifen zu fragen, warum es nicht möglich sei, einen überzeugten Kommunisten wie Biermann, der eine nachvollziehbare Kritik an der Umsetzung der Idee in unserem Land übte, hier leben zu lassen. „Der Sozialismus darf doch keiner Auseinandersetzung auf ideologischem Gebiet ausweichen. Warum fällt es uns denn so schwer, Kritik zuzulassen?“, fragte ich. Die Augenbrauen von Horst waren hochgegangen. Eine Antwort gab es nicht. Der Rest des Seminars schwieg ebenfalls. Die Frage danach, warum man Kritik – die Kritik von Biermann – nicht aushalten kann, schien einen wunden Punkt zu berühren.
Drei Tage später wurde ich zum SED-Parteisekretär der Sektion Wirtschaftswissenschaften bestellt. Meine simple Frage im Seminar hatte ein Nachspiel. Im Gespräch mit dem Funktionär wurde sie plötzlich zur Bewährungsprobe. Mein Rauswurf aus der Uni hing in der Luft. Ich war angespannt. Mein Vater setzte mir heftig zu. „Ich sage dir schon seit Langem, dass du Gefahr läufst, mit deinem Querulantentum alles zu versauen. Was ich mit meiner Hände Arbeit aufgebaut habe, das setzt du leichtfertig aufs Spiel. Für so einen bescheuerten Liedermacher gefährdest du das Glück der ganzen Familie. Das ist unverantwortlich!“
Er hatte das Recht, wütend auf mich zu sein. Meine Entscheidung, meine eigene Meinung sagen zu wollen, hatte direkte Konsequenzen für sein Leben. Das war nicht meine Absicht, aber unvermeidlich. Dennoch. Ich wollte auch mir treu bleiben können. Das Dilemma war perfekt. Meine Mutter machte es nicht besser. „Was soll denn nun werden? Es hat doch sowieso keinen Sinn, sich anzulegen. Du musst jetzt mal klein beigeben.“ Mir wurde mehr als mulmig zumute. Was tat ich meinen Eltern an? War Wolf Biermann nun wirklich so wichtig für die DDR? Und war die Möglichkeit, meine Meinung zu dem Rauswurf sagen zu dürfen, wirklich wichtiger als meine berufliche Zukunft und die meines Vaters? Wie konnte ich so leichtsinnig sein? Hatte ich das wirklich alles gut überlegt? Die Sorge um das vorzeitige Ende meines Studiums war ernst zu nehmen.
Der Parteisekretär hatte mir im Gespräch eine Aktennotiz zum Seminar vorgelesen. Ich hätte die Ausbürgerung Biermanns als eine verfeinerte stalinistische Methode bezeichnet und von einer Diktatur des Politbüros gesprochen. Ich bestritt, diese Äußerungen so getan zu haben, und erklärte, missverstanden worden zu sein. Er forderte mich auf, die Missverständnisse in einer Stellungnahme auszuräumen. In drei Tagen sollte sie auf seinem Schreibtisch liegen. Ich setzte mich in den Lesesaal im 25. Stock vor ein weißes Blatt Papier und überlegte. Uta, meine Kommilitonin, saß am Tisch gegenüber. Jeder im Seminar wusste, dass ich zum Sekretär beordert worden war. Wir diskutierten leise über die Stellungnahme. „Pass auf, dass sie dir nichts falsch auslegen können“, warnte sie. Die Argumentationslinie im Brief stellte hohe Anforderungen. Ich wollte nicht, dass sie mich als „Feind des Sozialismus“ abstempeln konnten. Ein Teil von mir wollte kämpfen um meinen Platz in der sozialistischen DDR. Ich wollte ihnen zeigen, dass man auch ein kritischer Sozialist sein kann. Dass die DDR solche Kritiker unbedingt braucht für ihre Weiterentwicklung. Ein anderer Teil von mir wollte aber unbedingt, dass ich meine Meinung offen äußern kann. Ich wollte mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Biermanns Kritik an der DDR befürwortete. Ich wollte meine Ablehnung der Ausbürgerung nicht zurücknehmen.
Diesen dreiseitigen Brief heute zu lesen setzt viele Emotionen frei. Ich bin erstaunt über mich, weil er zeigt, wie sehr ich bereit war, mich zu verbiegen, mich den Umständen der Situation anzupassen. Es ist ein ähnliches Gefühl, das einen beschleicht, wenn ein altes Jugendfoto mit großem Abstand auftaucht und man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt: „Oh Gott, wie sahen wir damals aus!“ Mit diesem Brief kann ich besichtigen, wie ich damals gedacht habe, wie ich lavierte und taktierte, um an der Uni zu bleiben. Am 29. November 1976 schrieb ich unter anderem:
„… Ich bin der Meinung, man müsste die Aberkennung der Staatsbürgerschaft des DDR-Bürgers Wolf Biermann noch einmal überdenken. Unser sozialistischer Staat ist stark. Er ist fähig, Meinungen, wie die Biermanns, gelassen und nachdenkend hinzunehmen. Der real existierende Sozialismus hat es und darf es nicht nötig haben, auf diese administrative Weise Meinungswidersprüche zu klären. Biermann hat sich kritisch, scharf, verallgemeinernd über die DDR geäußert. Er zeigt richtig einige Schwächen in unserem Lande auf, begeht dabei aber den Fehler, sie zu scharf, verallgemeinert und unrealistisch darzustellen. In seinem Drang, Widersprüche aufzudecken, steigert er sich oft zu überspitzten Äußerungen. Seine Darstellungen werden demzufolge oft falsch und spiegeln nicht das real Existierende wider. Biermann tut dies alles durch bürgerliche Massenmedien. Diese versuchen, die Äußerungen Biermanns in ihrer Hetze gegen den Sozialismus und die DDR einzubeziehen. Ich distanziere mich von den hier genannten Fehlern Biermanns …“
Der Eiertanz, den ich hier versuchte – es den Herrschenden recht zu machen, ihre Sprache zu übernehmen und doch eine eigene Position zu behaupten –, er ist holprig. Die Worte, die ich wählte – „bürgerliche Medien“, die „Hetze gegen den Sozialismus“, das „real Existierende“ –, sie waren Worte der Anpassung an das, von dem ich glaubte, dass es die Partei hören wollte. Ich war mir sicher, dass die Erklärung funktionieren würde. Der Brief ist ein typisches Produkt der DDR. Ein Dokument des Anpassens und Widersprechens.
An jenem 5. Januar 1977 schließlich sollte es zu einer endgültigen Entscheidung kommen. Meine Frage nach dem „Warum können wir Biermanns Kritik nicht zulassen?“ war auch offiziell zur Bewährungsprobe geworden. In unserer Seminargruppe sollten wir nun darüber abstimmen, wie mit mir weiter zu verfahren sei. Die Partei allein wollte das nicht entscheiden, das hätte zu sehr nach Willkür ausgesehen. So sollten nun eben meine Kommilitonen ran. So, „demokratisch“ abgestimmt, wäre ein für die Partei wünschenswertes Ergebnis besser vermittelbar. Die Studenten selbst fänden mich dann nicht mehr tragbar. Das wäre das stärkere Argument, das auch in die restliche Studentenschaft überzeugender hineinstrahlen würde.
Ich hatte kein Problem mit einer Abstimmung, ich fühlte mich sicher im Seminar. Wir waren schließlich eine ganz entspannte Gruppe. Keine Karrieristen und Parteiideologen. Wir alle wollten einen ordentlichen Beruf, Spaß haben und unser Ding machen. Irgendwo eine halbwegs sinnvolle Arbeit finden, in einem Kombinat, und mit Freunden und Familie leben. Wir hatten uns alle durch unsere ersten zwei Semester gewühlt und immer auch den Widerspruch zwischen Theorie und Praxis sozialistischer Wirtschaftsführung bemerkt. Roland Tix, der FDJ-Sekretär, der eigentlich auf eine sanfte Art seine sozialistische Überzeugung lebte. Kein 150-Prozentiger, kein Antreiber. Petra, die schon verheiratet an die Uni kam und immer für alle Diskussionen offen war. Hans-Jürgen, den wir den „Dicken“ nannten, der öfter mal erzählte, dass sein Vater in einem volkseigenen Betrieb eine leitende Stellung hatte. Günter, der ein klares Ziel hatte: einen Abschluss machen und Geld verdienen für sich und die Familie. Er hatte die Karriere im Blick, nicht zuletzt, weil seine Frau schon mit dem zweiten Kind schwanger war. Fred, der vieles mit maoistischen Theorien verglich, weil er China einfach gut fand und so auch hin und wieder mal den Seminarleitern widersprach. Und Ulli, der lockere Typ mit blonden langen Haaren, der alles ganz entspannt sah.
Wir saßen öfter abends in der Kneipe zusammen, so auch zwei Abende vor der Abstimmung. Es war wie immer. Wir diskutierten auch beim Bier über ein paar schwer zu verstehende Mathe-Modelle für die Wirtschaft, die wir am Tage gelernt hatten. Wir alberten über einen Professor. Karl-Heinz brachte das Gespräch auf Biermann. „Du hast schon recht, Roland. Was im Neuen Deutschland steht, das ist nicht das, was man im West-Fernsehen sehen konnte.“ Die Runde nickte. Die Gedanken wanderten kurz zur Abstimmung. „Mach dir keine Sorgen, Roland, wir stehen zu dir. Das wird schon.“ Meine Erklärung vom November hatten die Kommilitonen ja gelesen. „Damit hast du dich doch gut behauptet. Das ist alles nur reine Formsache.“ 15 Leute waren wir in der Seminargruppe. An dem Abend waren wir uns einig. Ich fühlte mich aufgehoben.
„Hier liegt eines der besten Bücher über den Alltag in der DDR vor.“
„Jahn zeigt sich in seinem Buch als kluger, auch selbstkritischer Analytiker. ›Wie Angepassten‹ ist ein wichtiger Diskussionsbeitrag zum längst nicht abgeschlossenen Thema ›Leben in der DDR‹.“
„Roland Jahn hat ein Buch geschrieben gegen das Vergessen, gegen das Verdrängen und gegen das Schweigen ohne moralische Abrechnung.“
„Dieses Buch ist für alle, die sich ihrer eigenen Biografie in der DDR nochmal vergewissern wollen, die noch keinen Haken drangesetzt haben. (...) Es ist ein Buch für alle, die neben Stasi-Debatten und Ostalgie noch mehr wissen wollen über Handeln und Schweigen in diesem Staat.“
„Groß ist das Buch trotzdem. Weil es ohne Schaum vorm Mund gerade jüngeren Menschen einen guten Einblick in das gibt, was die DDR gewesen ist: autoritär fürsorglich, bei Bedarf gemein und im Ernstfall ein Unrechtsstaat.“
„Jahn (...) schreibt mild und versöhnlich. Und bekennt, selbst schwach gewesen zu sein.“
„Das sehr ehrliche Buch ist eine Reflexion in elf Kapiteln.“
»Das bemerkenswerte Sachbuch ist eine kritische Wiederbegegnung mit einem Land, das nach 40 Jahren Existenz von der Bildfläche verschwand und zugleich eine Einladung, sich dem Gespräch zu stellen. (...) Verstehen und nicht vorverurteilen – dafür wirbt Roland Jahn in seinem über die Zeit hinaus wirkenden, ehrlich-kritischen ›Plädoyer für das Erzählen‹.«
„Roland Jahn hat ein kluges Buch geschrieben, ein unbequemes dazu.“
„Dieses Buch gewährt einen tiefen Einblick in den Alltag der Diktatur. Nach 172 Seiten hat man die DDR verstanden.“
„Dieses Buch gewährt einen tiefen Einblick in den Alltag der Diktatur. Nach 172 Seiten hat man die DDR verstanden.“
„Sein Buch ist mehr als nur ein wichtiges Stück DDR-Erinnerungsliteratur - es ist vor allem ein beklemmender Bericht zu der Frage, warum Unrechtsstaaten oft so erschreckend gut und lange funktionieren.“
„Nach der Lektüre kann sich jeder westdeutsche Leser selbst fragen, wie er sich wohl verhalten hätte.“
„Es ist eine neue Form, DDR-Geschichte zu erzählen. Das Buch ist daher vor allem Lesern zu empfehlen, die sich bisher gescheut haben, ihre DDR Vergangenheit (selbstkritisch) zu erinnern, denn es erzählt uns von der Anpassung als evolutionäre Notwendigkeit und Überlebensstrategie in der DDR.“
„Entstanden ist ein gutes, ein notwendiges Buch, das zum besseren Verständnis zwischen Ost- und Westdeutschen beitragen kann.“
„Ein Stück Aufklärung.“
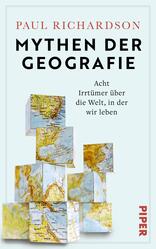



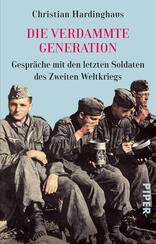





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.