
Wir müssen über Kevin reden — Inhalt
Kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag richtet Kevin in der Schule ein Blutbad an. Innerhalb weniger Stunden ist das Leben seiner Familie nicht mehr, wie es war. – Lionel Shriver erzählt aus der Sicht einer Mutter, die sich auf schmerzhafte und ehrliche Weise mit Schuld und Verantwortung, mit Liebe und Verlust auseinandersetzt. Hätte sie ihr Kind mehr lieben sollen? Hätte sie das Unglück verhindern können? Ein höchst aktueller Roman von erschütternder Klarheit und stilistischer Brillanz.
Leseprobe zu „Wir müssen über Kevin reden“
8.November 2000
Lieber Franklin,
ich bin nicht sicher, warum ein unwesentliches Ereignis heute nachmittag mich bewogen hat, dir zu schreiben. Aber seit wir getrennt sind, vermisse ich wohl am meisten, daß ich dir beim Nachhausekommen nicht mehr die Kuriositäten des Tages erzählen kann – sie dir nicht mehr zu Füßen legen kann wie eine Katze Mäuse: anspruchslose kleine Gaben, die Paare sich darbieten, nachdem sie eben noch jeder für sich getrennte Felder beackert haben. Wenn du jetzt in meiner Küche sitzen und, so kurz vor dem Abendessen, eine Scheibe [...]
8.November 2000
Lieber Franklin,
ich bin nicht sicher, warum ein unwesentliches Ereignis heute nachmittag mich bewogen hat, dir zu schreiben. Aber seit wir getrennt sind, vermisse ich wohl am meisten, daß ich dir beim Nachhausekommen nicht mehr die Kuriositäten des Tages erzählen kann – sie dir nicht mehr zu Füßen legen kann wie eine Katze Mäuse: anspruchslose kleine Gaben, die Paare sich darbieten, nachdem sie eben noch jeder für sich getrennte Felder beackert haben. Wenn du jetzt in meiner Küche sitzen und, so kurz vor dem Abendessen, eine Scheibe Vollkornbrot dick mit grober Erdnußbutter bestreichen würdest, hätte ich meine Einkaufstüten noch gar nicht abgestellt – die eine hinterläßt eine klare klebrige Spur –, und diese kleine Geschichte käme zum Vorschein, noch vor meinem Geschimpfe, daß es heute abend Pasta gibt und du bitte nicht das ganze Sandwich aufessen sollst.
Früher waren meine Berichte natürlich exotische Importe, aus Lissabon, aus Katmandu. Aber eigentlich hört keiner gern Geschichten aus der Fremde, und an deiner verräterischen Höflichkeit merkte ich gleich, daß du heimatliche Anekdoten lieber mochtest: vom absonderlichen Schlagabtausch mit dem Mann in der Maut-Bude an der George-Washington-Brücke, zum Beispiel. Solche lokalen Kleinodien festigten deinen Glauben, daß meine Fernreisen eigentlich Schummelei waren. Meinen Souvenirs – einer Packung altbackener belgischer Waffeln oder dem britischen Wort für Stuß „Codswallop!“ – dichtete ich magische Kräfte an, allein weil sie von so weit her stammten. Wie bei diesem Krimskrams, den sich Japaner schenken –in einer Schachtel in einer Tüte in noch einer Schachtel in noch einer Tüte –, war das Glanzvolle meiner ausländischen Mitbringsel eigentlich reine Verpackungskunst. Dagegen ist es eine beträchtliche Leistung, im Alltagsmüll des Allerweltsstaats New York herumzustochern und dem Besuch des Grand-Union-Supermarkts in Nyack eine gewisse Pikanterie abzugewinnen.
Was genau der Ort ist, an dem meine Geschichte spielt. Ich begreife anscheinend endlich, was du mir immer beibringen wolltest, nämlich daß mein eigenes Land so exotisch und sogar so gefährlich ist wie Algerien. Ich war in dem Gang mit Butter, Käse, Eiern und brauchte nicht viel; wieso auch. Ich esse keine Pasta mehr, weil du nicht mehr den Großteil der Schüssel verputzt. Mir fehlt dein Appetit.
Es fällt mir immer noch schwer, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Man sollte annehmen, daß ich in einem Land, dem es notorisch an Geschichtssinn mangelt – wie die Europäer behaupten –, von der berühmt-berüchtigten amerikanischen Amnesie profitieren könnte. Weit gefehlt. Niemand in dieser „Gemeinde“ läßt Anzeichen von Vergessen erkennen, nicht – auf den Tag genau – nach einem Jahr und acht Monaten. Also muß ich immer noch allen Mut zusammennehmen, wenn mir die Vorräte ausgehen. Oh, für die Verkäufer im 7-Eleven in der Hopewell Street bin ich keine Sensation mehr, und ich kann dort, ohne beglotzt zu werden, Milch holen. Aber in unserem alten Grand-Union-Supermarkt bleibt es beim Spießrutenlauf.
Dort fühle ich mich immer wie eine Diebin. Deswegen halte ich mich kerzengerade, mache mich breit. Jetzt weiß ich, was „den Kopf hoch tragen“ heißt, und manchmal staune ich, wieviel innere Verwandlung ein aufrechter Gang auslösen kann. Wenn mein Körper stolz dasteht, fühle ich mich einen Deut weniger gedemütigt.
Ich überlegte, ob ich mittelgroße oder große Eier nehmen sollte, und blickte zum Joghurt. Ein paar Meter vor mir glänzte das fusselige schwarze Haar einer Kundin am Ansatz einen Fingerbreit weiß, und nur die Enden waren noch lockig: eine herausgewachsene Dauerwelle. Das lavendelfarbene Kostüm war vielleicht einmal schick gewesen, doch jetzt schnitt die Bluse unterm Arm ein, und das Schößchen betonte die breiten Hüften. Das Ganze verdiente, aufgebügelt zu werden, und auf den gepolsterten Schultern verlief ein verblichener Strich, der Abruck vom Drahtkleiderbügel. Ein Fundstück aus den hinteren Regionen des Kleiderschranks, vermutete ich – weil alles übrige schmutzig oder auf dem Fußboden gelandet war. Als der Kopf der Frau sich zum Weichkäse neigte, entdeckte ich ein Doppelkinn.
Versuch nicht zu raten; nach dieser Beschreibung kämst du nie drauf. Früher war sie geradezu zwanghaft adrett, immer Hochglanz, wie ein professionell verpacktes Geschenk. Obwohl die Vorstellung von abgemagerten Hinterbliebenen romantischer sein mag, kann man mit Pralinen offenbar ebenso wirkungsvoll trauern wie mit Leitungswasser. Außerdem halten sich manche Frauen weniger deshalb rank und schlank, weil sie ihren Ehemann beglücken wollen, sondern weil sie mit ihrer Tochter konkurrieren, und dank uns fehlt ihr dieser Ansporn ja nun.
Es war Mary Woolford. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich konnte ihr nicht gegenübertreten. Ich machte kehrt. Mit klammen Händen griff ich den Eierkarton und prüfte, ob die Eier heil waren. Ich setzte die Miene einer Kundin auf, der gerade etwas aus dem übernächsten Gang eingefallen war, und packte die Eier, ohne mich umzudrehen, in den Kindersitz des Einkaufswagens. Trat mit gekonntem Täuschungsmanöver den Rückzug an. Den Einkaufswagen ließ ich stehen, weil die Räder quietschten. In der Suppenabteilung atmete ich auf.
Ich hätte darauf gefaßt sein sollen, und häufig bin ich es – gewappnet, gewarnt, oft grundlos, wie sich herausstellt. Aber ich kann nicht für jede blöde Besorgung in voller Rüstung aus dem Haus gehen, und außerdem, wie soll Mary mir jetzt noch schaden? Sie hat schon alles versucht; sie hat mich vor Gericht gebracht. Dennoch war ich machtlos gegen mein Herzklopfen, und zurück zu Butter, Käse, Eiern konnte ich auch nicht, dabei hatte ich den bestickten ägyptischen Beutel mit meinem Portemonnaie im Einkaufswagen gelassen.
Das war der einzige Grund, warum ich den Grand Union nicht auf der Stelle verließ. Ich mußte zu meiner Tasche zurück, und deshalb drückte ich mich vor Campbell’s Spargel und Käse herum, wobei mir durch den Kopf ging, wie entsetzt Warhol über das neue Design wäre.
Bei meiner Rückkehr war die Luft rein, und ich schnappte mir meinen Wagen, ganz die vielbeschäftigte Karrierefrau, die in Null Komma nichts ihre Hausfrauenpflichten erledigt. Eine vertraute Rolle, sollte man meinen. Aber ich habe mich schon lange nicht mehr so gesehen; ich war mir sicher, daß die Leute vor mir an der Kasse meine Ungeduld nicht als typische Zweitverdiener-Hektik empfanden – Zeit ist Geld –, sondern als panisches Fluchtverhalten.
Als ich mein Lebensmittel-Sammelsurium aufs Band stellte, klebte der Eierkarton, worauf die Kassiererin ihn öffnete. Aha. Mary Woolford hatte mich also entdeckt.
„Volltreffer!“ rief das Mädchen. „Ich lasse Ihnen eine andere Packung holen.“
Ich hielt sie davon ab. „Nein, nein“, sagte ich. „Ich hab’s eilig. Ich nehme sie so.“
„Aber sie sind total –“
„Ich nehme sie so!“ In diesem Land setzt man seinen Willen am besten durch, wenn man nicht-ganz-richtig-im-Kopf mimt. Nachdem sie das Etikett mit einem Kleenex gesäubert hatte, scannte sie die Eierpackung ein und wischte sich dann augenrollend die Hände an dem Papiertuch ab.
„Khatchadourian“, sagte das Mädchen überdeutlich, als ich ihr meine Kundenkarte reichte. Sie sprach so laut, als richtete sie sich an die ganze Schlange. Es war spätnachmittags, die beste Schicht für jobbende Schüler; das Mädchen, etwa siebzehn, hätte eine von Kevins Klassenkameradinnen sein können. Wobei es in dieser Gegend sicher ein halbes Dutzend Highschools gibt, und vielleicht war ihre Familie ja gerade erst aus Kalifornien hergezogen. Doch ihre Augen sprachen dagegen. Sie fixierte mich mit einem harten Blick. „Das ist ein ungewöhnlicher Name.“
Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich habe es so satt. Natürlich schäme ich mich. Ich bin nur schon völlig erschöpft vom Schämen, überall ganz klebrig davon, wie mit Eiweiß überzogen. Scham ist ein Gefühl, das zu nichts führt. „Ich bin die einzige Khatchadourian in New York State“, sagte ich herausfordernd und riß ihr die Karte weg. Sie warf die Eier in eine Einkaufstüte, wo sie noch ein bißchen mehr ausliefen.
Jetzt bin ich also zu Hause – wenn man es so nennen will. Natürlich warst du nie hier, deshalb beschreibe ich es für dich.
Du wärst entsetzt. Nicht nur, weil ich in Gladstone geblieben bin, nachdem ich mich so gewehrt hatte, überhaupt in einen Vorort zu ziehen. Aber ich wollte Kevin noch mit dem Auto erreichen können. Außerdem – sosehr ich mich nach Anonymität sehne, ich möchte nicht, daß meine Nachbarn vergessen, wer ich bin; ich will vergessen, aber keine Stadt der Welt würde mir das ermöglichen. Dies ist der einzige Ort, wo die Verstrickungen meines Lebens restlos zu spüren sind, und heute ist mir weniger wichtig, daß man mich mag, als daß man mich versteht.
Mir blieb, nachdem die Rechtsanwälte bezahlt waren, genug Geld, um mir etwas Kleines kaufen zu können, doch das Provisorische eines Mietverhältnisses paßte mir. Zudem entsprach dieses zwei-etagige Spielzeugreihenhaus stimmungsmäßig meiner Existenz. Oh, du wärst fassungslos; die jämmerlichen Preßspanschränke verhöhnen das Motto deines Vaters: „Das Material ist alles.“ Aber genau dieses Unsolide mag ich.
Hier ist alles riskant. Die steile Treppe zum zweiten Stock hat kein Geländer; nach drei Gläsern Wein bekomme ich beim Aufstieg ins Bett Höhenangst. Die Fußböden knarren, und die Fensterrahmen sind undicht; das Ganze strahlt eine Brüchigkeit und Unsicherheit aus, als könnte die gesamte Konstruktion plötzlich nachgeben und sich in nichts auflösen wie eine schlechte Idee. Unten flackern winzige Halogenlampen an rostigen Kleiderbügeln, die an einem Elektrodraht unter der Decke schaukeln, und das zittrige Licht unterstützt mein neues Lebensgefühl – mal an, mal aus. Aus meinem einzigen Telefonstecker hängen die Eingeweide heraus; meine ungewisse Verbindung zur Außenwelt baumelt an zwei schlecht gelöteten Drähten, die manchmal kurzschließen. Obwohl der Vermieter mir einen richtigen Herd versprochen hat, stört mich die Kochplatte mit dem defekten Schalter nicht. Oft fällt mir die Klinke der Haustür in die Hand. Bis jetzt habe ich sie immer wieder festmachen können, doch der bloße Klinkenstumpf erinnert mich an meine Mutter: unfähig, das Haus zu verlassen.
Außerdem habe ich festgestellt, daß die Energieversorgung meines Häuschens schnell an ihre Grenzen stößt. Die Heizung ist schwach, Wärme steigt wie schlechter Atem von den Heizkörpern auf, und schon Anfang November habe ich die Thermostate voll aufgedreht. Beim Duschen verbrauche ich das ganze heiße Wasser und kein kaltes; dann ist es gerade so warm, daß ich nicht zittere, doch das Wissen, daß es keine Reserven gibt, beunruhigt mich bei meinen Waschritualen. Der Kühlschrank läuft auf Hochtouren, dennoch hält die Milch nur drei Tage.
Die Farbgestaltung hat etwas Unechtes, Spöttisches, das sich durchaus passend anfühlt. Unten ist der Anstrich grell gelb, wie mit Buntstiften gemalt – das Weiß darunter ist an manchen Stellen sichtbar. Oben in meinem Schlafzimmer sind die Wände laienhaft türkis gekleckst, wie von Vorschulkindern. Dieses wacklige kleine Haus – es fühlt sich nicht ganz real an, Franklin. Ich mich auch nicht.
Doch ich hoffe, du bedauerst mich nicht; das will ich nicht. Ich hätte etwas Feineres finden können, wenn ich gewollt hätte. Irgendwie gefällt es mir hier. Es ist unernst, wie Spielzeug. Ich wohne in einem Puppenhaus. Selbst die Möbel haben falsche Proportionen. Die Eßtischplatte reicht mir bis zur Brust, so daß ich mich minderjährig fühle, und der kleine Tisch im Schlafzimmer, auf dem dieser Laptop steht, ist zum Schreiben zu niedrig – man könnte daran Kindergartenkindern Kokosplätzchen und Ananassaft servieren.
Vielleicht erklärt diese zusammengeschusterte, jugendliche Atmosphäre, warum ich gestern bei der Präsidentschaftswahl nicht gewählt habe. Ich habe es einfach vergessen. Alles um mich herum scheint weit entfernt. Und anstatt meiner Entwurzelung einen soliden Gegenpol zu bieten, ist das Land mir in die Gefilde des Surrealen gefolgt. Die Wählerstimmen sind ausgezählt. Aber wie in einer Geschichte von Kafka scheint keiner zu wissen, wer gewonnen hat.
Nun stehe ich hier mit dieser Packung Eier – vielmehr mit dem, was davon übrig ist. Ich habe alles in eine Schüssel gekippt und die Schalen herausgefischt. Wenn du hier wärst, würde ich uns eine schöne Frittata backen, mit gewürfelten Kartoffeln, frischem Kreuzkümmel, und – unerläßlich – einem Teelöffel Zucker. Allein kippe ich alles in eine Pfanne, rühre und stochere trotzig. Aber immerhin, ich esse. Marys Geste war übrigens, auf eine etwas unausgereifte Weise, ziemlich elegant.
Essen ekelte mich anfangs. Zu Besuch bei meiner Mutter in Racine wurde mir vom bloßen Anblick ihrer gefüllten dolma ganz übel, und das, obwohl sie den ganzen Tag Weinblätter blanchiert und die Lamm-Reis-Füllung zu ordentlichen Päckchen gerollt hatte; ich erinnerte sie daran, daß man sie einfrieren konnte. Wenn ich in Manhattan, auf dem Weg zu Harveys Anwaltspraxis, am Deli in der 57. Straße vorbeikam, drehte sich mir beim Pfeffergeruch des Pastrami-Fetts der Magen um. Doch die Übelkeit verging, und dann fehlte sie mir. Als ich nach vier, fünf Monaten Hunger bekam – Heißhunger –, fand ich den Appetit unpassend. Also spielte ich weiter die Frau, die jedes Interesse am Essen verloren hatte.
Doch nach etwa einem Jahr mußte ich zugeben, daß dieses Theater sich nicht lohnte. Niemanden kümmerte es, wenn ich abmagerte. Worauf wartete ich – daß du meinen Brustkorb mit deinen Bärenpranken umfassen, mich hochheben und streng mahnen würdest, die heimliche Freude einer jeden westlichen Frau: „Du bist zu dünn“?
Also esse ich jeden Morgen ein Croissant zu meinem Kaffee und tupfe jeden Krümel mit meinem angefeuchteten Zeigefinger auf. Methodisches Kohlhacken füllt einen Teil der langen Abende. Einfach abgesagt habe ich die paar Einladungen, die manchmal noch mein Telefon aufschrillen lassen, meist von ausländischen Freunden, die ab und zu eine E-Mail schicken, die ich aber seit Jahren nicht gesehen habe.
Abgesagt erst recht, wenn sie nicht Bescheid wissen, und das erkenne ich immer an der Stimme; Unwissende krakeelen fröhlich drauflos, während Eingeweihte stottern und die Stimme dämpfen wie in der Kirche. Ich will ganz sicher nicht die Geschichte erzählen. Ich will auch nicht das stumme Mitgefühl von Freunden, die gar nicht wissen, was sie sagen sollen, und es mir überlassen, mein Herz auszuschütten und Konversation zu machen. Aber der eigentliche Grund für meine Standard-Ausrede, ich sei zu „beschäftigt“, ist meine panische Angst, daß wir nur einen Salat bestellen und uns schon um halb neun oder neun die Rechnung bringen lassen, und dann komme ich zurück in mein Minihaus und habe nichts mehr kleinzuhacken.
Eigentlich lachhaft, daß ich, die so lange für A Wing and a Prayer unterwegs war – jeden Abend ein anderes Restaurant, Thai oder Spanisch sprechende Kellner, marinierter Fisch oder Hund auf der Speisekarte –, inzwischen so fixiert auf diese Routine bin. Schrecklich, ich bin wie meine Mutter. Aber ich brauche diese exakte Abfolge (ein paar Stückchen Käse oder sechs, sieben Oliven; Hähnchenbrust, Gemüsepfanne oder Omelett; ein einziger Vanillekeks; genau eine halbe Flasche Wein), als würde ich auf dem Schwebebalken balancieren – ein falscher Schritt, und ich stürze ab. Erbsen sind von der Speisekarte gestrichen, weil die Vorbereitung zu mühelos ist.
Jedenfalls weiß ich trotz unserer Entfremdung, daß du dich sorgst, ob ich genug esse. Das hast du immer getan. Dank Mary Woolfords kläglicher Rache bin ich heute abend reich verpflegt. Nicht alle fixen Ideen unserer Nachbarn hatten einen solch positiven Nebeneffekt.
Als ich noch in unserem neureichen Ranch-Haus in der Palisades Parade wohnte, kippten sie literweise blutrote Farbe über die Vorderfront (ob es dir paßt oder nicht, Franklin, eine Ranch – genau das war’s). Über die Fenster, die Haustür. Sie kamen in der Nacht, und als ich am nächsten Morgen erwachte, war die Farbe fast trocken. Damals, kaum einen Monat nach – wie soll ich diesen Donnerstag nennen? –, dachte ich, daß mich nun nichts mehr entsetzen oder verletzen könnte. Wenn man so am Boden zerstört ist, redet man sich offenbar ein, daß diese totale Zerstörung einen nun beschützt.
Als ich aus der Küche um die Ecke ins Wohnzimmer bog, begriff ich, daß all das Stuß war. Ich schnappte nach Luft. Die Sonne schien durch die Fenster – durch jene ohne Farbstreifen. Sie schien auch durch die Stellen, wo die Farbe dünn war, und warf rotes Licht auf die fast weißen Wände, wie in einem kitschigen chinesischen Restaurant.
Ich hatte immer die Angewohnheit – was du bewundert hast –, mich meinen Ängsten zu stellen, wobei diese Angewohnheit noch aus Zeiten stammte, als ich mich am meisten davor fürchtete, mich in einer fremden Stadt zu verlaufen – ein Kinderspiel. Was würde ich heute dafür geben, wenn ich mich in jene Tage zurückversetzen könnte, als ich noch keine Ahnung hatte, was mich erwartete (Kinderspiele, zum Beispiel). Dennoch, alte Gewohnheiten sind nicht totzukriegen, so daß ich mich nicht wieder unter die Decken unseres Betts verkroch. Ich beschloß, die Verwüstung zu besichtigen. Aber die Haustür ging nicht auf, die dicke rote Lackfarbe hatte sie versiegelt. Lackfarbe ist nicht wasserlöslich wie Binderfarbe. Und Lackfarbe ist teuer, Franklin. Sie hatten es sich etwas kosten lassen. Klar, in unserer alten Nachbarschaft mangelte es an allem Möglichen, aber sicher nicht an Geld.
Also ging ich im Morgenmantel durch die Seitentür vors Haus. Als ich sah, was die Nachbarn angerichtet hatten, fühlte ich, wie mein Gesicht wieder zu der „teilnahmslosen Maske“ wurde, die die New York Times in ihrem Prozeßbericht beschrieben hatte. Die Post hatte, weniger freundlich, meinen Gesichtsausdruck „trotzig“ genannt. Und unser Lokalanzeiger war noch weiter gegangen: „Aus Eva Khatchadourians versteinerter, unversöhnlicher Miene zu schließen, hatte ihr Sohn nichts Unerhörteres verbrochen, als einen Zopf in ein Tintenfaß zu tauchen.“ (Ich gebe zu, daß ich mich im Gerichtssaal um Haltung bemühte, daß ich blinzelte und mir von innen in die Wangen biß; ich weiß noch, daß ich mir deine Devise für harte Männer vor Augen hielt: „Zeig nie, daß du schwitzt.“ Aber Franklin, „trotzig“? Ich habe mich bemüht, nicht zu weinen.)
Der Effekt war durchaus grandios, wenn man Sensationen mag – was ich gewiß nicht mehr tue. Das Haus sah aus, als hätte ihm jemand die Kehle durchgeschlitzt. Wilde, triefende Formen bedeckten die Wände, in einem sorgfältig ausgewählten Farbton – tief, satt und üppig, eine Spur Blau, wie extra gemischt. Wenn die Übeltäter die Farbe hatten anrühren lassen, könnte die Polizei sie ausfindig machen, dachte ich benommen.
Nur würde ich freiwillig kein Polizeirevier mehr betreten.
Mein Kimono, der, den du mir zu unserem ersten Hochzeitstag 1980 geschenkt hast, war ziemlich dünn. Er ist für Sommerwetter geeignet, das einzige Kleidungsstück, das ich von dir habe, und ich wollte nichts anderes suchen. Ich habe soviel weggeworfen, aber nichts, was du mir geschenkt oder hinterlassen hast. Ich gebe zu, daß es eigentlich eine Qual bedeutet, diese Dinge als Talisman aufzubewahren. Schon deshalb behalte ich sie. Diese Typen, die mir mit ihrem therapeutischen Anspruch auf die Nerven gehen, würden behaupten, meine vollgestopften Schränke seien nicht „gesund“. Ich bitte doch, dabei zu differenzieren. Verglichen mit dem jämmerlichen, schmutzigen Schmerz, den Kevin, die Farbe, die Straf- und Zivilverfahren auslösten, ist dieser Schmerz heilsam. Die sechziger Jahre haben Heilsamkeit ziemlich in Verruf gebracht – aber inzwischen halte ich sie für ein rares Gut.
Tatsache ist, daß ich in meiner blaßblauen Baumwolle und angesichts des ungefragten Action Painting meiner Nachbarn zu frieren begann. Es war Mai, aber kühl, und der Wind pfiff. Früher hätte ich angenommen, daß nach einer persönlichen Apokalypse die kleinen Scherereien des Daseins praktisch verschwänden. Aber das stimmt nicht. Man fühlt noch Kälte, man rauft sich noch die Haare, wenn ein Päckchen in der Post verlorengeht, und man ärgert sich immer noch, wenn man bei Starbucks zu wenig Wechselgeld herausbekommt. Auch wenn es angesichts der Umstände unangebracht scheint, daß ich immer noch einen Pullover brauche oder einen Muff, oder daß ich mich wehre, wenn man mich um einen Dollar fünfzig betrügt. Doch seit jenem Donnerstag ist mein ganzes Leben in ein solches Unangebrachtsein gehüllt, daß ich diese vorübergehenden Mißlichkeiten geradezu tröstlich finde, Zeichen einer überlebenden Normalität. Für die Jahreszeit unangemessen bekleidet, oder schimpfend, daß in einem viehmarktgroßen Wal-Mart kein einziges Päckchen Streichhölzer aufzutreiben ist, schwelge ich in emotionalen Alltäglichkeiten.
Ich tappte wieder zur Seitentür und rätselte, wie die Frevler dieses Haus mit solcher Gründlichkeit attackieren konnten, während ich drinnen ahnungslos schlief. Ich schob es auf die hohe Dosis Beruhigungsmittel, die ich jede Nacht einnahm (kein Kommentar bitte, Franklin, ich weiß, daß du es nicht gut findest), bis ich begriff, daß ich mir die Szene ganz falsch vorstellte. Es geschah einen Monat danach, nicht einen Tag. Es hatte kein Toben und Heulen gegeben, keine Vermummten und keine Gewehre mit abgesägtem Lauf. Sie kamen klammheimlich. Nur das Zweigeknacken war zu hören gewesen, ein dumpfes Klatschen, als der Inhalt des ersten Eimers unsere polierte Mahagonitür traf und eine Farbwelle sich am Fenster brach, ein leises Rat-a-tat-tat der Spritzer, nicht lauter als starker Regen. Unser Haus war nicht im ersten Zorn mit Neonfarbe besprüht, sondern mit einem Haß übergossen worden, der so lange eingekocht war, bis er die Konsistenz und Würze einer französischen Soße hatte.
Du hättest darauf bestanden, daß wir jemanden bestellen, der alles saubermacht. Du hattest dieses uramerikanische Faible für Spezialfirmen – für jeden Zweck einen Experten –, und manchmal hast du zum reinen Vergnügen im dicken gelben Branchenbuch geblättert. „Farbentfernung: Blutroter Lack.“ Aber in der Zeitung hatte soviel darüber gestanden, wie reich wir waren, wie verwöhnt Kevin war. Ich gönnte Gladstone das Naserümpfen nicht: Seht ihr, sie läßt immer andere die Drecksarbeit für sich machen, zuerst der teure Rechtsanwalt und jetzt dies. Nein, sie durften Tag für Tag zuschauen, wie ich eigenhändig alles abkratzte und für die Ziegel ein Sandstrahlgerät auslieh. Eines Abends schaute ich nach meinem Tagewerk in den Spiegel – verschmierte Kleider, abgeknickte Fingernägel, gesprenkeltes Haar – und schrie auf. So hatte ich schon einmal ausgesehen.
Ein paar Spalten um die Tür glänzen vielleicht noch rot; in den Ritzen zwischen den pseudo-antiken Ziegeln schimmern noch ein paar Tropfen, an die ich mit der Leiter nicht herankam. Ich verkaufte das Haus. Nach dem Zivilprozeß mußte ich es.
Ich dachte, es wäre schwierig, die Immobilie loszuwerden. Abergläubische Käufer würden sicher zurückschrecken, wenn sie erfuhren, wem das Haus gehörte. Was nur bewies, wie wenig ich mein eigenes Land verstand. Du hast mir einmal vorgeworfen, daß ich meine ganze Neugier an „beschissene Dritte-Welt-Löcher“ vergeuden würde, während sich vor meiner Nase das mit Abstand außergewöhnlichste Reich in der Geschichte der Menschheit befände. Du hattest recht, Franklin. Es geht nichts über zu Hause.
Sobald die Immobilie inseriert war, kamen die Angebote. Nicht weil die Interessenten es nicht wußten. Sondern weil sie es wußten. Unser Haus brachte viel mehr, als es wert war – über 3 Millionen Dollar. In meiner Naivität hatte ich nicht begriffen, daß gerade sein fragwürdiger Ruhm den Marktwert steigerte. Während neureiche Käuferpaare unsere Vorratskammer inspizierten, stellten sie sich offenbar bereits den krönenden Augenblick ihrer Einweihungsparty vor.
(Kling-kling!) Alle mal herhören. Bevor ich mit euch anstoße – ihr werdet nicht glauben, von wem wir dieses Superhaus gekauft haben. Seid ihr bereit? Eva Khatchadourian … Schon mal gehört? Klar. Wohin sind wir gezogen? Gladstone! … Ja, genau die Khatchadourian, Pete, wie viele Khatchadourians kennst du denn? Mensch, bist du schwer von Begriff.
… Genau, „Kevin“. Irre, was? Mein Sohn Lawrence hat sein Zimmer. Hat versucht, mir letztens abends einen Streich zu spielen. Sagte, er müsse aufbleiben und Henry: Portrait eines Serienkillers gucken, weil „Kevin Ketchup“ in seinem Zimmer „spuken“ würde. Tut mir leid, sagte ich, Kevin Ketchup spukt ganz sicher nicht in deinem Schlafzimmer, weil der kleine miese Nichtsnutz noch quicklebendig im Jugendgefängnis in Upstate New York einsitzt. Wenn es nach mir ginge, hätte die Ratte den elektrischen Stuhl gekriegt … Nein, so schlimm wie Columbine war’s nicht. Wie viele waren’s noch, Honey? Zehn? Neun, aha, sieben Kinder und zwei Erwachsene. Die Lehrerin, die er umgelegt hat, war auch noch seine große Förderin oder so. Und ich weiß nicht, man kann nicht alles auf die Videos und Rockmusik schieben. Wir sind doch auch mit Rockmusik aufgewachsen, oder? Keiner von uns hat ’nen Rappel gekriegt und ist in der Highschool Amok gelaufen. Oder nimm Lawrence. Der Kleine liebt Horror im Fernsehen, egal, wie drastisch, er verzieht keine Miene. Aber als sein Kaninchen überfahren wurde? Da hat er eine Woche geweint. Der kennt doch den Unterschied.
Wir erziehen ihn, daß er Recht und Unrecht unterscheiden kann. Vielleicht ist es unfair, aber über die Eltern muß man sich schon wundern.
Eva
15. November 2000
Lieber Franklin,
du weißt, ich versuche immer höflich zu sein. Wenn meine Kollegen – du liest richtig, ich arbeite, und zwar gern, in einem Reisebüro in Nyack, du wirst es kaum glauben –, wenn sie sich also ereifern über die unverhältnismäßig hohe Stimmenzahl für Pat Buchanan in Palm Beach, warte ich geduldig, bis sie aufhören, und bin deshalb ein rarer Schatz: Ich bin im Büro die einzige, die jeden ausreden läßt. Auch wenn die Atmosphäre in diesem Land an Karneval erinnert – heiter, mit drastischen Meinungsäußerungen –, nehme ich an dieser Party nicht teil. Mir ist egal, wer Präsident ist.
Dennoch kann ich mir ausmalen, wie ich die vergangene Woche erlebt hätte, wenn nicht … Ich hätte für Gore gestimmt, du für Bush. Wir hätten vor der Wahl hitzige Diskussionen geführt, doch das jetzt – das –, oh es wäre wunderbar gewesen. Laut, gellend, Fäuste ballend und Türen knallend, ich mit ausgewählten Zitaten aus der New York Times, du mit Meinungen aus dem Wall Street Journal – und die ganze Zeit verkneifen wir uns ein Lächeln. Wie sehr ich es vermisse, mich über Bagatellen aufzuregen.
Vielleicht war es unaufrichtig von mir, zu Beginn meines letzten Briefs so zu tun, als ob ich am Ende eines Tages, wenn wir uns trafen, immer alles erzählte. Im Gegenteil, der Impuls, dir zu schreiben, rührt auch daher, daß mir der Kopf wegen all der kleinen Geschichten fast platzt, die ich dir nie erzählt habe.
Glaub nicht, daß ich meine Geheimnisse genossen habe. Sie haben mich gefangengenommen, umzingelt, und ich hätte dir für mein Leben gern mein Herz ausgeschüttet. Aber Franklin, du wolltest nichts hören. Ich glaube, du willst es immer noch nicht. Und vielleicht hätte ich damals hartnäckiger versuchen sollen, dich zum Zuhören zu zwingen, doch schon früh vertraten wir gegensätzliche Positionen. Für viele streitende Paare sind diese gegensätzlichen Positionen nicht klar umrissen, es gibt nur eine vage Trennlinie – eine Geschichte, ein undefinierbarer Groll, ein unsinniger Machtkampf, der sein Eigenleben entwickelt: unfaßbar. Wenn sich diese Paare versöhnen, trägt die Unwirklichkeit dieser Trennlinie zu ihrer eigenen Auflösung bei. Schau doch, sehe ich – voller Neid – sie feststellen, es steht nichts zwischen uns; keine dicke Luft mehr. Doch in unserem Fall war das Trennende nur allzu greifbar, und wenn es gerade nicht im Raum stand, konnte es jederzeit hereinschneien.
Unser Sohn. Der keine Anekdotensammlung ist, sondern eine einzige lange Geschichte. Und obwohl geborene Geschichtenerzähler natürlich anfangen, wo es anfängt, verkneife ich mir das. Ich muß noch weiter ausholen. So viele Geschichten sind bereits entschieden, bevor sie ihren Anfang nehmen.
Welcher Teufel ritt uns? Wir waren so glücklich! Warum setzten wir alles, was uns lieb war, auf diese eine, wahnsinnige Karte und spielten um ein Kind? Natürlich findest du schon die Fragestellung widernatürlich. Obwohl die Unfruchtbaren ein Recht darauf haben, sich einzureden, daß sie nicht viel verpassen, gehört es sich nicht, wenn man ein Baby hat, das Leben „vorher“ und „nachher“ gegeneinander abzuwägen. Ich ziehe dennoch, widerborstig wie ich bin, den verbotenen Vergleich. Ich besitze Phantasie, und ich bin gern wagemutig. Und ich wußte schon im vorhinein: Ich bin die Sorte Frau, die – wie schrecklich es auch sein mag – dazu fähig ist, selbst etwas so Unwiderrufliches wie einen anderen Menschen zu bereuen. Aber auch Kevin betrachtete die Existenz anderer Menschen nicht als unwiderruflich – oder?
Verzeih, aber erwarte nicht, daß ich mir das Thema verkneife. Ich finde vielleicht keine adäquate Bezeichnung für jenen Donnerstag. Die Katastrophe klingt wie aus der Zeitung; das Ereignis spielt das Geschehene bis an den Rand der Obszönität herunter; und der Tag, an dem unser Sohn einen Massenmord beging ist zu lang, stimmt’s? Wenn man darüber reden will. Und ich will darüber reden. Ich wache jeden Morgen mit seiner Tat auf und gehe jeden Abend mit ihr zu Bett. Sie ist ein schäbiger Ersatz für einen Ehemann.
Also habe ich mir das Hirn zermartert und mir wieder jene Monate in Erinnerung gerufen, in denen wir offiziell „unseren Entschluß“ faßten. Wir wohnten damals noch in meinem höhlenartigen Loft in Tribeca – umgeben von Homosexuellen, bindungslosen Künstlern, die du selbstbezogen schimpftest, und unverheirateten berufstätigen Paaren, die jeden Abend beim Mexikaner aßen und sich anschließend bis um drei im Limelight austobten. Kinder waren in jener Umgebung ähnlich rar wie der Fleckenkauz oder andere gefährdete Arten. Kein Wunder also, daß unsere Überlegungen etwas Künstliches, Abstraktes hatten. Wir setzten uns sogar einen Termin, um Himmels willen – meinen siebenunddreißigsten Geburtstag im August –, weil wir kein Kind wollten, das noch bei uns zu Hause wohnte, wenn wir über sechzig waren.
Sechzig! Wir! Damals ein Alter, so unfaßbar theoretisch wie das potentielle Baby. Dabei werde ich in fünf Jahren auch dieses fremde Territorium erreichen – es ist so simpel wie eine Fahrt mit dem Bus. 1999 machte ich einen Zeitensprung, obwohl mir mein Älterwerden weniger im Spiegel auffiel als an den Reaktionen anderer Leute. Als ich im Januar den Führerschein verlängerte, war der Beamte gar nicht erstaunt über meine vierundfünfzig. Ich war auf diesem Sektor verwöhnt, weißt du noch, ich bekam regelmäßig Komplimente, daß ich mindestens zehn Jahre jünger aussähe. Die Komplimente versiegten über Nacht. Einmal in Manhattan, kurz nach dem Donnerstag, machte mich ein Fahrkartenverkäufer der U-Bahn peinlicherweise darauf aufmerksam, daß ich mit über fünfundsechzig ein Recht auf Ermäßigung hätte.
Wir waren uns einig, daß die Elternfrage „die mit Abstand wichtigste Entscheidung war, die wir je gemeinsam treffen würden“. Doch wegen ihrer Tragweite wirkte die Entscheidung nie wirklich echt, sondern eher wie eine fixe Idee. Immer wenn einer von uns die Elternfrage anschnitt, kam ich mir wie eine Siebenjährige vor, die sich zu Weihnachten eine Babypuppe wünscht, die pinkeln kann.
Ich erinnere mich an eine Reihe von Gesprächen damals, die mit schöner Regelmäßigkeit entweder auf ein Dafür oder ein Dagegen hinausliefen. Das optimistischste war sicher jenes nach einem Sonntags-Lunch mit Brian und Louise am Riverside Drive. Sie luden nicht mehr zum Abendessen ein, weil das zu elterlicher Apartheid führte: Ein Elternteil spielte Erwachsensein bei Kalamata-Oliven und Cabernet, der andere jagte, badete und bettete diese beiden übermütigen kleinen Mädchen. Ich treffe mich lieber abends mit Leuten – man ist eindeutig ausgelassener –, aber ausgelassen war kein Adjektiv mehr, das ich in Zusammenhang mit diesem freundlichen, soliden Fernsehdrehbuchautor brachte, der seine eigene Pasta machte und dünne Petersilienpflänzchen im Balkonkasten goß.
Im Fahrstuhl nach unten wunderte ich mich: „Und er war mal ein richtiger Kokser.“
„Du klingst wehmütig“, stelltest du fest.
„Oh, er ist jetzt sicher glücklicher.“
Ich war mir nicht sicher. Damals fand ich Normalsein noch suspekt. In der Tat war es zusammen richtig „nett“ gewesen, was mich merkwürdig ratlos machte. Ich hatte die eichene Eßzimmergarnitur bewundert, die sie für einen Apfel und ein Ei bei einem Lagerverkauf in Upstate New York erstanden hatten, und du hattest dir mit einer Engelsgeduld von dem kleineren Mädchen ihre komplette Cabbage-Patch-Puppensammlung vorführen lassen, worüber ich nur staunte. Wir lobten überschwenglich den ausgefallenen Salat – in den achtziger Jahren waren Ziegenkäse und getrocknete Tomaten noch nicht passé.
Vor Jahren hatten wir beschlossen, daß du dich mit Brian nicht mehr über das Thema Ronald Reagan in die Haare kriegen würdest – deiner Ansicht nach ein gutmütiger Kerl, blitzgescheit und ein Finanzgenie, der unserer Nation ihren Stolz zurückgegeben hatte, für Brian ein gefährlicher Idiot, der das Land mit seinen Steuergeschenken an die Reichen in den Bankrott treiben würde. Wir blieben also bei den unverfänglichen Themen, während im Hintergrund in Erwachsenenlautstärke „Ebony and Ivory“ lief und ich mein Unbehagen unterdrückte, daß die kleinen Mädchen falsch mitsangen und immer wieder den gleichen Song dudelten. Du beklagtest, daß die New York Knicks es nicht in die Basketball-Playoffs geschafft hatten, und Brian tat dir zuliebe, als interessierte er sich für Sport. Wir bedauerten alle, daß bald die letzte Staffel von All in the Family laufen würde, waren uns aber einig, daß die Serie eigentlich ausgedient hatte. Den einzigen Konflikt des Nachmittags gab es anläßlich von M*A*S*H*, weil dieser Sendung ein ähnliches Schicksal drohte. Wohl wissend, daß Brian Alan Alda vergötterte, hast du ihn als „scheinheilige Schnarchnase“ verrissen.
Doch der Streit verlief bestürzend gutmütig. Brian war in bezug auf Israel auf einem Auge blind, und so war ich versucht, ganz ruhig etwas über „Juden-Nazis“ zu sagen, um dieses leutselige Treffen platzen zu lassen. Statt dessen fragte ich ihn nach dem Thema seines neuesten Drehbuchs, bekam aber keine Antwort, weil das ältere Mädchen sich ihr barbieblondes Haar mit Kaugummi verklebt hatte. Es gab ein langes Hin und Her über Lösungsmittel, dem Brian ein Ende setzte, indem er die Locke mit einem Küchenmesser absäbelte, was Louise etwas schockierte. Das war aber auch der einzige Aufruhr, ansonsten trank keiner zuviel und keiner war beleidigt; die Wohnung war nett, das Essen war nett, die Mädchen waren nett – nett, nett, nett.
Ich war selbst enttäuscht darüber, daß ich unser durchaus angenehmes Essen mit durchaus angenehmen Leuten ungenügend fand. Warum hätte ich lieber einen Krach gehabt? Waren die beiden Mädchen nicht absolut hinreißend, was machte es schon, wenn sie ständig dazwischenredeten und ich den ganzen Nachmittag keinen klaren Gedanken fassen konnte? War ich nicht mit dem Mann verheiratet, den ich liebte? Wieso wünschte sich dann etwas Böses in mir, daß Brian mir unter den Rock faßte, als wir zusammen die Schüsseln mit Häagen-Dazs-Eis aus der Küche holten? Rückblickend war es richtig, daß ich mich verurteilte. Nur ein paar Jahre später hätte ich bares Geld für eine normale, gutgelaunte Familienfeier gegeben, wo Kaugummi-in-die-Haare-Kleben das Schlimmste war, was die Kinder anstellten.
Du jedoch hast großspurig im Hauseingang verkündet: „Das war toll. Ich finde die beiden klasse. Wir müssen sie unbedingt bald einladen, wenn sie einen Babysitter finden.“
Ich hielt den Mund. Dir war jetzt nicht nach meiner Nörgelei, ob dieser Lunch nicht ein bißchen harmlos gewesen war; ob du nicht auch fandest, daß diese Vater-ist-der-Beste-Nummer ein bißchen schlicht und bieder und einfältig wirkte, wo Brian doch früher so ein Wahnsinnstyp gewesen war (endlich kann ich zugeben, daß ich vor deiner Zeit auf einer Party einen Gästezimmer-Quickie mit ihm abgezogen habe). Womöglich hast du genau das gleiche gefühlt wie ich, und dieses oberflächlich so erfolgreiche Treffen kam auch dir platt und abgeschmackt vor, doch anstelle eines anderen Modells, das man hätte anstreben können – wir wollten ja nicht gleich zu Koks greifen –, hast du einfach die Augen verschlossen. Diese Leute waren gut, und sie waren zu uns gut gewesen, und deshalb hatte es dir gut gefallen. Eine andere Logik machte Angst, beschwor den Geist einer unbenennbaren Größe, ohne die wir nicht leben, die wir aber auch nicht auf Wunsch herbeirufen konnten, am wenigsten, indem wir tugendhaft nach bewährtem Rezept handelten.
Du warst der Ansicht, Erlösung sei ein Willensakt. Du hast Leute verachtet (Leute wie mich), die immer ein Haar in der Suppe fanden. Du empfandest es als Charakterschwäche, sich nicht an den Dingen des einfachen Lebens zu erfreuen. Wählerische Esser, Hypochonder und Snobs, die über Filme wie Zeit der Zärtlichkeit – nur weil sie gerade „in“ waren – die Nase rümpften, hast du gehaßt. Nettes Essen, nette Wohnung, nette Leute – was wollte ich mehr? Außerdem fällt dir das gute Leben nicht in den Schoß. Freude ist harte Arbeit. Wenn du also mit einiger Mühe zu dem Ergebnis kamst, daß es bei Brian und Louise theoretisch schön gewesen war, mußte es auch de facto schön gewesen sein. Das einzige Indiz, daß der Nachmittag auch dich angestrengt hatte, war deine übertriebene Begeisterung.
Als wir durch die Drehtür am Riverside Drive kreiselten, waren meine Zweifel diffus und flüchtig. Später würden diese Gedanken zurückkehren und mich verfolgen. Doch ich konnte nicht ahnen, daß deine Neigung, diese störrische, verunglückte Erfahrung ordentlich zu verdrängen, wie jemand, der ein wirres Bündel Treibholz in einen festen Samsonite-Koffer stopft, daß diese bedenkliche Verwechslung des Ist mit dem Sollte-Sein – deine herzzerreißende Neigung, das, was du tatsächlich hattest, mit dem zu verwechseln, was du dringend wolltest –, daß dies alles so verheerende Folgen haben würde.
Ich schlug vor, zu Fuß nach Hause zu gehen. Wenn ich für A Wing and a Prayer unterwegs war, ging ich überallhin zu Fuß, es war mir in Fleisch und Blut übergegangen.
„Es sind sicher sechs, sieben Meilen nach Tribeca“, gabst du zurück.
„Du nimmst ein Taxi, um dann vor dem Spiel der New York Knicks siebentausendfünfhundertmal seilzuspringen, aber ein ordentlicher Spaziergang, der dich dahin bringt, wohin du willst, ist dir zu anstrengend.“
„Zum Teufel, ja. Alles zu seiner Zeit.“ Deine Macken waren hinreißend, solange sie sich auf deine Fitneß oder deine Hemden-Faltmethode beschränkten. Aber in einem ernsteren Kontext, Franklin, war ich weniger begeistert. Ordnungsliebe führt mit der Zeit zu Angepaßtheit.
Also drohte ich, allein nach Hause zu gehen – damit kriegte ich dich rum; drei Tage später sollte ich nach Schweden fahren, und du warst hungrig nach meiner Gesellschaft. Wir tobten den Fußweg hinunter in den Riverside Park, wo die Gingko-Bäume blühten und die leicht abfallende Wiese voller Magersüchtiger war, die Tai Chi übten. Aufgekratzt, weil ich vor meinen eigenen Freunden flüchtete, kam ich ins Stolpern.
„Du bist betrunken“, sagtest du.
„Zwei Gläser!“
Dein Blick wurde streng. „Am hellichten Tage.“
„Drei wären besser gewesen“, sagte ich bissig. Abgesehen vom Fernsehen war bei dir jedes Vergnügen rationiert, und ich wünschte mir manchmal, daß du dich wieder gehenlassen würdest, wie damals, als du um mich warbst und mit zwei Pinot Noir, einem Sechserpack St. Pauli Girl und einem geilen Blick vor meiner Tür auftauchtest – was alles nicht danach aussah, als wolltest du warten, bis wir uns die Zähne mit Zahnseide gesäubert hatten.
„Wenn du Brians Kinder siehst“, begann ich förmlich, „möchtest du dann auch welche?“
„Mmm, vielleicht. Sie sind niedlich. Aber ich muß die Racker ja auch nicht in die Falle schaffen, wenn sie einen Keks wollen, ihren Lieblingshasen und fünf Millionen Gläser Wasser.“
Ich verstand. Unsere Dialoge folgten Spielregeln, und dein Auftakt war unverbindlich. Einer von uns übernahm immer die Rolle des Spielverderbers, und das letzte Mal hatte ich die Figuren auf dem Brett umgeworfen: Ein Kind war laut, machte Dreck, engte ein und war undankbar. Diesmal übernahm ich den kühneren Part: „Wenn ich schwanger würde, dann würde wenigstens was passieren.“
„Offensichtlich“, sagtest du trocken. „Du bekämst ein Kind.“
Ich zog dich auf den Weg zum Flußufer. „Mir gefällt die Idee, einfach eine neue Seite aufzuschlagen.“
„Das kann alles heißen.“
„Ich meine, wir sind doch glücklich. Oder?“
„Klar“, fuhrst du vorsichtig fort. „Davon gehe ich aus.“ Aus deiner Sicht durfte man unser Glück nicht zu genau fixieren – als wäre es ein scheuer Vogel, leicht zu verschrecken, und in dem Augenblick, wo einer von uns riefe, Sieh doch den schönen Schwan!, würde es auf und davon flattern.
„Na, vielleicht sind wir zu glücklich.“
„Genau, deswegen wollte ich schon ein ernstes Wort mit dir reden. Mach mich doch ein bißchen unglücklicher.“
„Hör auf. Ich rede von Geschichten. Im Märchen heißt es am Schluß immer: Und wenn sie nicht gestorben sind …“
„Tu mir einen Gefallen: Sprich mit mir wie mit einem Normalsterblichen.“
Oh, du hast genau gewußt, was ich meinte. Nicht, daß Glück langweilig war. Es eignete sich nur nicht so gut zum Erzählen. Und einer unserer liebsten Zeitvertreibe, wenn wir älter werden, ist, daß wir unsere Geschichte erzählen, nicht nur den anderen, auch uns selbst. Ich sollte das wissen; ich bin täglich vor meiner eigenen Geschichte auf der Flucht, und sie bleibt mir auf den Fersen wie ein treuer Straßenköter. Dementsprechend habe ich mich gegenüber meinem jüngeren Ich verändert: Heute halte ich Leute, die kaum eine oder gar keine Geschichte zu erzählen haben, für schrecklich glücklich.
An den Tennisplätzen im hellen Aprillicht gingen wir langsamer, blieben stehen und bewunderten durch eine Lücke im grünen Windschutz eine kräftige Rückhand. „Alles scheint so geordnet“, jammerte ich. „A Wing and a Prayer ist so erfolgreich; das einzige, was mir beruflich passieren könnte, wäre ein Firmenbankrott. Ich könnte immer mehr Geld verdienen – aber eigentlich bin ich ein Secondhand-Fan, Franklin, und weiß gar nicht, was ich mit soviel Geld anfangen soll. Geld ödet mich an, und ich mag nicht, wie es unseren Lebensstil verändert. Viele Leute haben keine Kinder, weil sie sich keine leisten können. Für mich wäre es eine Erleichterung, etwas Wichtiges zu haben, für das sich die Ausgaben lohnen.“
„Ich bin nicht wichtig?“
„Du bist nicht kostspielig genug.“
„Neues Springseil?“
„Zehn Dollar.“
„Na ja“, hast du eingelenkt, „wenigstens wäre ein Kind die Antwort auf die Große Frage.“
Auch ich konnte störrisch sein. „Welche Große Frage?“
„Du weißt schon“, sagtest du leichthin und fuhrst in gedehntem Südstaaten-Dialekt fort, „das alte existentielle Dilemma.“
Ich grübelte nicht lange, warum, doch deine Große Frage rührte mich nicht. Mir gefiel das Neue-Seite-Aufschlagen besser. „Ich könnte mich immer noch in ein neues Land verkrümeln –“
„Gibt’s da noch welche? Du sammelst Länder wie andere Leute CDs.“
„Rußland“, sagte ich. „Obwohl ich mein Leben ungern bei Aeroflot aufs Spiel setze. In letzter Zeit … kommt es mir überall irgendwie gleich vor. Alle Länder haben unterschiedliches Essen, aber sie haben alle Essen, verstehst du, was ich meine?“
„Wie nennst du das noch? Genau! Stuß.“
Siehst du, damals hattest du die Angewohnheit, so zu tun, als hättest du keine Ahnung, wenn ich von etwas Komplexem oder Subtilem sprach. Später verkam diese spielerische Strategie des Sich-dumm-Stellens zur dumpfen Unfähigkeit, meine Anliegen zu begreifen, nicht weil sie zu abstrus, sondern weil sie nur allzu klar waren – und das mochtest du nicht.
Erlaube mir einen Exkurs: Alle Länder haben anderes Wetter, aber alle haben sie irgendein Wetter, irgendeine Architektur, eine Haltung zu der Frage, ob Rülpsen beim Essen ein Kompliment oder eine Unhöflichkeit ist. Deshalb hatte ich angefangen, mir weniger Gedanken darüber zu machen, ob ich in Marokko meine Sandalen vor der Tür stehenlassen mußte, als vielmehr über die generelle Tatsache, daß – egal, wo ich mich befand – jede Kultur auf dem Schuh-Sektor ihre besonderen Bräuche hatte. Reisen schien mir ein großer Aufwand – Gepäck, Jetlag etc. –, wenn man sich doch immer wieder nur innerhalb des Wetter-Schuh-Kontinuums bewegte; dieses Kontinuum immergleicher Faktoren wurde selbst zu einer Art Ort, so daß ich im Grunde regelmäßig und gnadenlos an dieser gleichen Stelle landete. Obwohl ich manchmal über die Globalisierung schimpfte – ich konnte deine schokoladenbraunen Lieblingstreter bei Banana Republic in Bangkok kaufen –, war es doch im Grunde die Welt in meinem Kopf, die monoton geworden war; das, was ich dachte, was ich fühlte und was ich redete. Mein Kopf würde erst an einem wirklich anderen Ort ankommen, wenn ich mich in ein anderes Leben begab und nicht an einen anderen Flughafen.
„Mutterschaft“, brachte ich es im Park auf den Punkt, „das ist ein fremdes Land.“
Aber wenn ich, selten genug, wirklich Ernst machen wollte, wurdest du nervös. „Vielleicht bist du deinen Erfolg leid“, sagtest du. „Aber Location-Scouting für Madison-Avenue-Werbeagenturen ist für mich auch nicht der Gipfel der Selbstverwirklichung.“
„Gut.“ Ich blieb stehen, lehnte mich rücklings gegen das warme Holzgeländer am Hudson River und breitete die Arme seitlich darauf aus, um dir offen gegenüberzutreten. „Also, was soll passieren? Was meinst du, worauf warten und hoffen wir beruflich?“
Du hast den Kopf geschüttelt, mir prüfend ins Gesicht gesehen. Du schienst zu begreifen, daß ich weder deine Leistung noch die Wichtigkeit deiner Arbeit anfechten wollte. Es ging um etwas anderes. „Ich könnte als Scout beim Film arbeiten.“
„Aber du hast immer gesagt, das sei derselbe Job: Du findest die Leinwand, ein anderer malt die Szene. Und Werbeagenturen zahlen besser.“
„Da ich mit einer goldenen Gans verheiratet bin, ist das ja egal.“
„Ist es dir aber nicht.“ Dein erwachsener Umgang mit mir als der deutlich besser Verdienenden hatte seine Grenzen.
„Vielleicht mache ich was völlig anderes.“
„Was denn, läßt du dir endlich einreden, daß du ein eigenes Restaurant aufmachen sollst?“
Du mußtest lächeln. „Das schafft keiner.“
„Genau. Du bist viel zu praktisch veranlagt. Vielleicht machst du etwas anderes, aber doch immer etwas auf der gleichen Ebene. Ich rede von Topographie. Von der emotionalen, narrativen Topographie. Wir leben in Holland. Aber manchmal zieht es mich nach Nepal.“
Da New Yorker gemeinhin als zielstrebig galten, hättest du beleidigt sein können, daß ich dich nicht ehrgeizig fand. Aber du sahst dich selbst ausgesprochen pragmatisch und warst mir nicht böse. Du warst ehrgeizig, was dein Leben anging – wie es war, wenn du morgens aufwachtest –, doch du warst nicht hinter irgendwelchen Errungenschaften her. Wie die meisten Menschen, die nicht von klein auf eine besondere Berufung verspürt hatten, kamst erst du und dann deine Arbeit; deine Beschäftigung füllte deinen Tag, aber nicht dein Herz. Das mochte ich an dir. Ich mochte es wirklich sehr.
Wir gingen weiter, und ich schwenkte deine Hand. „Unsere Eltern werden bald sterben“, fing ich wieder an. „Über kurz oder lang werden alle, die wir kennen, ihre irdischen Verstrickungen im Suff ertränken. Wir werden alt, und irgendwann verlierst du mehr Freunde, als du gewinnst. Sicher können wir in die Ferien fahren, zu guter Letzt noch Rollkoffer anschaffen. Wir können mehr essen, können mehr Wein trinken und mehr Sex haben. Aber – und versteh mich nicht falsch – ich fürchte, daß alles etwas langweilig wird.“
„Einer von uns könnte immer noch Bauchspeicheldrüsenkrebs kriegen“, schlugst du gutgelaunt vor.
„Stimmt. Oder im Pick-up mit einem Betonmischer zusammenstoßen, das macht die Geschichte noch ein bißchen raffinierter. Aber genau das meine ich. Alle größeren Ereignisse, die ich mir von unserer Zukunft erwarte – ich meine keine liebevollen Postkarten aus Frankreich, sondern ernstzunehmende Ereignisse –, sind schrecklich.“
Du gabst mir einen Kuß aufs Haar. „Ganz schön trübe Gedanken an so einem wunderschönen Tag.“
Ein paar Schritte gingen wir halb umarmt, aber unsere Schritte kamen aus dem Takt; ich hakte meinen Zeigefinger in deine Gürtelschlaufe. „Du kennst doch diesen Euphemismus, sie ist froher Erwartung? Genau das. Die Geburt eines Kindes ist, wenn es gesund ist, etwas, worauf man sich freuen kann. Etwas Gutes, ein großes, gutes, enormes Ereignis. Und von da an geschieht alles Gute, was dem Kind geschieht, auch dir. Alles Schlechte natürlich auch“, fügte ich hastig hinzu, „aber auch erste Schritte, erste Freundschaften, erster Platz im Sackhüpfen. Kinder machen einen Schulabschluß, sie heiraten, sie bekommen selbst Kinder – man erlebt gewissermaßen alles zum zweiten Mal. Selbst wenn unser Kind Probleme hätte“, sagte ich naiv, „wären es wenigstens nicht unsere alten Probleme …“
Genug. Dieses Gespräch noch einmal wiederzugeben bricht mir das Herz.
Rückblickend war meine Aussage, daß ich mehr „Geschichte“ wollte, vielleicht meine Art anzudeuten, daß ich noch jemanden brauchte, den ich lieben konnte. So etwas sprachen wir nie laut aus; wir waren zu schüchtern. Und es ängstigte mich, je nahezulegen, daß du mir nicht genug sein könntest. Jetzt, wo wir getrennt sind, finde ich eigentlich, daß ich es dir viel öfter hätte sagen sollen: Mich in dich zu verlieben war das Erstaunlichste, was mir je passiert ist. Nicht allein das Verlieben, dieses seichte Ereignis an sich, sondern das In-dich-verliebt-Sein. An jedem Tag, den wir getrennt verbrachten, stellte ich mir deine breite warme Brust vor, die Wölbung, fest und rund von deinen täglichen hundert Liegestützen, die Schlüsselbeinmulde, in die ich an jedem herrlichen Morgen meinen Kopf kuschelte, an dem ich nicht pünktlich am Flughafen sein mußte. Manchmal hörte ich dich von irgendwoher meinen Namen rufen: „Eee-VA!“ Gereizt, kurz, fordernd riefst du mich, weil ich dir gehörte, wie einen Hund, Franklin! Aber ich gehörte dir ja, und ich hatte nichts dagegen, und ich mochte diesen Anspruch: „Eeeeeee-VA!“, immer auf der zweiten Silbe betont, und an manchen Abenden konnte ich kaum antworten, weil ich einen dicken Kloß im Hals verspürte. Ich mußte aufhören, die Äpfel für den Kuchen in Scheiben zu schneiden, weil meine Augen feucht wurden und die ganze Küche verschwamm und ich mir sonst in den Finger geschnitten hätte. Du hast mich immer angeschrien, wenn ich mich geschnitten habe; du wurdest dann wütend, und dein irrationaler Zorn war so betörend, daß ich es am liebsten gleich noch einmal getan hätte.
Ich habe dich nie und nimmer für selbstverständlich gehalten. Dazu hatten wir uns zu spät getroffen. Ich war damals fast dreiunddreißig, und meine Vergangenheit ohne dich war mir zu karg und zu eindringlich in Erinnerung, als daß ich das Wunder der Zweisamkeit normal gefunden hätte. Aber nachdem ich so lange von den Brosamen meines eigenen emotionalen Tischs gelebt hatte, verwöhntest du mich mit einem täglichen Festmahl verschwörerischer So-ein-Arschloch-Blicke auf Partys, grundloser Überraschungsblumensträuße und Nachrichten am Kühlschrankmagneten, die immer mit „1000 Küsse, Franklin“ unterschrieben waren. Du machtest mich gierig. Wie ein Süchtiger wollte ich mehr Stoff. Und ich war voller Neugier. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlte, wenn ein Kinderstimmchen schon von weitem „Mamm-MIII?“ rief. Du hast damit angefangen – wie jemand, der einem einen einzelnen Ebenholz-Elefanten schenkt, und plötzlich denkt man, wie schön es wäre, so was zu sammeln.
Eva
P.S. (3.40 Uhr nachts)
Ich habe versucht die Schlaftabletten abzusetzen, schon weil ich weiß, daß du dagegen bist, wenn ich sie nehme. Aber ohne Tabletten wälze ich mich nur herum. Morgen werde ich im Travel R Us nicht zu gebrauchen sein, aber ich will noch eine Erinnerung aus jener Zeit loswerden.
Erinnerst du dich, wie wir mit Eileen und Belmont im Loft Krebse gegessen haben? Das war ein ausgelassener Abend. Selbst du schlugst über die Stränge und holtest um zwei Uhr nachts noch den Himbeergeist hervor. Ohne Unterbrechungen, weil es Puppenkleider zu bewundern gab, ohne ein „Morgen ist schließlich ein Schultag“ schlemmten wir, aßen Obst und Sorbet und schenkten großzügig gefüllte zweite Gläser des klaren, hochprozentigen Framboise nach, juchzten über unglaubliche Geschichten in einer Orgie ewiger Jugend, typisch für Kinderlose mittleren Alters.
Wir redeten über unsere Eltern – besser gesagt, machten uns kollektiv über sie lustig. Wir veranstalteten einen inoffiziellen Wettbewerb: Wessen Eltern hatten die schlimmsten Macken. Du warst im Nachteil; der unerschütterliche Neu-England-Stoizismus deiner Eltern war schwer zu parodieren. Dagegen bot der Erfindungsreichtum meiner Mutter, mit dem sie vermied, das Haus zu verlassen, Anlaß für großen Jubel, und ich gab auch den Standardspruch von meinem Bruder und mir zum besten: „Wie ungemein praktisch!“ – was in unserer Familie gleichbedeutend war mit „Sie liefern frei Haus“. Früher (bevor er vermied, seine Kinder in meine Nähe zu lassen) brauchte ich nur zu sagen: „Wie ungemein praktisch!“, und Giles prustete los. Im Morgengrauen konnte ich auch Eileen und Belmont gegenüber bemerken: „Wie ungemein praktisch!“, und sie schrien vor Lachen.
Mit diesem multikulturellen Varieté-Gespann aus zwei welterfahrenen Bohemiens konnten wir allerdings beide nicht mithalten. Eileens Mutter war schizophren, ihr Vater ein professioneller Falschspieler; Belmonts Mutter hatte früher als Prostituierte angeschafft und kleidete sich immer noch wie Bette Davis in Was geschah wirklich mit Baby Jane? Sein Vater war ein halbberühmter Jazz-Schlagzeuger, der mit Dizzy Gillespie aufgetreten war. Ich spürte, daß sie diese Geschichten schon oft erzählt hatten – sie erzählten sie um so besser. Und nach soviel Chardonnay, mit dem wir die Krebsberge hinunterspülten, lachte ich, bis mir die Tränen kamen. An einem Punkt hätte ich beinah das Gespräch auf die Wahnsinns-Entscheidung gebracht, mit der wir uns herumtrugen, aber Eileen und Belmont waren mindestens zehn Jahre älter, und ich war mir nicht sicher, ob ihre Kinderlosigkeit gewollt war; ich wollte nicht taktlos sein.
Sie gingen erst nachts um vier. Und vertu dich nicht: Diesmal hatte ich mich blendend amüsiert. Es war einer der raren Abende, an dem es sich gelohnt hatte, daß ich zum Fischmarkt gerannt war, daß ich eine Menge Obst kleingeschnitten hatte, und wo sich eigentlich selbst das Küche-Putzen hätte lohnen sollen, in der überall Mehl und Mangoschalen klebten. Ich glaube, daß ich ein bißchen ernüchtert war, weil der Abend vorbei war, oder vom Alkohol nur mehr ein bißchen schwerfällig und nicht mehr so euphorisiert. Ich war wacklig auf den Beinen, hatte müde Augen und mußte mich zusammenreißen, die Weingläser nicht fallenzulassen. Aber nicht deshalb hatte ich Katzenjammer.
„So still“, bemerktest du beim Tellerstapeln. „Fix und fertig?“
Ich aß die letzte einsame Krebsschere, die in den Topf zurückgerutscht war. „Wir haben – wie lange – vier, fünf Stunden über unsere Eltern geredet.“
„Und? Wenn du Schuldgefühle hast, weil du über deine Mutter hergefallen bist, tue bitte Buße bis 2025. Das ist doch dein Lieblingszeitvertreib.“
„Ich weiß. Das ist es ja, was mich beunruhigt.“
„Sie konnte dich nicht hören. Und niemand am Tisch hat dir, als du dich über sie lustig gemacht hast, unterstellt, du fändest sie nicht auch tragisch. Oder daß du sie nicht lieben würdest.“ Du hast hinzugefügt: „Auf deine Art.“
„Aber wenn sie stirbt, werden wir … werde ich nicht so weitermachen können. Dann kann ich unmöglich weiter so zynisch sein, ohne daß ich mir wie eine Verräterin vorkomme.“
„Also mach die arme Frau lächerlich, solange du kannst.“
„Aber sollten wir überhaupt noch über unsere Eltern reden, stundenlang, in unserem Alter?“
„Wo ist das Problem? Du hast dermaßen gelacht, wahrscheinlich hast du dir dabei in die Hosen gepinkelt.“
„Als sie gingen, sah ich uns plötzlich – uns vier, alle über achtzig, überall Leberflecken, wie wir uns immer noch voll laufen lassen, immer noch die gleichen Geschichten erzählen. Wie wir immer noch, vielleicht mit ein bißchen mehr Wehmut oder Bedauern, weil sie inzwischen tot sind, über unsere komischen Eltern reden. Ist das nicht ein bißchen erbärmlich?“
„Du würdest dich lieber über El Salvador aufregen.“
„Das ist es nicht –“
„Oder Kultur-Gemeinplätzchen zum Kaffee reichen: Belgier sind unhöflich, Thais hassen Gefummel in der Öffentlichkeit, Deutsche sind analfixiert.“
Die Bitterkeit solcher Sticheleien hatte zugenommen. Meine hart erarbeiteten anthropologischen Erkenntnisse sollten mich wohl daran erinnern, daß ich mich in der Fremde ins Abenteuer stürzte, während du in New Jerseys Vororten nach einer heruntergekommenen Garage für Black and Decker fahnden mußtest. Ich hätte dir über den Mund fahren können – schade, daß meine Reisegeschichten dich anöden –, aber eigentlich machtest du Spaß, es war spät, und ich hatte keine Lust, mich zu streiten.
„Sei nicht blöd“, sagte ich. „Ich bin wie alle: Ich rede gerne über andere Leute. Nicht fremde Leute. Leute, die ich kenne, Leute, die mir nahestehen – Leute, die mich aufregen. Aber ich finde, ich mache zuviel Gebrauch von meiner Familie. Mein Vater war tot, bevor ich geboren wurde; ein Bruder und eine Mutter bieten wenig Angriffsfläche. Ehrlich, Franklin, vielleicht sollten wir ein Kind bekommen, damit wir mal ein anderes Gesprächsthema haben.“
„Also das“, du hast den Spinattopf in die Spüle geknallt, „ist naiv.“
Ich griff deine Hand. „Ist es nicht. Was wir reden, ist, was wir denken, ist, was unser Leben ausmacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein ganzes Leben lang über meine Schulter auf meine Elterngeneration zurückschauen möchte – wo ich doch auf dem besten Wege bin, meine Sippe endgültig auszulöschen. Keine Kinder zu kriegen ist nihilistisch, Franklin. Als würde man nicht an die Menschheit glauben. Wenn jeder es uns nachmachen würde, wäre die Spezies Mensch in hundert Jahren ausgestorben.“
„Raus“, hast du geschimpft. „Kein Mensch kriegt Kinder, um die Spezies zu erhalten.“
„Vielleicht nicht bewußt. Aber eigentlich können wir solche Entscheidungen erst seit den sechziger Jahren treffen, ohne ins Kloster zu gehen. Außerdem wäre es nach Abenden wie diesem eine Art poetischer Gerechtigkeit, wenn meine erwachsenen Kinder später bei ihren Freunden stundenlang über mich herziehen würden.“
Wie sehr wir uns selbst in Sicherheit zu wiegen wissen! Mir gefiel die Aussicht, dermaßen unter die Lupe genommen zu werden. War Mama nicht hübsch? War Mama nicht mutig? Mensch, sie ist immer mutterseelenallein in diese fürchterlichen Länder gereist! In meiner Phantasie sprachen meine Kinder in ihren nächtlichen Diskussionen nur in den höchsten Tönen von ihrer Mutter – keine Spur der boshaften Vivisektion, die ich an meiner Mutter vornahm. Ein Versuch: Mama ist so eine Angeberin! Hat sie nicht eine Riesennase? Und diese Reiseführer, die sie sich abringt, sind toooodlangweilig. Am schlimmsten ist, daß Söhne und Töchter ihre Eltern deshalb so leicht denunzieren können, weil sie Zugang zu allen vertraulichen Informationen haben, was das Ganze zu einem doppelten Vertrauensbruch macht.
Doch selbst rückblickend war diese Sehnsucht „nach einem anderen Gesprächsthema“ alles andere als naiv. Tatsächlich ließ ich mich anfangs durch verlockende kleine Phantasien – wie Kino-Vorschauen – für eine Schwangerschaft erwärmen: Wie ich dem Jungen, der die erste Liebe meiner Tochter ist, die Tür öffne (ich muß zugeben, ich stellte mir immer eine Tochter vor); wie ich seine Unbeholfenheit durch einen freundlichen Plausch vertreibe; wie ich ihn endlos, spielerisch, gnadenlos durchdiskutiere, nachdem er wieder weg ist. Meine Sehnsucht, mit Eileen und Belmont bis in die Nacht einmal über junge Leute herzuziehen, die ihr Leben noch vor sich hatten – die neue Geschichten hervorbrachten, über die ich neue Ansichten hatte, und deren Stoff nicht schon ganz abgedroschen vom vielen Erzählen war – diese Sehnsucht war echt und keine fixe Idee, keine Spinnerei.
Oh, aber ich habe nie darüber nachgedacht, was ich denn eigentlich zu erzählen haben würde, wenn ich denn endlich mit meinem heißersehnten frischen Gesprächsstoff versorgt wäre. Wirklich nicht vorhersehen konnte ich die tragische Ironie, daß ich über mein abendfüllendes neues Thema eben den Mann verlieren würde, mit dem ich am liebsten darüber reden wollte.
28. November 2000
Lieber Franklin,
es sieht nicht so aus, als ob dieser Zirkus in Florida demnächst ein Ende haben wird. Unser Büro ist in hellem Aufruhr wegen einer Staatsbeamtin mit viel Make-up, und einige meiner überarbeiteten Kollegen sagen eine „Verfassungskrise“ voraus. Obwohl ich die Geschichte nicht in allen Einzelheiten verfolgt habe, bezweifele ich das. Was mir – angesichts der Leute, die an der Imbißtheke, wo sie vor kurzem noch schweigend gegessen haben, nun lautstark übereinander herfallen – zu denken gibt, ist nicht, wie sehr sie sich bedroht fühlen, sondern wie sicher. Nur ein Land, das sich unantastbar fühlt, kann es sich leisten, politische Wirren als Unterhaltung zu betrachten.
Wenige Amerikaner armenischer Abstammung, deren Angehörige noch vor gar nicht allzu langer Zeit beinah ausgerottet worden wären (ich weiß, du kannst es nicht mehr hören), teilen dieses überhebliche Sicherheitsgefühl. Die Daten meines eigenen Lebens sind apokalyptisch. Ich wurde im August 1945 geboren, als die Sporen zweier Giftpilze uns einen warnenden Vorgeschmack auf die Hölle gaben. Kevin kam während des bangen Countdowns zum Jahr 1984 zur Welt – von vielen gefürchtet, du erinnerst dich. Obwohl ich die Nase rümpfte über Leute, die sich George Orwells Zufallstitel zu Herzen nahmen, begann für mich mit diesen Zahlen eine Ära der Tyrannei. Der Donnerstag schließlich fand 1999 statt, jenem Jahr, für das man den Weltuntergang vorausgesagt hatte. Und das mit Recht.
Seit meinem letzten Brief habe ich meine Erinnerung nach meinen ursprünglichen Bedenken gegen eine Mutterschaft durchforstet. Ich weiß, daß ich einen ganzen Packen Ängste hatte, nur nicht die richtigen. Hätte ich die Nachteile der Elternschaft aufgelistet, hätte dort niemals gestanden: „Sohn könnte ein Killer werden.“ Die Liste hätte eher folgendermaßen ausgesehen:
1. Streß.
2. Weniger Zeit für uns beide. (Besser gesagt, keine Zeit für uns beide.)
3. Andere Leute. (Elternabende. Ballettlehrerinnen. Die unerträglichen Freunde des Kindes und ihre unerträglichen Eltern.)
4. Daß ich eine Kuh werde. (Ich war zierlich und wollte es gerne bleiben. Meine Schwägerin hatte während der Schwangerschaft dicke Krampfadern bekommen, die sich nie zurückbildeten, und die Aussicht auf Unterschenkel mit blauen verästelten Adern versetzte mich in größere Panik, als ich zugeben konnte. Also sagte ich nichts. Ich bin eitel oder war es einmal, und eine meiner Eitelkeiten bestand darin, so zu tun, als wäre ich es nicht.)
5. Unnatürlicher Altruismus: der Zwang, Entscheidungen an dem Wohl eines anderen Menschen auszurichten. (Ich bin ein Schwein.)
6. Einschränkung meiner Reisen. (Wohlgemerkt: Einschränkung. Nicht Ende.)
7. Tödliche Langeweile. (Kleine Kinder ödeten mich schrecklich an. Das habe ich mir von Anfang an eingestanden.)
8. Das Ende aller guten Beziehungen. (Ich hatte noch nie ein anständiges Gespräch unter Freunden erlebt, wenn ein Fünfjähriger dabei war.)
9. Gesellschaftlicher Abstieg. (Ich war eine angesehene Unternehmerin. Mit einem Kleinkind im Schlepptau würde jeder Mann in meinem Bekanntenkreis – jede Frau deprimierenderweise auch – mich weniger ernst nehmen.)
10. Vergeudete Investition. (Eltern zahlen eine Schuld ab. Aber wer möchte schon eine Schuld abzahlen, der man entrinnen kann? Kinderlose kommen auch so davon. Außerdem, was bringt es, wenn die Zahlung an die falsche Adresse geht? Nur die kaputteste Mutter könnte es als Belohnung für ihre Mühen empfinden, daß ihre Tochter ebenfalls ein erbärmliches Dasein fristet.)
Das sind, nach bestem Wissen und Gewissen, die klitzekleinen Bedenken, die ich vorher abwog, und ich habe versucht, ihre erschütternde Naivität nicht mit dem zu vermischen, was tatsächlich geschah. Die Argumente für eine andauernde Unfruchtbarkeit – was für ein verheerendes Wort – entpuppten sich als kleinere Unannehmlichkeiten und harmlose Verzichtsleistungen. Sie waren egoistisch, gemein und engstirnig, so daß jeder, der einen solchen Katalog aufstellte und sich danach immer noch für ein aufgeräumtes, stickiges, statisches, sackgassenartiges, saftloses familienfreies Dasein entschied, nicht nur ein kurzsichtiger, sondern auch ein schrecklicher Mensch war.
Wenn ich diese Liste jetzt betrachte, fällt mir auf, daß die konventionellen Einwände gegen eine Elternschaft, egal, wie entschieden sie ausfallen, immer praktischer Natur sind. Seit Kinder nicht mehr die elterlichen Felder bestellen oder ihre inkontinenten Erzeuger im Alter zu sich nehmen, gibt es doch keinen vernünftigen Grund mehr, Kinder zu kriegen, und es ist kaum zu fassen, daß sich Menschen, seit es wirksame Verhütungsmittel gibt, überhaupt noch freiwillig fortpflanzen. Im Gegensatz dazu sind Liebe, Geschichte, Sinn, der Glaube an das Menschliche – kurz, die modernen Anreize zur Fortpflanzung – wie Luftschiffe: aufgeblasen, freischwebend und rar; optimistisch, großherzig, auch inhaltsschwer, aber beängstigend wenig geerdet.
Jahrelang hatte ich die vielzitierte überwältigende Sehnsucht erwartet – den betörenden Kinderwunsch, der kinderlose Frauen im Park wie hypnotisiert fremde Kinderwagen anpeilen läßt. Ich wäre gerne vom hormonellen Imperativ überwältigt worden, wäre gern eines Tages aufgewacht, hätte dich umarmt, dich gesucht, hätte, als meine Iris schwarz zuckte, gebetet, daß du mir ein Kind gemacht hattest. (Mit Kind: was für ein Klang, warm, archaisch, zärtlich, neun Monate nicht allein, wohin du auch gehst. Schwanger assoziiere ich mit anstrengend, unförmig, und es klingt immer nach schlechten Nachrichten: „Ich bin schwanger.“ Dabei stelle ich mir instinktiv eine Sechzehnjährige beim Abendessen vor – blaß, unwohl, mit einem Tunichtgut als Freund artikuliert sie die schlimmsten mütterlichen Ängste.)
Keiner dieser Impulse packte mich – ich fühlte mich hintergangen. Als ich Mitte Dreißig immer noch keine Muttergelüste entwickelt hatte, befürchtete ich, daß etwas mit mir nicht stimmte, daß etwas fehlte. Als ich mit siebenunddreißig Kevin bekam, machte ich mir Vorwürfe, warum ich diesen zufälligen, vielleicht nur chemischen Defekt nicht einfach akzeptiert, sondern zu Shakespeareschen Dimensionen hochstilisiert hatte.
Also, was lockte mich schließlich aus der Defensive? Du, vor allem. Denn obwohl wir glücklich waren, warst du es nicht, nicht ganz, und das wußte ich wohl. In deinem Leben klaffte eine Lücke, die ich nicht ausfüllen konnte. Du hattest eine Arbeit, und sie paßte zu dir. Versteckte Ställe und Kasernen aufspüren, ein Feld mit einem Holzzaun suchen, einen kirschroten Silo und schwarzweiße Kühe (Kraft-Scheibletten aus echter Milch) – du konntest dir deine Zeit einteilen, deine Vorstellungen umsetzen. Du mochtest deine Arbeit, Location Scouting. Aber du hast sie nicht geliebt. Du liebtest Menschen, Franklin. Als ich dich mit Brians Kindern spielen, ihre Plüschaffen knuddeln und ihre abwaschbaren Tattoos bewundern sah, sehnte ich mich danach, dir etwas zu geben, das dich so begeisterte wie mich A Wing and a Prayer – oder wie du es nanntest, AWAP.
Ich weiß noch, daß du das einmal ausdrücken wolltest, zögernd und untypisch für dich, das Gefühl, die Sprache. Dir war immer unwohl, wenn über Gefühle geredet wurde, allerdings nicht angesichts der Gefühle an sich. Du hattest Angst, daß die Gefühle Schaden nehmen könnten, wenn man sie zerpflückte, ähnlich wie ein Salamander, den große, ungeschickte Hände wohlmeinend, aber brutal befingerten.
Wir lagen im Bett, noch in unserem sich über uns wölbenden Loft in Tribeca, dessen klappriger Aufzug immer kurz vorm Zusammenbruch war. Höhlenartig, staubüberzogen, nicht mit Beistelltischchen in zivilisierte Räume unterteilt, erinnerte mich das Loft immer an das Versteck, das mein Bruder und ich uns in Racine aus rostigem Alteisen gebaut hatten. Du und ich, wir hatten Liebe gemacht, und ich war gerade am Eindösen, als ich aufschreckte. In zehn Stunden ging mein Flugzeug nach Madrid, und ich mußte noch den Wecker stellen. Als ich damit fertig war, sah ich, daß du auf dem Rücken lagst. Deine Augen waren offen.
„Was ist?“
Von dir kam ein Seufzen. „Ich weiß nicht, wie du das schaffst.“ Als ich mich hinlegen und ein weiteres Loblied auf meine enorme Unternehmungslust und meinen Mut anstimmen wollte, hast du gemerkt, daß ich dich falsch verstanden hatte, denn du fügtest hastig hinzu: „Weggehen. Immer so lange weggehen. Von mir weggehen.“
„Aber ich bin nicht scharf drauf.“
„Das ist die Frage.“
„Franklin, ich habe mir meine Firma nicht aufgebaut, um deinen Fängen zu entkommen. Vergiß nicht, sie war schon da.“
„Oh, wie könnte ich das vergessen.“
„Es ist mein Job!“
„Das müßte es nicht sein.“
Ich setzte mich auf. „Meinst du –“
„Nein.“ Du schobst mich sachte zurück; es lief nicht wie geplant, und offenbar hattest du es geplant. Du hast dich auf mich gerollt, die Ellenbogen neben mir aufgestützt, meine Stirn mit deiner Stirn berührt. „Ich will dir deine Reiseführer nicht wegnehmen. Ich weiß, was sie dir bedeuten. Das ist es ja. Aber andersrum könnte ich es nicht. Ich könnte nicht morgen früh aufstehen und nach Madrid fliegen und dir dann noch ausreden, mich nach drei Wochen am Flughafen abzuholen. Einmal, zweimal würde ich das schaffen. Aber nicht immer wieder.“
„Wenn du müßtest, könntest du es auch.“
„Eva. Du weißt es, und ich weiß es. Du mußt nicht.“
Ich wand mich. Du warst so nah, mir war heiß, und ich fühlte mich zwischen deinen Ellenbogen gefangen. „Das hatten wir doch schon.“
„Nicht oft. Deine Reiseführer laufen von selbst. Du könntest College-Studenten für die Basisarbeit in den Billighotels anstellen, die du jetzt selbst machst. Sie erledigen ohnehin schon die meiste Recherche.“
Ich war ärgerlich; das hatte ich bereits einmal durchgespielt. „Wenn ich ihnen nicht auf die Finger gucke, pfuschen sie. Sie behaupten, daß sie einen Eintrag überprüft haben, und scheren sich nicht darum, sondern trinken lieber einen. Später stellt sich dann raus, daß ein B&B den Besitzer gewechselt hat und die Läuse gleich mit eingezogen sind oder daß die Adresse sich geändert hat. Ich kriege Beschwerden von Fahrradtouristen, die hundert Meilen fahren und vor einer Versicherungsagentur landen und nicht in ihrem wohlverdienten Bett. Sie sind wütend, und mit Recht. Und ohne die Chefin, die allen über die Schulter schaut, nehmen manche Studenten Schmiergelder. AWAPs kostbarstes Gut ist sein ausgezeichneter Ruf …“
„Du könntest auch jemanden für die Ortsbesichtigungen einstellen. Du fährst morgen nach Madrid, weil du es willst. Daran ist nichts Schlimmes, außer daß ich es nicht tun würde und könnte. Weißt du, daß ich die ganze Zeit an dich denke? Stündlich frage ich mich, was du wohl gerade ißt, wen du wohl gerade triffst –“
„Aber ich denke doch auch an dich!“
Du hast gelacht, und dein Lachen war brüderlich; du wolltest keinen Streit. „Red keinen Stuß, Eva. Du grübelst, ob der Falafel-Stand an der Ecke die nächste Auflage überlebt und wie du die Farbe des Himmels beschreiben könntest. Gut. Aber in diesem Fall empfindest du bestimmt etwas anderes für mich als ich für dich. Mehr will ich gar nicht sagen.“
„Willst du allen Ernstes behaupten, daß ich dich nicht genauso liebe?“
„Du liebst mich nicht auf dieselbe Weise. Es ist keine Frage der Intensität. Da ist etwas – das du für dich behältst“, versuchtest du zu erklären. „Vielleicht beneide ich dich deswegen. Eine Art Reservekanister. Du gehst hier aus der Tür und zapfst diese andere Energiequelle an. Du tuckerst durch Europa oder Malaysia, bis deine Reserve erschöpft ist, und dann kommst du nach Hause.“
In Wirklichkeit paßte deine Beschreibung eher auf mein Prä-Franklin-Ich. Früher einmal war ich eine effiziente kleine Einheit gewesen, wie eine von diesen zusammenklappbaren Reisezahnbürsten. Ich weiß, daß ich jene Zeiten übermäßig romantisiere, aber besonders zu Beginn war ich wie beflügelt. Ich war fast noch ein Teenager. Ich hatte die Idee für A Wing and a Prayer mitten während meines ersten Europatrips, für den ich viel zu wenig Geld mitgenommen hatte. Der Plan zu einem unkonventionellen Reiseführer gab meiner Reise einen Sinn – sonst hätte ich womöglich die meiste Zeit herumgesessen und Kaffee getrunken. Von da an nahm ich überallhin ein zerfleddertes Notizbuch mit, merkte mir Preise für Einzelzimmer, ob es heißes Wasser gab, ob das Personal Englisch sprach und die Toiletten richtig funktionierten.
Jetzt, wo AWAP so viele Nachahmer gefunden hat, vergißt man leicht, daß die Globetrotter Mitte der sechziger Jahre fast völlig dem Guide Bleu ausgeliefert waren, dessen Zielgruppe mittleren Alters war und zur Mittelschicht zählte. 1966, als Western Europe on a Wing and a Prayer beinah über Nacht in die zweite Auflage ging, begriff ich, daß ich einen großen Wurf gelandet hatte. Ich beschreibe mich selbst gern als clever, aber wir wissen beide, daß ich Glück hatte. Ich hätte niemals die Schwemme der Rucksacktouristen voraussehen können, und ich verfügte noch nicht über ausreichende demographische Grundkenntnisse, um auf die vielen rastlosen Sprößlinge des Babybooms zu zählen, die alle auf einen Schlag erwachsen wurden; die in einer Ära des Wohlstandes von Daddys Kleingeld lebten und mit viel Optimismus Italien erobern wollten – und dabei dringend Rat brauchten, damit ihre Reise, die so gar nicht in Daddys Sinne war, so lange wie möglich andauerte. Ich ging davon aus, daß der nächste Entdeckungsreisende nach mir genausoviel Angst hatte wie ich, genauso fürchtete, daß man ihn übervorteilte; und wenn ich es schon in Kauf nahm, eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen, konnte ich später wenigstens dafür sorgen, daß unser Novize nicht gleich seinen ersten magischen Abend in der Fremde über der Kloschüssel verbrachte. Ich will nicht sagen, daß ich selbstlos war, aber ich schrieb den Reiseführer, den ich selbst gern gehabt hätte.
Du rollst mit den Augen. Die Geschichte ist abgedroschen, und vielleicht ist es unvermeidlich, daß genau die Dinge, die an jemandem zunächst attraktiv erscheinen, einem später auf die Nerven gehen. Habe Nachsicht mit mir.
Du weißt, daß ich immer panische Angst hatte, wie meine Mutter zu werden. Komisch, Giles und ich lernten den Begriff „Agoraphobie“ erst, als wir über dreißig waren, und ich war immer verwundert über die strenge Definition, die ich mehr als einmal nachgeschlagen habe: „Angst vor offenen oder öffentlichen Räumen“. Keine, wie ich fand, besonders zutreffende Beschreibung ihres Leidens. Meine Mutter hatte keine Angst vor Fußballstadien, meine Mutter hatte Angst davor, aus dem Haus zu gehen, und ich hatte den Eindruck, daß ihre Panik offene wie geschlossene Räume betraf, solange sich die geschlossenen Räume nicht in der Enderby Avenue 137 in Racine, Wisconsin, befanden. Aber es schien dafür kein Wort zu geben (Enderby-philie?), und wenigstens wissen die Leute, was ich meine, wenn ich meine Mutter als agoraphob bezeichne.
Mensch, ist das komisch, habe ich unzählige Male gehört. Wenn man bedenkt, wo du überall warst. Andere Leute ergehen sich über die Symmetrie scheinbarer Gegensätze.
Aber laß mich ehrlich sein. Ich bin meiner Mutter sehr ähnlich. Vielleicht, weil ich als Kind immer Besorgungen machen mußte, für die ich viel zu jung war und vor denen ich deshalb ein bißchen Angst hatte; mit acht wurde ich losgeschickt, um neue Gummidichtungen für die Küchenspüle aufzutreiben. Indem meine Mutter mich zu ihrer Botin machte, als ich noch klein war, vererbte sie mir die gleiche übertriebene Angst vor harmlosen Interaktionen mit der Außenwelt, die sie mit zweiunddreißig empfand.
Mir fällt keine einzige Auslandsreise ein, die ich – egal, wie gern ich fahren wollte – nicht dennoch fürchtete und verzweifelt zu umgehen suchte. Immer wieder zwang mich nur die Verknüpfung bereits eingegangener Verpflichtungen: das gekaufte Ticket, das bestellte Taxi, all die bestätigten Reservierungen. Und um mich noch ein bißchen mehr festzulegen, malte ich die Reise, bevor es an den überschwenglichen Abschied ging, meinen Freunden jedesmal in den schillerndsten Farben aus. Im Flugzeug wäre ich selig gewesen, wenn der breite Rumpf für immer und ewig in die Stratosphäre entschwunden wäre. Anzukommen war eine Qual, das Bett für die erste Nacht zu finden war eine Qual, doch die folgende Verschnaufpause – meine persönliche Reproduktion des Enderby-Avenue-Szenariums – war phantastisch. Über kurz oder lang wurde ich geradezu süchtig nach dieser Abfolge sich steigernder Qualen, die erst in dem entkräfteten Fall auf meine angemietete Matratze ihr Ende fand. Mein ganzes Leben habe ich mich angespornt, etwas zu unternehmen. Ich bin nie nach Madrid gefahren, weil ich Lust auf Paella hatte; und jede Recherche-Reise, die ich dir zufolge unternahm, um dem sicheren Hafen unseres heimischen Friedens zu entkommen, war in Wirklichkeit ein Fehdehandschuh, den ich mir selber hinwarf. Ich war vielleicht glücklich, daß ich die Reise gemacht hatte, aber ich habe mich nie gefreut, sie anzutreten.
Doch der Widerwille legte sich mit den Jahren, und die Überwindung eines bloßen Ärgernisses ist nicht mehr so befriedigend. Nachdem ich gelernt hatte, meine inneren Hürden zu überwinden – wiederholt zu beweisen, daß ich unabhängig, kompetent, mobil und erwachsen war –, verkehrte sich die Angst mit der Zeit ins Gegenteil: Mehr als vor einer Reise nach Malaysia fürchtete ich mich vor dem Zuhausebleiben.
Ich hatte also nicht nur Angst, wie meine Mutter zu werden, sondern eine Mutter zu werden. Ich fürchtete mich davor, ein fester, stabiler Anker zu werden, Sprungbrett für einen jungen Abenteurer, den ich um seine Reisen beneidete und dessen Zukunft noch nicht festgelegt und verplant war. Ich fürchtete mich davor, diese archetypische Figur im Hausflur zu werden – ein bißchen schludrig, rundlich –, die zum Abschied winkt und Kußhände wirft, während ein Rucksack im Kofferraum verstaut wird; die sich im Auspuffmief des abfahrenden Wagens die Augen mit dem Schürzenvolant abtupft; die sich verloren umdreht und den Riegel vorschiebt und das Geschirr –plötzlich viel zu wenig – abwäscht, während die Stille auf dem Raum lastet wie eine abgesengte Decke. Mehr als vor dem Verlassen hatte ich eine Panik vor dem Verlassenwerden entwickelt. Wie oft hatte ich dir das angetan, hatte dir die Baguette-Krusten unseres Abschiedsessens hinterlassen und war in mein wartendes Taxi verschwunden. Ich glaube, ich habe dir nie gesagt, wie leid es mir tat, wenn ich dich wieder und wieder verließ, dich all diese kleinen Tode sterben zu lassen und dir gerade mal geraten zu haben, dein verständliches Gefühl der Vernachlässigung auf gelegentliche spitze Bemerkungen zu beschränken.
Franklin, ich hatte panische Angst davor, ein Kind zu bekommen. Wenn ich mir vor meiner Schwangerschaft das Kinderhaben ausmalte – vor dem Einschlafen Geschichten über fröhliche kleine Lokomotiven vorlesen oder Babybrei in schlaffe Münder löffeln –, waren es immer Bilder einer anderen Frau. Mir graute vor der Konfrontation mit meinem womöglich verschlossenen, versteinerten Wesen, meiner Selbstsucht und meiner mangelnden Großzügigkeit, der harten, zähen Macht meines Widerwillens. Wie verlockend die Idee des „Eine Neue-Seite-Aufschlagens“ auch schien, ich hatte eine Sterbensangst vor der Aussicht, mich hoffnungslos in der Geschichte eines anderen Menschen zu verfangen. Und ich glaube, genau diese Panik gab schließlich den Ausschlag – so wie eine Klippe zum Absprung verführt. Gerade diese Unüberwindlichkeit der Aufgabe, gerade das Abstoßende daran war am Ende, was mich anzog.
Eva


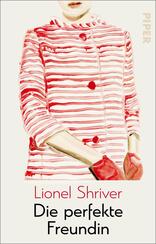











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.