Prolog
Denken Sie mal zurück. Wann sind Sie das erste Mal mit einer Bibel in Berührung gekommen? Ich war fünf, vielleicht auch sechs Jahre alt, saß im Schneidersitz auf einem kratzigen beigen Teppich und hatte ein großes Bilderbuch auf dem Schoß. Das Buch war eine illustrierte Kinderbibel, und seine Seiten rochen köstlich – herb, wie Plakatfarbe, wenn auch ein bisschen muffig, wie die Leihbibliothek. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, was ich da alles sah. Abraham hatte seinen Sohn Isaak gefesselt auf etwas gelegt, das aussah wie ein noch nicht entzündetes Lagerfeuer. Er hatte ein Messer und war drauf und dran, ihn damit zu erstechen und dann zu verbrennen. Doch da wurde er plötzlich von einem Engel am Himmel gestoppt, einem Engel mit gelben Haaren und einem wallenden Gewand, der auf ein fettes, flauschiges Schaf zeigte. Es waren noch mehr Bilder in dem Buch: ein alter Mann auf einem Berg mit zwei großen Steintafeln in den Händen; ein anderer alter Mann in einem Streitwagen, der von zwei Pferden aus Feuer gezogen wurde. Ich blätterte weiter und weiter. Da war ein Mann, ganz mit Seetang überzogen, er saß im Bauch eines großen blauen Wals. Der kleine Jesus in einem Bett aus Stroh, um den sich Schafe, Kühe und ein Esel scharten, die ihn ansahen. Eine Frau, die mit Schals herumwirbelte, während sie vor einem Kopf auf einem Teller tanzte. Ich hielt kurz inne und schaute auf das Bild des Mannes, der an ein großes Holzkreuz genagelt war. Er war über und über mit Kratzern bedeckt, und an seinem Kopf tropfte Blut herunter.
Ich habe nie an Gott geglaubt, aber Religion hat mich immer fasziniert. Als ich aufwuchs, war sie allgegenwärtig, drängte sich in mein Blickfeld und strukturierte den Lebensablauf – von den täglichen Schulversammlungen und dem Fernsehprogramm am Sonntagabend bis zur freudigen Erwartung vor weihnachtlichen Krippenspielen und Ostereiersuchen. Doch erst die Familienausflüge ins Museum machten Religion für mich konkret. Riesige Steinstatuen von Göttern, rundlich, fleischig und machtvoll. In Tuniken gehüllte Götter mit Sandalen an den Füßen. Götter mit Zehennägeln, Ellbogen, Augenbrauen. In anderen Räumen standen farbenfroh bemalte Särge mit Leichnamen, die in schmutzige Stoffstreifen eingewickelt waren, umgeben von Göttern mit den Gesichtern von Tieren. Eine Katze. Ein Hund. Ein Vogel. Ein Krokodil. Einmal die Ecke rum, und da waren noch mehr Götter, dieses Mal in kleine polierte Steine geritzt; in langen Röcken saßen sie auf Thronen, hatten Hörner auf ihren Kronen und Ungeheuer zu ihren Füßen liegen. In Museen lernte ich, dass die Gottheiten aus Ägypten, Mesopotamien, Griechenland und Rom zu der größeren Welt gehörten, in der die Bibel entstand. Aber wo waren die Statuen vom Gott der Bibel selbst – der einzigen Gottheit, die bis in die heutige Zeit überlebt hat?
Als ich Theologie und Religionswissenschaft studierte, gingen Dozenten wie Studenten gleichermaßen davon aus, dass der Gott der Bibel keinen Körper besitzt. Es war ein gestaltloser, unsichtbarer Gott, von dem es kein Bild gab und der sich in der hebräischen Bibel (dem Alten Testament) in geheimnisvoll von Propheten gesprochenen Worten offenbarte und dann im Neuen Testament in Jesus Christus Fleisch wurde, um für die Sünden der Menschheit zu sterben, bevor er wiederauferstand und in den Himmel zurückkehrte. Doch als ich mir die Bücher, aus denen die Bibel besteht, einmal etwas genauer anschaute, konnte ich diesen körperlosen Gott nicht finden. Vielmehr beschworen die alten Texte ein überraschend leibhaftiges Bild von einem Gott in Menschengestalt herauf, der herumlief, redete, weinte und lachte. Einem Gott, der aß und schlief, Gefühle hatte und atmete. Und einem Gott, der eindeutig männlichen Geschlechts war.
Während meines Grundstudiums schien niemand ein Wort über den Körper des biblischen Gottes verlieren zu wollen – bis zu einer denkwürdigen Vorlesung, in der es um die Genderthematik in der modernen christlichen Theologie ging. Begeistert stellte ich fest, dass feministische Theologen sowohl auf jüdischer als auch auf christlicher Seite schon lange Widerspruch gegen den rein männlichen Gott in ihren heiligen Schriften erhoben. Doch stellte sich schnell heraus, dass sowohl feministische als auch traditionalistische Theologen dieses heikle Thema dadurch zu umschiffen gedachten, dass sie sich darauf zurückzogen, Gott könne unmöglich ein Geschlecht haben, denn Gott habe ja keinen Körper. Ich weiß noch genau, dass ich in der Diskussionsrunde am Ende der Vorlesung Protest einlegte. „Aber viele biblische Texte lassen den Schluss zu, dass Gott männlich ist und einen männlichen Körper hat.“
„Das Problem ist nicht Gott“, erwiderte der Professor, ein hoch angesehener christlicher Theologe und Geistlicher. „Problematisch wird es nur, wenn wir die Beschreibungen der Bibel zu wörtlich nehmen.“ Dann führte er weiter aus, dass jene lästigen biblischen Darstellungen eines leibhaftigen, männlichen Gottes schlicht und einfach metaphorisch gemeint seien oder poetisch. „Wir sollten uns nicht zu sehr von Anspielungen auf seinen Körper ablenken lassen“, sagte er. Denn sonst würde man sich zu vereinfachend mit den biblischen Texten auseinandersetzen. Anscheinend sollten wir nicht nur auf die Texte schauen, sondern durch sie hindurch, um ihren theologischen Wahrheiten auf die Spur zu kommen.
Alle anderen im Raum schienen mit dieser Herangehensweise an den Gott der Bibel erstaunlich zufrieden zu sein, aber ich fand sie zutiefst frustrierend. Warum sollte ich an dem klaren Bild von Gott als riesenhaftem Mann mit einem schweren Schritt, Waffen in der Hand und einem Atem so heiß wie Schwefel vorbeisehen? Einem Gott, der es in einem physischen Kampf mit einem gewaltigen Seeungeheuer aufnahm – und siegte? Einem Gott, der in seinem himmlischen Garten und in den Friedhöfen seines Volkes herumlief? Einem Gott, der eine Frau nackt auszog und sie der Gruppenvergewaltigung und Verstümmelung preisgab? Einem Gott, der auf einem Thron in einem Tempel saß und sich am Aroma von verbranntem Tierfett erfreute, während er auf sein Abendessen wartete? Einem Gott, der nicht nur Kinder hatte, sondern auch noch bereitwillig und mutwillig seinen geliebten Sohn hergab, damit er den Opfertod erlitt? Wie konnte ich davon nicht abgelenkt werden? Hier war eine Gottheit, genau wie die, die ich als Kind in Museen besucht hatte – ein Gott aus alten Mythen, fantastischen Geschichten und längst verloren geglaubten Ritualen, ein Gott aus der fernen Vergangenheit, aus einer Gesellschaft so ganz anders als die unsere. Unter diesen Vorzeichen wollte ich ihm begegnen, nicht als distanziertes, abstraktes Wesen, sondern als Produkt einer bestimmten Kultur, zu einer bestimmten Zeit, nach dem Bild der Menschen gemacht, die damals lebten; ein Gott, den sie nach ihren eigenen physischen Gegebenheiten formten, nach ihrer Weltsicht – und nach ihren eigenen Vorstellungen.
Als ich da so in dem Hörsaal saß, kam es mir vor, als wäre diese kraftvolle Gestalt irgendwie wegtheoretisiert und ersetzt worden durch das abstrakte Wesen, mit dem wir heute vertrauter sind: einen Gott, den wir in unseren kulturellen Ritualen feiern, auf den unsere Politiker sich gerne berufen und der jeden Sonntag im Fernsehen gepriesen wird. Einen Gott, dem ich, nach Meinung vieler meiner Kommilitonen und Dozenten, Rechenschaft schuldig war, ob nun in diesem Leben oder im nächsten. Einen Gott, dessen angebliche Gebote unsere gesellschaftlichen und kulturellen Konventionen bezüglich Gender, Sex und Moral, Macht und sozialer Schicht, Leben und Tod geprägt haben. Und dann dämmerte es mir mit einem Mal. Alle anderen im Raum, mein Theologieprofessor eingeschlossen, zensierten die Bibel, desinfizierten ihren Gott, befreiten ihn von allen mythologischen, diesseitigen und verstörenden Merkmalen. Ich war enttäuscht von ihnen. Und sie taten mir leid.
Das hier ist das Buch, das ich gern gelesen hätte, als ich auf der Uni war. Es erzählt die Geschichte des wahren Gottes der Bibel in all seinen leiblichen, unzensierten, skandalösen Ausprägungen. Indem es die theologische Fassade über die Jahrhunderte angesammelter jüdischer und christlicher Pietät herunterreißt, befreit das Buch den Gott der Heiligen Schrift von seinen biblischen und dogmatischen Fesseln und bringt eine Gottheit hervor, die ganz anders ist als der Gott, der heute von Juden und Christen verehrt wird. Der in diesem Buch enthüllte Gott ist die Gottheit, als die seine Anhänger im Altertum ihn sahen: ein überdimensionaler, muskelbepackter, gut aussehender Gott mit übermenschlichen Kräften, irdischen Leidenschaften und einer Schwäche für das Fantastische und Monströse.
Einleitung
1 Die Gottheit auf dem Seziertisch
Im Juni 2018 veröffentlichten Nachrichtenplattformen in aller Welt eine Fotografie von Gott. „Zeigt DIESES Foto das wahre Gesicht Gottes?“, tönte eine Clickbait-Überschrift. „Die Wissenschaft enthüllt das Gesicht Gottes, und es sieht aus wie Elon Musk“, spottete eine zweite. Andere, darunter die Webseite von NBC, waren weniger effekthascherisch in ihren Aufmachern: „Das Gesicht Gottes liegt im Auge des Betrachters.“ Das besagte Foto zeigte das unscharfe Schwarz-Weiß-Bild eines männlichen Weißen mittleren Alters mit einem weichen, runden Gesicht und dem Anflug eines Lächelns. Das Bild war von Forschern der University of North Carolina in Chapel Hill erzeugt worden, die einer demografisch repräsentativen Auswahl US-amerikanischer Christen eine Abfolge von computergenerierten Gesichtern vorgelegt hatten, in denen sich bestimmte kulturelle Stereotype von emotionalen, ethischen, sozialen und spirituellen Werten ausdrückten, und sie gebeten hatten, die herauszusuchen, die ihrem geistigen Bild von Gott am nächsten kamen. Einige dieser Gesichter hatten ein androgynes Aussehen, manche waren eher feminin, andere maskuliner. Alle waren sie grau, wie auf einer schwarz-weißen Fotokopie, doch hatten einige eine hellere Haut und andere eine dunklere. Manche Gesichter waren ausdrucksstark, andere eher nichtssagend. Doch jedes Gesicht war eine Leinwand, auf die die Teilnehmer an dem Experiment nach Belieben ihre eigenen Mutmaßungen projizieren konnten. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und dazu genutzt, ein Phantombild von Gott zu erstellen. Wenig überraschend förderte die Studie zutage, dass in den USA Gott dem Bild eines weißen männlichen Amerikaners entspricht.
Psychologen und Sozialanthropologen haben schon lange erkannt, dass bei der Deutung des Göttlichen in menschlichen Gesellschaften ein hohes Maß an kognitiver Verzerrung zum Tragen kommt. Doch auch wenn moderne Studien wie die aus Chapel Hill uns etwas über die psychologischen und sozialen Prozesse sagen, die dieser Neigung zugrunde liegen, ist das nicht eben neu. Vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren, im späten 6. beziehungsweise frühen 5. Jahrhundert v. Chr., war der griechische Denker und Abenteurer Xenophanes von Kolophon bereits zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt: „Wenn Kühe, Pferde oder Löwen Hände hätten und damit malen und Werke wie die Menschen schaffen könnten, dann würden die Pferde pferde-, die Kühe kuhähnliche Götterbilder malen und solche Gestalten schaffen, wie sie selber haben.“ Für Xenophanes war die menschliche Neigung, sich Götter nach ihrem Ebenbild zu schaffen, ebenso sehr lokalen kulturellen Vorlieben geschuldet wie übergeordneteren, ambitionierten Idealen, was die Vielfalt von Gottheiten in seiner Welt nur bestätigte: „Die Äthiopen stellen sich ihre Götter schwarz und stumpfnasig vor, die Thraker dagegen blauäugig und rothaarig.“ Was Xenophanes betraf, so war die weitverbreitete Annahme, die Götter hätten Körper wie die ihrer Anhänger, untrennbar mit der Vorstellung verbunden, Götter benähmen sich ganz so wie Menschen – und das war überaus problematisch, denn es entwertete unweigerlich die moralische Natur des Göttlichen. Beweise dafür ließen sich in den griechischen Mythen selbst finden: „Alles haben Homer und Hesiod den Göttern angedichtet, was nur immer bei den Menschen Schimpf und Schande ist: Stehlen, Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen“, beklagte Xenophanes. Es war ein Einwand, der in seiner Philosophensicht wurzelte, dass ein Gott von Natur aus und zwangsläufig „weder an Aussehen den Sterblichen ähnlich [sei] noch an Gedanken“.
Ähnliche Ideen wurden schon bald auch von anderen griechischen Denkern verfochten, vornehmlich von Plato (um 429–347 v. Chr.) und seinem Schüler Aristoteles (um 384–322 v. Chr.) sowie nachfolgenden Generationen ihrer elitären, gebildeten Anhänger in der griechisch-römischen Welt, die darüber spekulierten, dass die göttliche Macht, die letzten Endes das Universum trägt, zwangsläufig ohne Körper sein muss – ein körperloses, unsichtbares abstraktes Prinzip beziehungsweise eine entsprechende Macht oder ein Intellekt, ganz und gar jenseits und verschieden von der materiellen Welt. Nicht, dass solche abgehobenen Ansichten größere Auswirkungen auf das religiöse Leben der Durchschnittsmenschen gehabt hätten. Ob sie nun in Philosophie geschult waren oder nicht, und auch unabhängig davon, welche Gottheiten sie verehrten, die meisten der in der griechisch-römischen Welt lebenden Menschen stellten sich ihre Götter auch weiterhin als leibhaftige Wesen mit Körpern wie ihren eigenen vor – ganz wie eh und je.
Doch gegen Ende des ersten vorchristlichen Jahrtausends und bis in die frühen nachchristlichen Jahrhunderte hinein hielten diese gelehrten philosophischen Ideen allmählich Einzug in das Denken bestimmter jüdischer und christlicher Intellektueller, die ihre Vorstellung von ihrem Gott gründlich überdachten, bis er für sie zunehmend körperlos und immateriell wurde. Dabei machten sie immer feinere Unterschiede zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, dem Göttlichen und dem Menschlichen, dem Geistigen und dem Körperlichen. Das im Großen und Ganzen platonische Konzept von der Unterschiedenheit des Göttlichen von allem im Universum und darüber hinaus hat die formaleren theologischen Deutungen Gottes in der religiösen Vorstellungswelt des Westens entscheidend geprägt. Allerdings bauen diese Deutungen auf einem konzeptionellen Bezugsrahmen auf, der in großem Widerspruch zur Bibel selbst steht, denn in diesen alten Texten wird Gott auf verblüffend menschenähnliche Weise dargestellt. Dort haben wir eine Gottheit mit einem Körper.
Im Anfang
Der Hochgott hatte bereits mehrere Tage damit zugebracht, neue Wunder ins Dasein zu rufen – er hatte die urzeitlichen Wasser des Chaos in ein himmlisches und ein unterweltliches Reservoir aufgeteilt, trockenes Land geschaffen und es mit Obstbäumen und Feldfrüchten bepflanzt, hatte die Sonne angewiesen, den Tag, und den Mond, die Nacht zu erleuchten, und schließlich dem neu entstandenen Land, Meer und Himmel befohlen, Landtiere, Fische und Vögel hervorzubringen. Jetzt war er im Begriff, erneut das Wort zu ergreifen. „Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich“, sagt er zu den anderen Gottheiten in seinem Gefolge. Es ist eher eine Ansage als ein Vorschlag, aber dennoch eine gute Idee, denn die neuen Menschen werden die Aufgabe haben, in der neu geschaffenen irdischen Sphäre Ordnung zu halten. Und so formt der Hochgott den allerersten Menschen: „Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn.“ Das neue Geschöpf – adam, was so viel bedeutet wie „Erdling“ – weist große Ähnlichkeit mit seinem göttlichen Schöpfer auf und bekommt rasch eine weibliche Version an die Seite gestellt: „Männlich und weiblich erschuf er sie.“ Ausgestattet mit Gott nachempfundenen Körpern werden die Menschen vor den übrigen neu erschaffenen Geschöpfen auf der Welt bevorzugt, über die ihnen die Herrschaft verliehen wird. Nachdem er die Menschen mit Fruchtbarkeit gesegnet hat, überträgt der Hochgott ihnen zwei Aufgaben: sich zu vermehren und zu herrschen. Sie sollen seine Welt mit ihrer Nachkommenschaft füllen und die übrigen Geschöpfe unter Kontrolle halten. Zufrieden mit seinem Werk entscheidet der Hochgott, dass seine Arbeit getan ist. Am folgenden Tag ruht er sich aus.
In akademischen Kreisen wäre wohl an dieser freien Wiedergabe der Eingangsgeschichte des Buches Genesis nichts auszusetzen. Die meisten Bibelwissenschaftler würden zustimmen, dass Gott, wenn er sagt: „Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich“, die übrigen Mitglieder seiner „himmlischen Versammlung“ anspricht – das Etikett, das die Bibel Gottes Rat aus niederen Gottheiten und göttlichen Wesen verpasst hat. Und die meisten würden auch unterschreiben (obgleich der eine oder die andere sich dabei ein wenig winden würde), dass die frisch geformten Menschen dadurch, dass sie nach dem Ebenbild der Götter gemacht wurden, eine sichtbare Ähnlichkeit mit ihren eigenen Gottheiten aufweisen, so, wie später in der Genesis von Adams Sohn Set gesagt wird, dass er wie „das Bild“ seines Vaters sei, und wie in anderen biblischen Texten Götterstatuen das „Ebenbild“ der Götter sind, die sie darstellen. Die unsere heutige Bibel eröffnende Schöpfungsgeschichte, die um das 5. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde, jedoch auf ältere Mythen zurückgreift, zeugt von einer Zeit, als Jahwe – die Gottheit von Jerusalem, heutzutage besser bekannt unter dem Namen „der Herr“ – erst noch in die Rolle des einzigen göttlichen Wesens im Universum hineinwachsen musste. Wie der babylonische Marduk oder der griechische Zeus war diese altbekannte Gottheit schon seit Langem als König des Alls gefeiert worden, war aber, wie diese beiden, bei Weitem nicht allein im Himmel. Vor allem war er noch mehrere Jahrhunderte von der immateriellen, körperlosen Abstraktion aus der späteren jüdischen und christlichen Theologie entfernt. Er war einfach wie jede andere Gottheit in der Welt des Altertums auch. Er hatte einen Kopf, Haare und ein Gesicht mit Augen, Ohren, einer Nase und einem Mund. Er hatte Arme, Hände, Beine und Füße, eine Brust und einen Rücken. Er war ausgestattet mit einem Herzen, einer Zunge, Zähnen und Genitalien. Er war ein Gott, der ein- und ausatmete. Hier hatten wir es mit einer Gottheit zu tun, die nicht nur aussah wie ein Mensch – wenn auch in weitaus imposanterem, glanzvollerem Umfang –, sondern sich auch noch sehr oft wie ein Mensch benahm. Er mochte gern Abendspaziergänge und herzhafte Mahlzeiten, er hörte Musik, schrieb Bücher und stellte Listen auf. Er war ein Gott, der nicht nur sprach, er lachte auch, schrie laut, weinte und führte Selbstgespräche. Er war ein Gott, der sich verliebte und raufte, ein Gott, der sich mit seinen Anhängern zankte und mit seinen Feinden kämpfte, ein Gott, der Freundschaften schloss, Kinder großzog, sich Ehefrauen nahm und Sex hatte.
Diese Darstellung Gottes wurde nicht von irgendwelchen obskuren, auf längst vergessene Tontafeln eingeschriebenen Mythen zusammengesucht. Sie stammt aus der Bibel selbst – einem Buch, so komplex wie die Gottheit, deren Werbetrommel sie rührt, nicht zuletzt, weil die Bibel eigentlich gar kein einzelnes Buch ist, sondern eine Sammlung von Büchern, die sich in zwei Teile gliedert. Der erste ist die hebräische Bibel, die im Judentum Tanach und im Christentum Altes Testament heißt. Sie ist eine Anthologie aus uralten Texten, die ursprünglich als Schriftrollen verfasst wurden. Die meisten dieser Texte sind selbst komplexe Zusammenstellungen unterschiedlicher literarischer Überlieferungen. Die Mehrzahl von ihnen wurde zwischen dem 8. und dem 2. Jahrhundert v. Chr. in Juda, einem kleinen, südlich gelegenen Staatswesen in der Levante verfasst, der Region, die wir heute als Palästina, Israel, Jordanien und Westsyrien kennen. Im 8. Jahrhundert v. Chr. wurde das Königreich Juda von den Assyrern erobert; zu Beginn des 6. Jahrhunderts widerfuhr ihm das Gleiche noch einmal, nur waren die Eroberer diesmal die Babylonier. Bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. war aus Juda eine persische Provinz geworden, um das Jahr 333 v. Chr. wurde es dem riesigen Reich Alexanders des Großen einverleibt. Einige Texte aus der hebräischen Bibel berichten von Judas wechselvollen politischen Entwicklungen, andere sind Geschichten über legendäre Helden und Mythen aus sehr weit zurückliegenden Zeiten. Bei einigen handelt es sich um Orakelsammlungen, die verschiedenen Propheten zugeschrieben werden, bei anderen um Zusammenstellungen von Gedichten, rituellen Gesängen, Gebeten und Lehren. Doch keiner dieser Texte ist uns in der „Originalfassung“ überliefert. Vielmehr wurden an allen im Lauf der Zeit wiederholt sowohl inhaltlich als auch formal Überarbeitungen, Ergänzungen, Verbesserungen und Bearbeitungen vorgenommen, worin sich die wechselnden ideologischen Interessen ihrer Kuratoren spiegeln, die sie als heilige Schriften verstanden.
Es war dieser lange Prozess der schöpferischen Bearbeitung, der der biblischen Geschichte von Gottes Beziehung zu „Israel“, dem Volk, das er unter seine Fittiche genommen hat, narrative Form gegeben hat. Die ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel erzählen von der Begründung und Verfestigung dieser Beziehung. Nach der Erschaffung der Welt und der Sintflut schließt Gott einen Bund (oder Vertrag) mit den Vorfahren der Israeliten – Abraham, seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob –, denen er zahlreiche Nachkommenschaft verspricht als Gegenleistung für ihren Gehorsam, den sie vor allem dadurch unter Beweis stellen sollen, dass sie nur ihn allein verehren. Als die Israeliten in Ägypten in Sklaverei geraten, befreit Gott sie und beauftragt Mose damit, sie ins „Gelobte Land“ Kanaan zu führen und sie gleichzeitig in Gottes Lehren (tora) zu unterweisen – die Bestimmungen, die ihr weiteres Verhältnis zur Gottheit prägen werden, darunter auch Anweisungen für den prächtigen Tempel, den sie in dem ihnen von Gott geschenkten Heimatland errichten sollen. Zusammen genommen sind diese fünf Bücher – Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium – unter dem Namen Tora bekannt, und gemeinsam arbeiten sie die vermutlich rivalisierenden Überlieferungen über Vorfahren und Ursprünge der Israeliten zu einem weitgehend kohärenten Narrativ einer „israelitischen“ Identität um.

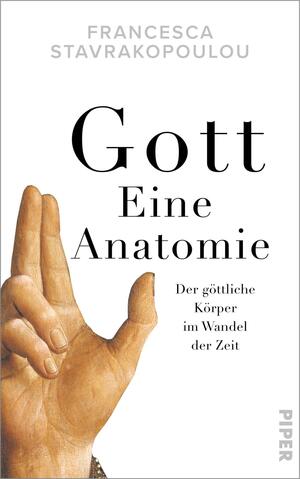

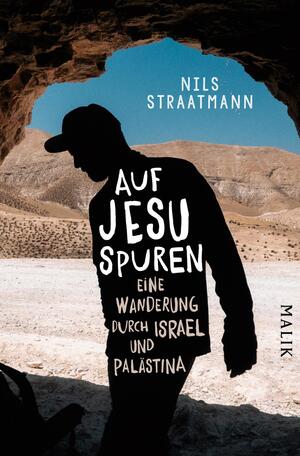











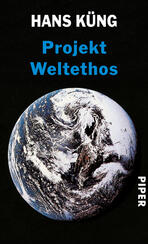





Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.